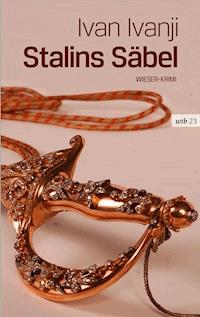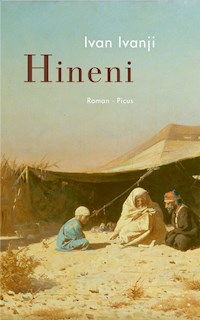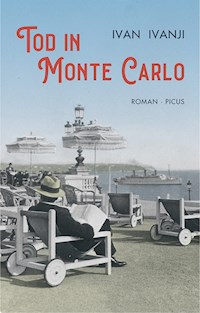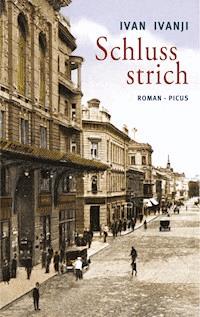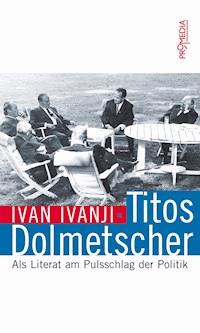17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Picus Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Bei Renovierungsarbeiten im Krematorium der Gedenkstätte des Konzentrationslagers Buchenwald macht ein Dachdecker im Mai 1997 einen ungeheuerlichen Fund: 700 Urnen mit der Asche von namenlosen Häftlingen. Erste Ratlosigkeit mündet in dem Beschluss, die Asche der Toten in einem Gemeinschaftsgrab beizusetzen. Basierend auf dieser Begebenheit lässt Ivan Ivanji, selbst einst Häftling in Buchenwald, aus den Genen der anonymen Verstorbenen eine neue Gestalt von mythischer Wucht erstehen: den Aschenmenschen von Buchenwald, ein wolkenförmiges Wesen, das hinabsteigt vom Ettersberg nach Weimar. Sind die im Aschenmenschen versammelten Individuen Erinnyen, rachesuchende Seelen Ermordeter? In einem Stimmenkonzert der Toten lässt Ivanji sie zu Wort kommen, ihre Geschichten erzählen, nach Gemeinsamkeiten und Erklärungen suchen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 182
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Copyright © 1999 Picus Verlag Ges.m.b.H., Wien
Neuauflage 2024
Alle Rechte vorbehalten
Grafische Gestaltung: Buntspecht, Wien
Umschlagabbildung: © Pattadis Walarput/iStockphoto
ISBN 978-3-7117-2145-7
eISBN 978-3-7117-5507-0
Informationen über das aktuelle Programm des Picus Verlags und Veranstaltungen unter www.picus.at
Ivan Ivanji
Der Aschenmensch von Buchenwald
Roman
Picus Verlag Wien
Für Dragana,
die in der Nacht vom 24. auf den 25. August 1997 in Weimar als Erste die Anwesenheit des Aschenmenschen von Buchenwald bemerkt und mich auf ihn aufmerksam gemacht hat.
Inhalt
der fund
die beisetzung
stimmen
heisse schokolade für geheimrat von goethe
weimar bereitet sich vor
die baustelle
die unsichtbare wolke
suche nach einer gestalt
goethes eiche und des aschenmenschen gesicht
weitere bücher von ivan ivanji
der fund
Ich wüsste gerne mehr über die Menschen, die ich nur rasch vorbeihuschen sehe, über die Welt, die sie umgibt, vor allem darüber, wie sie sich angesichts der Begebenheiten, die zu beschreiben sind, verhalten werden. Schemenhaft, kaum dreidimensional, nehme ich sie wahr, und bevor sie sich im nächsten Augenblick gänzlich auflösen, traurige Leere hinterlassen, tauchen andere Figuren auf, die meine Aufmerksamkeit wiederum nur kurz binden können.
Der Berg umhüllt von der Wärme des Monats Mai, der den nahenden Sommer ankündigt. Der Wald. Aus Buchen bricht frisches Grün. Die gute Asphaltstraße, die sich breit zum Gipfel hinaufwindet. Der bequeme Sessel im Bus. Der Wind, der hier oben fast immer weht, hat den blauen Himmel von allen Wolken der letzten Tage und Wochen sauber gefegt, danach hat er sich gelegt, und im Augenblick spürest du, wie es mit endgültigen Worten einer aufschrieb, der oft hier war und diesen Ort, das Firmament über ihm und jeden Luftzug aufmerksam beobachtete und gut kannte, kaum einen Hauch.
Ich betrachte einen Mann im Bus genauer. Er ist Dachdecker. Ich kann nicht wissen, ob er sich Goethes Verse, die er in der Volksschule gelernt haben wird, gemerkt hat, ob er sie zitieren könnte. Er freut sich, endlich wieder eine feste und ordentlich bezahlte Arbeit zu haben. Das Ende des zwanzigsten Jahrhunderts ist eine schwierige Zeit für das Baugewerbe in dieser Gegend im Osten, die früher Mitteldeutschland, die Zone oder Deutsche Demokratische Republik hieß, was verbergen sollte, dass ein guter Teil dessen, was Deutschland vor den sogenannten Weltkriegen dargestellt hatte, was damals sein Osten gewesen war, endgültig verloren ist und vergessen werden muss.
Jedenfalls gibt es in Weimar jetzt zumindest wieder Aufträge für Baufirmen. Schöner wäre es für den Dachdecker natürlich, unten in der Stadt beschäftigt zu sein, vielleicht mit der Restaurierung eines der vielen Schlösser. Das würde ihm die Fahrten jeden Morgen hinauf zur Gedenkstätte, »auf den Berg«, wie man in Weimar – noch immer mit etwas Schauder in der Stimme – sagt, am Abend wieder hinunter in die Stadt, den ganzen Zeitaufwand ersparen. Und manchen schwierigen, unerfreulichen Gedanken? Man darf aber nicht unzufrieden sein, und außerdem: Was bedeutet dem Handwerker schon ein Name wie Buchenwald? Gewiss, das hier oben war einmal ein Konzentrationslager. Ist das etwas anderes als der Dreißigjährige Krieg, die Hermannsschlacht, Karl der Große? Diese Begriffe kennt man aus der Schule, hat sie gelernt – gehört und wiedergeben müssen –, einfach, um den Lehrer zufriedenzustellen, um gute Noten zu bekommen, das war alles. Ein Konzentrationslager also. Heute eine Gedenkstätte.
Für den Dachdecker ist ein Dach zu reparieren. Fünfzig Jahre oder länger ist es nicht ausgebessert worden. Ein Krematorium soll das kleine Haus gewesen sein. Etwas anders sieht es schon aus als ähnliche bescheidene Bauwerke, vor allem weil der Schornstein unverhältnismäßig massig ist und irgendwo hoch hinaufzeigt. Leichen von Häftlingen hat man hier verbrannt. In diesem Raum hat man manchmal auch Leute erschossen. Und gehenkt. Damals, im Krieg.
Oder schon vorher?
Der Dachdecker ist lange nach dem Krieg geboren, in einer Gesellschaft aufgewachsen, die darauf bestanden hat, ein Arbeiter- und Bauernstaat zu sein. Er hat sich seine Gedanken darüber gemacht – wie die Mehrzahl jener, die später »Wir sind das Volk!« geschrien haben. Er hat sein Handwerk erlernt, jetzt hat er Dachziegel vor sich, Balken, sein Werkzeug. Er steht auf der Leiter mit dem Himmel über sich, aber er nimmt sich keine Zeit, ihm einen Blick zu schenken. Unter die Dachpfannen ist eine Schutzfolie einzuziehen, eine einfache Arbeit. Er hat ein paar lange Nägel im Mund, sonst würde er fröhlich vor sich hin pfeifen.
Das Dach könnte genauso einen Kreißsaal überdecken oder ein Büro, eine Werkstatt oder ein Opernhaus. Hier bedeckt es ein ehemaliges Krematorium, aber längst werden in diesem Gebäude keine Menschen mehr verbrannt, längst ist es eine Art Museum, das weiß der Dachdecker. Mit seiner Schulklasse war er schon einmal da, noch zu Zeiten der DDR, als Vorbereitung auf die Jugendweihe. Die Lehrerin hat mit schriller Stimme langweilige Geschichten über den antifaschistischen Kampf und dessen Helden erzählt, über Thälmann, den Generalsekretär der KP, der hier ermordet worden sein soll. Und der zukünftige Dachdecker hat damals nur Dagmars blonde Zöpfe vor sich gesehen und hätte gerne daran gezogen, traute sich aber nicht.
Jedenfalls braucht er sich auf diesem Dachboden nicht anders zu fühlen als auf einer anderen Baustelle in Weimar oder sonst irgendwo auf der Welt. Ob man sich unter den vielen Dächern, die er aufgesetzt oder ausgebessert hat, freut oder ob man leidet, lacht und liebt oder weint und stirbt, das weiß er, Gott sei Dank, nicht, und er ist kein Mensch, der sich solche Fragen stellt, sonst wäre er kein Dachdecker geworden, sondern einer, der über Dachdecker auf den Dächern von Krematorien und den Maihimmel über dem Ettersberg schreibt.
Auch für die Angestellten der Gedenkstätte, die eine gründliche Restaurierung des Krematoriums in Auftrag gegeben haben, und ihren Direktor ist dies ein ganz gewöhnlicher Tag. Sie sind an diesem Tag, wie an jedem anderen auch, mit ihren Autos auf den Berg hinaufgefahren oder sie haben den Bus genommen. Und sie konnten sich sogar über die Schönheit des Waldes freuen. Die Torinschrift am Eingang zum ehemaligen Lager »Jedem das Seine« haben sie nicht beachtet, weil sie an ihren Anblick gewöhnt sind und nur darauf aufmerksam machen, wenn sie Gruppen zur Besichtigung hindurchführen.
Sonnig, trocken, windstill ist es, was an der Nordseite des Ettersberges nicht einmal im Mai oft der Fall ist. Kein Tag wichtiger Termine, bedeutender Besuche oder besonderer Ereignisse. Ohne den Fund des Dachdeckers würde er die Bezeichnung Alltag verdienen. »Ein Tag«, schreibt der Direktor der Gedenkstätte später, »wie man ihn lebt ohne große Aufmerksamkeit, ein Tag wie die Tage, die dem Gedächtnis keinen Anhalt geben, weil sie ganz und gar unauffällig sind.«
Die Angestellten wissen, dass die verstorbenen oder ermordeten Häftlinge von Buchenwald anfangs im Weimarer Krematorium eingeäschert wurden, was für den Dachdecker bei seiner Arbeit keine Rolle spielt. Man sammelte die Toten in einer besonderen Baracke – man konnte ja nicht für jeden Leichnam gleich ein Auto in Bewegung setzen –, mit Benzin musste man sparsam umgehen, da waren die Inspektoren aus dem Reichssicherheitshauptamt in Berlin pingelig. Als dann aber mit Kriegsbeginn die Zahl der Lagerinsassen und damit auch die der Toten stieg, gab die Lagerleitung der Firma Topf & Söhne im nahe gelegenen Erfurt den Auftrag, eine entsprechende Anlage zu entwerfen und zu bauen. Nicht von Anfang an war man sich der Dimension der benötigten Kapazität bewusst, die Mörder und ihre Helfer mussten ihr Handwerk erst erlernen, es gab keine verbrieften Erfahrungswerte, auf die man sich hätte verlassen können, so viele Menschen auf einmal waren noch nie an ein und derselben Stelle zu Tode gebracht worden. Erst allmählich, unter der Beihilfe von mehreren Fachleuten, entstand das endgültige, äußerst funktionale Gebäude. Das Krematorium hatte eine Kapazität von drei- bis vierhundert Leichen in vierundzwanzig Stunden, war aber trotzdem überlastet: In einem Rekordmonat wurden zweitausendachthundert Körper verbrannt. Die Brennstätte erhielt einen gefliesten Fußboden sowie einen Aufzug, der von Häftlingen mit einer Kurbel bedient wurde, um die Leichen nach oben zu befördern, wo sie in einem der sechs Öfen verbrannt wurden. Es gab eine Rutsche für die Leichen, auf der sie hinuntergeworfen werden sollten, alles geplant unter Berücksichtigung der Anzahl der Toten, die zu erwarten war. Die mühevoll erarbeitete Technik konnte die Firma später gewinnbringend – und gleichzeitig Volk, Reich und Führer dienend – auch in anderen Konzentrationslagern anwenden.
Für die Ermordung von so vielen Menschen wurde eine weitere Anlage benötigt und auch geschaffen, sie wurde nach reiflicher Überlegung in einem ehemaligen Pferdestall installiert. Der war massiv gebaut und fünfundfünfzig Meter lang.
Marschmusik wurde gespielt. Die Häftlinge standen Schlange, waren ruhig, auch noch, als sie einzeln in den Hinrichtungssaal gelassen wurden, denn alles, was sie sahen, war eine Messlatte, wie es sie in vielen Untersuchungszimmern und ärztlichen Ordinationen gibt. Da mussten sich die Männer aufstellen, einer nach dem anderen. Der Schuss ins Genick kam durch einen Schlitz in der Wand, aus einem anderen Raum. Todesschütze und Opfer sahen einander nicht. Der Abtransport der Leichname zum Krematorium erfolgte in verzinkten Behältern.
Massenmord erfordert Erfindungsgabe. Die Leute sollen möglichst gefasst in den Tod gehen, sonst ist der Aufwand zu groß: Zu viele bewaffnete Posten werden benötigt, und die braucht man an der Front, wo sie eine mindestens genauso wichtige Aufgabe zu erfüllen haben. Morden ist mitunter eine anstrengende Arbeit – aber nichts im Vergleich zum Aufwand, den die Beseitigung der irdischen Hüllen des Menschen bedeutet.
Eine Abteilung, genannt »Pathologie«, wurde zum Krematorium hinzugebaut, dorthin schaffte man die Toten nach der Exekution und vor der Verbrennung. Natürlich nicht, um die Todesursache festzustellen – die war den Prüfern bekannt –, nein, die goldenen Zähne mussten herausgebrochen, die Haut von Häftlingen, die sich, wer weiß, wann und warum, hatten tätowieren lassen, abgezogen und Präparate angefertigt werden.
Im Keller des Krematoriums wurden auch Einzelhinrichtungen vorgenommen. Das Henken erfolgte an Wandhaken – einen Galgen erachtete man als zu aufwendig für diesen banalen Zweck. Die Angestellten der Gedenkstätte wissen, dass hier über tausend Menschen erdrosselt worden sind, als Jüngster der achtjährige Iwan Belewzew aus Charkow. Der Dachdecker weiß das nicht. Ich glaube aber, selbst wenn er es wüsste, würde er sich deswegen nicht besonders aufregen – das war ja vor einem halben Jahrhundert, was kümmert es ihn?
Dann schlägt der Dachdecker einen neuen Nagel ein, den zehnten oder vierzigsten an diesem Tag, ohne seinem Tun besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Als Lehrling hat er sich oft genug mit dem Hammer auf den Finger geschlagen, inzwischen hat er längst gelernt, schnell zu arbeiten, ohne sich dabei zu verletzen. Alles ist wie üblich, aber nicht der Ton, der Klang unter dem Schlag, als der Nagel den Holzsparren durchbohrt und auf der anderen Seite heraustritt. Etwas liegt unter dem Eisen, was kein Holz sein kann. Es klingt, als habe er den Metallstift in einen Blumentopf geschlagen. Der Dachdecker stutzt, dann sieht er nach und findet im Verschlag unter dem Spitzgiebel seltsame, ineinandergeschobene Gefäße. Die meisten sind aus Metall. Sie sehen fast aus wie Granatenhülsen, nur sind sie aus dünnerem Blech, wie Ofenrohre. Nicht die, die er zuerst getroffen hat – die sind aus Keramik. Der junge Meister weiß nicht, was das für Gegenstände sind, aber dass er auf etwas Besonderes gestoßen ist, begreift er sofort. Er hält inne und ruft, jemand, der sich auskennt, solle doch bitte mal kurz raufkommen.
Natürlich ist ein studierter Museologe auf dem Gelände. Unter seiner Aufsicht holt man vorsichtig einige dieser Behälter unter den Balken hervor und bringt sie nach unten. Der Sachverständige sagt, es seien Urnen, darin hätte man die Asche verbrannter Leichen aufbewahrt. Diese hier scheinen auf den ersten Blick leer zu sein. Dann aber steigen ein paar Ascheflocken auf – trocken und leicht, als hätten sie jahrzehntelang auf den Augenblick gewartet, endlich bewegt zu werden und sich dadurch selber bewegen zu dürfen.
»Was ist das?«, fragt der Dachdecker.
»Asche«, antwortet der junge Wissenschaftler.
»Das sehe ich selber«, sagt der Dachdecker. »Aber was für Asche?«
»Menschenasche. Sie waren also doch nicht ganz leer. Die Urnen, meine ich. Das da war ein Krematorium!« Und als der Dachdecker nur nickt und schweigt, fügt er hinzu. »Hier hat man Menschen verbrannt!«
»Ja, ich weiß. Die Frage ist: Was sollen wir jetzt machen?«
»Keine Ahnung. Ich muss den Direktor fragen …«
Der erinnert sich:
»In der Mittagszeit dieses Tages hat mich, ich weiß nicht mehr, welcher Mitarbeiter der Gedenkstätte, doch, der junge Handwerker Matthias Billig, glaube ich, über den Urnenfund informiert, als er mich fragte, wie man die Urnen aufbewahren solle. Man habe bereits mit dem zuständigen Museologen gesprochen und sei dabei, die Behälter nach unten zu bringen, damit sie bei den Dacharbeiten nicht zerstört würden, aber es seien viele Urnen, zu viele, wie viele wisse man noch nicht, aber zu viele, um sie erst zu bergen und dann zu beraten, und Ascheflocken stiegen unvermeidbar gelegentlich aus den Urnen auf, selbst bei diesem kurzen Transport.«
Jemand hat diese Urnen angefertigt. Die irdenen, wie man in der Gedenkstätte zu wissen glaubt, aus dem Ton der Erlstädter Grube, die auch zum Lager gehörte. Geschickte Handwerkerhände haben sie geformt, gebrannt. Häftlinge. Haben sie gewusst, zu welchem Zweck sie diese Gegenstände herstellten? Wahrscheinlich. Und was haben sie sich dabei gedacht? Dass auch ihre Asche einst in so einer Urne ruhen würde? Im normalen Leben gibt es Sargtischler. Denken sie bei der Arbeit an ihr eigenes Begräbnis? Aber das ist wohl etwas anderes.
Ist das etwas anderes?
Der Direktor und einige Mitarbeiter stürmen aus dem Direktionsgebäude, laufen schnell unter den großen, schönen Kastanienbäumen hindurch, an der gelben Front des ehemaligen Stabsgebäudes der SS vorbei, durch den Tag, der begonnen hat wie jeder andere, zum Krematorium.
Die Sonne scheint gleichgültig, warm. Es ist auch weiterhin, unverändert, der Monat Mai.
Die Ascheflocken waren einmal Menschen. Der Direktor weiß, dass an der Gedenkstätte Auschwitz während der Restaurierungsarbeiten immer wieder Asche gefunden wurde. Sehr viel Asche. Jahrelang war aus den Schornsteinen in Auschwitz Rauch zum Himmel aufgestiegen, und ein Teil davon hat sich als Asche überall auf die Erde gelegt. Als das Todeslager noch in Betrieb war, haben neu angekommene junge Häftlinge die alten gefragt:
»Was ist das für ein Rauch?«
Und die alten haben die Gaskammer erwähnt, die Krematorien, das Sonderkommando und schließlich geantwortet:
»Dieser Rauch – das sind deine vergasten und verbrannten Eltern.«
Wir schaufeln ein Grab in den Lüften, flüstert der Direktor nur für sich. Denke erst ich daran? Dein aschenes Haar Sulamith, wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland, denkt er, oder denke ich, und der Handwerker, der, ein wenig verblüfft über so viel Aufregung, mit hängenden Armen dasteht und darauf wartet, weiterarbeiten zu dürfen, der junge Dachdecker, ist ja auch ein deutscher Meister. Ein Meister aus Deutschland. So hat es der Dichter Celan nicht gemeint.
Oder doch?
Den meisten Menschen, die nicht unmittelbar mit ihm zu tun haben, wie Leichenbeschauer, Sargverkäufer, Pfarrer, Ärzte oder die Musiker auf den Friedhöfen, graut es vor dem Tod. Die Handwerker, die das Krematorium renovieren, haben verdrängt, wo sie arbeiten. Sie werden relativ anständig bezahlt, viele ihrer Kollegen im Land sind arbeitslos. Der Frühlingstag ist bis zu dem Augenblick des Fundes schön gewesen.
Die Angestellten der Gedenkstätte gehören zu den Menschen, die an den Umgang mit dem Tod gewöhnt sind. Zumindest auf dem Papier. Alles, was sie verwalten, in Dokumenten finden, organisieren, in Ausstellungen anderen zugänglich machen, hat mit dem Tod, seinen Ursachen oder damit zu tun, wie man ihm zufällig, durch Glück oder Mut, entgehen konnte.
Es soll Lampen mit hübschen Lampenschirmen gegeben haben. Angefertigt waren sie aus tätowierter Menschenhaut. Die Frau des Lagerkommandanten Koch liebte solche Dinge. Ihr Mann erfüllte ihr jeden Wunsch. Hatte jemand eine Tätowierung, die besonders gut für eine solche kleine Leuchte passte, war sein Leben verwirkt. Dann wurde er ermordet, sein Leichnam gehäutet, bevor man den Rest ins Krematorium schickte und seine Haut gegerbt wurde. Tätowierungen waren eine Todesursache. Eine von vielen in Buchenwald. Aber darüber gibt es nur noch Dokumente und Aussagen der Häftlinge, kein Lampenschirm aus Menschenhaut befindet sich in der Ausstellung.
»Ganz Buchenwald war ja eine riesige Fabrik, in der Menschen verwertet, praktisch weiterverwertet, wurden, ihre Knochen, ihre Haut, ihre Haare …«, erzählt, zum Besuch der Gedenkstätte befragt, ein Schüler.
»Dass den Menschen die Haut abgezogen wurde, damit man daraus Lampenschirme machen konnte, das fand ich schon ziemlich ätzend …«, berichtet eine Schülerin. »Ziemlich ätzend«, sagt sie.
»Der Schrumpfkopf sah ja vielleicht auch ein bisschen lustig aus, so ein kleiner Kopf, und wenn man sich vorstellt, dass das wirklich einmal ein Menschenkopf war! So was kennt man ja sonst nur aus Indianerfilmen!«
Ein anderes Mädchen:
»Ich persönlich hatte furchtbare Angst vor den Schrumpfköpfen. Ich würde mir zwar einen Totenkopf auf den Schreibtisch stellen, aber so was, nein danke! So ein Totenkopf gefällt mir, aber die sind teuer. Vielleicht später mal …«
Einen Totenkopf will sie sich »vielleicht später mal« auf den Tisch stellen, dieses deutsche Mädchen, das die Gedenkstätte Buchenwald besucht hat. Was Goethe mit Schillers Schädel angestellt hat, weiß es nicht, sonst hätte es das gewiss auch gesagt.
»Dass die die Menschen auf einen Tisch gelegt haben, aufgeschnitten und die Haut abgezogen haben!«, entsetzt sich ein junger Besucher, »das kann doch einfach nicht sein!«
Ein Kind berichtet:
»Im Film das Massengrab, wie die ganzen Leichen da rumlagen. Also die Leichen, die da reingeschaufelt wurden mit dem Bagger. Das fand ich fast eklig und ziemlich deprimierend eben, dass so viele Menschen in der Grube lagen. Und wie die die dann eingebuddelt haben, dass die auch nicht mal ein eigenes Grab gekriegt haben und die Angehörigen vielleicht gar nicht wussten, dass da jemand drin ist, eben ein Sohn oder so …«
»Oder so«, sagt das Schulkind. Ein Kind. Ich war genauso alt wie dieses Kind, als ich da war, mit der Nummer 58116.
Soll ich die Kinder trösten und ihnen sagen, auch während der Französischen Revolution war es in gewissen Kreisen kurzfristig Mode, Bücher in Aristokratenhaut einzubinden? Oder lieber doch nicht? Obwohl es auch wahr ist. Wahrheit. Ein Teil der ganzen Wahrheit. Nachdem der Sieg der Revolution in die Geschichte eingegangen war, hat man das verdrängt. Und die Buchenwalder Lampenschirme aus tätowierter Menschenhaut, wann verdrängen wir auch sie?
Die Bagger waren in Bergen-Belsen im Einsatz, in Buchenwald machte die geringe Zahl der Toten diese Art der Verscharrung unnötig. Eine geringe Zahl. Wie relativ alles ist. In den letzten drei, vier Monaten vor der Befreiung waren es ja nur vierzehn- bis fünfzehntausend Tote. Nur. Tote. Und was die Fetzen tätowierter Haut und den Schrumpfkopf angeht, die nicht mehr öffentlich gezeigt werden, bestattet worden sind diese Reste von Menschen nicht, denn man hält sie für Sachbeweise – das ist das Wort, das man gebraucht: Sachbeweise – Sachbeweise für die Verbrechen, denn, wer weiß, vielleicht muss man ihre Existenz gegen solche, die behaupten, nichts sei gewesen, wieder einmal ins Feld führen.
Oder ist es schon so weit?
Vor dem Museum der Gedenkstätte steht kein Würstelstand. Das mögen einige Besucher bedauern. Stärken muss man sich in der Cafeteria beim Parkplatz. Die meisten Häftlinge sind hungrig gestorben, da soll man sie nicht mit dem Kauen von belegten Broten stören.
In einer Broschüre über die Wirkung der Besuche von Gedenkstätten auf Schülerinnen und Schüler steht: »Ein Teil der Befragten empfindet, dass viele Gedenkstätten schon zu sehr auf Tourismus getrimmt sind. Durch Übernachtungsmöglichkeiten, Restaurants, Eintrittsgelder und Parkgebühren erhalten sie den Status normaler Ausflugsziele.« Daran habe ich früher gar nicht gedacht, dass man für die Besichtigung des Lagers Eintrittsgeld und, wenn man mit dem eigenen Auto angefahren kommt, Parkgebühren zahlen sollte. Obwohl das logisch ist. Man bietet ja etwas an, etwas zum Anschauen, und dafür soll in einer Konsumgesellschaft auch bezahlt werden.
Der Tod ist zur Routine geworden, man nennt ihn beim Namen, aber man verdrängt, dass man selber sterben muss, er wird zu einem Vorgang, den man als aktenkundig studiert und als stattgefundenes Ereignis mitteilbar macht. Auch der Umgang mit den Exponaten, mit Gegenständen aus dem Konzentrationslager, die man jetzt in ordentlichen Vitrinen betrachten darf, die oft mit dem Tod in Zusammenhang gestanden sind oder irgendwie an ihn erinnern, ist für die hier Beschäftigten normaler Alltag. Man leistet, was in manchen Schriften allen Ernstes als »Erinnerungsarbeit« bezeichnet wird. Man macht sich Gedanken »über Fragen der Formen, der Inhalte und der gesellschaftlichen Bedeutung der gegenwärtigen Erinnerungsarbeit«. Das Wort riecht nach Staub und Moder. Es trifft nicht, was gemeint ist. Aber kann man jedes Wort auf die Goldwaage legen? Ein anderes findet man nicht, fand man weder hier noch anderswo in Deutschland, Amerika oder Israel, wo man sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen hat.
Die Urnen auf dem Dach des Krematoriums sind auch für die Mitarbeiter der Gedenkstätte eine Überraschung und verlangen nicht nur nach der Suche nach neuen Worten, sondern auch nach einer neuen Handlungsweise.
Was soll ich jetzt machen?, fragt sich der Direktor. Ihm ist zum Weinen zumute, aber alle anderen warten auf seine Weisungen. Und er sagt sich: Genau deshalb bist du hier! Und plötzlich weiß er, dass er inniger und tiefer denn je mit der Geschichte des Ortes in Verbindung getreten ist.
Mit der Geschichte des Ortes? Für den Direktor ist Weimar nicht nur die Wirkungsstätte Goethes und so vieler anderer, deren Namen man in den Schulen aller Welt kennenlernt – er ist eben kein Germanist, sondern ein in der Geschichte Bohrender und Suchender, er zählt die Meilensteine auf dem Wege der Entwicklung und will die Tatsache ernst genommen wissen, dass Hitler Goethe gefolgt ist. Selbstverständlich soll das nicht heißen, dass Goethe Wegbereiter war, wenngleich der Geheime Rat ziemlich staatsautoritär gedacht und gewirkt hat. Aber was Weimar angeht, muss man einfach feststellen, dass die hohe Kultur nicht nur nicht resistent war, sondern dass die Barbarei aus der Mitte der Kultur kam.
Was Goethe mit Buchenwald zu tun hat?
Im Gedächtnis der Häftlinge, von denen viele gebildeter waren als ihre deutschen Wächter und Folterknechte, hat Goethe eine gewisse Rolle gespielt, für manch einen eine große. Für sie war Weimar bis zu ihrer Ankunft mit seinem Namen verbunden.
Und seither?
Warum wird ein junger Historiker, der eine glanzvolle akademische Laufbahn vor sich hat und nebenbei die Ausbildung