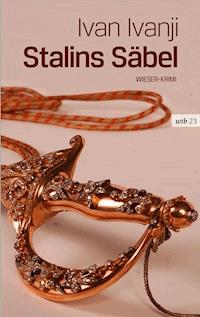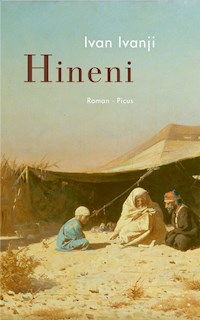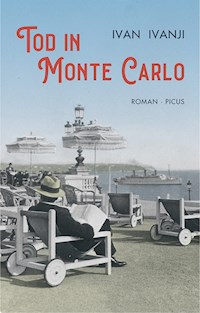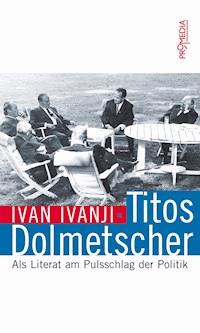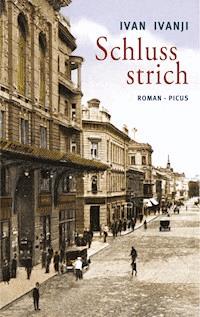
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Picus Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Rudolf von Radványi, ein ungarischer Jude, lebt im Belgrad des Jahres 1941 ein nicht ungefährliches Doppelleben: Zum einen ist er Dolmetscher der deutschen Intendantur, gedeckt von Oberst Martin Hellmer, mit dem ihn eine gemeinsame Vergangenheit verbindet, und zum anderen arbeitet er als Kommunist im Verborgenen gegen das nationalsozialistische Regime. Wie konnte es dazu kommen? Meisterhaft komponiert Ivan Ivanji eine Familiensaga, die rund hundertfünfzig Jahre überspannt: Beginnend bei den Rotbarts in Betschkerek im Banat der 1880er Jahre, als der junge Leopold seinen Nachnamen in Radványi ändert und dann Tierarzt wird, über seinen Sohn Ferenc, genannt Ferko, den Arzt, und dessen Sohn Rudolf, die beide – ohne es voneinander zu ahnen – als Partisanen gegen die deutschen Truppen kämpfen, bis hin zu Goran, dem Nachkriegskind, der den Zerfall Jugoslawiens miterlebt und seine Zukunft jenseits der Heimat sieht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 426
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
IVAN IVANJI
Schlussstrich
Gedruckt mit freundlicher Unterstützung der Kulturabteilung der Stadt Wien.
Copyright © 2017 Picus Verlag Ges.m.b.H., WienAlle Rechte vorbehaltenGrafische Gestaltung: Dorothea Löcker, WienUmschlagabbildung: © akg-images/arkiviISBN 978-3-7117-2051-1eISBN 978-3-7117-5342-7
Informationen über das aktuelle Programmdes Picus Verlags und Veranstaltungen unterwww.picus.at
Ivan Ivanji, 1929 im Banat geboren, war unter anderem Journalist, Diplomat und Dolmetscher Titos. Er lebt als freier Schriftsteller und Übersetzer in Belgrad. Im Picus Verlag erschienen zahlreiche seiner Romane, darunter »Barbarossas Jude«, »Das Kinderfräulein«, »Der Aschenmensch von Buchenwald«, »Geister aus einer kleinen Stadt«, »Buchstaben von Feuer« sowie 2014 »Mein schönes Leben in der Hölle«.
IVAN IVANJI
Schlussstrich
ROMAN
PICUS VERLAG WIEN
Inhalt
Über den Autor
1. OBERST HELLMER
2. LEOPOLD
3. FERKO
4. FRANZISKA
5. RUDOLF
6. IRINA
7. DER PARTISANENKRIEG
8. MASCHA
9. ZIGEUNERMUSIK
10. AEROBIC IN PEKING
11. GORAN
WEITERE BÜCHER VON IVAN IVANJI
1. OBERST HELLMER
Die ersten Sonnenstrahlen am frühen Morgen des 19. August 1941 versprachen der Hauptstadt Serbiens, Belgrad, einen angenehmen Sommertag. Es würde hoffentlich nicht mehr so heiß werden wie in den vergangenen Wochen, als man mit nackten Füßen kaum auf den Asphalt hatte treten können und der wolkenlose Himmel wie ein blauer Deckel über dem siedenden Topf des Häusermeers gelegen war. Die deutsche Besatzungsmacht bemühte sich um Normalität, die Bevölkerung sollte ruhig und zufrieden mit der neuen Ordnung sein, das war einfacher als Gewaltanwendung, die Truppen wurden an der Ostfront benötigt. Im Widerspruch dazu stand, dass auf einem der wichtigsten Plätze der Stadt, dem Terazije, mitten im Zentrum, von den Masten, die die Straßenbahnleitungen hochhielten, die Körper von fünf gehängten Männern baumelten.
Der Terazije-Platz mündet in den Hauptplatz, auf dem sich das Nationaltheater und die Reiterstatue des Fürsten Mihailo befinden. Junge Paare verabreden sich »unter dem Schwanz«, womit der Bronzeschweif der Skulptur gemeint ist. Man verliebt sich auch im Krieg. Vielleicht sogar erst recht im Angesicht der Gefahr?
Vor dem sechsstöckigen Haus schräg gegenüber des Theaters wäre Rudi fast mit einem Dreiertrupp der deutschen Militärpolizei zusammengestoßen, doch er sah es rechtzeitig, bemühte sich, Ruhe zu bewahren, und ging einfach an ihm vorbei. Trotz der Hitze trug er einen grauen Zweireiher mit blauer Krawatte, es erwies sich jetzt als günstig, dass Mama darauf bestanden hatte, ihm für das Studium je einen seriösen Anzug für den Winter und für die warmen Tage nähen zu lassen. Damals hatte er es überflüssig gefunden, aber nicht widersprochen, weil er sie in Belgrad ohnehin nicht tragen musste, wenn seine Mutter ihn nicht sah. Den Hut hatte er in der Hand. Er rannte das Stiegenhaus hinauf, ohne wie früher stets zwei Stufen zu nehmen – nicht weil er es damals eilig gehabt hätte, sondern weil er seine Energie nicht hatte zügeln können; jetzt bewegte er sich absichtlich gesetzt, ruhig, gutbürgerlich. Nicht auffallen!
Das Klingelzeichen hatten sie, lange bevor sie in die Illegalität abgetaucht waren, verabredet, nur so zum Scherz, dreimal kurz, dann länger und nach einer kleinen Pause noch zweimal ganz kurz. Petar, Kosename Pero, auch Mali genannt, der Kleine, öffnete tatsächlich fast sofort und sah ihn entsetzt an.
»Bist du verrückt geworden? Du solltest nicht herkommen!«
»Willst du mich nicht erst einmal reinlassen?«
Pero trat zurück, warf einen kontrollierenden Blick in das Stiegenhaus, versperrte die Wohnungstür hinter ihnen und begann mit einem Redeschwall: »Du, ich weiß nicht, ob es bei mir sicher ist, für eine Nacht vielleicht oder zwei, wir müssen etwas Besseres finden … Unterbrich mich nicht! Du weißt doch, wie mein Vater ist, also verpfeifen würde er dich nie, nie direkt … Aber gewiss wird er dich bitten, uns nicht zu gefährden. Er weiß, dass du Jude bist, aber natürlich nicht, dass wir beide Jungkommunisten sind. Dass man mir selbst auf die Schliche kommen könnte, wenn jemand verhaftet wird und nicht durchhält, das weiß er natürlich erst recht nicht, aber … Hör mal, wieso trägst du keinen Judenstern?«
»Lass mich doch endlich zu Wort kommen. Ich brauche keine Bleibe, ich bin ganz legal in einem Hotel angemeldet …«
»Was bist du?«
»Legal bin ich. Ein braver, ungarischer Mitbürger, Mitglied des deutschen Kulturbunds, angestellt beim deutschen Militärkommando. Ich will dich abholen, du kommst jetzt mit, Pero. Und zieh dich anständig an, wie ich. Feine Herrschaften fallen nicht auf. Ich muss dir auf dem Terazije-Platz etwas zeigen. Aber willst du mir nicht inzwischen einen Platz anbieten?«
»Ja, ich sage doch, dass du verrückt geworden bist. Bitte, nimm Platz. Soll ich dir vielleicht einen Kaffee kochen? Meine Mutter hat rechtzeitig einige Kilogramm beiseitegeschafft …«
Der Besucher kümmerte sich nicht um die Nervosität seines Kommilitonen und Genossen, er fand sie sogar ein wenig lächerlich. Freilich staunte er gleichzeitig, dass er so überlegen war, was ihn ziemlich selbstzufrieden machte: »Deine Eltern sind nicht zu Hause?«
»Nein, sie sind … Papa in der Bank, Mama in ihrem Blumenladen.«
»Das ist gut. Brave Gewohnheitsmenschen trotz des Krieges und der Besatzungszeit, das habe ich mir gedacht. Ist auch für dich gut. Ich möchte trotzdem, dass du dich beeilst. Nein, danke, keinen Kaffee …«
Anstatt sich zu setzen, trat Rudolf ans Fenster und öffnete es. Eine erschrockene Stadt. Wenige Passanten. Ein Fiaker rumpelte über den Platz, ein deutscher Kübelwagen bog in die Französische Straße ein. Hielt vor der Nummer sieben, gleich nach dem Theater. Dort war der Sitz der Gestapo.
»Willst du mir nicht erklären …«
»Gleich. Aber nur um dich zu beruhigen: Schau dir das an.«
Ein Ausweis, gutes graues Papier, oben der schwarze Reichsadler, ausgestellt auf Rudolf von Radványi, Dolmetscher, unleserliche Unterschrift, roter Stempel.
»Echt?«, staunte der Freund.
»Hundertprozentig.«
»Du bist nicht nur verrückt, sondern auch ein Hochstapler. Und wieso dieses Adelsprädikat? Wie bist du zu dem gekommen?«
»Das Ypsilon im Ungarischen ist so eine Art Adelsprädikat und es ist besser hoch- als tiefzustapeln. Je mehr du übertreibst, desto glaubwürdiger wirkst du heutzutage, niemand denkt auch nur im Schlaf, dass ein Illegaler ausgerechnet so etwas machen würde.«
»Bist du mit nicht einmal zwanzig nicht zu jung, um offizieller Dolmetscher für die Deutschen zu sein?«
»Ich glaube, dass ich älter aussehe. Insbesondere in dieser Aufmachung mit Hut.«
»Ich kenne dich doch, Mensch. Dein Blick soll schelmisch wirken, du funkelst so mit deinen schwarzen Augen, aber dahinter verbirgt sich nichts als Angst.«
»Wenn du das von meinem Blick ablesen kannst, hast du das Zeug zu einem guten Gestapoagenten.«
»Kann ich ja noch werden, wenn du ein amtlicher deutscher Dolmetscher bist …«
Es war jedoch nicht viel Zeit für Frotzeleien. Die beiden Jungkommunisten hatten keine Ahnung, wer der Generalsekretär ihrer Partei war, dass sein Pseudonym Tito lautete und schon gar nicht, dass er seine Illegalität in Belgrad im Laufe des Sommers auf ähnliche Weise schützte wie Rudi, nämlich mit einer Art Hochstapelei. Er wohnte in der Botić-Gasse in der Villa des steinreichen Besitzers der Tageszeitung Politika, Vladislav Ribnikar. Zwei Häuser weiter befand sich die Residenz des deutschen Stadtkommandanten, und Tito spazierte jeden Morgen elegant gekleidet mit einem großen, deutschen Schäferhund an dem Posten vorbei. Auffälliger konnte man sich gar nicht benehmen, und deshalb wurde dieser Herr mit Hund von keiner Patrouille verdächtigt und angehalten.
Während Pero in sein Zimmer gegangen war, um sich umzuziehen, sah sich Rudi in dem vertrauten, mit alten Möbeln vollgestopften Salon um. Nichts hatte sich verändert. Ein wenig roch es nach Staub. Er atmete durch, denn es fiel ihm nicht leicht, die Ruhe zu bewahren. Die beiden waren schnell unzertrennliche Freunde geworden, der Belgrader Pero, der kleiner und magerer war, hatte sich des »Provinzlers« angenommen. Rudi hatte pechschwarze, ein wenig zu lange Haare, was seinen Vater geärgert, aber seine Mutter gut geheißen hatte, Pero hingegen trug eine hellbraune, fast blonde, ordentlich gescheitelte Frisur.
»Na endlich!« Pero hatte gar nicht so lange gebraucht, sich anzuziehen. »So ist es recht. Gehen wir?«
»Du bist … Wie zum Teufel hast du dir so einen Ausweis verschaffen können? Und hast du überhaupt Verbindung zur Organisation?« Organisation nannte man unter Genossen die Partei.
»Das erzähle ich dir später. Oder vielleicht lieber nicht. Vorerst immer mit der Ruhe. Eines kann ich dir sagen, die frühere Verbindung habe ich nach dem Putsch am 27. März verloren, aber … Du kannst beruhigt sein, ich kann dir jetzt nicht alles sagen, das wirst du verstehen, und ob du berichten musst, dass wir uns gesehen haben, weiß ich nicht. Das musst du selber entscheiden.«
Pero seufzte und sagte zum dritten Mal: »Sag ich ja, du bist definitiv verrückt geworden! Wieso meinst du, dass ich noch eine Verbindung mit der Partei habe?«
»Ich kenne dich doch!«
Terazije ist ein persisches Wort, das aber auch im ottomanischen Reich dieselbe Bedeutung hat, nämlich Waage, gleichzeitig jedoch kennzeichnet es auch den Begriff der Wasserverteilung. Belgrad gehörte bis tief in das neunzehnte Jahrhundert zum Osmanischen Reich, erst 1867 wurde die türkische Fahne eingezogen und Ali Riza Pascha übergab feierlich dem Fürsten Mihailo die Schlüssel der Stadt, demselben, unter dessen 1882 errichteten Denkmal sich junge Belgrader am liebsten zu versammeln pflegten.
Die türkische Verwaltung hatte Wasserspeichertürme gebaut, der größte wurde 1859 abgerissen, um einem schönen Brunnen Platz zu machen, und so erhielt Terazije seinen Namen. Es war eigentlich gar kein Platz, sondern schon seit Langem eine nach beiden Seiten erweiterte Hauptstraße. In der Mitte gab es 1941 kleine Rasenflächen und eine Bedürfnisanstalt, rechts und links verliefen Straßenbahnschienen. Die erste Linie wurde 1894 in Betrieb genommen, die Wagen wurden von Pferden gezogen, aber ab 1905 fuhr die Tram schon elektrifiziert.
Als Belgrad die Hauptstadt nicht nur Serbiens, sondern des Königreichs Jugoslawien wurde, erhielt Terazije eine gute Beleuchtung. Hohe Masten trugen rechts und links auch die Leitungen für die Straßenbahn an schön geschwungenen schmiedeeisernen Armen, auf die freilich bisher kaum jemand geachtet hatte. Auf sie knüpfte die deutsche Besatzungsmacht fünf junge Männer, die für Mitglieder der Befreiungsbewegung gehalten wurden. Die Hinrichtung wurde nicht hier durchgeführt, man hatte sie vorher erschossen. Ihre Leichname mitten im Zentrum der Stadt aufzuhängen, war eine Idee des Gestapochefs, des SS-Sturmbannführers Karl Kraus. Kraus musste sich mit seiner makabren Idee an den Befehlshaber für Serbien, General Heinrich Dankelmann, wenden, der einige Bedenken hatte, er wollte nicht riskieren, die Bevölkerung gegen seine Truppen aufzuhetzen. Der SS-Offizier setzte sich durch, musste allerdings versprechen, dass die zum Tode verurteilten Männer klar als kommunistische Terroristen bezeichnet würden.
Dutzende Menschen blieben an diesem Morgen entsetzt oder nur verwundert stehen. Es war unglaublich. Mehr als zehn Meter über ihnen hingen die gefesselten Männer ruhig, fast unbeweglich, nur ganz leise schaukelten sie im Wind, starr wie Puppen. Es war unvorstellbar, aber real. Die neue Realität. Und da sie so hoch hingen und sich nichts an ihnen rührte, die Gesichter kaum erkennbar waren, keine Todesangst, kein Krampf des Erstickens zu sehen war, sondern eine blasse Gleichgültigkeit, war es zwar möglicherweise nicht so furchtbar, wie es sich Kraus vorgestellt hatte, aber schrecklich genug und weckte neben Angst und Verzweiflung auch Wut.
Die Straßenbahnen fuhren wie gewöhnlich vorbei. Dass Juden die Fahrt mit ihnen verboten war, war eigentlich überflüssig, denn in Belgrad gab es keine freien Juden mehr. Sie waren schon tot oder in Lagern. Wenige von ihnen hatten sich zu den Partisanen in die Wälder durchgeschlagen, noch weniger waren bei guten Menschen versteckt.
Auf der Mauer eines modernen Eckhauses verkündeten große Buchstaben auf Deutsch »Kraft durch Freude – Front Bühne«. Es war das jüngste, sehr moderne Kino der Stadt, in dem auch schon vor dem Krieg vor allem UFA-Filme gezeigt worden waren. Ein anderes, etwas kleineres Plakat auf Serbisch warb für Pferderennen. Vier Monate nach der Eroberung versuchte die Besatzungsmacht vorzutäuschen, das Leben gehe weiter wie bisher. Für manche war es tatsächlich so. Die gehängten Männer bewiesen jedoch, dass es sich im wahrsten Sinne des Wortes um eine neue Ordnung handelte.
Rudolf und Pero betrachteten die Gehängten lange von der anderen Seite des Platzes. Unwillkürlich gaben sie sich die Hand. Sie standen vor dem Hotel »Moskva«, das 1906 im sezessionistischen Stil erbaut worden war, nur von einem kleineren Platz mit Brunnen von ihm getrennt auf derselben Seite des Platzes das modernere, 1936 fertiggestellte Hotel »Balkan«. Aus den Fenstern der beiden besten Herbergen der Stadt bot sich ein guter Blick auf die Hingerichteten.
»Den einen kenne ich«, sagte Pero und verbesserte sich sofort. »Ich habe ihn gekannt … Das ist Milorad Pokrajac. Er ging in die siebente Klasse des Gymnasiums.«
»In welches Gymnasium?«
»Nicht in Belgrad, in Vinkovci. Die Deutschen haben dort seinen Vater ermordet und dann ist er hierher geflohen und hat sich uns angeschlossen.«
»Uns? Jetzt hast du es zugegeben … Du musst aufpassen, Pero. Und?«
»Ja, er wollte ein Attentat auf einen deutschen Offizier verüben. Das hat er wahrscheinlich versucht …«
Die beiden jungen Männer standen noch ein Viertelstunde still, als wären sie eine Ehrenwache, sodass sie einem serbischen Geheimpolizisten im Dienste der Deutschen auffielen. Junge Männer waren ohnehin verdächtig. Er trat an sie heran, zeigte seine Dienstmarke und befahl harsch: »Papiere!«
Rudolf zeigte seinen Ausweis. Der Mann nickte: »Und der andere?«
»Der Herr ist in meiner Begleitung!«
Als der Polizist weitergegangen war, flüsterte Pero: »Die Leute stehen herum, gaffen, gehen wir weiter …«
Später erfuhren sie, wer die anderen Ermordeten waren, der Schneidergeselle Jovan Janković, der Schustergeselle Svetislav Milin und die Bauern Velimir Jovanović und Ratko Jevtić.
»Warum hast du mich eigentlich hergeschleppt, Rudi?«
»Ich hatte einfach die Bedürfnis, es mit noch jemandem anzuschauen …«
»Eigentlich ist das dumm und gefährlich.«
»Das weiß ich.«
Die beiden Freunde waren seit dem Einmarsch der deutschen Besatzungsmacht am 13. April vorsichtiger geworden, hatten nicht sofort gewusst, wie es weitergehen sollte. Sie trafen sich im Laufe der ersten Wochen selten und nur in Parkanlagen, denn sie wollten einander nicht gefährden. In der letzten Zeit waren sie auf verschiedene Weise »organisiert«, wie man das nannte, auf unterschiedliche Weise an die streng illegale, gemeinsame Partei gebunden, eigentlich durften sie nicht gemeinsam öffentlich gesehen werden, aber von ihrer alten Kameradschaft wollten sie nicht ablassen, noch begriffen sie nicht ganz, wie lebensgefährlich das war.
Frühherbst. Ein warmer Oktobertag. Sie saßen auf einer Bank in der Grünanlage der alten Festung Kalemegdan und ihr Blick schweifte über den Fluss Save. Rechts konnte man die Mündung in die viel mächtigere Donau erkennen. Die Möwen waren vielleicht vom weit entfernten Schwarzen Meer, wo die Russen eine schwere Niederlage nach der anderen erlitten, bis hierher geflogen. Auf dem anderen Ufer begann der neue, sich unabhängig nennende, aber nur durch deutsche Gnade entstandene Staat Kroatien. Der Fluss, der bis vor Kurzem nur zwei Stadtteile voneinander getrennt hatte, war jetzt Staatsgrenze wie vor dem Ersten Weltkrieg. In ihrem Blickfeld befand sich auch das ehemalige Belgrader Messegelände. Sie wussten noch nicht, dass dort gerade Vorbereitungen liefen, ein Konzentrationslager für Juden und Roma zu errichten. Sie flüsterten von deutschen Meldungen über unerhörte Siege im fernen Russland, von dem die Jugoslawen vergeblich Hilfe erwartet hatten, fragten sich, ob sie wahr waren oder nur Propaganda.
»Ich fürchte, es ist mehr als Propaganda«, sagte Rudolf.
Die beiden Freunde hätten einander viel erzählen können, aber es war besser, nichts zu wissen, was man unter Gestapofolter verraten könnte. Niemand wusste, wie lange man durchhalten würde. Was man nicht weiß, kann man nicht verraten. Es war belastend, ständig aufpassen zu müssen.
»Ich wäre ja so neugierig, wie du es geschafft hast«, begann Pero. »Was machst du eigentlich für die Deutschen? Aber sag mir nur ja nichts, was gefährlich sein könnte!«
»Und wie kommt dein Vater so zurecht?« Rudolf lenkte ab.
»Ein braver Angestellter seiner Bank, was freilich in der Praxis bedeutet, dass er de facto für die Besatzungsmacht arbeitet …«
»Gerne würde ich ihn grüßen lassen, aber dann müsstest du sagen, wo und wie wir uns getroffen haben. Und die Mama?«
»Danke. Sie klagt, wie schwierig es ist, Ware zu beschaffen, aber es geht ganz gut, die deutschen Offiziere brauchen viele Blumen für ihre Maitressen, echte Kavaliere, besonders die Österreicher.« Das war natürlich ironisch gemeint. Er zögerte, ob er fragen sollte. »Und die deinen?«
»Mutter ist in Novi Sad. Soviel ich weiß … Unter den Ungarn ist es angeblich besser als hier. Meine Großeltern … Keine Ahnung, wie es meinen Großeltern mütterlicherseits ergangen ist, die leben ja in Deutschland, in Weimar, wahrscheinlich schrecklich. Opapa aus Perlez, der Tierarzt, ist tot. Es heißt, er habe sich zu Tode gesoffen, was ich mir nicht vorstellen kann. Ich habe ihn nie betrunken gesehen. Vielleicht hat er das alles nicht ertragen wollen. Die Omama ist auch nach Novi Sad gezogen.«
»Ich weiß nicht, ob ich weiter fragen darf … dein Vater?«
»Das sollte ich wahrscheinlich … Ach was, ich sag’s dir. Ich habe gehört, dass er in den Wald gegangen ist.« So nannte man das, wenn sich einer den Partisanen angeschlossen hatte. »Er ist sofort nach dem Einmarsch der Ungarn in die Batschka verschwunden. Aber meine Eltern haben sich ohnehin schon früher auseinandergelebt, er hat selten zu Hause übernachtet.«
»Er als Freiheitskämpfer?«, wunderte sich Pero.
»Ja. Falls es stimmt. Der solide, pragmatische Mensch, den ich immer ein wenig als Opportunisten verachtet habe … Schön wäre es, falls es wahr ist. Ich habe natürlich keine Verbindung zu ihm. Wer weiß, manchmal war er so ruhig, freundlich zu Hause, ich habe ihn aber auch aggressiv und brüllend erlebt. Was ihn angeht, kann ich mir wirklich alles vorstellen. Nun ja, wer kennt schon seinen Vater, du vielleicht?«
Dazu sagte Pero nichts. Sie schwiegen und fühlten, wie ihre Gedanken aneinander vorbeischwirrten.
»Und die Liebe?« Rudolf wollte das Gespräch irgendwie weiterführen.
»Wenn du Vera meinst, ich habe sie seit Kriegsausbruch nicht gesehen. Ich weiß nicht einmal, ob sie in Belgrad ist …«
»Schau doch bei ihr vorbei.«
»Das wäre vielleicht zu gefährlich für sie. Unsereins sollte mit niemandem Kontakt haben, man sollte niemanden damit in Gefahr bringen, dass man ihn verdächtigen könnte, zu uns zu gehören. Und ich fühle mich ohnehin wie eine Wolke in Hosen.«
»Majakowski?«
»Natürlich. Aber weißt du, in den Hosen wäre noch etwas da bei mir, im Kopf jedoch heißt es, Ruhe zu bewahren …«
»Und das Herz?«
»Das klopft manchmal rasend. Und bei dir? Tut sich was?«
»Etwas schon … vielleicht …« Einen Augenblick überlegte Rudolf, aber dann beschloss er, lieber nichts von Irina zu sagen.
Jedermann hat manchmal das Bedürfnis, seine Gedanken, Sorgen und Ängste laut auszusprechen, sie jemand anderem mitzuteilen, Bedrängnisse loszuwerden. Darum braucht man Freunde, die einen anhören, die mitfühlen, trösten können. Nachdem Rudolf über seinen Vater mehr mitgeteilt hatte, als er es im Nachhinein für gut hielt, hätte er am liebsten über seine Begegnung mit Oberst Martin Hellmer berichtet, aber das war unmöglich, es hätte für alle drei lebensgefährlich werden können, auch für den deutschen Offizier. Immer mehr Genossen wurden verhaftet, gefoltert, in das Konzentrationslager Banjica in Belgrad interniert oder hingerichtet. Möglicherweise gab es Verräter und Provokateure in den Reihen der Jungkommunisten, die Agenten der serbischen Sonderpolizei kannten ohnehin von früher viele Kommunisten, die noch im Königreich zu Haftstrafen verurteilt worden waren oder langfristig beobachtet wurden. Sofort nach dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht wurden serbische Polizeiorganisationen der Gestapo unterstellt, um die schmutzigste Arbeit zu leisten, aber auch weil ihnen die Szene schon seit Langem vertraut war. Wie lange würde Pero unter Folter aushalten, falls man ihn erwischte? Rudolf wusste es auch von sich nicht, er musste aber den Freund zumindest vor dieser Versuchung bewahren und schwieg. Er schwieg so lange, dass es Pero auffiel.
»Was hast du?«
»Nichts, Mali.« Pero zuckte zusammen. Schon lange hatte ihn niemand mit diesem Kosenamen angesprochen. »Sind diese Wolken nicht wunderschön?«
»Das sind sie, aber ich verstehe schon, du möchtest mir etwas sagen und traust dich nicht.« Und als Rudolf schwieg, setzte er fort. »Sicher hast du recht. Die schönen Wolken werden sich in nichts auflösen.«
Rudolf hatte es nach mehr als zwei Monaten der Besetzung Belgrads durch die deutschen Truppen gewagt, in das Dorf Perlez im Banat zu fahren um, wenn möglich, Speck, Würste und Schinken zu holen. Die Gegend östlich der Theiß gehörte formal zu Serbien, man benötigte keine Papiere. Viele Belgrader setzten über die Donau, um sich mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Die einzige große Brücke war zwar gesprengt, aber der Fährdienst funktionierte gut. Nach Hause, nach Novi Sad in der Batschka, wagte er sich nicht. Diesen Teil des Landes hatten die Ungarn besetzt, also hätte er einen Pass gebraucht.
Satter Juli. Kukuruz hoch wie ein Wald. Das kannte er, das war wie ein Ausflug in die Kindheit. Kurz stand er am Grab des Großvaters. Er wusste, ein guter Jude würden einen Kaddisch sprechen, aber er fühlte sich überhaupt nicht als Jude und hätte nicht gewusst, wie man das macht. Einen Stein soll man aufs Grab legen, das wusste er und das tat er.
Großmutter war entzückt und erschrocken zugleich. Ordentlich frisierte graue Haare, graues Kleid, jugendlich in stets schneller, fast hastiger Bewegung. Seltsam, dachte der Enkelsohn, ich habe sie, noch vor kaum zehn Jahren, als langsame, bedächtige Frau in Erinnerung. Sie rief laut, wie glücklich sie sei, ihn in so guter Verfassung zu sehen, aber sofort danach, wie gefährlich sein Erscheinen sein könnte, hier kenne doch jeder jeden und alle wussten, dass sie Juden waren. Nun, vielleicht lebten hier auch gute Menschen. Allerdings … Bisher jedenfalls … Sie kam ins Stottern. In Novi Sad sei es womöglich besser und in Belgrad könne er vielleicht leichter untertauchen, oder … Und dann kam die Großtante aus dem anderen Zimmer und weinte und lachte zugleich und zeigte sich noch besorgter. Rudolf erklärte, er müsse etwas holen, um zu überleben, und ob noch Speck da sei, ironisierte er, als gute Juden habe man doch geschlachtet, als die Großtante ans Fenster trat und schrie: »Die Deutschen kommen!«
»Verschwinde in die Scheune!«, rief Omama. Aber Rudolf trat auch ans Fenster, ein Mercedes und ein Kübelwagen waren vorgefahren, es war zu spät sich zu verstecken, weil ein groß gewachsener Offizier bereits an der Tür klopfte. Rudolf stellte gleich fest, dass das Klopfen irgendwie höflich und normal klang, und da die beiden alten Damen wie erstarrt waren, machte er selbst auf und erkannte sofort die Rangabzeichen eines Obersten. So hohe Offiziere kamen bestimmt nicht, um kleine Juden abzuholen.
»Guten Tag!«, sagte der Offizier. »Hellmer mein Name. Vielleicht kann sich jemand von Ihnen an mich erinnern …«
Oberst Hellmer war kein junger, aber ein noch immer gut aussehender Mann, mehr als eins achtzig groß, der weiße Lippenbart war zu einem schmalen Hitlerbärtchen gestutzt, aber Rudolf fühlte sich erleichtert und wurde gleich frech.
»Ja, doch, Herr Oberst … Aber Sie waren damals in Zivil und hatten einen gezwirbelten schwarzen Schnurrbart!«
»So ist es, junger Mann. Darf ich mich setzen? Der Enkelsohn? Und wo ist der Herr Doktor Radványi?«
»Er ist nicht mehr bei uns.«
Der Offizier begriff.
»Mein Beileid. Aber Sie, Frau Flora? Bei guter Gesundheit? Na, Gott sei Dank …«
Rudolf konnte sich sehr gut erinnern, er war damals acht oder neun Jahre alt gewesen, Großvater und Vater waren in den Sommerferien mit ihm nach Perlez gekommen, weil der Urgroßvater gestorben war, ein Mann noch in besten Jahren. Sie wollten sein Wirtshaus und das Gut verpachten, doch dann beschlossen sie, einen Verwalter anzustellen. Sie alle schliefen damals im alten Haus mit dem kleinem Vorgarten, der Hinterhof war Hühnern, Enten, Gänsen und einem Pfau vorbehalten. Mindestens ein farbenprächtiger, Rad schlagender Pfau gehörte zu jedem wohlhabenden Hof im Banat. Einige Kühe und Schweine standen im Stall. Im Wirtshaus »Zum weißen Krug«, das auch ihnen gehörte, wurde der Junge damals einem Herrn aus Österreich vorgestellt, mit dem Urgroßvater gute Geschäfte gemacht hatte und der nun mit Opapa über die künftige Zusammenarbeit reden wollte. Rudolf durfte sich mit an den Tisch setzen, bekam eine Limonade, die beiden älterem Herren tranken Maulbeerschnaps und unterhielten sich über Getreidepreise, dann stieß auch sein Vater dazu und es wurde erst eine Suppe und danach Gegrilltes aufgetragen. Das neue Thema war, wie der Wein dieses Jahr sein würde. Gut, wahrscheinlich, es war warm genug und gehagelt hatte es überhaupt nicht.
Später fragte er seinen Vater, wieso der österreichische Herr seinen Großvater mehrmals als Bruder und mit dem Vornamen, Leopold, angesprochen hatte, nicht als Herrn Doktor Radványi, wie es sich gehörte – sei man verwandt? Und warum hatte Urgroßvater Rotbart geheißen und sein Sohn, der Großvater, Radványi? Nein, erklärte der Vater, verwandt sei man nicht mit dem Österreicher, die beiden gehörten aber einer Vereinigung an, in der sich die Mitglieder so ansprachen. Und was die Nachnamen anging: Großvater habe seinem Namen magyarisiert. Erst einige Jahre später würde Rudolf das alles halbwegs begreifen. Jetzt bohrte er nach:
»Was sind Freimaurer, Papa?«
»Kein Ahnung.«
»Soll ich Opapa fragen, der ist doch einer, nicht wahr?«
»Der weiß auch nicht, warum er das macht! So ist er nun einmal. Er muss immer alles übertreiben …« Es klang so abweisend, dass der Junge Ruhe gab.
Und jetzt? Konnte ein hoher Hitleroffizier Freimaurer sein? Die Frage direkt zu stellen, wagte er natürlich nicht. Er wäre ohnehin nicht zu Wort gekommen, weil Oberst Hellmer seiner Großmutter und seiner Großtante erklärte, sie müssten so bald wie möglich über die Theiß in die Batschka übersetzen. Sie sollten noch heute und morgen alles, was möglich war, losschlagen, Geld und womöglich Gold mitnehmen, durchsuchen werde man sie an der Grenze nicht, dafür würde er sorgen, er würde ihnen noch heute Papiere verschaffen.
»In einigen Tagen werden alle Juden im Banat verhaftet!«, erklärte er.
»Und Rudolf?«, fragte Großmutter ängstlich.
»Keine Sorge, den nehme ich mit!«
In diesem Augenblick trat, ohne anzuklopfen, ein Mann im schwarzen Anzug, weißen Hemd und der Hakenkreuzbinde am Ärmel forsch in das Zimmer, zuckte aber vor dem Obersten zusammen, der sofort fragte: »Sie sind?«
»Klemens Lorenz, Herr Oberst. Mein Vater war Gutsverwalter beim Juden und ich habe Haus und Hof zu übernehmen … Mein Vater ist auch noch da, und …«
»Recht so, Volksgenosse«, unterbrach in der hohe Offizier. »Die Erträge werden Sie mit meiner Intendantur in Belgrad abrechnen, der junge Mann da wird mein Verbindungsmann sein.«
»Aber der ist doch Jude!«
»Der Reichsmarschall hat einmal gesagt, wer Jude sei, bestimme er. Hier im Banat und in Serbien bestimme ich das, Lorenz, und verantworte es vor dem Führer, verstanden?«
»Jawohl, Herr Oberst.«
»Die beiden alten Frauen da lasse ich über die Theiß nach Ungarn verfrachten. Erst einmal können Sie jetzt gehen, Volksgenosse Lorenz, natürlich bleiben wir in Verbindung, das Reich braucht das Getreide hier und das Vieh. Das ist kriegswichtig!«
»Zu Befehl, Herr Oberst!« Er ging aber nicht, sondern blieb an der Tür stehen, als müsste er die Situation auch weiterhin überwachen.
Rudolf wagte kein Wort zu sagen. Dieser Lorenz war doch Vaters Freund gewesen, die beiden waren gemeinsam ausgeritten, waren zur Jagd gegangen. Jetzt sprach er verächtlich vom Juden. Wenn dieser Offizier nicht aufgetaucht wäre, hätte er ihn also wahrscheinlich ohne Weiteres angezeigt. Rudolf suchte den Blickkontakt zu dem Volksdeutschen, aber der vermied ihn, wandte sich nur an den Obersten.
»Wir haben auch zwei Jagdgewehre und eine Pistole, Marke Browning, beschlagnahmt.«
»Interessiert mich nicht. Melden Sie das den Behörden!«
Der Oberst besichtigte kurz Haus und Hof, Lorenz und die Frauen zwei Schritte hinter ihm. Als er die Scheune aufmachte, rief er überrascht: »Ein Laubfrosch!«
»Wie bitte?«, fragte Lorenz.
»Das war der Spitzname dieses Opels. Fährt er noch?«
»Das Ding steht schon mehr als ein Jahrzehnt nur so herum.«
»Wollen Sie mir das Auto verkaufen, Frau Radványi?«
»Es gehört meinem Sohn und der …«
Lorenz fiel ihr ins Wort: »Sie können das Fahrzeug doch beschlagnahmen, Herr Oberst. Vielleicht hätten wir es anmelden sollen, ich habe aber gedacht, dass es nichts wert ist.«
Hellmer kümmerte sich nicht um diese Bemerkung: »Und wo ist Ihr Sohn, Frau Radványi?«
»Das wissen wir schon lange nicht«, seufzte Frau Flora.
»Das wissen wir wirklich nicht!«, bestätigte Lorenz ungefragt.
Für einen Augenblick wurde es so still, dass Rudolf wieder nur Vogelgezwitscher hörte, das Summen von Insekten, Lieder der Banater Erde im Sommer. Dann umarmte er Großmutter und Großtante. Der Oberst wies ihn an, in den Kübelwagen zu steigen. Lorenz grüßte den Oberst mit erhobener Hand.
»Heil Hitler, Herr Oberst!«
Später erfuhr Rudolf, dass Martin Hellmer aus dem Burgenland stammte, deshalb ebenso gut Deutsch, Ungarisch und Kroatisch sprach wie hier im Banat fast jedermann, nur dass fast dieselbe Sprache hier Serbisch hieß. Hellmer wollte als junger Bursche das Gut seiner Vorfahren nicht übernehmen, sondern Berufsoffizier werden, kämpfte im Ersten Weltkrieg an der Isonzo-Front, wurde verwundet und hoch dekoriert. Als nach dem Zerfall Österreich-Ungarns mit dem Soldatentum, das ihn ohnehin enttäuscht hatte, nichts mehr los war, übernahm er doch das Familiengut, das ihm jedoch nicht genügte, und so stieg er erfolgreich in den Großhandel mit Getreide ein. Das hatte ihn auch bis nach Perlez und zu Rudolfs Urgroßvater und Großvater geführt. Nach dem »Anschluss« Österreichs an Großdeutschland bekam er es mit der Angst zu tun. Zwar war er Mitglied der wenig bekannten Freimaurerloge »Prometheus«, was man in seinem Heimatdorf im Burgenland nicht wusste, aber es galt vorzubeugen. Er beantragte die Aufnahme in die Wehrmacht, sprachgewandte Experten waren gefragt. Zu Kriegsbeginn erwies er sich in Frankreich als so energisch und geschickt, dass er befördert und mit Beginn des Jugoslawienfeldzugs im April 1941 als Oberstintendant nach Belgrad geschickt wurde und nicht nur für das besetzte Serbien, sondern ganz besonders auch für den Banat zuständig war. Er war praktisch für die Geldversorgung, Verpflegung, Bekleidung und auch die Lazarette und die Feldpost zuständig, die Generäle verließen sich lieber auf ihn, als sich in Dinge, die sie nicht verstanden, einzumischen. Er hatte, wann immer er es wünschte, Zutritt zum Befehlshaber Serbiens, Dankelmann, deshalb war er sehr mächtig. Der Sicherheitsdienst beäugte ihn argwöhnisch, mit dem Hauptmann der Abwehr, Josef Matl, ein weiterer Österreicher, war er hingegen eng befreundet. Die Offiziere der militärischen Abwehr der Wehrmacht und die SS konnten einander ohnehin nicht leiden, wer jedoch über so viele praktische Möglichkeiten verfügte, alles Denkbare schnell zu erledigen, wie Oberst Hellmer, stand über jeder Intrige.
Natürlich wussten Gestapo und SD alles über ihn und er wusste, dass sie es wussten. Die Beziehungen zwischen deutschen Freimaurern und der nationalsozialistischen Bewegung waren nicht einfach. Alfred Rosenberg hatte 1921 seine Schrift »Die Verbrechen der Freimaurerei. Judentum, Jesuitismus, Deutsches Christentum« veröffentlicht. Die drei altpreußischen Großlogen gaben am 16. Februar 1924 in einer gemeinsamen Erklärung bekannt, dass nur Christen in eine Freimaurerloge aufgenommen werden könnten und die Logen keine Beziehungen mehr zu den Brüdern in den Logen der Siegermächte des Ersten Weltkriegs unterhalten würden. Das war zwar gegen die Grundprinzipien der Freimaurerei, aber wen kümmerte es? Die Großloge von Preußen, »Royal York zur Freundschaft«, die Großloge der Freimaurer von Deutschland und die Große National-Mutterloge »Zu den drei Weltkugeln« nahmen eine nationalistische und konservative Haltung an, was nicht alle Logen goutierten. Am 7. April 1933 wurde auf einem Treffen des Großmeisters der Großen Landesloge der Freimaurer von Deutschland mit Hermann Göring die Umbenennung in den Deutsch-Christlichen Orden der Tempelherren vereinbart und die meisten Logen passten sich an. Die von der Großloge »Zur Sonne« ab 1926 als Erkennungsmerkmal verwendete kleine Blume, ein blaues Vergissmeinnicht, wurde später zum allgemeinen halbgeheimen Abzeichen.
Hitler hatte 1938 eine Amnestie für Freimaurer erlassen, die keine hohen Ämter in ihren Logen innehatten. Wenn sie im Staatsdienst bleiben wollten, wo er viele von ihnen brauchte, sollten sie einfach die Verbindung mit der Organisation abbrechen. In einem SS-Bericht hieß es ausdrücklich, Freimaurer erledigten ihre Aufgaben meist gut, aber es sei unzulässig, sie in der Wehrmacht zu fördern oder für leitende Dienstgrade vorzusehen. Oberstintendant war freilich ein ziemlich hoher Dienstgrad und Hellmer hoffte, der SD würde ihn trotzdem in Ruhe lassen. Lebensbedrohlich würde eine Entdeckung seiner früheren Verbindungen nicht sein, aber wer weiß? Zumindest an die Ostfront würde man ihn schicken. Mit der Beschaffung von Papieren für jüdische Frauen und der Anstellung von Rudolf in der Intendantur hatte er allerdings etwas getan, was er nicht als Irrtum erklären hätte können.
Rosenberg hatte schon lange vor der Machtergreifung behauptet, an der Spitze aller deutschfeindlichen Kräfte stünden die Großloge Frankreichs und serbische Freimaurer. Hitler dachte eigentlich differenzierter. Im Laufe eines seiner Tischgespräche in der Wolfsschanze im Februar 1942 erzählte er, vor der Machtergreifung sei er selbst einmal zum Besuch einer Loge in München eingeladen worden, habe natürlich abgelehnt, Ludendorff jedoch sei nicht nur hingegangen, sondern habe sich sogar unvorsichtig in ihr Buch eingetragen. Manche Deutsche seien aus Dummheit Freimaurer geworden, wenn sie austräten, habe man sie in Ruhe zu lassen.
Es war für Oberst Hellmer überhaupt kein Problem, Rudolf Radványis Identität zu verbessern, ihn etwas älter zu machen und als ziviles Mitglied seines Stabes als Dolmetscher anzustellen.
Rudolf war klar, dass seine Partei diese Entwicklung begrüßen würde. Natürlich war das alles gefährlich. Sehr gefährlich sogar, aber ein richtiges Abenteuer. Er bekam nur eine einzige Kontaktperson und einen Ersatzkontakt, die vorläufig nicht aktiviert wurden, allerdings würde er jetzt von anderen Genossen als abtrünnig, sogar als Verräter wahrgenommen werden, auch wenn man ihm als Juden diesen verzweifelten Versuch zu überleben vielleicht nachsehen könnte. Vielleicht würde man trotzdem versuchen, ihn als Verräter zu ermorden. Wirklich vorstellen, von den eigenen Genossen getötet zu werden, konnte sich Rudolf jedoch nicht, er lebte nicht in Angst und Schrecken, ihn verfolgten keine schlimmen Träume, alles war so … er suchte ein richtiges Wort für sich … so interessant. Interessant war nicht der richtige Ausdruck. Aufregend? Besser, aber er war ihm nicht gleich eingefallen.
Also war er nun Herr Rudolf von Radványi. Abwarten. Das ist stets schwierig, aber warten heißt auch, dass etwas noch kommt. Bestimmt kommen wird.
Indem er ihn gerettet hatte, hatte sich Hellmer Rudolf gewissermaßen ausgeliefert. Wenn man entdecken würde, dass der Dolmetscher der deutschen Intendantur Kommunist und dazu auch noch Jude war und man ihn foltern würde? Dann könnte auch herauskommen, dass der keineswegs geliebte Oberst früher nicht nur Freimaurer gewesen war, sondern auch eine alte Verbindung zu Juden im Banat besaß, die er verschwiegen hatte. Schon deshalb musste er alles tun, um seinen Schützling nicht auffliegen zu lassen. Aber warum hatte er überhaupt das Risiko auf sich genommen, Rudolf, dessen Großmutter und Großtante zu retten? Weil er eigentlich trotz der Uniform ein guter Mensch war? Gab es das also wirklich?
Der erste Herbst in Belgrad unter deutscher Besatzung ging zu Ende, der Winter drohte. Ein kalter Wind wehte aus dem Osten, aus Russland, wo deutsche Truppen auch weiter auf dem Vormarsch waren und bald Moskau und Leningrad einnehmen wollten. Bei ihren Gegnern breitete sich Verzweiflung aus, und viele Menschen versuchten, sich der Lage anzupassen. Man fürchtete sich davor, die Wohnungen nicht heizen zu können, niemand wusste, wie die Versorgung mit Holz und Kohle im Winter funktionieren würde. Wohlhabende Bürger hatten sich in den serbischen Kurorten, zum Beispiel in Vrnjačka Banja, Wohnmöglichkeiten gesichert.
Die Stadt war voller Plakate, die eine Ausstellung über Freimaurer, Juden und Kommunisten ankündigten. Sie wurde am 20. Oktober in der Garašanin-Straße 6 eröffnet. Dort hatte sich früher die Großloge Jugoslawiens befunden. Wie wichtig es für die Quisling-Regierung war, sich auch auf diese Weise bei der Besatzungsmacht einzuschmeicheln, bewies, dass sechzigtausend Plakate und hundertachttausend Broschüren gedruckt, vier Sonderbriefmarken ausgegeben und hundertsechsundsiebzig Werbespots in den Kinos gezeigt wurden.
Von einem der Plakate glotzte die Fratze einer in einen schwarzen Kaftan gehüllten Figur mit einer Waage in der Hand. Auf der rechten Waagschale lag viel Geld, auf der anderen stand Stalin mit rotem, fünfzackigem Stern an der Brust, die Inschrift lautete: »Was wiegt schwerer? Nichts, denn der Jude sorgt für das Gleichgewicht. Besuchen Sie die Ausstellung über das wahre Wesen der Freimaurerei und Sie werden überzeugt sein.« Auf einem anderen balancierte der Jude im Kaftan mit gegrätschen Beinen auf einem Brett über einem Globus, rechts war ein Mann mit einer Krücke, links ein anderer mit Glatze, beide blickten untertänigst hinauf und die Inschrift lautete »Jüdisches Gleichgewicht«. Auf einem dritten war eine Fratze zu sehen, die jüdisch wirken sollte, der Bart ging in ein Schlangenknäuel über, die Köpfe der Reptilien zierten ein roter Stern, ein Dollar-Zeichen, Hammer und Sichel sowie ein Dreieck als Symbol des Freimaurertums.
In seiner Eröffnungsrede hatte Djordje Perić, der als Chef der staatlichen Propaganda vorgestellt wurde, behauptet, Ziel der Freimaurer sei es, Familie, Staat und Religion zu vernichten und die eigene Weltherrschaft an ihre Stelle zu setzen, wodurch die ganze Menschheit versklavt werden solle.
Der erste Saal war die Nachbildung einer Freimaurerloge, in der sowohl das Geld als auch Satan angebetet würden. Der zweite Saal war Juden als Gefahr für die Welt insgesamt, vornehmlich aber für das serbische Volk gewidmet. Besondere Aufmerksamkeit wurde dem Verleger und Buchhändler Geza Kohn geschenkt, er sei der große Vergifter des serbischen Volkes, obwohl er ein wichtiger Pfeiler der serbischen Kultur war. Geza Kohn hatte von einem Piloten das Angebot erhalten, ihn samt seiner Familie nach Griechenland auszufliegen, er jedoch glaubte noch immer an die Deutschen als Kulturmenschen, ließ die Gelegenheit verstreichen und wurde ermordet. Im dritten Saal ging es um Kommunisten, aber auch hier wurde die Aufmerksamkeit vor allem auf einen Menschen, den Maler und Publizisten Moša Pijade, gerichtet, den einzigen Juden unter den führenden Mitgliedern der Kommunistischen Partei Jugoslawiens. Pero wunderte sich sehr. Von diesem Pijade hatte er nie etwas gehört, er musste aber wohl ein Mordskerl sein, wenn die Deutschen sich seinetwegen so erregten, aber Kommunist und Freimaurer, wie passte das zusammen?
Für Schulklassen war der Besuch der Ausstellung Pflicht, Besucher wurden auch mit Geschenken wie Lebensmittel und Bons für Heizmaterial angelockt. Der dreißigtausendste Besucher, ein Eisenbahnbeamter, erhielt als Gabe zwei geschlachtete Hühner und eine Handvoll Broschüren, worüber die örtlichen Zeitungen mit Fotos berichteten.
Im Süden Serbiens hatte es einstweilen schwere Kämpfe mit den Partisanen gegeben, sie hatten eine große Region mit einigen Städten, mit Užice als Hauptstadt, erobert. Mit vier Divisionen, die jetzt in Russland fehlten, und der Hilfe der Tschetniks des königlichen Obersten Draža Mihailović hatte eine Großoffensive begonnen, um die Freiheitskämpfer zu vernichten oder zumindest in die bosnischen Berge zu vertreiben. Rudolf konnte im Büro von Oberst Hellmer die Wehrmachtsberichte lesen, aber was an ihnen war wahr?
Die Behauptungen der Ausstellungsmacher standen im Gegensatz zur Wahrheit, denn Freimaurer bekannten sich überall im Prinzip zu dem Staat, in dem sie lebten, und respektierten alle Religionen. Mitglied werden durften nur Männer mit bestem Leumund, also möglichst verheiratet und tadellose Ehegatten. Die Gleichsetzung der Juden mit dem Freimaurertum war Nazipropaganda. Im alten England gab es keine Steinmetze, die Juden waren, so war auch keiner von ihnen von Anfang an dabei. Toleriert wurden sie in England jedoch bald, in Deutschland wurden Juden erst Ende des neunzehnten Jahrhunderts in Logen aufgenommen. Wohlhabenden Juden galt die Aufnahme als Beweis, dass sie jetzt gleichberechtigte Mitmenschen waren.
»Haben Sie diese interessante Ausstellung gesehen, die die serbische Regierung organisiert hat, Herr Oberst?«, fragte der Vertreter des SD, Doktor Wilhelm Höttl.
»Nein, Obersturmbannführer, mir hat der Führer andere Aufgaben anvertraut. Ist doch ein Schmarrn. Mensch, haben Sie in unserer Situation nichts Gescheiteres zu tun?«
Der SS-Offizier hielt Hellmer für einen aufgeblasenen burgenländischen Bauern, er selbst war Doktor der Geschichtswissenschaften aus Wien und fühlte sich ihm in jeder Hinsicht weit überlegen. Aber er wollte einen Pelzmantel für seine Geliebte aus dem Magazin mit Kleidungsstücken, die eigentlich für das Winterhilfswerk bestimmt waren, und der Oberstintendant wachte mit Argusaugen darüber, dass möglichst wenig davon in ungewünschte Bahnen gelangte.
In diesem Augenblick klopfte es kurz, und Rudolf erschien, ohne eine Antwort abzuwarten, in der Tür. Als er den SS-Offizier sah, entschuldigte er sich sofort, Hellmer sagte streng, aber nicht sehr laut: »Später!«
»Jawohl, Herr Oberst.«
Als die Tür zugefallen war, schüttelte Höttl den Kopf und zwinkerte anzüglich: »Einen hübschen Jungen haben Sie sich da zugelegt, Herr Oberst!«
Jetzt stutzte Hellmer doch, kam aber sofort zum Schluss, dass es vielleicht besser war, den Verdacht nicht ganz auszuräumen, dass es eine homosexuelle Verbindung zwischen ihm und Rudolf geben könne. Dann würde der SD wahrscheinlich nicht besonders neugierig werden, zumindest nicht auf die Idee kommen, Hellmer habe einen jungen Juden gerettet.
»Der Mann spricht perfekt Deutsch, Serbisch und Ungarisch und kennt sich aus. Er gehört zu den Ungarn im Banat, die rechtzeitig in den Deutschen Kulturbund eingetreten sind, weil sie wissen, dass das auch für ihre nationale Politik mehr hergibt, als Extrawürste zu braten. Und was mein Privatleben angeht, Obersturmbannführer, ich kümmere mich auch nicht darum, für wen Sie einen neuen Pelz brauchen, aber bitte sehr …«
»Sie haben es überhaupt bequem, Herr Hellmer«, absichtlich nannte er nicht mehr den Offiziersrang, um Intimität vorzuspiegeln. »Sie werden zu keinem unserer Einsätze hinzugezogen, Sie wissen schon, was ich meine …«
»Wissen natürlich schon, aber darum reißen werde ich mich gewiss nicht …«
»Das meine ich ja. Heydrich hat meinem Chef, Schellenberg, gesagt, jeder von uns müsse auch im Einsatz gewesen sein, sich bewähren, so wie er sich das wünscht, wortwörtlich hat er gesagt, jeder soll am Morden beteiligt sein, mitschuldig werden und sich nicht auf akademische Grade berufen und heraushalten.«
»Das gilt für Sie von der SS.«
»Für die Wehrmacht nicht, sagen Sie? Unser Grundsatz ›Meine Ehre heißt Treue‹ bedeutet Ihnen nichts?«
»Ich habe als Offizier meinen Eid auf den Führer geschworen.«
»Ja, also, lieber Kriegskamerad, Herr Oberstintendant Hellmer, wir müssen miteinander auskommen. So lange es geht …«
War das eine Drohung gewesen?
Rudolf hatte als Büro eine Kammer neben dem Kabinett des Obersten bezogen. Platz war gerade für den Schreibtisch und zwei klapprige Stühle, einen Vorhang für das schmale Fenster hatte er nicht bekommen, aber er saß ohnehin selten und nur für Minuten auf seinem Arbeitsplatz, er war viel unterwegs, den Chef begleitend, meist aber selbständig. Seine Übersetzungen diktierte er aus dem Stegreif der Sekretärin im Vorzimmer.
»Schauen Sie mir nicht so unverschämt ins Gesicht, Radványi!«, sagte der Oberst einmal.
»Wohin soll ich denn schauen, Herr Oberst? Ich will ja nur zeigen, dass ich Ihren Worten gehorsamst folge …«
»Aber nicht mit so einem impertinenten Blick, als wollten Sie mich auf den Arm nehmen. Bei den Schwarzen kommen Sie damit nicht an. Freche Leute reden manchmal zu viel, und wenn Sie sich irgendwie verplappern, werde ich größte Mühe haben, mich herauszureden, komme bestenfalls an die Ostfront, während Sie eines gar nicht leichten Todes sterben. Was schauen Sie weiter so komisch?«
»Darf ich etwas sagen?«
»Wenn wir schon reden … Los!«
»Sie schauen so oberlehrerhaft, Herr Oberst. Und Sie sind ein gütiger Mensch, Herr Oberst.«
Hellmer konnte ein Lächeln nicht verbergen, obwohl er streng bleiben wollte: »Machen Sie sich an die Arbeit, Radványi. Sie können gehen!«
»Zu Befehl, Herr Oberst!«
Der Oberst hatte ihm eine Garçonnière, ausgerechnet im ersten Stock des Hauses auf dem Terazije-Platz, verschafft, aus der er auf den Strommast schauen konnte, an dem vor einigen Monaten der Gymnasiast Pokrajac und vier andere Genossen aufgehängt gewesen waren. Ein großes Zimmer, ein elegantes Badezimmer und eine kleine Teeküche. So angenehm, so selbständig hatte er noch nie gelebt wie jetzt als Jude mitten im vom Deutschen Reich besetzten Belgrad. Ach wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß. Verpflegung erhielt er wie die Deutschen.
Im Stadtzentrum gab es keine Hinrichtungen, das von deutschen Bomben beschädigte Nationaltheater wurde mithilfe deutscher Soldaten renoviert, es gab Opern und Stücke klassischer serbischer Dichter, Wettbewerbe für Tischtennis und Ähnliches wurden veranstaltet, aber im Konzentrationslager Banjica fanden tagtäglich Erschießungen statt und aus dem Lager bei dem ehemaligen Artillerieschuppen wurden Männer, Juden und Zigeuner, zur Hinrichtung geführt, hundert für einen getöteten, fünfzig für einen verwundeten Deutschen.
Wenn man jung ist, denkt man nicht viel nach, genießt den Augenblick, findet gute Ausreden, um sich keine Sorgen zu machen. In meiner jetzigen Lage kann ich für die richtige Sache mehr tun, als wenn ich mich töten lasse, dachte Rudolf. Für seine Partei, für die Aufständischen, war er vorläufig eine Art Maulwurf. Er sollte beobachten und von Zeit zu Zeit berichten.
Der Winter wurde sehr streng, als wollte er die Lage der Menschen weiter erschweren. Rudolfs Wohnung besaß eine Etagenheizung, die funktionierte, weil er auch Koks beziehen konnte, aber viele Belgrader froren jämmerlich, tauschten im ersten Kriegswinter den letzten Schmuck für einen Klafter Holz oder hundert Kilogramm Kohle.
Die Intendantur war nicht weit. Rudolf hatte einen blauen Wintermantel angezogen, den er sich im Magazin ausgesucht hatte und der vielleicht einem ermordeten Juden gehört hatte, was er befürchtete, jedoch hinnahm. Der Oberst hatte befohlen, dass er sich ordentlich anziehen solle, mindestens zwei Winteranzüge solle er nehmen, gute Hemden, Krawatten, er sei jetzt Angestellter einer deutschen Militärbehörde. Den wahrscheinlich ermordeten ehemaligen Besitzern konnte er die Garderobenstücke nicht mehr zurückgeben, aber … Kein Aber! Es galt weiterzuleben.
An diesem Morgen hatte er keine Zeit mehr für ein Frühstück, wollte er pünktlich vor dem Chef an seinem Arbeitsplatz sein. Wenn er mit schnellem Schritt auf dem von Schnee und Eis geräumten Gehweg unterwegs war, fühlte er sich erwachsen, gut gelaunt und schämte sich ein wenig deswegen. Er war verschont, zufällig, wer weiß warum und wieso und wie lange noch.
Vor der Intendantur stand ein Mädchen und redete auf den Posten ein, der sie überhaupt nicht anzuhören schien, sondern gerade Anstalten machte, sie grob wegzuschicken.
»Worum geht es?«, fragte er auf Serbisch, weil es eindeutig um eine einheimische Bittstellerin ging. Erst als sie ihm ihr Gesicht zuwandte, sah er, wie schön sie war, jung, ungeschminkt, in einem Mäntelchen, das ihr zu klein geworden war und sich deshalb so eng an ihren Körper schmiegte, dass es ihre Figur betonte, als hätte sie nur ein Trikot an, auf dem Kopf eine große blaue Baskenmütze.
»Ich wollte zu Herrn Oberst Hellmer«, ihre Stimme klang tiefer als erwartet. »Mein Vater ist verhaftet worden und hat mir noch gesagt, ich soll das dem Herrn Oberst …«
»Wer ist Ihr Vater?«
»Ein Mühlenbesitzer in Pančevo, im Banat …«
»Ja und?«
»Er hat mit Herrn Oberst Hellmer … Sie kennen sich noch von früher … Sie hatten …«
»Das werden Sie dem Herrn Oberst selbst sagen. Wenn irgendjemand helfen kann, ist er es. Kommen Sie mit!«
Dem Posten gab er nur ein Zeichen. Der nickte, hatte wohl seine Meinung über diesen Zivilisten, aber solange der Chef diesen Frechdachs duldete, war kein Kraut gegen ihn gewachsen.
Im Erdgeschoß führte Rudolf das Mädchen zu einem Schalter.
»Wir müssen Sie anmelden, einen Zettel ausfüllen. Wie heißen sie? Ein Anmeldeformular, bitte!«
Sie war wirklich hübsch.
»Ich heiße Vukov.«
»Wir brauchen auch Ihren Vornamen und die Telefonnummer, falls Sie eine haben«.
»Ja, haben wir, aber in Pančevo … Irina!«
»Irina ist ein feiner Name.«
Starke Augenbrauen, ein schmales, ovales Gesicht, schön geschwungene Lippen und der Blick … War es ein Blick der Dankbarkeit oder mehr? Oder lag es daran, dass er so lange kein weibliches Geschöpf aus der Nähe gesehen hatte und sie ihn so hoffnungsvoll mit ihren großen kaffeebohnenbraunen Augen ansah?
2. LEOPOLD
»Ich will nicht mehr so heißen, Papa. Ich habe keinen roten Bart. Wer hat uns diese blöden Namen verpasst?«
»Wenn du es so genau wissen willst, Kaiser Josef II. Ihm haben wir vieles zu verdanken. Setz dich …«
Es war im Frühjahr 1885. Der neunzehnjährige Leopold Rotbart hatte vieles von dem, was ihm Samuel erzählte, überhaupt nicht oder zumindest nicht in allen Einzelheiten gewusst. Als Kind im Dorf Perlez, im Banat, wurde er als Sohn des wohlhabenden Gastwirts und Gutsbesitzers akzeptiert, er war für jedermann der kleine Leo. Erst als er 1876 in Szeged ins Gymnasium kam, hatte er ein Problem, weniger mit seinem Judentum, als überhaupt mit dem Fremdsein, die Schulkameraden waren Ungarn, katholisch oder reformiert, orthodoxe Serben und Rumänen, man sprach viele Sprachen durcheinander, in den höheren Klassen nicht nur Ungarisch, sondern Deutsch, Serbisch, Rumänisch und Slowakisch, auch Latein und sogar Altgriechisch. Nach dem österreichisch-ungarischen Ausgleich war allerdings das Ungarntum auch in Szeged die beherrschende Ideologie und Leopold fühlte sich davon angezogen, allein deshalb, um sich weniger von den anderen zu unterscheiden. Oder um überhaupt nicht anders zu sein als sie.
Ein 1867 in Ungarn verabschiedetes Gesetz über die Judenemanzipation hatte wesentlich dazu beigetragen, dass Juden nicht mehr abseits der Gesellschaft leben mussten und auch nicht verfolgt wurden. Nicht mehr. Das genügte Leo nicht. Er hatte sich in seinem Banater Dorf nie abgesondert oder gar verfolgt gefühlt, aber er wollte mehr, er wollte voll dazugehören. Wozu? Zum ungarischen Volk?
Das Hochwasser, das Szeged 1879 überschwemmte und von etwa sechstausend Häusern nur dreihundert stehen gelassen hatte, vertrieb Leo aus der fünften Klasse des Gymnasiums, er musste danach in Großbetschkerek in die Schule gehen. Der Vorteil war, diese Kleinstadt lag näher bei Perlez, der Nachteil: Sie war viel provinzieller. Leopold Rotbart war nicht der einzige ehemalige Szegediner Gymnasiast, der am Ufer des Begakanals statt an der mächtigen Theiß seine Matura machen musste, und bald hatten sich, wie bei jungen Schülern üblich, viele neue Freundschaften gebildet. Leo war ein guter Schüler, erhielt aber einen strengen Verweis, weil er heimlich eine Tanzschule besucht hatte, eigentlich einfach nur, um Mädchen an der Taille berühren zu dürfen.
Nach dieser Rüge, die Leo schwer traf, nahm ihn der neue, relativ junge Lateinlehrer, Professor Török, beiseite.
»Nehmen Sie das nicht so ernst, Rotbart!« Ab der fünften Klasse wurden die Gymnasialschüler gesiezt. »Lesen Sie Ovid, Arma gravi numero violentaque bella parabam, aber ein bisschen auch die »Ars amatoria«. Latein ist keine kriegerische Sprache.«
Der Professor klopfte den Rhythmus des Hexameters mit knochigem Finger auf die Tischplatte und schaute Leo mit seinen kurzsichtigen, brillenbewährten Augen ins Gesicht.
»Haben Sie verstanden?«
»Ja, gewiss. Der Dichter sagt, er habe grausame Kriege und Waffengänge in Hexametern herausgeben wollen.«
»Sicher, aber was meint er damit? In der Folge kommt Amor dazwischen. Wir sollten mehr von Liebe lehren und lernen, nicht nur von ruhmreichen Kriegen und Revolutionen. Aber Sie werden es gut machen, Rotbart, Sie tun immer so liebenswert, ut ameris, amabilis esto!«
Leo verstand auch das, er liebte Latein, Liebenswürdige würden die Liebe verdienen.
»Ich habe aber aus Liebe getanzt, Herr Professor, sondern nur so, um mitzumachen … Und warum sagen Sie immer so streng Rotbart zu mir?«
»So heißen Sie doch?«
»Ich mag den Namen nicht. Ich werde ihn magyarisieren, sobald ich volljährig bin.«
»Und was sagt Ihr Herr Vater dazu?«
»Er ist dagegen, aber wenn ich einmal selber entscheiden kann, will ich ein richtiger Ungar sein.«
»So, so! Nun, mein lieber junger Mann, mein ungarischer Nachname bedeutet eigentlich ›der Türke‹.«
»Dann stimmt der Satz Nomen est omen nicht, Sie sind doch keiner, Herr Professor …«
»Was wissen Sie schon, was ich bin.«
Zwischen dem Schüler und dem nur zehn Jahre älteren Lehrer entwickelte sich ein freundschaftliches Verhältnis. Professor Török sorgte dafür, dass in Leopolds Reifezeugnis kein Vermerk über die Strafe wegen der Tanzschule eingetragen wurde.
Leo hatte seinem Vater nichts über den Vorfall erzählt. Auch die besten Väter müssen nicht alles wissen. Als Anerkennung für das gute Reifezeugnis bot ihm der merklich zu früh gealterte Samuel zum ersten Mal ein Schnäpschen an, einen Barack, dazu wurde auch die Mutter eingeladen, die aber nur nippte. Vom Alkohol ermutigt sagte Leo, es gehe jetzt nicht um Lob, er habe sich eben bemüht, und sprach die Namensfrage an.
»Jetzt setzen wir uns einmal gemütlich hin, mein Sohn!«, sagte Samuel ernst. Es war ein ruhiger Vormittag Ende Juni, die Arbeit auf den Weizenfeldern war voll im Gange und das Wirtshaus leer. Die Linden dufteten sehr stark. Der alte Mann war immer kurzsichtiger geworden, hatte sich einen Kneifer angeschafft, den er Pince-nez nannte, konnte sich jedoch nicht an das Ding gewöhnen, entweder musste er es mit der Hand auf seiner Nase festhalten, wenn er etwas genauer betrachten wollte, oder es fiel hinunter, zum Glück war es an einer schwarzen Schnur am Knopf seiner Weste befestigt. Jetzt fingerte er am Kneifer herum, weil er vor seinem Sohn nicht komisch wirken wollte.