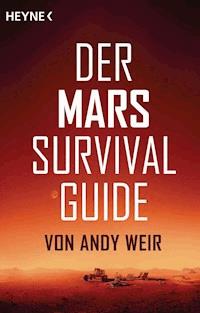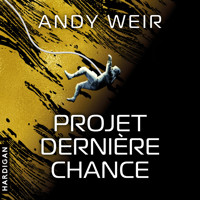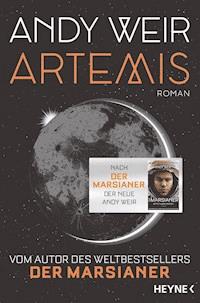11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Der neue große Roman vom Autor des Weltbestsellers »Der Marsianer«
Als Ryland Grace erwacht, muss er feststellen, dass er ganz allein ist. Er ist anscheinend der einzige Überlebende einer Raumfahrtmission, Millionen Kilometer von zu Hause entfernt, auf einem Flug ins Tau-Ceti-Sternsystem. Aber was erwartet ihn dort? Und warum sind alle anderen Besatzungsmitglieder tot? Nach und nach dämmert es Grace, dass von seinem Überleben nicht nur die Mission, sondern die Zukunft der gesamten Erdbevölkerung abhängt.
- Ryland Grace ist der Letzte auf seinem Raumschiff, und er hat nur ein Ziel: überleben und die Erde retten
- »Der Astronaut« hat alle Erfolgszutaten von »Der Marsianer«: ein einsamer Held, ein Überlebenskampf im All und jede Menge scheinbar unmögliche Problemlösungen
- Die Filmrechte wurde bereits in Hollywood verkauft, und Ryan Gosling soll die Hauptrolle spielen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 767
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
DAS BUCH
Als Ryland Grace erwacht, muss er feststellen, dass er ganz allein ist. Er ist anscheinend der einzige Überlebende einer Raumfahrtmission, Millionen Kilometer von zu Hause entfernt, auf einem Flug ins Tau-Ceti-Sternsystem. Aber was erwartet ihn dort? Und warum sind alle anderen Besatzungsmitglieder tot? Nach und nach dämmert es Grace, dass von seinem Überleben nicht nur die Mission, sondern die Zukunft der gesamten Erdbevölkerung abhängt.
Von Andy Weir sind im Heyne Verlag erschienen:
Der Marsianer
Artemis
Der Astronaut
DER AUTOR
Andy Weir war bereits im Alter von fünfzehn Jahren als Programmierer und später als Softwareentwickler für diverse Computerfirmen tätig, bevor er mit seinem Roman Der Marsianer einen internationalen Megabestseller landete. Seither widmet er sich ganz dem Schreiben und beschäftigt sich in seiner Freizeit mit Physik, Mechanik und der Geschichte der bemannten Raumfahrt – Themen, die sich auch immer wieder in seinen Romanen finden. Sein Debüt Der Marsianer wurde von Starregisseur Ridley Scott brillant verfilmt.
Mehr zu Andy Weir und seinen Werken finden Sie auf:
ANDY WEIR
DER ASTRONAUT
ROMAN
Aus dem Amerikanischen
von Jürgen Langowski
Deutsche Erstausgabe
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Die Originalausgabe erscheint unter dem Titel PROJECT HAIL MARY bei Ballantine Books, New York
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2021 by Andy Weir
Copyright © 2021 der deutschsprachigen Ausgabe
und der Übersetzung
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Innenillustrationen: David Lindroth
Covergestaltung: Das Illustrat, München, unter Verwendung
eines Motivs von Shutterstock.com (Rick Partington , nasti23033, atk work)
Redaktion: Ralf-Oliver Dürr
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN 978-3-641-27283-8V011
diezukunft.de
Für John, Paul, George und Ringo
1
»Was ist zwei plus zwei?«
Aus irgendeinem Grund ärgert mich die Frage. Ich bin müde. Beinahe schlafe ich wieder ein.
Ein paar Minuten vergehen, dann höre ich sie wieder.
»Was ist zwei plus zwei?«
Der leisen Frauenstimme fehlt jedes Gefühl, und der Tonfall ist genau derselbe wie beim letzten Mal. Es ist ein Computer. Ein Computer, der mich nervt. Meine Verärgerung wächst.
»Lsmchnr«, sage ich und staune. Eigentlich wollte ich sagen: »Lass mich in Ruhe«, was meiner Ansicht nach eine absolut verständliche Reaktion ist. Aus irgendeinem Grund kann ich nicht richtig sprechen.
»Nicht korrekt«, entgegnet der Computer. »Was ist zwei plus zwei?«
Zeit für ein Experiment. Ich will versuchen, »Hallo« zu sagen.
»Harch?«
»Nicht korrekt. Was ist zwei plus zwei?«
Was ist hier eigentlich los? Das wüsste ich wirklich gern, aber ich habe nicht viele Anhaltspunkte. Außer dem Computer kann ich nichts anderes hören. Ich kann nicht einmal etwas fühlen. Nein, das stimmt nicht. Ich spüre etwas. Ich liege auf etwas Weichem. Auf einem Bett.
Ich glaube, meine Augen sind geschlossen. Das ist gar nicht so schlecht. Ich muss sie nur öffnen. Ich versuche es, aber nichts passiert.
Warum bekomme ich die Augen nicht auf?
Öffnen.
Uuuuuund … öffnen!
Verdammt noch mal, geht auf!
Oh! Gerade hat etwas gezuckt. Die Augenlider haben sich bewegt. Das konnte ich fühlen.
GEHT AUF!
Ganz langsam gehorchen die Augenlider, gleißendes Licht fällt auf die Netzhäute.
»Nampf«, sage ich und halte mit größter Willenskraft die Augen offen. Alles ist grellweiß und tut weh.
»Augenbewegung entdeckt«, sagt meine Peinigerin. »Was ist zwei plus zwei?«
Das grelle Weiß schwächt sich ab. Meine Augen passen sich an die Helligkeit an. Ich erkenne Umrisse, die mir aber noch nichts sagen. Mal sehen … kann ich die Hände bewegen? Nein.
Die Füße? Ebenfalls nein.
Aber ich kann den Mund bewegen, oder? Ich habe etwas gesagt. Nichts Verständliches, aber immerhin.
»Vrrmp.«
»Nicht korrekt. Was ist zwei plus zwei?«
Allmählich schälen sich Umrisse heraus. Ich liege in einem Bett. Es ist … oval geformt.
Über mir strahlen LED-Lampen. Kameras in der Decke überwachen jede Bewegung. So unheimlich das auch auf mich wirkt, die Roboterarme machen mir noch viel größere Sorgen.
An der Decke hängen zwei Edelstahlausleger. Beide sind mit beunruhigenden, nach Penetration aussehenden Geräten bestückt, wo die Hände sein sollten. Ich kann nicht behaupten, dass mir der Anblick gefällt.
»Virch… ie… rrr«, stöhne ich. Ob das reicht?
»Nicht korrekt. Was ist zwei plus zwei?«
Verdammt. Ich raffe meine ganze Willenskraft und meine innere Stärke zusammen. Außerdem gerate ich allmählich in Panik. Na gut, auch das kann ich nutzen.
»Vvvvviiiierrr«, sage ich endlich.
»Korrekt.«
Gott sei Dank. Ich kann sprechen. Irgendwie.
Erleichtert atme ich aus. Moment mal – ich habe gerade meine Atmung kontrolliert. Ich hole noch einmal Luft. Absichtlich. Mein Mund brennt, die Kehle ist wie ausgedörrt. Aber es ist mein Brennen. Ich habe die Kontrolle.
Ich trage eine Atemmaske. Sie sitzt fest auf meinem Gesicht und ist mit einem Schlauch verbunden, der über meinem Kopf verschwindet.
Kann ich aufstehen?
Nein. Aber ich kann den Kopf ein wenig bewegen. Ich betrachte meinen Körper. Ich bin nackt und mit mehr Schläuchen verbunden, als ich zählen kann. Je einer steckt in den Armen und Beinen, einer in meiner Herrenausstattung, zwei führen unter dem Oberschenkel entlang. Vermutlich sitzt einer davon da, wo niemals die Sonne scheint.
Das verheißt nichts Gutes.
Außerdem bin ich mit Elektroden zugepflastert. Die Sensoren ähneln denen eines EKG-Geräts, aber sie sind überall. Na ja, wenigstens kleben sie auf der Haut und sind nicht in mich hineingebohrt.
»Wa…«, keuche ich. Ich versuche es noch einmal. »Wo bin ich?«
»Was ist die Kubikwurzel von acht?«, fragt der Computer.
»Wo bin ich?«, frage ich noch einmal. Es geht schon besser.
»Nicht korrekt. Was ist die Kubikwurzel von acht?«
Ich hole tief Luft und spreche betont langsam. »Zwei mal e hoch zwei-i-pi.«
»Nicht korrekt. Was ist die Kubikwurzel von acht?«
Meine Antwort war aber gar nicht falsch. Ich wollte nur sehen, wie schlau der Computer ist. Nicht besonders, wie mir scheint.
»Zwei«, antworte ich.
»Korrekt.«
Ich warte auf weitere Fragen, aber der Computer scheint zufrieden zu sein. Ich bin müde, und langsam dämmere ich weg.
Ich wache auf. Wie lange habe ich geschlafen? Anscheinend ziemlich lange, denn ich fühle mich ausgeruht. Ohne Schwierigkeiten öffne ich die Augen. Das ist ein Fortschritt.
Als Nächstes versuche ich, die Finger zu bewegen. Sie wackeln wie gewünscht. Alles klar. Das wird schon wieder.
»Handbewegung entdeckt«, stellt der Computer fest. »Bleiben Sie ruhig liegen.«
»Was? Warum …«
Die Roboterarme nähern sich. Sie sind sehr schnell. Im Handumdrehen haben sie mir die meisten Schläuche aus dem Körper gezogen. Ich habe überhaupt nichts gespürt. Meine Haut ist irgendwie taub.
Nur drei Schläuche sind noch da: eine Infusion im Arm, der Schlauch im Hintern und ein Katheter. Die letzten beiden wäre ich zwar gern so schnell wie möglich losgeworden, aber seiʼs drum.
Ich hebe den rechten Arm und lasse ihn wieder auf das Bett sinken. Dann noch einmal das Gleiche mit dem linken Arm. Sie fühlen sich ungeheuer schwer an. Ich wiederhole die Übung einige Male. Meine Arme sind kräftig. Das kann doch nicht sein. Es sieht ganz danach aus, als hätte ich ein größeres gesundheitliches Problem gehabt und eine Weile in diesem Bett verbracht, sonst hätten sie mich ja wohl kaum an dieses ganze Zeug angeschlossen. Aber hätten dabei nicht meine Muskeln schrumpfen müssen?
Sollten hier nicht auch Ärzte sein? Oder wenigstens die Geräusche, die man in einem Krankenhaus erwartet? Und was ist mit dem Bett los? Es ist nicht rechteckig, sondern oval, und ich glaube, es ist in der Wand verschraubt, statt auf dem Boden zu stehen.
»Nimm …« Ich muss noch einmal ansetzen, ich bin immer noch müde. »Nimm die Schläuche raus.«
Der Computer reagiert nicht.
Ich hebe noch einige Male die Arme und wackle mit den Zehen. Ja, es wird allmählich besser.
Dann bewege ich die Füße. Sie gehorchen. Als Nächstes ziehe ich die Knie an. Auch meine Beine sind muskulös. Nicht so muskulös wie bei einem Bodybuilder, aber immer noch viel zu kräftig für jemanden, der offensichtlich dem Tode nahe war. Andererseits kann ich nicht genau sagen, wie dick sie eigentlich sein sollten.
Ich stemme die Hände flach auf das Bett und drücke mich hoch. Mein Oberkörper hebt sich. Ich kann mich tatsächlich aufrichten! Es erfordert meine ganze Kraft, aber ich lasse nicht locker. Sobald ich den Kopf weit genug gehoben habe, sehe ich, dass das Kopf- und das Fußende des ovalen Betts an stabilen Verankerungen in der Wand hängen. Es ist eine Art starre Hängematte. Eigenartig.
Kurz danach sitze ich auf dem Schlauch in meinem Hintern. Kein sehr angenehmes Gefühl, aber wann wäre so ein Schlauch schon einmal angenehm gewesen?
Jetzt kann ich mehr erkennen. Es ist kein gewöhnliches Krankenzimmer. Die Wände sehen aus, als wären sie aus Plastik, und der Raum ist rund. Aus den LED-Leuchten in der Decke strahlt grelles Licht.
An den Wänden sind noch zwei weitere Hängemattenbetten verankert, in denen Patienten liegen. Wir sind in einem Dreieck angeordnet, und die Folterarme sind zwischen uns an der Decke angebracht. Ich nehme an, sie kümmern sich um uns drei Patienten. Von meinen Leidensgenossen kann ich nicht viel erkennen, sie sind so tief im Bett versunken, wie ich es war.
Eine Tür gibt es nicht. Nur eine Leiter, die zu einer … ist das eine Luke? Sie ist rund und hat in der Mitte ein Handrad. Ja, es muss eine Art Luke sein. Wie auf einem U-Boot. Ob wir drei eine ansteckende Krankheit haben? Vielleicht ist dies ein Quarantänezimmer? Hier und da entdecke ich kleine Lüftungsgitter in den Wänden, und ich spüre einen leichten Luftstrom. Es könnte eine kontrollierte Umgebung sein.
Ich schiebe ein Bein über die Bettkante, worauf die Liege wackelt. Die Roboterarme rasen auf mich zu. Ich zucke zusammen, doch sie halten kurz vor mir inne und schweben in der Luft – bereit, mich aufzufangen, falls ich stürze.
»Vollständige Körperbewegung entdeckt«, sagt der Computer. »Wie heißen Sie?«
»Ist das dein Ernst?«, frage ich.
»Nicht korrekt. Zweiter Versuch: Wie heißen Sie?«
Ich öffne den Mund und will antworten.
»Äh …«
»Nicht korrekt. Dritter Versuch: Wie heißen Sie?«
So langsam dämmert es mir. Ich weiß nicht, wer ich bin. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich erinnere mich an rein gar nichts.
»Ähm«, mache ich.
»Nicht korrekt.«
Schlagartig werde ich müde. Es ist sogar ganz angenehm. Anscheinend hat mich der Computer über die Infusion betäubt.
»… haaaalt …«, murmle ich noch.
Die Roboterarme legen mich sachte auf das Bett.
Wieder wache ich auf. Einer der Roboterarme berührt mein Gesicht. Was macht er da?
Ich schaudere, eher erschrocken als alles andere. Der Arm zieht sich auf seine Warteposition unter der Decke zurück. Ich taste mein Gesicht nach Verletzungen ab. Auf einer Seite sind Stoppeln, die andere ist glatt.
»Hast du mich rasiert?«
»Bewusstsein entdeckt«, sagt der Computer. »Wie heißen Sie?«
»Das weiß ich immer noch nicht.«
»Nicht korrekt. Zweiter Versuch: Wie heißen Sie?«
Ich bin weiß, männlich und spreche Englisch. Also lassen wir es mal darauf ankommen. »J-John?«
»Nicht korrekt. Dritter Versuch: Wie heißen Sie?«
Ich ziehe die Infusionsnadel aus dem Arm. »Leck mich doch.«
»Nicht korrekt.« Der Roboterarm greift nach mir.
Ich rolle mich vom Bett herunter. Das ist ein Fehler. Die anderen Schläuche sind noch angeschlossen. Der Schlauch im Hintern rutscht einfach heraus. Das spüre ich kaum. Dagegen wird der geblockte Katheter extrem unsanft aus meinem Penis gerissen. Das tut furchtbar weh, als hätte ich einen Golfball gepinkelt.
Schreiend winde ich mich auf dem Boden.
»Physisches Leiden«, stellt der Computer fest. Die Roboterarme greifen nach mir. Ich krieche über den Boden, um ihnen zu entkommen, und kann unter einem Bett verschwinden. Die Arme halten kurz davor inne, geben aber nicht auf. Sie warten. Sie werden von einem Computer gesteuert. Ihre Geduld ist unendlich.
Ich lasse den Kopf auf den Boden sinken und schnappe nach Luft. Nach einer Weile ebben die Schmerzen ab, und ich wische mir die Tränen ab.
Ich habe keine Ahnung, was hier los ist.
»He!«, rufe ich. »Ihr zwei da, wacht auf!«
»Wie heißen Sie?«, fragt der Computer.
»Einer von euch Menschen, wacht doch bitte auf.«
»Nicht korrekt«, sagt der Computer.
Mein Unterleib tut so weh, dass ich lachen muss. Es ist absurd. Außerdem wirkt das Endorphin, und mir wird schwindlig. Ich blicke wieder zum Katheter auf meiner Koje und schüttle verwundert den Kopf. Das Ding hat in meiner Harnröhre gesteckt. O Mann.
Und es hat beim Herausreißen Schaden angerichtet. Auf dem Boden entdecke ich ein wenig Blut. Nur ein schmaler roter Streifen …
Ich schlürfte Kaffee, schob mir das letzte Stück Toast in den Mund und winkte der Kellnerin, um zu bezahlen. Ich hätte mir das Geld sparen und zu Hause frühstücken können, statt jeden Morgen ein Lokal aufzusuchen. Angesichts meines bescheidenen Gehalts wäre das vermutlich sogar eine gute Idee gewesen. Aber ich koche nicht gern, und ich mag Eier mit Speck.
Die Kellnerin nickte und ging zur Kasse, um meine Rechnung auszudrucken. In diesem Augenblick trafen neue Gäste ein, denen sie zuerst noch einen Platz zuweisen musste.
Ich sah auf die Uhr. Es war kurz nach sieben Uhr. Ich hatte es nicht eilig. Ich musste erst um acht anfangen, war aber meist schon um zwanzig nach sieben im Büro, um mich auf den Tag vorzubereiten.
Ich zückte das Handy und checkte meine E-Mails.
AN: Astronomische Kuriositäten [email protected]
VON: (Dr. Irina Petrowa) [email protected]
BETREFF: Die dünne rote Linie
Mit gerunzelter Stirn betrachtete ich den Display. Ich dachte, ich hätte mich von dieser Mailingliste abgemeldet. Dieses Leben hatte ich schon vor langer Zeit aufgegeben. Es war nicht viel, was über die Liste hereinkam, aber wenn mich meine Erinnerung nicht trog, waren die wenigen Beiträge meist recht interessant. Nur ein paar Astronomen, Astrophysiker und Experten auf anderen Gebieten, die sich über alles unterhielten, was ihnen seltsam vorkam.
Ich warf einen Blick in Richtung Kellnerin. Die neue Kundschaft hatte viele Fragen zur Speisekarte. Wahrscheinlich wollten sie wissen, ob es in Sallys Diner auch glutenfreie vegane Grashalme gab oder so. Die lieben Leute in San Francisco konnten ziemlich anstrengend sein.
Da ich nichts weiter zu tun hatte, las ich die E-Mail.
Hallo, Kollegen, ich bin Dr. Irina Petrowa, und ich arbeite am Pulkowo-Observatorium in Sankt Petersburg in Russland.
Ich schreibe Ihnen, weil ich Ihre Hilfe brauche.
Seit zwei Jahren arbeite ich an einer Theorie, die mit Infrarot-Emissionen aus Nebeln zu tun hat. In diesem Zusammenhang habe ich detaillierte Beobachtungen zu einigen speziellen Infrarotwellenbändern durchgeführt. Dabei bin ich auf etwas Seltsames gestoßen – aber nicht in einem Nebel, sondern hier, in unserem eigenen Sonnensystem.
Ich habe eine sehr schwache, aber erkennbare Linie entdeckt, die auf einer Wellenlänge von 25,984 Mikrometern infrarotes Licht abstrahlt. Es gibt keine Schwankungen, die Wellenlänge ist anscheinend immer gleich.
Ich sende eine Excel-Tabelle mit den Daten mit. Außerdem habe ich ein paar neuere Darstellungen der Daten in Form eines 3-D-Modells angefertigt.
Sie können dem Modell entnehmen, dass die Linie die Form eines Bogens hat, der am Nordpol der Sonne entspringt und 37 Millionen Kilometer weit gerade aufsteigt. Dann schwenkt sie scharf nach unten ab und entfernt sich in Richtung Venus von der Sonne. Jenseits des Apex erweitert sich die gekrümmte Linie zu einem Trichter. In der Nähe der Venus ist der Querschnitt so groß wie der Planet selbst.
Das infrarote Leuchten ist sehr schwach. Ich konnte es nur entdecken, weil ich auf der Suche nach Infrarotemissionen von Nebeln sehr empfindliche Messgeräte eingesetzt habe.
Um ganz sicherzugehen, habe ich das Atacama-Observatorium in Chile darum gebeten, die Daten zu überprüfen. Meiner Ansicht nach ist es das beste Infrarotobservatorium weltweit. Sie haben meine Erkenntnisse bestätigt.
Es gibt viele Gründe, warum man im interplanetaren Raum Infrarotstrahlung findet. Es könnten Staubwolken oder andere Partikel sein, die das Sonnenlicht reflektieren. Oder es handelt sich um eine Molekülansammlung, die Energie absorbiert und im Infrarotbereich wieder abstrahlt. Dies würde sogar erklären, warum die Wellenlänge immer gleich bleibt.
Besonders interessant ist die Form des Bogens. Zuerst nahm ich an, es handelte sich um eine Ansammlung von Partikeln, die sich an Magnetfeldlinien orientieren. Doch die Venus besitzt kein nennenswertes Magnetfeld. Keine Magnetosphäre, keine Ionosphäre, nichts. Welche Kräfte sollten die Partikel zu ihr ziehen? Und warum sollten sie dabei glühen?
Ich bin dankbar für alle Anregungen und Theorien.
Was, zum Teufel, war das denn?
Die Erinnerung war schlagartig da. Sie ist ohne Vorwarnung in meinem Kopf aufgetaucht.
Über mich selbst habe ich dabei nicht viel herausgefunden: Ich lebe in San Francisco, so viel weiß ich jetzt. Und ich frühstücke gern. Außerdem habe ich mich früher mit Astronomie beschäftigt, was ich aber jetzt anscheinend nicht mehr mache.
Mein Gehirn war wohl der Ansicht, es sei wichtig, mich an die E-Mail zu erinnern und nicht an so triviale Dinge wie meinen Namen.
Mein Unterbewusstsein will mir etwas mitteilen. Die Blutspur auf dem Boden hat mich anscheinend an die »dünne rote Linie« in der E-Mail erinnert. Aber was hat das mit mir zu tun?
Ich rutsche unter dem Bett hervor und lehne mich an die Wand. Die Roboterarme tasten nach mir, erreichen mich aber nicht.
Es ist an der Zeit, einen Blick auf meine Mitpatienten zu werfen. Ich weiß nicht, wer ich bin und warum ich hier bin, aber wenigstens bin ich nicht allein und ... sie sind tot.
Eindeutig. Direkt neben mir liegt eine Frau, glaube ich. Jedenfalls hatte sie lange Haare. Davon abgesehen, ist sie größtenteils mumifiziert. Ausgetrocknete Haut hängt auf den Knochen. Es riecht nicht. Hier verwest nichts. Sie ist offensichtlich schon lange tot.
Der zweite Patient war ein Mann. Er scheint sogar noch länger tot zu sein. Seine Haut ist nicht nur trocken und ledrig, sondern zerkrümelt bereits.
Na gut. Also bin ich hier in der Gesellschaft von zwei Leichen. Ich sollte es widerlich und entsetzlich finden, aber das gelingt mir nicht. Sie sind schon vor so langer Zeit gestorben, dass sie kaum noch wie Menschen aussehen. Eher wie Halloween-Dekorationen. Ich hoffe, ich war nicht mit ihnen befreundet. Falls doch, dann werde ich mich hoffentlich nicht daran erinnern.
Tote Menschen sind eine Sache. Größere Sorgen bereitet mir die Tatsache, dass sie schon so lange hier liegen. Selbst aus einem Quarantänebereich würde man Tote entfernen, oder? Was hier schiefläuft, muss ziemlich übel sein.
Ich stehe auf. Es geht nur langsam und ist ziemlich anstrengend. Ich halte mich an der Bettkante von Frau Mumie fest. Die Liege wackelt, und ich schwanke mit, bleibe aber aufrecht stehen.
Die Roboterarme fischen nach mir, und ich schmiege mich wieder an die Wand.
Ich bin ziemlich sicher, dass ich im Koma gelegen habe. Genau. Je länger ich darüber nachdenke, desto klarer wird es.
Ich kann nicht sagen, wie lange ich schon hier bin, aber wenn ich zur gleichen Zeit wie meine Zimmergenossen hier angekommen bin, muss es eine ganze Weile her sein. Ich reibe mir über das halb rasierte Gesicht. Die Roboterarme sind fähig, bewusstlose Patienten längere Zeit zu versorgen. Noch ein Beweis dafür, dass ich im Koma gelegen habe.
Vielleicht kann ich die Luke erreichen?
Ich mache einen Schritt, dann noch einen. Und dann sinke ich zu Boden. Es ist zu anstrengend. Ich muss mich ausruhen.
Warum bin ich trotz meiner gut ausgebildeten Muskeln so schwach? Warum habe ich überhaupt Muskeln, wenn ich im Koma war? Ich sollte ein verwittertes dürres Bündel sein und kein strammer Rettungsschwimmer.
Ich habe keine Ahnung, was hier läuft. Was soll ich jetzt tun? Bin ich wirklich krank? Ich meine, natürlich fühle ich mich miserabel, aber nicht krank. Mir ist nicht übel, ich habe keine Kopfschmerzen. Fieber habe ich wohl auch nicht. Wenn ich nicht krank bin, warum habe ich dann im Koma gelegen? Eine schwere Verletzung?
Ich taste meinen Kopf ab. Keine Schwellungen, Narben oder Verbände. Auch der Rest meines Körpers kommt mir ziemlich stabil vor. Mehr als stabil. Ich habe sogar einen Waschbrettbauch.
Am liebsten würde ich ein Nickerchen machen, aber ich kämpfe gegen die Müdigkeit an.
Es wird Zeit, es noch einmal zu versuchen. Ich stemme mich wieder hoch. Es ist wie Gewichtheben, geht dieses Mal aber etwas leichter. Wie es scheint, erhole ich mich langsam. Hoffentlich.
Ich schlurfe an der Wand entlang und stütze mich mit dem Rücken genauso stark ab wie mit den Füßen. Die Roboterarme tasten ständig nach mir, aber ich bleibe außer Reichweite.
Ich keuche und japse und fühle mich, als wäre ich einen Marathon gelaufen. Vielleicht habe ich eine Lungenentzündung? Vielleicht bin ich zu meinem eigenen Schutz in Isolation?
Endlich erreiche ich die Leiter. Ich stolpere darauf zu und packe eine Sprosse. Ich bin furchtbar schwach. Wie soll ich eine zehn Fuß hohe Leiter hinaufklettern?
Zehn Fuß!
Ich denke im angloamerikanischen Maßsystem. Das ist ein Hinweis. Wahrscheinlich bin ich Amerikaner. Oder Brite. Oder Kanadier. Für kurze Entfernungen benutzen die Kanadier manchmal Fuß und Zoll.
Ich frage mich: Wie weit ist es von Los Angeles bis New York? Die Antwort ist sofort da: 3000 Meilen. Ein Kanadier hätte die Kilometer genannt. Also bin ich Brite oder Amerikaner. Oder aus Liberia.
Ich weiß, dass sie in Liberia das angloamerikanische Maßsystem benutzen, aber ich weiß meinen eigenen Namen nicht. Das ist ärgerlich.
Ich hole tief Luft, halte mich mit beiden Händen an der Leiter fest und stelle den Fuß auf die unterste Sprosse. Ich ziehe mich hoch. Es ist wacklig, aber es geht. Jetzt stehen beide Füße auf der untersten Sprosse. Ich greife nach oben und packe die nächste Sprosse. Na gut, ich mache Fortschritte. Mein ganzer Körper ist bleischwer, jede Bewegung ist eine Qual. Ich will mich hochziehen, aber ich habe nicht genug Kraft.
Ich kippe rückwärts von der Leiter. Das wird wehtun.
Es tut nicht weh. Die Roboterarme fangen mich auf, ehe ich auf den Boden pralle, weil ich in ihrer Reichweite gestürzt bin. Sie zögern keine Sekunde und stecken mich wieder ins Bett wie eine Mutter, die ihr Kind schlafen legt.
Wissen Sie was? Das ist mir ganz recht. Ich bin jetzt wirklich müde, und es tut gut, einfach nur dazuliegen. Das sanfte Wiegen des Bettes ist beruhigend. Etwas an der Art und Weise, wie ich von der Leiter gefallen bin, stört mich. Ich gehe es im Kopf noch einmal durch, kann aber nicht genau bestimmen, was mir daran seltsam vorkommt. Irgendetwas ist einfach falsch.
Hm.
Ich schlafe ein.
»Essen Sie.«
Auf meiner Brust liegt eine Zahnpastatube.
»Ähm?«
»Essen Sie«, wiederholt der Computer.
Ich nehme die Tube. Sie ist weiß mit schwarzer Beschriftung: TAG 1 – MAHLZEIT 1.
»Was soll das?«, frage ich.
»Essen Sie.«
Ich schraube den Verschluss ab und ein köstlicher Duft steigt mir in die Nase. Mir läuft sofort das Wasser im Mund zusammen. Erst jetzt wird mir bewusst, wie hungrig ich bin. Ich drücke auf die Tube, aus der ein widerlicher brauner Matsch quillt.
»Essen Sie.«
Wer bin ich, dass ich einem unheimlichen Computerboss mit Roboterarmen widersprechen würde? Vorsichtig lecke ich an der Paste.
O mein Gott, schmeckt das gut! Es ist wie dicke Bratensoße, aber nicht zu aufdringlich. Ich quetsche mir eine Ladung direkt in den Mund. Ich könnte schwören, dass es besser ist als Sex.
Ich weiß, was das heißt. Man sagt ja, Hunger sei das beste Würzmittel. Wenn man am Verhungern ist, schenkt einem das Gehirn eine hübsche Belohnung, sobald man endlich etwas zu sich nimmt. Gut gemacht, sagt das Gehirn. Jetzt werden wir für eine Weile nicht sterben.
Allmählich fällt der Groschen. Ich habe lange im Koma gelegen und wurde künstlich ernährt. Beim Aufwachen hatte ich keinen Schlauch im Magen, also haben sie mich vermutlich mit einer Nasensonde durch die Speiseröhre versorgt. Das ist die am wenigsten invasive Art, einen Patienten zu füttern, der nicht selbst essen kann, aber keine Verdauungsprobleme hat. Außerdem bleibt so das Verdauungssystem aktiv und gesund. Und das erklärt, warum der Schlauch nicht mehr da war, als ich wach wurde. Wenn möglich, soll man die Nasensonde entfernen, solange der Patient noch bewusstlos ist.
Woher weiß ich das? Bin ich Arzt?
Ich quetsche mir noch eine Ladung Bratencreme in den Mund. Immer noch köstlich. Ich schlucke das Zeug herunter. Bald ist die Tube leer. Ich halte sie hoch. »Mehr davon!«
»Mahlzeit beendet.«
»Ich habe aber noch Hunger. Gib mir noch eine Tube!«
»Nahrungszuteilung für diese Mahlzeit ist ausgeschöpft.«
Das ist sogar vernünftig. Mein Verdauungssystem hat sich an halb flüssige Nahrung gewöhnt. Ich sollte es langsam angehen. Wenn ich so viel esse, wie ich will, wird mir wahrscheinlich übel. Der Computer macht das schon richtig.
»Gib mir mehr zu essen!« Wenn man Hunger hat, ist einem egal, was richtig ist.
»Nahrungszuteilung für diese Mahlzeit ist ausgeschöpft.«
»Pah.«
Trotzdem fühle ich mich erheblich besser als vorhin. Das Essen hat mir sofort neue Energie geschenkt, und ich habe mich ausgeruht.
Ich rolle mich aus dem Bett heraus und strebe eilig zu der Wand, doch dieses Mal verfolgen mich die Roboterarme nicht. Anscheinend darf ich das Bett verlassen, nachdem ich bewiesen habe, dass ich essen kann.
Ich betrachte meinen nackten Körper. Es kommt mir nicht richtig vor. Sicher, die einzigen anderen Menschen hier sind tot, aber trotzdem.
»Kann ich etwas zum Anziehen haben?«
Der Computer schweigt.
»Na gut, von mir aus.«
Ich ziehe das Laken vom Bett und wickle es mir mehrmals um den Rumpf. Eine Ecke lege ich mir von hinten über die Schulter und verknote sie vorne mit einer anderen Ecke. Spontantoga.
»Eigenständige Fortbewegung entdeckt«, bemerkt der Computer. »Wie heißen Sie?«
»Ich bin Kaiser Koma. Knie nieder vor mir.«
»Nicht korrekt.«
Mal sehen, was da oben jenseits der Leiter ist.
Ich bin noch immer etwas wacklig auf den Beinen, wandere aber unverdrossen quer durch den Raum. Das ist schon ein kleiner Sieg – ich bin nicht auf schaukelnde Betten oder Wände angewiesen, um mich festzuhalten.
Als ich die Leiter erreiche, greife ich sofort zu. Ich brauche nichts mehr, um mich festzuhalten, aber es macht das Leben leichter. Die Luke da oben sieht ziemlich massiv aus. Wahrscheinlich ist sie luftdicht. Und höchstwahrscheinlich ist sie zugesperrt. Aber ich muss es wenigstens versuchen.
Ich steige eine Sprosse hinauf. Schwer, aber machbar. Noch eine Sprosse. Gut, so langsam komme ich in Fahrt. Ruhig und gleichmäßig.
Ich erreiche die Luke, halte mich mit einer Hand an der Leiter fest und betätige mit der anderen das Handrad. Tatsächlich, es dreht sich!
»Heiliger Strohsack!«, sage ich.
Heiliger Strohsack? Ist das mein Standardspruch, wenn ich überrascht bin? Ich meine, dagegen ist ja nichts einzuwenden, aber ich hätte etwas erwartet, das nicht so stark nach den 1950er-Jahren klingt. Was bin ich eigentlich für ein Knallkopf?
Sobald ich das Handrad dreimal herumgedreht habe, höre ich ein Klicken. Ich mache Platz, und die Luke klappt herunter. Der Deckel fällt an einer Seite herab und hängt an dem kräftigen Scharnier. Ich bin frei!
Gewissermaßen.
Jenseits der Luke ist es stockfinster. Etwas beunruhigend, aber immerhin, es ist ein Fortschritt.
Ich strecke den Arm aus und ziehe mich nach oben in den nächsten Raum. Sobald ich dort ankomme, flammt das Licht auf. Wahrscheinlich war es der Computer.
Der Raum ist genauso groß wie der, den ich gerade verlassen habe. Auch er ist rund.
Im Boden ist ein großer Tisch – anscheinend ein Labortisch – verschraubt. In der Nähe sind drei Hocker befestigt. Ringsherum sehe ich nur Laborausrüstung. Alles ist auf Tischen oder Werkbänken montiert, die ihrerseits im Boden verankert sind. Es sieht so aus, als sei der Raum für ein katastrophales Erdbeben gerüstet.
An einer Wand führt eine Leiter zu einer weiteren Luke in der Decke hinauf.
Ich befinde mich in einem gut ausgestatteten Labor. Seit wann dürfen in einer Isolierstation die Patienten ins Labor? Außerdem sieht es nicht einmal nach einem medizinischen Labor aus. Verflixt und zugenäht, was ist hier los?
Verflixt und zugenäht? Ehrlich? Vielleicht habe ich kleine Kinder. Oder ich bin fromm.
Ich richte mich auf und sehe mich gründlich um.
Auf dem Labortisch sind mehrere Geräte montiert. Ich erkenne ein Mikroskop mit 8000-facher Vergrößerung, einen Autoklav, ein Gestell mit Reagenzgläsern, Schubladenkästchen mit Vorräten, einen Kühlschrank für Proben, einen Laborkammerofen, Pipetten – Moment mal. Woher kenne ich diese Gerätschaften?
Ich betrachte die größeren Apparate an der Wand. Rasterelektronenmikroskop, Mikro-3-D-Drucker, Labormischer, Laser-Interferometer, Vakuumkammer mit einem Kubikmeter Fassungsvermögen – ich bin mit all dem vertraut. Und ich weiß, wie man es benutzt!
Ich bin Wissenschaftler. Jetzt kommen wir weiter! Also wird es Zeit, die Wissenschaft zu nutzen. Mach schon, du Superhirn, lass dir was einfallen!
Ich … habe Hunger.
Gehirn, du lässt mich im Stich.
Na gut, ich habe keine Ahnung, warum dieses Labor hier ist und warum ich es betreten darf. Also … weiter!
Die Luke in der Decke befindet sich zehn Fuß über dem Boden. Ein weiteres Abenteuer auf der Leiter. Wenigstens bin ich jetzt etwas kräftiger.
Ich atme einige Male tief durch und steige die Leiter hinauf. Es geht genauso mühsam wie vorher, sogar diese einfache Tätigkeit ist eine große Belastung. Auch wenn es mir besser geht, von »gut« kann keine Rede sein.
Lieber Himmel, bin ich schwer. Mit Mühe und Not schaffe ich es bis nach oben.
Ich richte mich auf den unbequemen Sprossen ein und stemme mich gegen den Griff der Luke. Er rührt sich nicht.
»Bitte nennen Sie Ihren Namen, um die Luke zu entriegeln«, verlangt der Computer.
»Aber ich weiß meinen Namen nicht!«
»Nicht korrekt.«
Ich schlage mit der flachen Hand nach dem Riegel. Er gibt nicht nach, und mir tut die Hand weh. Verstehe. So wird das nichts.
Diese Luke muss warten. Vielleicht fällt mir mein Name noch ein, oder ich sehe ihn irgendwo aufgeschrieben.
Ich steige die Leiter hinunter. Oder besser gesagt, ich versuche es. Man könnte meinen, es sei einfacher und sicherer, nach unten zu klettern. Aber nein. Keineswegs. Statt anmutig den Fuß auf die nächste Sprosse zu setzen, rutsche ich ab und verliere den Halt am Griff der Luke. Ich stürze ab wie ein Idiot.
Ich winde mich wie eine wütende Katze und greife nach irgendetwas, an dem ich mich festhalten kann. Leider ist das eine richtig schlechte Idee. Ich lande auf dem Tisch und pralle mit dem Schienbein gegen ein Schubladenkästchen mit Laborutensilien. Das tut höllisch weh. Ich schreie auf, greife an mein schmerzendes Schienbein, rolle vom Tisch und falle auf den Boden.
Dieses Mal fangen mich keine Roboterarme auf. Ich lande auf dem Rücken und kann nicht mehr atmen. Um das Maß vollzumachen, kippt das Kästchen um, die Schubladen gehen auf, und das Laborzubehör prasselt auf mich herab. Die Baumwolltupfer sind kein Problem. Die Reagenzgläser tun nur ein bisschen weh und gehen überraschenderweise nicht kaputt. Das Maßband fällt mir mitten auf die Stirn.
Noch mehr Sachen poltern herab, aber ich bin zu sehr damit beschäftigt, die wachsende Beule auf der Stirn zu betasten. Wie kann ein Maßband nur so schwer sein? Es fällt drei Fuß tief vom Tisch herunter, und ich habe eine Beule auf der Stirn.
»Das hat nicht geklappt«, sage ich zu niemandem im Besonderen. Diese ganze Aktion war einfach lächerlich. Wie aus einem Charlie-Chaplin-Film.
Ja … genau so war es. Sogar ein wenig zu viel davon.
Wieder habe ich das Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmt.
Ich schnappe mir ein Reagenzglas und werfe es hoch. Es steigt empor und kommt herunter, wie es sein sollte. Trotzdem ist etwas an der Art, wie Objekte hier fallen, grundverkehrt. Ich will es herausfinden.
Was steht mir hier zur Verfügung? Nun ja, ein ganzes Labor, das ich sogar zu benutzen weiß. Aber was davon ist schnell zur Hand? Ich betrachte das Zeug, das auf den Boden gefallen ist. Mehrere Reagenzgläser, Labortupfer, Holzspatel, eine digitale Stoppuhr, Pipetten, Klebeband, ein Stift …
Fein. Ich glaube, das ist alles, was ich brauche.
Ich rapple mich auf und klopfe die Toga ab. Sie ist gar nicht verstaubt. Anscheinend ist meine ganze Welt hier sauber und steril. Ich mache es trotzdem.
Ich nehme das Maßband und betrachte es. Es ist metrisch. Vielleicht bin ich in Europa? Wer weiß. Dann sehe ich mir die Stoppuhr an. Sie ist ziemlich robust, wie etwas, das man auf eine Wanderung mitnimmt. Eine kräftige Plastikhülle mit einem schützenden Hartgummiring. Zweifellos wasserdicht. Außerdem mausetot. Die LCD-Anzeige ist leer.
Ich drücke auf mehrere Knöpfe, aber nichts passiert. Ich werfe einen Blick auf das Batteriefach auf der Rückseite. Vielleicht finde ich in einer Schublade die richtigen Batterien, wenn ich weiß, welchen Typ die Stoppuhr braucht. Hinten ragt ein kleiner roter Plastikstreifen hervor. Ich ziehe, und er rutscht ganz heraus. Die Stoppuhr erwacht zum Leben.
Wie bei dem Spielzeug, auf dem »Batterie inklusive« steht. Der kleine Plastikstreifen soll verhindern, dass sich die Batterie entlädt, bevor der neue Besitzer das Ding zum ersten Mal benutzt. Schön, jetzt habe ich also eine nigelnagelneue Stoppuhr. In diesem Labor sieht eigentlich alles nagelneu aus. Sauber, aufgeräumt, keine Gebrauchsspuren. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll.
Ich spiele eine Weile mit der Stoppuhr herum, bis ich verstanden habe, wie sie funktioniert. Eigentlich ist es ganz einfach.
Mit dem Maßband ermittle ich, wie hoch der Tisch ist. Die Unterkante ist genau 91 Zentimeter über dem Boden.
Ich nehme ein Reagenzglas. Es besteht gar nicht aus Glas. Vermutlich ein extrem widerstandsfähiges Plastikmaterial. Jedenfalls ist es nicht zerbrochen, als es aus drei Fuß Höhe auf den harten Boden gefallen ist. Wie auch immer, die Dichte ist groß genug, um den Luftwiderstand vernachlässigen zu können.
Ich lege es auf den Tisch und halte die Stoppuhr bereit. Mit einer Hand schiebe ich das Reagenzglas über die Tischkante, mit der anderen starte ich die Stoppuhr und messe, wie lange das Reagenzglas braucht, um auf den Boden zu fallen. Dabei kommen etwa 0,37 Sekunden heraus. Das ist ziemlich schnell.
Ich notiere die Zeit mit dem Stift auf dem Arm. Papier habe ich bisher noch nicht gefunden.
Dann lege ich das Röhrchen wieder hin und wiederhole den Test. Dieses Mal sind es 0,33 Sekunden. Ich versuche es noch zwanzigmal und notiere die Ergebnisse, um die Auswirkung meiner Ungenauigkeit beim Starten und Stoppen des Zeitnehmers zu verringern. Am Ende bekomme ich einen Durchschnittswert von 0,348 Sekunden heraus. Mein Arm sieht aus wie die Tafel eines Mathelehrers, aber das stört mich nicht.
0,348 Sekunden. Die Strecke entspricht der halben Beschleunigung mal Zeit zum Quadrat. Die Beschleunigung entspricht demnach zweimal Strecke durch Zeit zum Quadrat. Die Formeln fallen mir sofort ein. Es ist wie meine zweite Natur. Mit Physik kenne ich mich also aus. Gut zu wissen.
Ich gehe die Zahlen durch und bekomme ein Ergebnis, das mir nicht gefällt. Die Schwerkraft in diesem Raum ist zu hoch. Die Fallbeschleunigung liegt bei fünfzehn Metern pro Quadratsekunde, obwohl der Wert nur 9,8 betragen sollte. Deshalb kommt es mir so falsch vor, wenn etwas fällt – die Dinge fallen zu schnell. Und deshalb bin ich trotz meiner Muskeln so schwach. Hier ist alles anderthalbmal so schwer, wie es sein sollte.
Das Problem ist nur, dass rein gar nichts die Schwerkraft beeinflussen kann. Man kann sie nicht erhöhen oder vermindern. Die Fallbeschleunigung auf der Erde beträgt 9,8 Meter pro Quadratsekunde. Ende der Diskussion. Aber hier liegt der Wert höher. Dafür gibt es nur eine mögliche Erklärung.
Ich bin nicht auf der Erde.
2
Erst mal tief durchatmen. Keine voreiligen Schlussfolgerungen. Ja, die Schwerkraft ist zu hoch. Gehe davon aus und überlege dir vernünftige Antworten.
Ich könnte in einer Zentrifuge stecken. Sie müsste allerdings ziemlich groß sein. Die Erdschwerkraft beträgt 1 g, und man könnte diese Räume schräg auf Schienen laufen lassen oder sie ans Ende eines langen starken Auslegers hängen oder so. Durch die Rotation könnte man dank der Summe aus Zentrifugalkraft und Erdschwerkraft auf fünfzehn Meter pro Sekundenquadrat kommen.
Warum sollte jemand eine riesige Zentrifuge mit Krankenhausbetten und einem Labor bauen? Keine Ahnung. Ist so etwas überhaupt möglich? Wie groß müsste der Radius sein? Und wie schnell bewegt sich die Vorrichtung?
Vielleicht weiß ich, wie ich Antworten auf diese Fragen finden kann. Ich brauche einen genauen Beschleunigungsmesser. Gegenstände von einem Tisch zu werfen und die Zeit zu messen, das mag für eine grobe Schätzung reichen, aber das Ergebnis kann nur so genau sein wie meine Reaktionszeit beim Bedienen der Stoppuhr. Ich brauche etwas Besseres. Es gibt nur eines, das für diese Aufgabe geeignet ist: ein kleines Stück Schnur.
Ich durchwühle die Schubladen im Labor.
Nach ein paar Minuten habe ich die Hälfte geschafft und so ziemlich alles gefunden, was man im Labor brauchen kann, außer eine Schnur. Als ich schon aufgeben will, entdecke ich endlich eine Spule mit Nylonfaden.
»Ja!« Ich ziehe ein paar Fuß Faden ab und beiße ihn mit den Zähnen durch. An einem Ende knote ich eine Schlaufe, das andere verbinde ich mit dem Maßband. Es soll bei diesem Experiment das Gegengewicht spielen. Jetzt muss ich die Vorrichtung nur noch irgendwo aufhängen.
Ich blicke zur Luke in der Decke hoch. Wieder steige ich die Leiter empor (schneller als vorher) und streife die Schlaufe über den Griff der Luke. Dann lasse ich das Maßband die Schnur stramm ziehen.
Ich habe ein Pendel.
Das Schöne an einem Pendel ist: Die Zeit, die es von einem bis zum anderen Ende schwingt – die Periode –, bleibt immer gleich, ganz egal, wie weit es ausschlägt. Wenn es viel Energie hat, schwingt es weiter und schneller, aber die Periode ist immer die gleiche. Dies nutzen mechanische Uhren, um die Zeit anzuzeigen. Letzten Endes wird die Periode ausschließlich von zwei Faktoren bestimmt: von der Länge des Pendels und der Schwerkraft.
Ich ziehe das Pendel zur Seite, lasse es los und starte die Stoppuhr. Während es hin und her schwingt, zähle ich die Zyklen. Aufregend ist das nicht. Ich könnte gleich wieder einschlafen, aber ich halte durch.
Zehn Minuten später bewegt sich das Pendel kaum noch. Ich beschließe, dass es reicht. Gesamtsumme: 346 volle Zyklen in zehn Minuten.
Weiter zu Phase zwei.
Ich messe die Distanz vom Lukengriff bis zum Boden. Etwas mehr als zweieinhalb Meter. Dann steige ich hinunter ins »Schlafzimmer«. Auch dieses Mal ist die Leiter kein Problem. Ich fühle mich viel besser. Das Essen hat sehr geholfen.
»Wie heißen Sie?«, will der Computer wissen.
Ich betrachte meine Bettlakentoga. »Ich bin der große Philosoph Pendulus!«
»Nicht korrekt.«
Ich hänge das Pendel an einem Roboterarm unter der Decke auf. Hoffentlich bleibt es auch eine Weile dort. Dann schätze ich die Entfernung zwischen dem Roboterarm und der Decke ab. Sagen wir mal, das ist ein Meter. Mein Pendel hängt jetzt viereinhalb Meter tiefer als vorher.
Ich wiederhole das Experiment. Zehn Minuten auf der Stoppuhr, und ich zähle die Zyklen. Es sind 346, genau wie oben.
Meine Güte.
In einer Zentrifuge wird die Fliehkraft umso stärker, je weiter man sich vom Zentrum entfernt. Wäre ich in einer Zentrifuge, dann müsste die Schwerkraft hier unten höher sein als oben. Das ist sie aber nicht.
Und wenn ich in einer sehr großen Zentrifuge bin? So groß, dass die Differenz zwischen diesem Raum und dem Labor so klein ist, dass sich die Zahl der Zyklen nicht verändert?
Mal sehen … die Formel für ein Pendel … und die Formel für die Kraft einer Zentrifuge … Halt, ich habe ja gar nicht die Kraft, sondern nur die abgezählten Zyklen, also muss ich mit eins durch x rechnen … Es ist wirklich ein sehr lehrreiches Problem.
Ich habe einen Stift, aber kein Papier. Na gut, ich habe eine Wand. Nach vielen Kritzeleien, die an einen verrückten Gefangenen im Kerker erinnern, habe ich die Antwort.
Sagen wir mal, ich sitze auf der Erde in einer Zentrifuge. Dies würde bedeuten, dass die Zentrifuge einen Teil der Kraft beisteuert (den Rest liefert die Erde). Meinen Berechnungen zufolge (ich bin stolz auf mein Werk!) müsste die Zentrifuge einen Radius von 700 Metern haben (beinahe eine ganze Meile) und sich mit 88 Metern pro Sekunde drehen. Das entspricht mehr als 200 Meilen pro Stunde!
Hm. Wenn ich wissenschaftlich arbeite, denke ich immer in metrischen Einheiten. Interessant. So halten es doch die meisten Wissenschaftler, oder? Sogar diejenigen, die in den USA aufgewachsen sind.
Wie auch immer, das wäre die größte Zentrifuge, die je gebaut wurde … Warum sollte man so etwas tun? Außerdem wäre so ein Apparat furchtbar laut. Mit zweihundert Meilen pro Stunde durch die Luft sausen? Man müsste hier und da zumindest ein paar Turbulenzen spüren, ganz zu schweigen vom Fahrtwind. Aber ich höre und spüre überhaupt nichts.
Es wird immer seltsamer. Und wenn ich im Weltraum bin? Dann gäbe es keine Turbulenzen und keinen Windwiderstand, aber die Zentrifuge müsste noch größer und schneller sein, weil die unterstützende Schwerkraft der Erde fehlt.
Noch mehr rechnen, noch mehr Kritzeleien an der Wand. Der Radius müsste 1280 Meter betragen – beinahe eine Meile. So etwas Großes wurde noch nie im Weltraum gebaut.
Also bin ich nicht in einer Zentrifuge. Und ich bin nicht auf der Erde.
Auf einem anderen Planeten? Aber es gibt keinen anderen Planeten, Mond oder Asteroiden, der eine so hohe Schwerkraft hat. Die Erde ist das größte massive Objekt im Sonnensystem. Die Gasriesen sind natürlich größer, aber solange ich nicht in einem Ballon durch die Stürme auf Jupiter treibe, gibt es keinen Ort, an dem ich solchen Kräften ausgesetzt wäre.
Woher weiß ich das alles? Das Wissen ist einfach da. Es kommt mir ganz selbstverständlich vor. Informationen, auf die ich ständig zurückgreife. Vielleicht bin ich Astronom oder Planetologe. Vielleicht arbeite ich für die NASA oder die ESA oder …
Jeden Donnerstagabend traf ich mich mit Marissa auf ein Steak und ein Bier im Murphyʼs in der Gough Street. Immer um achtzehn Uhr, und weil uns die Mitarbeiter kannten, bekamen wir immer denselben Tisch.
Wir hatten uns vor beinahe zwanzig Jahren an der Universität kennengelernt. Sie war damals mit meinem damaligen Zimmergenossen zusammen. Ihre Beziehung war, wie so oft unter Studenten, eine Katastrophe, und nach drei Monaten trennten sie sich wieder. Doch Marissa und ich waren am Ende gute Freunde.
Als mich der Wirt bemerkte, lächelte er und deutete mit dem Daumen auf den üblichen Tisch. Ich ging an der kitschigen Deko vorbei zu Marissa. Vor ihr standen zwei leere Gläser, ein volles hielt sie in der Hand. Anscheinend hatte sie früh angefangen.
»Hast du einen Vorsprung?« Ich setzte mich zu ihr.
Sie senkte den Blick und spielte mit ihrem Glas.
»He, was ist denn los?«
Sie trank einen Schluck Whisky. »Ein harter Tag in der Arbeit.«
Ich winkte dem Kellner. Er nickte und kam nicht einmal zu uns. Er wusste, dass ich ein Ribeye medium mit Stampfkartoffeln und ein Pint Guinness haben wollte. Wie jede Woche.
»Wie hart kann es denn sein?«, fragte ich. »Ein behaglicher Regierungsjob im Energieministerium. Du hast – wie viel? Zwanzig bezahlte Urlaubstage? Und du musst einfach nur erscheinen, um dein Gehalt zu kassieren, oder?«
Sie lachte immer noch nicht. Verzog keine Miene.
»Ach, nun komm schon«, sagte ich. »Wer hat dir in die Suppe gespuckt?«
Sie seufzte. »Weißt du, was der Petrowa-Strahl ist?«
»Klar. Das ist ein interessantes Rätsel. Ich tippe auf Strahlung von der Sonne. Die Venus hat kein Magnetfeld, aber positiv geladene Partikel könnten dort angezogen werden, weil das Feld elektrisch neutral ist …«
»Nein«, widersprach sie. »Es ist etwas anderes. Wir wissen nicht genau, was es ist, aber es ist … etwas anderes. Egal. Lass uns Steak essen.«
Ich schnaubte. »Hör doch auf, Marissa, erzählʼs mir schon. Was ist los mit dir?«
Sie dachte nach. »Na gut. In zwölf Stunden erfährst du es sowieso vom Präsidenten.«
»Vom Präsidenten?«, fragte ich. »Dem Präsidenten der Vereinigten Staaten?«
Sie trank noch einen Schluck Whisky. »Hast du schon mal etwas von der Amaterasu gehört? Das ist eine japanische Solar-Sonde.«
»Sicher«, bestätigte ich. »Die JAXA hat ausgezeichnete Daten gewonnen. Das ist eine feine Sache. Die Sonde umkreist die Sonne auf halbem Wege zwischen Merkur und Venus und hat zwanzig verschiedene Messinstrumente an Bord, die …«
»Ja, schon gut, das weiß ich selbst«, unterbrach sie mich. »Den Daten zufolge nimmt die Strahlung der Sonne ab.«
Ich zuckte mit den Achseln. »Ja, und? Wo sind wir gerade im Sonnenzyklus?«
Sie schüttelte den Kopf. »Es hat nichts mit dem Elfjahreszyklus zu tun. Es ist etwas anderes. Die JAXA hat den Sonnenzyklus berücksichtigt. Trotzdem geht es nach unten. Sie sagen, die Sonne sei 0,01 Prozent weniger hell, als sie sein sollte.«
»Ja, das ist interessant. Aber das rechtfertigt keine drei Whisky vor dem Essen.«
Sie schürzte die Lippen. »Das dachte ich auch. Aber die Dämpfung der Helligkeit nimmt zu. Und die Steigerungsrate nimmt ebenfalls zu. Es ist eine Art exponentieller Verlust, den sie dank der empfindlichen Instrumente in der Sonde sehr, sehr früh wahrgenommen haben.«
Ich lehnte mich zurück in meiner Nische. »Ich weiß nicht, Marissa. Eine exponentielle Progression so früh wahrzunehmen, das kommt mir sehr unwahrscheinlich vor. Aber meinetwegen, nehmen wir an, die Wissenschaftler der JAXA haben recht. Wohin verschwindet dann die Energie?«
»In den Petrowa-Strahl.«
»Wie bitte?«
»Die JAXA hat sich den Petrowa-Strahl gründlich angesehen und ist der Meinung, dass er in demselben Maße heller wird, in dem die Sonne dunkler wird. Irgendwie stiehlt der Petrowa-Strahl der Sonne die Energie.«
Sie zog einen Papierstapel aus ihrer Handtasche und legte ihn auf den Tisch. Es waren vor allem Kurven und Diagramme. Nach einigem Blättern hatte sie die richtige Zeichnung gefunden und schob sie zu mir herüber.
Die x-Achse war mit »Zeit« beschriftet, die y-Achse mit »Leuchtkraftverlust«. Ja, der Verlauf war definitiv exponentiell.
»Das kann doch nicht sein«, sagte ich.
»Es stimmt aber«, beharrte sie. »Der Ausstoß der Sonne wird im Laufe der nächsten neun Jahre um ein ganzes Prozent sinken. In zwanzig Jahren sind es fünf Prozent. Das ist übel, wirklich übel.«
Ich starrte auf das Diagramm »Das würde eine neue Eiszeit bedeuten. Und zwar in kürzester Zeit. Eine Blitz-Eiszeit.«
»Ja, mindestens das. Missernten, Hungersnöte … ich weiß nicht, was sonst noch alles.«
Ich schüttelte den Kopf. »Wie kann es in der Sonne zu einer so abrupten Veränderung kommen? Du meine Güte, das ist ein Stern. Bei Sternen geschieht nichts schnell. Veränderungen dauern Millionen von Jahren, nicht nur ein paar Dutzend. Komm schon, das weißt du doch.«
»Nein, das weiß ich nicht. Früher habe ich es gewusst. Jetzt weiß ich nur, dass die Sonne stirbt«, entgegnete sie. »Leider ist mir nicht klar, warum, und ich habe keine Ahnung, was wir dagegen tun können. Aber ich weiß, dass sie stirbt.«
»Wie …« Ich runzelte die Stirn.
Sie kippte den Rest ihres Drinks hinunter. »Der Präsident hält morgen früh eine Ansprache an die Nation. Ich glaube, sie stimmen sich noch mit den Regierungen anderer Staaten ab, um es gleichzeitig zu verkünden.«
Der Kellner brachte mein Guinness. »Bitte, Sir. Die Steaks kommen gleich.«
»Ich nehme noch einen Whisky«, sagte Marissa.
»Für mich auch einen«, fügte ich hinzu.
Ich blinzle. Wieder ein Erinnerungsfetzen.
War er echt? Oder nur eine beliebige Erinnerung, wie ich mit einer Freundin gesprochen habe, die einer absurden Weltuntergangstheorie aufgesessen war?
Nein. Es ist echt. Ich bekomme Angst, wenn ich nur daran denke. Keine plötzlich hochschießende Angst. Es ist eine vertraute Angst, die einen Stammplatz am Tisch hat. Ich kenne sie schon lange.
Es ist real. Die Sonne stirbt, und ich habe etwas damit zu tun. Nicht nur als ein Erdenbürger, der zusammen mit allen anderen sterben wird – nein, ich bin aktiv beteiligt. Ich spüre eine Art Verantwortungsgefühl.
An meinen Namen kann ich mich immer noch nicht erinnern, aber ich stoße auf verschiedene Informationsbröckchen, die mit dem Petrowa-Problem verknüpft sind. Sie nennen es das Petrowa-Problem. Das ist mir gerade wieder eingefallen.
Mein Unterbewusstsein hat Prioritäten. Und es versucht verzweifelt, mir etwas über diese Situation zu sagen. Ich glaube, es ist meine Aufgabe, das Petrowa-Problem zu lösen.
Und zwar in einem kleinen Labor, gekleidet in eine Bettlakentoga und ohne zu wissen, wer ich bin. Meine Helfer sind ein tumber Computer und zwei mumifizierte Zimmergenossen.
Mir verschwimmt alles vor den Augen. Tränen. Ich wische sie ab. Ich kann … ich kann mich nicht an die Namen meiner Kollegen erinnern. Aber sie waren meine Freunde. Meine Kameraden.
Erst jetzt wird mir bewusst, dass ich ihnen die ganze Zeit den Rücken zugewandt habe. Ich habe getan, was ich konnte, um sie nicht ansehen zu müssen. Wie ein Irrer habe ich die Wand bekritzelt, während hinter mir die Leichen von zwei Menschen lagen, die mir wichtig waren.
Aber jetzt kann ich mich nicht länger ablenken. Ich drehe mich um und betrachte sie.
Ich schluchze. Die Erinnerung bricht ohne Vorwarnung über mich herein. Die Frau war witzig – immer zu Scherzen aufgelegt. Der Mann war professionell und hatte Nerven wie Drahtseile. Ich glaube, er war beim Militär und unser Kommandant.
Ich sinke zu Boden und berge den Kopf in den Händen. Ich kann es nicht mehr zurückhalten, ich weine wie ein Kind. Wir waren viel mehr als Freunde. Und »Team« ist auch nicht die richtige Bezeichnung. Es ist stärker. Es ist …
Es liegt mir auf der Zunge.
Endlich taucht das Wort in mein Bewusstsein empor. Es musste warten, bis ich nicht mehr hinschaute, um sich anzuschleichen.
Crew. Wir waren eine Crew. Und ich bin der Einzige, der noch übrig ist.
Dies ist ein Raumschiff. Das weiß ich jetzt. Ich weiß nicht, woher die Schwerkraft kommt, aber es ist ein Raumschiff.
Allmählich fügen sich die Puzzleteile zusammen. Wir waren nicht krank. Unsere Vitalfunktionen waren nur stark verlangsamt.
Diese Betten sind keine magischen »Kältekammern« wie im Film. Hier ist keine spezielle Technologie im Spiel. Ich glaube, wir haben in einem künstlichen Koma gelegen. Schläuche, Infusionen mit Nährstoffen, ständige medizinische Überwachung. Alles, was ein Körper braucht. Die Roboterarme haben wahrscheinlich die Laken gewechselt und uns gedreht, damit wir uns nicht wund liegen, und alles andere getan, was sonst die Pfleger auf der Intensivstation tun.
Elektroden am ganzen Körper haben unsere Muskeln stimuliert. Uns trainiert und fit gehalten.
Aber so ein Koma ist gefährlich. Extrem gefährlich. Ich bin der Einzige, der überlebt hat, und mein Gehirn ist ein Haufen Matsch.
Ich gehe zu der Frau. Wenn ich sie ansehe, fühle ich mich sogar besser. Vielleicht liegt es daran, dass ich jetzt gewissermaßen Frieden schließen kann. Oder es ist die Ruhe, die sich nach einem Heulkrampf einstellt.
An der Mumie sind keine Schläuche befestigt. Sie wird nicht mehr überwacht. In der ledrigen Haut ihres Handgelenks ist ein kleines Loch. Da war wohl vor dem Tod die Infusion angebracht. Also ist das Loch nicht mehr verheilt.
Der Computer hat alle Zugänge entfernt, als sie starb. Spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Es ist sinnlos, Ressourcen auf tote Menschen zu verschwenden. Lieber mehr für die Lebenden aufheben.
Anders ausgedrückt: mehr für mich.
Ich hole tief Luft und atme langsam wieder aus. Ich muss ruhig bleiben. Ich muss klar denken. Mir ist inzwischen eine Menge eingefallen – meine Crew, einige Aspekte ihrer Persönlichkeiten und dass ich in einem Raumschiff bin (deshalb werde ich später noch ausflippen). Erfreulich ist, dass immer mehr Erinnerungen zurückkehren, und sie kommen sogar, wenn ich sie bewusst abrufe, und nicht willkürlich und zufällig. Darauf will ich mich konzentrieren, aber die Trauer ist zu groß.
»Essen Sie«, sagt der Computer.
Mitten in der Decke öffnet sich eine Klappe, aus der eine Nahrungstube fällt. Ein Roboterarm schnappt sie und legt sie auf mein Bett. Auf dem Etikett steht: TAG 1 – MAHLZEIT 2.
Mir ist nicht nach Essen, aber mein Magen knurrt, sobald ich die Tube sehe. Ganz egal, in welcher seelischen Verfassung ich bin, mein Körper hat Bedürfnisse.
Ich öffne die Tube und quetsche mir die Paste in den Mund.
Ich muss zugeben, es ist schon wieder ein unglaubliches Geschmackserlebnis. Hühnchen mit einer Andeutung von Gemüse. Natürlich hat es keine Textur, im Grunde ist es Babybrei. Und es ist ein wenig zäher als die erste Mahlzeit.
»Wasser?«, frage ich zwischen zwei Happen.
Wieder öffnet sich die Klappe in der Decke, dieses Mal kommt eine Metallröhre zum Vorschein. Ein Roboterarm reicht sie mir. Der glänzende Behälter ist mit TRINKWASSER beschriftet. Ich schraube den Deckel ab, und richtig, drinnen ist Wasser.
Ich nehme einen Schluck. Es hat Zimmertemperatur und schmeckt schal. Wahrscheinlich ist es destilliert und enthält keine Mineralstoffe. Aber Wasser ist Wasser.
Ich beende meine Mahlzeit. Bisher musste ich noch nicht auf die Toilette, aber irgendwann wird es nötig. Ich möchte ja nicht auf den Boden pinkeln.
»Toilette?«, frage ich.
Ein Teil der Wand gleitet seitlich weg, und eine metallene Kloschüssel kommt zum Vorschein. Sie ist direkt in der Wand angebracht wie in einer Gefängniszelle. Ich sehe sie mir genauer an. Das Ding hat Knöpfe und Bedienelemente. Ich glaube, in der Schüssel ist eine Vakuumpumpe. Und es gibt kein Wasser. Möglicherweise ist es eine Null-g-Toilette, die man für den Gebrauch in der Schwerkraft umgebaut hat. Warum sollte man so etwas tun?
»Gut, äh … Toilette schließen.«
Das Wandstück gleitet zurück. Die Toilette ist verschwunden.
Na schön, ich habe gegessen und getrunken und fühle mich insgesamt etwas besser. Das Essen macht so etwas mit einem.
Ich muss mich auf etwas Positives konzentrieren. Ich lebe noch. Was auch immer meine Freunde getötet hat, es hat mich verschont. Ich befinde mich in einem Raumschiff. Genaueres weiß ich noch nicht, aber ich bin in einem Raumschiff, das anscheinend einwandfrei funktioniert.
Und meine seelische Verfassung verbessert sich. Da bin ich ganz sicher.
Ich hocke mich im Schneidersitz auf den Boden. Es wird Zeit für den nächsten Schritt. Ich schließe die Augen und lasse die Gedanken schweifen. Ich will mich absichtlich an etwas erinnern. Ganz egal, woran. Aber ich will die Erinnerung bewusst auslösen. Mal sehen, was dabei herauskommt.
Ich beginne mit Dingen, die mich glücklich machen. Ich mag Wissenschaft. Das weiß ich. Die kleinen Experimente, die ich durchgeführt habe, fand ich spannend. Und ich bin im Weltraum. Also, vielleicht kann ich über den Weltraum und die Wissenschaft nachdenken und sehen, was dann kommt …
Ich nahm die kochend heißen Fertig-Spaghetti aus der Mikrowelle und lief eilig zum Sofa. Dort zog ich die Plastikfolie ab und ließ den Dampf entweichen.
Dann schaltete ich den Ton des Fernsehers ein und verfolgte die Livesendung. Mehrere Kollegen und ein paar Freunde hatten mich eingeladen, es mit ihnen zusammen anzusehen, aber ich wollte nicht den ganzen Abend damit verbringen, Fragen zu beantworten. Ich wollte einfach in Ruhe zuschauen.
Das Ereignis hatte die höchste Zuschauerzahl in der Menschheitsgeschichte. Mehr als die Mondlandung. Mehr als jede Weltmeisterschaft. Alle Sender, alle Streamingdienste, alle Nachrichtenwebsites zeigten die gleichen Bilder: den Livefeed der NASA.
Eine Reporterin stand zusammen mit einem älteren Mann auf der Galerie eines Flugkontrollraums. Hinter ihnen beobachteten Männer und Frauen in blauen Hemden ihre Terminals.
»Ich bin Sandra Elias«, begann sie. »Ich stehe hier im Jet Propulsion Laboratory in Pasadena, Kalifornien. Bei mir ist Dr. Browne, der Leiter der Abteilung für Planetologie bei der NASA.«
Sie wandte sich an den Wissenschaftler. »Doktor, wie ist im Augenblick die Lage?«
Browne räusperte sich. »Wir haben vor neunzig Minuten die Bestätigung erhalten, dass die ArcLight erfolgreich in die Umlaufbahn um die Venus eingeschwenkt ist. Jetzt warten wir auf die ersten Datenpakete.«
Seit der Verlautbarung der JAXA zum Petrowa-Problem war ein hektisches Jahr vergangen. Studie um Studie hatte die bisherigen Erkenntnisse bestätigt. Die Uhr tickte, und die Welt musste herausfinden, was dort im Gange war. So erblickte das Projekt ArcLight das Licht der Welt. Die Situation war erschreckend, das Projekt selbst jedoch beeindruckend. Mein innerer Nerd konnte gar nicht anders, als aufgeregt zuzusehen.
Die ArcLight war das teuerste unbemannte Raumschiff, das je gebaut wurde. Die Welt brauchte Antworten und hatte keine Zeit für Kleinkrämerei. Normalerweise lachten einen die Raumfahrtagenturen aus, wenn man sie bat, in weniger als einem Jahr eine Sonde zur Venus zu schicken. Doch es ist erstaunlich, was man tun kann, wenn unbegrenzte Mittel zur Verfügung stehen. Die Vereinigten Staaten, die Europäische Union, Russland, China, Indien und Japan halfen, die Kosten zu decken.
»Erzählen Sie uns etwas über die Venus«, bat die Reporterin Browne. »Warum ist es gerade dort so schwierig?«
»Das Hauptproblem ist der Treibstoff«, erklärte der Wissenschaftler. »Es gibt bestimmte Zeitfenster, in denen interplanetare Reisen ein Minimum an Treibstoff verbrauchen, aber das nächste Erde-Venus-Fenster liegt in weiter Ferne. Deshalb mussten wir deutlich mehr Treibstoff als normalerweise üblich in den Weltraum schaffen, um die ArcLight ans Ziel zu bringen.«
»Schlechtes Timing, also?«, fragte die Reporterin.
»Ich glaube, dafür, dass die Sonne dunkler wird, gibt es überhaupt keinen guten Zeitpunkt.«
»Das ist wahr. Bitte fahren Sie fort.«
»Die Venus bewegt sich im Vergleich zur Erde sehr schnell, was bedeutet, dass wir noch mehr Treibstoff benötigen, um sie einzuholen. Selbst unter idealen Bedingungen braucht man für einen Flug zur Venus erheblich mehr Treibstoff als für einen Flug zum Mars.«
»Erstaunlich, wirklich erstaunlich. Dr. Browne, einige Leute haben gefragt: Warum kümmern wir uns überhaupt um den Planeten? Der Petrowa-Strahl ist riesig und führt in einem Bogen von der Sonne zur Venus. Warum steuern wir nicht irgendeinen Punkt dazwischen an?«
»Weil der Petrowa-Strahl dort am breitesten ist – so breit wie der ganze Planet. Und wir können die Schwerkraft des Planeten zu unserem Vorteil nutzen. Die ArcLight umkreist die Venus zwölfmal, während sie Proben von dem Material des Petrowa-Strahls nimmt.«
»Was glauben Sie, worum es sich bei dem Material handelt?«
»Wir haben keine Ahnung«, gestand Browne. »Absolut keine Ahnung. Aber bald werden wir hoffentlich die Antworten erfahren. Nach dem ersten Umlauf um die Venus müsste die ArcLight genügend Proben gesammelt haben, um im eingebauten Labor eine vorläufige Analyse durchzuführen.«
»Wie viel können wir heute Abend herausfinden?«
»Nicht viel. Das Bordlabor ist recht einfach. Nur ein starkes Mikroskop und ein Röntgenspektrometer. Die Mission besteht vor allem darin, mit Proben zur Erde zurückzukehren. Es wird noch einmal drei Monate dauern, bis die ArcLight mit den Proben hier eintrifft. Das Labor ist nur ein Provisorium, um wenigstens einige Daten zu gewinnen, falls es während der Rückkehr Probleme gibt.«
»Wie immer gut vorbereitet, Dr. Browne.«
»So halten wir es hier.«
Hinter der Reporterin brach Jubel aus.
»Ich höre gerade …« Sie wartete, bis sich der Aufruhr legte. »Ich höre, dass der erste Umlauf abgeschlossen ist und die Daten hereinkommen …«
Der Hauptbildschirm des Kontrollraums wechselte zu einer Schwarz-Weiß-Darstellung. Das Bild war überwiegend grau, hier und dort waren schwarze Punkte verstreut.
»Was sehen wir da, Doktor?«, fragte die Reporterin.
»Die Aufnahmen stammen aus dem internen Mikroskop«, erklärte Browne. »Es hat eine zehntausendfache Vergrößerung. Die schwarzen Punkte sind etwa zehn Mikrometer groß.«
»Sind die Punkte denn das, was wir gesucht haben?«, fragte Sandra Elias.
»Das wissen wir nicht genau. Es könnten auch nur Staubpartikel sein. Eine so große Schwerkraftquelle wie ein Planet sammelt eine Staubwolke in der Umgebung …«
»Scheiße, was ist das denn?«, fluchte jemand im Hintergrund. Mehrere Flugüberwacher schnappten nach Luft.
Die Reporterin kicherte. »Hier im JPL ist ja richtig was los. Wir senden live, deshalb entschuldigen wir uns für alle …«
»O mein Gott!«, sagte Browne.
Auf dem Hauptbildschirm wurden weitere Bilder sichtbar. Eines nach dem anderen. Alle sahen beinahe gleich aus.
Beinahe.
Die Reporterin betrachtete die Bilder. »Bewegen sich die Partikel etwa?«
Die Aufnahmen, die nacheinander eingespielt wurden, zeigten, dass sich die schwarzen Punkte deformierten und hin und her wanderten.
Die Reporterin räusperte sich und machte eine Bemerkung, die man durchaus als Untertreibung des Jahrhunderts betrachten konnte. »Finden Sie nicht auch, dass das ein wenig nach Mikroben aussieht?«
»Telemetrie!«, rief Dr. Browne. »Flattert die Sonde?«
»Schon überprüft«, antwortete jemand. »Kein Flattern.«
»Bleibt die Bewegungsrichtung gleich?«, fragte er. »Ist da etwas, das man mit einer externen Kraft erklären könnte? Magnetisch vielleicht? Statische Aufladung?«
Es wurde still in dem Raum.
»Vorschläge?«, fragte Browne.
Ich ließ die Gabel mitten in die Spaghetti fallen.
Sollte es sich um außerirdisches Leben handeln? Habe ich wirklich so großes Glück? Auf der Welt zu sein, wenn die Menschheit das erste Mal extraterrestrisches Leben entdeckt?
Mann! Ich meine – das Petrowa-Problem ist immer noch beängstigend, aber … Mann! Aliens! Es könnten Aliens sein! Ich kann es gar nicht erwarten, morgen mit den Kindern darüber zu sprechen.
»Bahnanomalie«, sagt der Computer.
»Mist!«, schimpfe ich. »Ich hatte es fast geschafft. Beinahe hätte ich mich an mich selbst erinnert!«
»Bahnanomalie«, wiederholt der Computer.
Ich entfalte meine Gliedmaßen und stehe auf. Trotz der eingeschränkten Interaktionen mit ihm versteht der Computer anscheinend in gewisser Weise, was ich sage. So ähnlich wie Siri oder Alexa. Also rede ich mit ihm, wie ich mit den Geräten reden würde.
»Computer, was ist eine Bahnanomalie?«
»Bahnanomalie: Als kritisch bewertete Objekte oder Körper dürfen sich nicht weiter als 0,01 Radiant vom erwarteten Standort entfernt befinden.«
»Welcher Körper hat die Anomalie?«
»Bahnanomalie.«