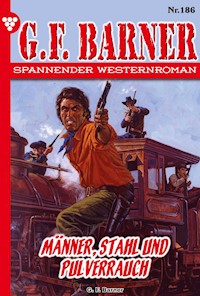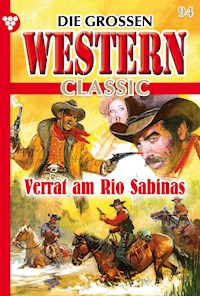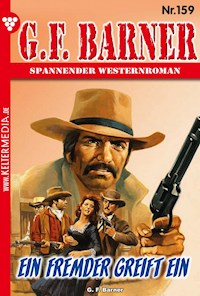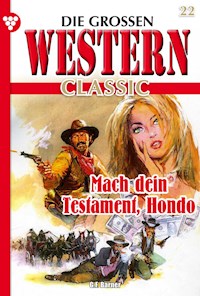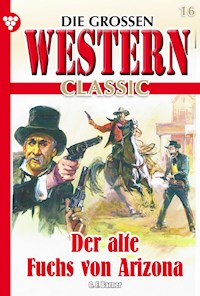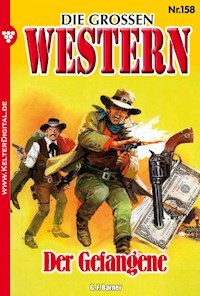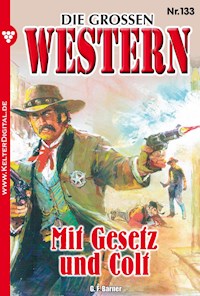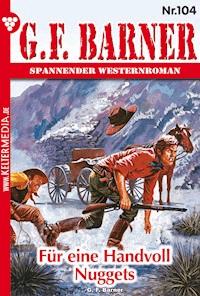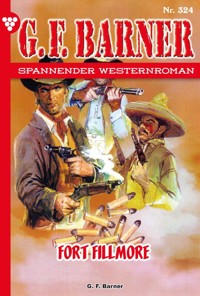Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Martin Kelter Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: G.F. Barner
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Nun gibt es eine exklusive Sonderausgabe – G.F. Barner Classic Begleiten Sie die Helden bei ihrem rauen Kampf gegen Outlaws und Revolverhelden oder auf staubigen Rindertrails. G. F. Barner ist legendär wie kaum ein anderer. Seine Vita zeichnet einen imposanten Erfolgsweg, wie er nur selten beschritten wurde. Als Western-Autor wurde er eine Institution. G. F. Barner wurde als Naturtalent entdeckt und dann als Schriftsteller berühmt. So unterschiedliche Romanreihen wie "U. S. Marines" und "Dominique", beide von ihm allein geschrieben, beweisen die Vielseitigkeit dieses großen, ungewöhnlichen Schriftstellers. Western von G. F. Irgendwo über dem Unterholz neben dem Weg nach Camp McAllen, begann ein Flußhüpfer zu keckern. Der Vogel meldete sich dreimal in kurzen Abständen, und Lucky Louis Charlton hob den Kopf. Er sah nach Norden, den Buschstreifen entlang am Hang vorbei, und entdeckte die schwache Staubwolke. Der Flußhüpfer schwieg jetzt. Rechts am Hang bewegten sich die Zweige eines Busches. Lucky Louis Charlton sah einen Moment Felice Garcias dunkles Kreolengesicht unter dem breitrandigen Sombrero. Dann verschwand der Sombrero. Felice war fort. Er hatte die Staubwolke wie Charlton gesehen und wußte, daß sie jetzt kamen. »Kommen sie?« Die Stimme war neben Charlton – eine weiche, katzenhaft schnurrende Stimme. »Si«, sagte Charlton. »Yes, sie kommen, Maddalena!« Eigentlich hieß sie Magdalena, aber sie sprachen den Namen so aus, nur Charlton nannte sie manchmal einfach Madge, wenn er ihren Namen amerikanisierte. »Sind sie schon zu erkennen?« »Na«, antwortete Charlton kurz.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 144
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
G.F. Barner Classic – 32 –
Der Banditengeneral
G.F. Barner
Irgendwo über dem Unterholz neben dem Weg nach Camp McAllen, begann ein Flußhüpfer zu keckern. Der Vogel meldete sich dreimal in kurzen Abständen, und Lucky Louis Charlton hob den Kopf. Er sah nach Norden, den Buschstreifen entlang am Hang vorbei, und entdeckte die schwache Staubwolke.
Der Flußhüpfer schwieg jetzt. Rechts am Hang bewegten sich die Zweige eines Busches. Lucky Louis Charlton sah einen Moment Felice Garcias dunkles Kreolengesicht unter dem breitrandigen Sombrero. Dann verschwand der Sombrero. Felice war fort. Er hatte die Staubwolke wie Charlton gesehen und wußte, daß sie jetzt kamen.
»Kommen sie?« Die Stimme war neben Charlton – eine weiche, katzenhaft schnurrende Stimme.
»Si«, sagte Charlton. »Yes, sie kommen, Maddalena!«
Eigentlich hieß sie Magdalena, aber sie sprachen den Namen so aus, nur Charlton nannte sie manchmal einfach Madge, wenn er ihren Namen amerikanisierte.
»Sind sie schon zu erkennen?«
»Na«, antwortete Charlton kurz. Die Sonne schien heiß – der Himmel war wolkenlos blau. »Es ist noch zu weit!«
»Wie weit?«
»Eine Viertelstunde, Maddalena.«
Er kroch ein Stück zurück und blieb im warmen Sand liegen. Charlton war müde. Sie waren die ganze Nacht geritten und drei Stunden vor dem Morgengrauen über den Fluß gesetzt. Jetzt warteten sie auf höchstens zehn Mann und einen oder auch zwei Wagen. Jener Flußhüpfer, dessen Keckern die Vormittagsstille durchbrochen hatte, hieß eigentlich Felipe. Der Mann konnte das Fauchen des Jaguars wie das Keckern eines Flußhüpfers oder das aufgeregte Gackern eines Taubenhuhnes nachahmen. Zudem besaß er die besten Augen der ganzen Horde, die Garcia führte.
»Woran denkst du?« Die Katzenstimme schnurrte, eine Hand kroch an Charltons Arm. Maddalena hatte schlanke Finger – ungewöhnlich lang und sogar fast immer sauber wie ihr ganzer braunhäutiger Körper. Charlton hatte nie zuvor einen so schönen und ebenmäßig gewachsenen Körper gesehen.
»Ich weiß nicht«, sagte Charlton müde. »Woran sollte ich jetzt denken?«
»An mich«, flüsterte sie. »Hörst du, du mußt an mich denken – jetzt… immer!«
»Katze«, sagte Charlton und hob den Kopf matt an. »Laß das jetzt!«
»Warum?« schnurrte sie. Ihre Hand kroch über seinen Nacken, erfaßte seine blonden langen Haare und kraulte sie. Charlton schloß die Augen, lag still und ließ es sich gefallen. »Warum nicht jetzt, eh? Denkst du, daß wir sie alle umbringen werden? Ah – das wird ein Spaß, sie sehen nichts von uns! Wenn wir wollen, sterben sie so schnell, daß sie nicht einmal mehr beten können. Würdest du sie beten lassen?«
»Vielleicht…«
Charlton sprach noch lahmer. Ihr Gekraule machte ihn müder und müder, beinahe schläfrig. Er öffnete die Lider erst spaltbreit, als ihre Hand jetzt sein Hemd bedächtig und doch zielsicher aufknöpfte und ihre Finger über seine Brusthaare tiefer und tiefer glitten.
»Was ist?« fragte sie, als er sich auf die Seite drehte und einmal unwirsch knurrte: »Wer Zeit hat zu beten, der hat auch noch Zeit zu schießen. Sie werden keine Zeit haben – zu nichts, verstehst du? Gefällt es dir nicht, eh?«
Ihre Finger umspielten sein Gürtelschloß, eine Silberschnalle mit einem Löwenkopf. Der Gurt hatte einmal den Bauch eines reichen Hazienderos umspannt, bis Felipe dem Mann eine Kugel genau eine Handbreit über der Gurtschnalle in die Haut gepflanzt hatte.
»Nicht jetzt«, sagte Charlton, seine Stimme klang belegt. »Herrgott, sie sind in dreizehn Minuten oder so hier. Maddalena, du bist verrückt…«
Sie kicherte, ihr Körper rutschte über den Sand näher, und ihre Finger ließen das Gurtschloß aufschnappen.
»Uns sieht doch keiner, Amigo – oder?«
»Du bist wirklich verrückt«, keuchte Charlton und wollte sich wegrollen, aber sie hielt ihn fest. »Die anderen könnten kommen und…«
»Na und? Ich liebe dich, du blonder Teufel!«
Sie trug eine Leinenjacke – ein ziemlich weites und angeschmutztes Ding, das sie wie ein Sack umhüllte und die Formen ihrer Figur verbarg. Jetzt hatte sie die Jacke offen, unter der sie eine Bluse aus dünnem Seidenstoff über den nackten braunen Oberkörper gestreift hatte. Wie die anderen hatte sie Leinenhosen an – weite, schlotternde Hosen, die nichts von ihren strammen, federnden Beinen zeigten.
»Du bist ja wahnsinnig«, ächzte Charlton, als sie die Jacke fortwarf und ihre Bluse. »Wenn dein Bruder kommt…«
»Pah«, machte sie nur. Ihre nackte Haut preßte sich an den Ausschnitt seines Hemdes auf seine Brust. »Komm… komm, rubioso…«
Charltons Müdigkeit war fort, die Sonne brannte auf seiner Haut, und er sah neben sich die sanfte, glänzende Rundung ihrer bloßen Schulter mit ein paar Sandkörnern wie glitzernde Perlsplitter darauf. Sein Blick glitt abwärts – und die Begierde siegte über seinen Verstand wie immer, wenn sie sich wie eine Katze an ihn schmiegte.
*
Es gab einen dumpfen Aufschlag, als der Mann von oben in die Mulde sprang und neben ihnen landete. Dann lag der Mann still, die Augen weit offen, den Mund auch.
»Damnato – verflucht noch mal!« zischte Garcia dann verstört. »Maddalena… seid ihr verrückt geworden? Dort kommen sie und ihr…, ah, was seid ihr für Menschen? Ihr könnt hier…«
»Por dios, was störst du uns?« fauchte Maddalena. Sie holte ihre Bluse und knöpfte sie zu, sah ihren Bruder scharf an und stieß ihm dann den Fuß in die Seite. »Zum Teufel, was geht dich das an, eh? Ich war es – ich! Hörst du? Schimpf nicht mit ihm – ich wollte es!«
»Du verdammte Katze!« knurrte Garcia finster. Er warf Charlton, der feuerrot geworden war, einen wütenden Blick zu. »Mußt du immer tun, was diese Teufelin will?«
»Ich – ich…«
»Schon gut«, schnitt ihm Garcia das Wort ab. »Es sind drei Wagen und zwölf Mann!«
»Drei?« staunte Charlton. »Aber er hat mir gesagt, es kämen höchstens zwei.«
»Statt hier herumzu…« Garcias Bart zuckte. Er zerbiß einen Fluch zwischen den Zähnen und deutete auf die Kante der Mulde, die nach Norden höher war als nach Süden. »Ich dachte, du hättest das gesehen. Ich wollte dich fragen, was der dritte Wagen zu bedeuten haben kann. Es ist ein Wagen mit einer Plane – und sie ist zugezogen, verstehst du? Was ist, wenn ihr die Planen zuzieht, eh? Los – antworte schon, wir haben keine fünf Minuten mehr! Du kennst alles, was mit der amerikanischen Armee zu tun hat. Was ist? Warum ist die Plane zugezogen?«
»Das muß ich erst sehen«, brummte Charlton. Er schloß sein Hemd, schob sich an die Kante und blickte unter den Buschzweigen durch nach Norden.
Der erste Wagen hatte einen Holzaufbau mit einem runden Dach – Charlton kannte diesen Wagentyp, weil er ihn selber gefahren hatte. Man transportierte bei der Armee entweder wichtige Schriftstücke oder eine Soldkasse in diesen Wagen. Auf dem zweiten Wagen, einem Flachkasten, waren zwei Sitzbänke auf jeder Seite, die insgesamt sechs Mann Platz boten. Die Männer saßen dort mit den Gewehren zwischen den Knien. Das war üblich bei einer Transportbegleitung. Der dritte Wagen erschien – seine Plane war geschlossen, und Charlton konnte die schwarzen Blockbuchstaben selbst auf diese Entfernung lesen – US Army!
»Siehst du ihn?«
»Ja«, sagte Charlton kurz. Er kniff die Lider zusammen und betrachtete die beiden Männer auf dem Bock. »Das ist weiter nichts!«
»Sagst du!« entfuhr es Garcia. Der schwere, breitschultrige Anführer der Bravados schlug in den Sand. »Und wenn es nun eine Falle ist? Was machen wir, wenn auf dem Wagen unter der verdammten Plane vielleicht noch zehn Mann sitzen und nur auf uns warten, he? Was ist, wenn dein Freund dich verraten hat?«
Einen Augenblick hatte Charlton ein komisches Gefühl, dann aber schüttelte er den Kopf.
»No«, erwiderte er bissig. »Das würde er nie wagen. Er weiß zu genau, daß er dann mit mir aufgehängt würde. Ich weiß zuviel von ihm.«
»Sie haben zweitausend Dollar auf deinen Kopf ausgeschrieben«, warnte Garcia finster. »Das ist viel Geld für einen Corporal. Und sein Freund ist Sergeant – der kann mit dem Geld aus der Armee ausscheiden und etwas anfangen.«
»Er kann mich nicht verraten. Außerdem weiß er nichts von euch, also – woher sollten es die da unten erfahren haben, Felice?«
Felice Garcia brummte etwas. »Und was kann im Wagen sein?«
»Weiß der Teufel! Vielleicht – Gewehre?«
»Gewehre?« schnaufte Garcia. »Diablo – wenn dort Gewehre wären, ah, das wäre gut! Und wenn doch Männer unter der Plane stecken?«
»Die wären längst erstickt bei der geschlossenen Plane, Felice.«
»Na gut«, brummte Garcia. »Also keine Männer, aber… der Teufel soll dich holen, wenn doch welche dort sitzen. Wir schießen sie alle tot, verstehst du?«
Charlton rutschte zurück und sah an Garcia vorbei.
»Ein Schuß fällt nicht weiter auf«, sagte er mürrisch. »Wenn du hier einen Krieg veranstaltest, Felice, wenn es ganze Salven gibt, deren Echo überall gehört wird, hast du bald Verfolger auf dem Hals. Außerdem… ich kenne ein paar der Burschen da unten!«
Garcia starrte ihn an. Er schüttelte verständnislos den Kopf.
»Ihr seid seltsame Menschen, ihr Gringos«, sagte er dann achselzuckend. »Ihr macht euch zuviel Gedanken. Wer tot ist, der ist tot, so ist das Leben, Amigo! Na gut, ich werde tun, was du vorgeschlagen hast – du kennst die Gringo-Armee besser als jeder von uns. Daß du dich nicht zeigst! Und du hältst deine neugierige Nase nicht über die Kante – verstanden, Maddalena?«
»Ich tue, was ich will, eh!«
»Katze!« zischte Garcia wütend. »Wenn du nicht meine Schwester wärst… Paß auf sie auf, Louis!«
Er kroch Über die Kante und war verschwunden. Charlton zog sich noch einmal empor und äugte nachdem Wagen. Er sah Lieutenant Ribben vor dem Wagen reiten. Der Abstand zwischen dem Lieutenant und den nächstfolgenden zwei Mann, einem Sergeant und einem Corporal, betrug etwa zwölf Schritt. Danach waren es noch einmal etwa zehn Schritt bis zum ersten Wagen.
»Louis, komm zurück, sie dürfen dich nicht sehen!« zischelte das Mädchen hinter ihm und zupfte an seinem Hosenbein. »Du bist stark, Louis – so stark!«
Er kroch zurück, sah mitten in ihre dunkelbraunen, fast schwarzen Augen und auf ihren lockenden, halbgeöffneten Mund. Sie schob sich wieder an ihn und legte den Kopf auf seinen Leib.
»Ich habe dir doch gesagt, daß dein Bruder kommen könnte«, brummelte Charlton. »So ein Wahnsinn, da unten werden sie vielleicht gleich alle sterben – und wir…«
»Und was ist, wenn wir sterben?« fragte sie leise und dunkel. Es war nichts Katzenhaftes mehr in ihrer Stimme, eher Schwermut und dunkle Vorahnung. »Dann werden wir wissen, daß wir noch einmal geliebt haben, ehe der Tod gekommen ist. Eines Tages werden wir sterben… beide… oder beide leben und reich sein. Eines Tages ist mein Bruder Gouverneur von Nuevo Leon. Er wird den Palast in Monterrey bewohnen, und ich werde seine Schwester sein – angesehen, reich… mit dir, mit meinem Mann… in Monterrey… Nuevo Leon!«
»Eines Tages«, sagte Charlton zögernd. »Ja… eines Tages… vielleicht…«
Dann schwieg er. Das Räderrollen näherte sich schnell. Die Wagen waren am letzten Hügel vorbei und fuhren nun auf die Senke zwischen den buschbestandenen Hügeln zu.
*
Felice Garcia hob das Gewehr sacht an. Seine Hand strich über den Kolben der Waffe, ehe er ihn an die Schulter setzte. Es war ein Dreyse-Gewehr – eine stark ziselierte und an den Holzteilen beschnitzte Waffe. Das Gewehr hatte jahrelang im Gewehrschrank von Garcias Vater gestanden – und es war neben dem Revolver die einzige Waffe, die Felice Garcia gerettet hatte. In Garcias Augen tauchte eine sengende Flamme auf wie jedesmal, wenn er das Gewehr in die Hand nahm. Das Gewehr seines Vaters, seine Lieblingswaffe…
Tot, dachte Garcia, alle tot. Ich werde sie umbringen… alle!
Die Erinnerung überflutete ihn wie ein Fieberanfall. Er schloß einen Moment die Augen und sah die brennende Hazienda vor sich, die stillen Gestalten in ihren Blutlachen auf dem Hof – Tote mit abgeschlagenen Köpfen, die Machetenhiebe abgetrennt hatten.
Sie müssen dafür büßen, dachte Garcia voller Haß und Rachsucht. Eines Tages wird wieder ein Garcia Gouverneur von Nuevo Leon sein wie früher!
Sein Vater war es gewesen – jahrelang, bis Mexiko einen Kaiser bekam und man dem alten Garcia nicht traute, weil er nie offen Partei ergriffen hatte. Man hatte ihn zuerst abgesetzt, einen Teil seiner Güter eingezogen, danach das Geld beschlagnahmt, damit er nicht etwa die Rebellen unter Benito Juarez unterstützen konnte.
»Abwarten!« hatte der Alte gesagt. »Nur nicht Partei nehmen, mein Sohn! Fahr nach San Luis Potosi, rede mit dem kaiserlichen General, versichere ihm, daß wir seine treuen Diener sind, aber sprich für dich mehr als für mich! Wir brauchen unser Geld, unseren Besitz. Warten wir ab, wer den Kampf gewinnt! Vielleicht halten sich die kaiserlichen Truppen, vielleicht siegt Juarez. Man muß auf beiden Schultern tragen in dieser Zeit…«
Beide Schultern, dachte Garcia. Sein Mund verzog sich zu einem schmalen, bitteren Strich – das hat er davon gehabt! Den Kopf haben sie ihm abgeschlagen!
Er spürte den Druck des Gewehrkolbens an der Schulter und öffnete wieder die Augen. Die Wagen kamen näher, es wurde Zeit. Und doch blieb ihm noch Raum für seine letzten Gedanken an jenen Tag in San Luis Potosi, als der kaiserliche General ihn angegrinst hatte, Spott in den Schlitzaugen.
»Was wollen Sie denn, Don Garcia. Wenn ihr Garcias wirklich für uns seid, dann habt ihr uns mit eurem Geld unterstützt, richtig? Das wäre doch eure Pflicht gewesen. Also, was soll es, Don Garcia? So oder so – das Geld wäre in unsere Kriegskasse gewandert. Ihr seid immer noch reich genug, habt beinahe hundert Peones – hundert Knechte, Don Garcia! Sagen Sie Ihrem Vater, er möchte selber kommen – so krank wird er schon nicht sein. Ein Garcia auf unserer Seite kann viel nützen – sagen Sie ihm das! Aber das Geld? Tut mir leid, Don Garcia, das Geld ist längst verbraucht. Eine Armee kostet viel…«
»Der Hund!« sagte Garcia zwischen den Zähnen und blickte auf die dichten Buschzweige. »Dieser gerissene Hund!«
Nach Hause gefahren, Grimm in der Brust, dachte Garcia, erfolglose Mission in San Luis Potosi, keine gute Nachricht für meinen Vater. Er hat die schlechte Nachricht nie mehr erfahren, wie? Als ich nach Hause kam mit meinen zehn Begleitern, da brannte alles. Die Juaristas hatten erfahren, daß ich nach San Luis gefahren war und sich ausgerechnet, was ich dort für uns erreichen wollte. Sie kamen auf die Hazienda, steckten sie an, holten meinen Vater und die Mutter heraus, die Hausdiener… und brachten sie alle bestialisch um. Sie nahmen Maddalena mit, dieser Kerl, dieser Teufel Gomez, ihr Anführer, dieser dreckige Indianer: Er nahm sie mit; er zwang sie, mit ihm zu schlafen. Das Schwein…
Garcia zitterte plötzlich heftig. Die Ehre einer Garcia besudelt, den Namen befleckt – diese Schande! In Mexiko brauchte man ein Mädchen nur zu belästigen, um dem Bruder oder Vater einen Grund zu geben, zum Revolver zu greifen. Garcia hatte nicht zum Revolver gegriffen – Garcia hatte sich Männer beschafft mit jenem Geld, das die Garcias aus Vorsicht und aus bösen Vorahnungen versteckt hatten. Männer – Waffen! Und danach hatte er Gomez bis in die Sierra della Iguana verfolgt, hatte ihn gesucht, gefunden, als Gomez in der Nähe von Lampazos nur mit einer Handvoll Männer und Maddalena einige Tage Ruhe einlegte.
Die Ameisen, dachte Garcia – sein Mund zuckte in der Erinnerung, die Lippen bebten – ich habe ihn den roten Ameisen gegeben. Wie er schrie, der Hund!
Die roten Ameisen hatten Gomez gefressen, bis nur noch sein Knochengerüst übrig war. Maddalena hatte er mitgenommen – eine andere Maddalena, eine völlig veränderte Schwester, nicht mehr die Unschuld von früher, eher eine Wildkatze, kaltblütig, scharfzüngig… eine Tigerin, die Männer verachtete, bis dieser Gringo gekommen war: dieser blonde, große Amerikaner. Sie fragte ihren Bruder nicht mal mehr, ob sie den blonden Amerikaner lieben durfte, sie nahm ihn sich, fertig!
Garcia richtete sich langsam auf. Die dichten, belaubten Buschzweige waren vor ihm – eine staubgraue, dichte Mauer. Der Hufschlag tackte heran und kam regelmäßig näher.
Felice Garcias Mund preßte sich zusammen, er dachte nicht mehr an seine Vergangenheit, nur noch an die Zukunft. Links von Garcia raschelte es einmal, als krieche eine Schlange durch das verfilzte Unterholz. Danach war alles still, aber Garcia wußte, daß sie alle bereit waren – sechsundzwanzig verwegene, wilde Bravados, die nur auf seine Befehle hörten.
Der Gewehrlauf schob sich langsam in die Zweige.
Dreißig Schritte, dachte Garcia, fünfundzwanzig… zwanzig… Und dann schnellte er jäh in die Höhe.
Garcia sah den Mann vor sich, das dunkelbraune Armeepferd mit der weißen Blesse. Garcia blickte über den Lauf des Dreyse, sah die Knöpfe der Uniformjacke blinken, das blaue Tuch…
*
Der Mann auf dem Pferd nahm den Kopf herum, als die Bewegung links vor ihm den Busch jäh zu spalten schien.
Aus der Mündung des Dreyse fauchte eine Feuerlanze. Die Kugel kam mit trockenem, wildem Hieb und traf den Mann mitten in der Brust.
Der Fahrer des ersten Wagens sah, wie der Busch unmittelbar neben seinem Bock sich jäh teilte und eine Gestalt heraussprang.
Greaser, dachte Falcon, der Fahrer, entsetzt – Mexikaner! Wo, zum Teufel, kommen diese Halunken her?
Danach hörte er den Schrei hinten – das knallende Wummern des nächsten Schusses, dem ein erstickter, gurgelnder Laut folgte. Falcon sah sie jetzt wie eine Menge Erdhörnchen, die plötzlich aus ihren Erdhöhlen auftauchten.
»Hände hoch!«
Neben ihm tat der Greaser einen Sprung und stieß ihm das Gewehr zwischen die Rippen.
»Du… schnell!« schrie der Greaser, dessen Gesicht mit den hervortretenden Wangenknochen und den Schlitzaugen Falcon an die Fratze eines wilden Mongolen erinnerte.
Unwillkürlich zuckte Falcons Blick zu der anderen Seite hinüber, traf den Posten, der neben ihm saß, fuhr an diesem vorbei…
Falcon sah sie drüben stehen, sechs – sieben der sogar zehn Greaser, die Gewehre im Anschlag. Während Falcon die Arme hob, traf sein Blick den Sergeanten. Er sah Bloomes Gesicht nicht, aber Bloomes Nacken. Und der war weiß wie Schlämmkreide.