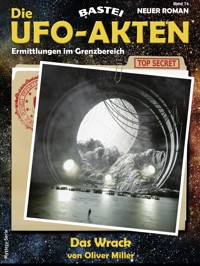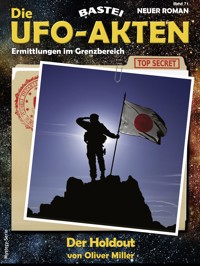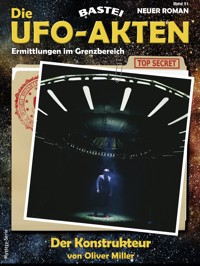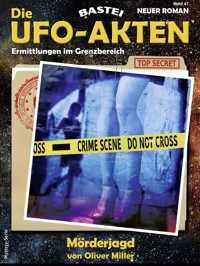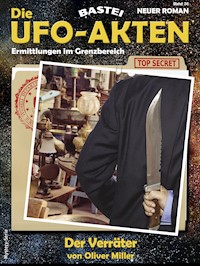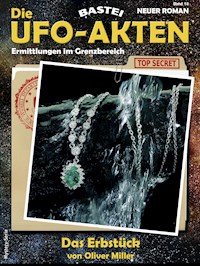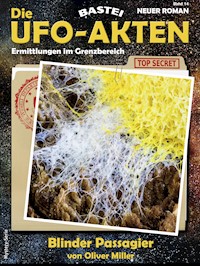Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Als der Geschichts-Professor Michael Baumann von den Schwestern eines katholischen Nonnen-Ordens um Hilfe gebeten wird, hält er ihr Anliegen zunächst für einen schlechten Scherz: Bei Abrissarbeiten eines alten Klosters in der Nähe von Venedig begann einer der dortigen Bäume offensichtlich an zu bluten. Schließlich willigt der Historiker in eine Untersuchung des Falles ein und reist mit einem seiner studentischen Mitarbeiter nach Santi Angeli, um vor Ort das mysteriöse Geschehen zu überprüfen. Vor Ort stellt sich schnell heraus, dass den Baum ein Rätsel umgibt, das bis in die Zeit der Kreuzigung Jesu zurückreicht und seine Wurzeln in dessen Jüngerschaft hat. Doch Baumann ist nicht der einzige, der darauf aufmerksam geworden ist und bald findet er sich in einer Hetz-Jagd wieder, die ihn auf den Spuren des Judas um die Erde führt – seine Verfolger aus höchsten Kirchenkreisen sind ihm dabei immer auf den Fersen …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 325
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
In dieser Reihe bisher erschienen:
7001 Stefan Melneczuk Marterpfahl
7002 Frank W. Haubold Die Kinder der Schattenstadt
7003 Jens Lossau Dunkle Nordsee
7004 Alfred Wallon Endstation
7005 Angelika Schröder Böses Karma
7006 Guido Billig Der Plan Gottes
7007 Olaf Kemmler Die Stimme einer Toten
7008 Martin Barkawitz Kehrwieder
7009 Stefan Melneczuk Rabenstadt
7010 Wayne Allen Sallee Der Erlöser von Chicago
7011 Uwe Schwartzer Das Konzept
7012 Stefan Melneczuk Wallenstein
7013 Alex Mann Sicilia Nuova
7014 Julia A. Jorges Glutsommer
7015 Nils Noir Dead Dolls
7016 Ralph G. Kretschmann Tod aus der Vergangenheit
7017 Ralph G. Kretschmann Aus der Zeit gerissen
7018 Ralph G. Kretschmann Vergiftetes Blut
7019 Markus Müller-Hahnefeld Lovetube
7020 Nils Noir Dark Dudes
7021 Andreas Zwengel Nützliche Idioten
7022 Astrid Pfister Bücherleben
7023 Alfred Wallon Der Sohn des Piratenkapitäns
7024 Mort Castle Fremde
7025 Manuela Schneider Die Waffe des Teufels
7026 Rudolph Kremer Die Turmkammer der schreienden Alraune
7027 Alfred Wallon Heimtückische Intriegen
7028 Marco Theiss Ein Texaner gegen Chicago
7029 Uwe Niemann Das unreine Herz
7030 Nils Noir Damn Evil
7031 Rudolph Kremer Die Höhle des blauen Drachen
7032 Wolfgang Rauh Ignael
7033 G.S. Foster Das Grauen von Cape De Ville
7034 Michael Tillmann Jenseits des Zeitgeistes lauern Gespenster
7035 Rudolph Kremer Die Kirche des gehörnten Küsters
7036 Oliver Miller Der blutende Baum
7037 Slim Shannon Jerry Stanton - Tödliches Chamäleon
7038 Axel Kruse Lvdowigvs von Lüttelnau
7039 Florian Reszner Lasst mich ein, ihr Kinder
7040Vincenzo Nero Etriaa - Der König unter den Bettlern
Der blutende Baum
Oliver Miller
Dieses Buch gehört zu unseren exklusiven Sammler-Editionen
und ist nur unter www.BLITZ-Verlag.de versandkostenfrei erhältlich.
In unserem Shop ist dieser Roman auch als E-Book lieferbar.
Bei einer automatischen Belieferung gewähren wir Serien-Subskriptionsrabatt. Alle E-Books und Hörbücher sind zudem über alle bekannten Portale zu beziehen.
* * *
Copyright © 2025 Blitz Verlag, eine Marke der Silberscore Beteiligungs GmbH, Andreas-Hofer-Straße 44 • 6020 Innsbruck - Österreich
Redaktion: Danny Winter
Grafik & Umschlaggestaltung: Mario Heyer unter Verwendung der KI Software Midjourney
Satz: Gero Reimer
Alle Rechte vorbehalten.
www.blitz-verlag.de
ISBN: 978-3-68984-547-6
7036 vom 05.10.2025
Inhalt
Teil I
Prolog
Kapitel 1
Zwischenspiel
Kapitel 2
Zwischenspiel
Kapitel 3
Zwischenspiel
Kapitel 4
Zwischenspiel
Kapitel 5
Teil II
Kapitel 6
Kapitel 7
Zwischenspiel
Kapitel 8
Zwischenspiel
Kapitel 9
Zwischenspiel
Kapitel 10
Teil III
Kapitel 11
Kapitel 12
Zwischenspiel
Kapitel 13
Zwischenspiel
Kapitel 14
Finale
Epilog
Nachtrag
TeilEins
Prolog
In der Nähe von Venedig – August 1638
Giacomo schwitze. Es war ein unglaublich heißer Nachmittag, selbst für die regionalen Klimaverhältnisse. Die gleißende Sonne brannte erbarmungslos auf ihn herab. Mit seinen kastanienbraunen Augen sah er müde zu der kleinen Kirche hinüber. Sie hatte in dieser Nacht schwer gelitten: Gegen Mitternacht war ein Erdstoß durch das Land gerollt – ein Beben von der Stärke, wie es Giacomo in seinem Leben hier noch nicht erlebt hatte. Und er lebte immerhin schon über vierzig Jahre in dieser Region. Es musste ein Zeichen Gottes sein, dachte er immer wieder – böse Zeiten würden kommen. Er wischte sich den Schweiß von der Stirn ...
Sein Vater war ein reicher Landbesitzer von niedrigem Adel gewesen, daher war Giacomo behütet und vergleichsweise sorgenfrei aufgewachsen. Das Latifundium warf gute Erträge ab, sein Vater handelte sogar in Venedig. Doch Giacomo selbst war für Landwirtschaft und Handel nicht gemacht. Sein älterer Bruder Pedro hatte dafür ein Händchen, schon als Jugendlicher erfasste er die Vorgänge auf dem Gut und wollte sie optimieren. So war es neben dem traditionellen Erbrecht auch rein praktisch die beste Entscheidung, dass Pedro nach dem Tod des Vaters den Hof erbte. Doch Giacomo blieb das Sorgenkind. Seine Eltern gaben ihn schließlich zunächst in eine Klosterschule, wo er mehr recht als schlecht lesen und schreiben lernte, danach schickten sie ihn zur Priesterausbildung. Diese zahlte noch sein Vater mit teuer Geld, sodass zumindest seine Weihe sicher war.
Als der alte Pfarrer dieser Kirche hier schließlich starb, wurde Giacomo hierher geschickt: in eine winzige Gemeinde, in eine winzige, marode Kirche, um dort Gottes Wort zu verbreiten.
Giacomo wusste, dass er kein kluger Mann war, und so ergab er sich in sein Schicksal und zog in eine windschiefe Kate neben dem eigentlichen Gotteshaus – das war vor über fünfzehn Jahren gewesen.
Seitdem bestand sein Leben aus den Gottesdiensten vor etwa zwei Dutzend Gemeindemitgliedern, dem gelegentlichen Unterricht der Dorfkinder, die nie mehr als eine Handvoll waren, und dem katholischen Trott der Tauf-, Ehe- und Sterbesakramente. Dazwischen quälte er sich mit dem nahezu gigantischen Gelände um die Kirche ab, um dem Boden ein paar Früchte abzuringen, doch, er musste es immer mehr einsehen, von Ackerbau verstand er nichts. So lebte er neben dem geringen Salär der Kirche von Essensgaben der Gemeinde, der er immerhin als ein geistiges Oberhaupt vorstand, und den Zuwendungen seines Bruders Pedro. Es war ein einfaches, hartes Leben, aber Giacomo war zufrieden.
Doch diese Nacht hatte ihn wieder einmal zurückgeworfen. Es würde Monate dauern, bis er die Schäden an der Kirche ausgebessert hatte, und auch das war nur eine vorsichtige Schätzung, falls keine Nachbeben kommen sollten.
Zunächst hatte er damit begonnen, die vom Dach gefallenen Lehmschindeln einzusammeln – aber es waren viele Schindeln und die meisten waren zersprungen. Er fuhr sich mit der rechten Hand durch das verschwitzte, lichter werdende braune Haar: Er würde wohl wieder die wenigen gut betuchten Gutsbesitzer seiner Gemeinde, zu denen auch sein eigener Bruder zählte, zu einer Spende für das Gotteshaus bitten müssen.
„Es musste eine Gottesstrafe sein ...“, murmelte er.
Im Moment brauchte er aber dringend etwas zu trinken, der Wasservorrat der Nacht war aufgebraucht und so schritt er zu dem Brunnen, der unweit der Kirche in den Boden geschachtet worden war. Er rieb seine Hände kurz an dem weißen, tunikaartigen Leinenhemd ab und ließ den Holzeimer hinunter in die Tiefe.
Überrascht stellte er fest, dass der Eimer nicht auf eine Wasserfläche traf, sondern am Ende des Seils frei schwang. Er beugte sich über den Schachtrand und sah in die dunkle Tiefe. Die praktisch senkrecht stehende Sonne reichte aus, um ihn erkennen zu lassen, dass der Brunnen kein Wasser mehr enthielt – stattdessen klaffte an einem Rand des Schachtes ein breiter Riss, durch welchen Erdreich eingebrochen waren. Verdammtes Beben, schoss es Giacomo durch den Sinn. Er beugte sich weiter über den Rand, verlor beinahe den Halt und sah im Halbdunkel einen kleinen, steinernen Absatz in der Schachtwand, etwa in Mannshöhe unter dem Rand angebracht.
Giacomo wunderte sich. Warum sollte ein Brunnenbauer dort einen Absatz einrichten? So griff er das Seil des Brunnens, schlang das eine Ende um den nächsten Baum und ließ sich daran zu dem Absatz hinab. Die steinerne Stufe war definitiv Menschenwerk und nicht durch eine Erdreichverschiebung entstanden.
Kaum begann Giacomo sich umzusehen, bemerkte er auf seiner rechten Seite, etwa in Höhe seines Arms, im Mauerwerk eine eiserne Klappe, etwa von der Größe eines Buches. Der einfache Riegel war zwar verrostet, ließ sich aber mit Mühe öffnen. Mit einem quietschend-knarzenden Geräusch öffnete Giacomo die kleine Tür – immer darauf bedacht, nicht den Halt zu verlieren.
Was konnte hier nur versteckt sein, fragte er sich. Tastend zog er eine kleine hölzerne Kiste hervor. Das Holz war unberührt von Feuchtigkeit, und Giacomo konnte, ohne sie gesehen zu haben, nur anhand des Fingertastens sagen, dass das Material von erlesener Qualität war. Mühevoll klemmte Giacomo sich das Kästchen unter den Arm und schwang sich nach oben ins Tageslicht.
Aufgeregt, mit zitternden Fingern, öffnete er noch am Rande des Brunnens das Kästchen. Seine Erwartungen waren hoch – mochte doch jemand an einem solchen Ort nur wirkliche Schätze verstecken, dachte er.
Doch in sein Gesicht kehrte Enttäuschung ein, als er den Inhalt sah. Giacomo ließ sich auf den Boden fallen und seufzte: Es war definitiv kein guter Tag.
Beinahe hätte er den kleinen vergilbten Umschlag übersehen, der ebenfalls in dem Kästchen war. Das Papier war alt, aber trocken. Er brach das Siegel und begann die wenigen Zeilen zu lesen. Obwohl die Handschrift klar und sauber war, brauchte er lange, um den Inhalt zu entziffern – Giacomo war nicht der beste Leser. Als er geendet hatte, betrachtete er das gebrochene Siegel erneut und verglich es mit der Unterschrift unter dem Dokument. Er griff noch mal in das Kästchen und fühlte einen harten, schweren Gegenstand. Giacomo begann zu lächeln, er hatte zwar keinen Schatz gefunden, aber zumindest ein Geheimnis gelüftet.
KapitelEins
Professor Michael Baumann hatte schlechte Laune – wobei er nicht einmal genau erklären konnte, was ihn so störte. Die vorlesungsfreie Zeit hatte an der Universität in Kassel vor knapp drei Wochen begonnen, die letzten Tage hatte er mit seiner Tochter verbracht, der Sommer zeigte sich von seiner besten Seite und im historischen Seminar war er jetzt, nachdem die letzten Studenten ihre Klausuren abgelegt hatten, mehr oder weniger ungestört, sodass er seit mehreren Stunden an seinem Schreibtisch saß, vor seinem PC lümmelte und eine Tasse Kaffee nach der anderen trank.
Dabei musste er natürlich zugeben, dass der Besuch von Clara nicht unbedingt stressfrei gewesen war – immerhin war sie gerade sechzehn Jahre alt und in einer Art Findungsphase, wie es seine Ex-Frau so schön genannt hatte. Das bedeutete schlicht, dass sie am ersten Abend sehr intensiv ihren Berufswunsch Influencer diskutiert hatten, am zweiten hatten sie gestritten bezüglich ihres aktuellen Freundes, der, wie Baumann meinte, ihr nicht unbedingt zuträglich war: Der junge Mann war Mitte zwanzig und Betreiber eines Fitnessstudios, was an sich nicht schlimm gewesen wäre, doch seine sonstige Lebensführung und generelle Auffassung ließen einem Vater die Haare zu Berge stehen. Sein Puls beschleunigte sich allein von dem Gedanken an das Foto, das ihm das Töchterlein gezeigt hatte. Viel war von dem Gesicht des Lebensabschnittsgefährten nicht zu sehen gewesen – den Tattoos sei Dank. Überhaupt, was sagte dazu eigentlich ihre Mutter, dachte Baumann ärgerlich. Wegen jedem kleinen Problem wurde er telefonisch zurate gezogen, beziehungsweise ihm Vorwürfe gemacht, doch wenn seine Tochter einen Kerl mit nach Hause brachte, der zumindest ein wenig ans Rotlichtmilieu erinnerte, dann schwieg man? Tief in seinem Inneren ahnte er die bittere Wahrheit: Seine geschiedene Frau wusste nichts von ihrem Traum-Schwiegersohn in spe. Das machte ihn noch wütender, denn er war von nun an Mitwisser, und ein solches exklusives Geheimnis wurde garantiert zu einer riesigen Falle für ihn.
Am letzten Abend schließlich hatten sie sich Pizza bestellt und versöhnt miteinander gegessen.
Er war immer glücklich, Clara zu sehen – seit der Scheidung vor fast acht Jahren war es ein beständiger Kampf um diese Gelegenheiten gewesen.
Nicht, dass seine Ex-Frau den Kontakt unterbinden wollte, nein, so schmutzig war die Trennung nun wirklich nicht gewesen, es lag vielmehr einerseits an der Entfernung zu ihrem neuen Wohnort in der Nähe von Hamburg, andererseits an der weiterhin hohen beruflichen Belastung beider Elternteile.
Doch auch das vermeintlich schöne Wetter war für ihn eine Spur zu warm – er strich sich über das leicht angeschwitzte Hemd, welches über seinem Bauch etwas spannte – noch so ein Problem, das Baumann ärgerte.
Das Junggesellenleben tat ihm nicht gut. Das ungesunde Essen, das Glas Rotwein und die fehlende Bewegung begannen sich nun langsam zu rächen, vor allem, wenn man wie er Anfang fünfzig war.
Generell fragte er sich in seiner etwas nöligen Stimmung, was er überhaupt in seinem Büro sollte. Die mündlichen Prüfungen waren noch nicht angelaufen, Hausarbeiten und Klausuren konnten noch warten und größere Forschungsprojekte standen für ihn schon länger nicht mehr an. Beim Gedanken daran verfinsterte sich seine Stimmung weiter.
Noch so ein Problemfeld, das sich vor ihm auftat: der berühmte Knick in der Karriere. Doch den hatte er bereits schon länger hinter sich gelassen – Baumann musste über seinen eigenen Witz schmunzeln, wobei ein wenig Wehmut darin lag. Als Clara auf die Welt kam, hatte er kurz vor der Habilitierung in Alter Geschichte gestanden, hatte eine blendende akademische Laufbahn bis dahin hingelegt: Abschlüsse mit Auszeichnung, Einladungen zu den hochrangigsten Tagungen im europäischen Bereich – Vorträge und wissenschaftliche Veröffentlichung hatten ihn vor sich hergetrieben. Die Professur in Kassel sollte dabei nur der Ausgangspunkt einer glänzenden Karriere werden ... Doch dann war irgendwie alles anders gekommen.
Er war so von Ehrgeiz und Erfolg betrunken gewesen, dass er weder die Bedürfnisse seiner Frau noch seines damals neugeborenen Kindes wirklich wahrgenommen hatte – als Elisa dann für sich beschloss, genug zurückgesteckt zu haben, und in ihrem Anwalts-Beruf wieder erfolgreich eingestiegen war, geriet diese Welt ins Wanken. Clara war damals fünf oder sechs gewesen – er wusste es nicht mehr genau. Sein Alltag veränderte sich grundlegend: Wenn er nach Hause kam, saß seine Frau am Schreibtisch oder war im Büro – Clara wurde nur allzu oft einfach wegorganisiert. Elisa sah er praktisch gar nicht mehr. Das Schlimmste war dabei, dass es ihm nicht einmal richtig auffiel.
Irgendwann kam er nach einem Tagungswochenende in Salzburg nach Hause und sie war nicht mehr da. Drei Tage vor Claras achten Geburtstag. Er hatte ihr noch ein Geschenk in Salzburg besorgt ... Nun waren beide weg. Ohne Streit und ohne ein Wort des Abschieds. Es gab auch keinen anderen Mann – nein, sie sagte später bei ihrer Scheidung, dass es für sie an dem Punkt egal gewesen war, ob sie noch zusammen oder alleine lebte, da er ja sowieso nie da war.
Die Monate danach waren schwer gewesen für Baumann, und im Grunde wusste er, dass er sich davon nie mehr richtig erholt hatte. Ihm war vieles gleichgültig geworden und er brauchte Jahre, um aus dem Loch des Selbstmitleids heraus zu kommen. Der Alltag lief zwar weiter, aber er funktionierte lediglich – zurückgezogen in seine neue kleine Dachgeschosswohnung. Die Scheidung war zwar sauber gelaufen, kein Kampf ums Geld, keine Hässlichkeiten, dennoch war er in sich zusammengefallen. Die Plötzlichkeit des für ihn so unvorhergesehenen Eheendes hatte ihn lange beschäftigt und zum Nachdenken über seine Fehler gezwungen. Diese hatte er schlussendlich zwar erkannt und reflektiert, doch dies hatte viel Zeit gekostet – Zeit, in der das Leben irgendwie so nebenherlief und er emotionslos die Tage abarbeitete und hinter sich brachte. Seine Karriere war somit vorbei gewesen – er machte seinen Job, doch es fehlte an Kraft und Motivation für die für ihn vorher so wichtigen höheren Weihen.
Mittlerweile hatte er sich wieder stabilisiert – der Kontakt zu Clara war zwar ausbaufähig, aber regelmäßig, seine Professur in Kassel war unbefristet, also sicher, und auch er selbst begann wieder, positiver in die Zukunft zu sehen. Doch die Spuren waren unübersehbar – etwa der deutliche Bauchansatz und das graue, schütter werdende Haar.
Er nahm einen Schluck aus der Kaffeetasse und verzog angewidert das Gesicht. Der Institutskaffee wurde auch nach der dritten Tasse nicht besser.
Er hatte das Gefühl, dass die Temperatur in seinem Büro weiterhin zunahm – der winzige Raum, der gerade einmal knappe zehn Quadratmeter maß, war an drei Seiten mit billigen Aluminium-Büro-Regalen ausgekleidet, die mit Büchern, Aktenordnern und losen Zetteln überquollen. Auf dem abgewetzten Linoleumboden lag ein abgewetzter Teppich. Vor der einen Seite, in der ein großes Fenster eingelassen war, stand Baumanns Schreibtisch, der von Papieren bedeckt war.
Das laute Klopfen an der alten Holztüre schreckte Baumann aus seinen Gedanken, sodass er die Herein-Antwort grummeliger von sich gab, als er eigentlich wollte.
Seine Sekretärin, eine kleine drahtige Frau, betrat sein Büro, verzog ob des Geruchs ihre Miene, suchte demonstrativ einen freien Platz auf dem zugemüllten Schreibtisch und legte einen Stapel Post auf den Tisch.
„Professor, ich gehe dann in die Pause – bedenken Sie Ihren Termin in einer halben Stunde!“
Baumann grunzte, ohne sich vom PC abzuwenden „Diese italienische Studentin? Ich habe ihren Namen in meinem Online-Kalender gesehen. Wer ist das eigentlich? Der Name sagt mir aus meinen Seminaren rein gar nichts?“
Sie sah ihn überrascht an: „Das ist keine Studentin, sie hat sich am Telefon als Ordensschwester vorgestellt.“
Baumann fuhr hoch: „Eine Ordensschwester? Eine Nonne? Was möchte die denn von mir?“
„Keine Ahnung, Professor, der Termin kam vorgestern recht kurzfristig rein.“ Sie schenkte ihm ihr bestes Vorzimmer-Drachen-Lächeln. „Ich lasse die Tür auf, dann sehen Sie sie gleich, wenn sie kommt.“ Mit diesen Worten verschwand sie aus dem Büro und ließ Baumann zurück, dessen Laune sich weiter verschlechterte.
* * *
Konstantins Schädel pochte dumpf. Es war ein fürchterlicher Morgen gewesen – der berühmte Morgen danach. Er war gestern auf einer Party der Sportfachschaft gewesen – nicht, dass er selbst Sport studiert hätte, er war mit Deutsch und Geschichte auf Lehramt vollauf ausgelastet, aber dort waren immer die hübschesten Studentinnen zugegen.
Die Frau fürs Leben hatte er gestern erwartungsgemäß nicht getroffen, dafür jede Menge seiner Kommilitonen, die alle von derselben Idee dort hingelockt worden waren. Der Abend endete somit in einem Beinahe-Totalabsturz, dessen Auswirkungen sich nun bis in den Mittag des Folgetages zogen.
Er konnte den Bestellungen der Gäste nur mit Mühe folgen: Wo er sich häufig alles einfach merkte, notierte er an diesem Tag alles in seiner krakeligen Schrift auf dem Notizblock. Es war zwar nur eine kleine Studentenkneipe, aber den Rüffel seines Chefs wollte er trotzdem umgehen. Doch die Hitze machte ihm zunehmend zu schaffen. Die Kellnerschürze klebte an seinen Beinen und er sehnte sich nach einer Pause. Die Mittagsschicht war normalerweise eine reine Gammel-Arbeitszeit, da die Studentenkneipe nur einen sehr überschaubaren Mittagstisch anbot. Was er leider nicht im Blick hatte, war, dass heute in einem Institut wohl Klausurtag gewesen war, und so strömten nun dutzende Studierende ausgehungert auf den Campusbereich. Seine letzte Hoffnung auf die Zentralmensa bewahrheitete sich nur teilweise: Die Kneipe war gerammelt voll und er weitgehend allein. Konstantin wischte sich durch sein verschwitztes, halblanges Haar, das zwar blond war, aber wenn es feucht wurde einen leicht rötlichen Einschlag bekam.
Er wankte ein wenig zum Tresen zurück, wo ihm einer der Wirte gerade ein Tablett mit Getränken zusammenstellte.
„Mensch, Konni, bist ganz schön blass um die Nase heute ...“, grummelte dieser.
Konstantin warf dem kleinen untersetzten Mann mit dem Dobermanngesicht einen um Mitleid heischenden Blick zu. „Hatte einen bösen Abend gestern“, murmelte er und nahm das Tablett.
„Na ja, wenn man es nicht verträgt, sollte man es lassen.“ Der Wirt lachte dröhnend, während er Konstantin hinterher sah.
Dieser versuchte sich nur darauf zu konzentrieren, die Getränke heil an ihren Bestimmungsort zu bringen – er musste noch knappe zwei Stunden durchhalten.
Er hatte dabei insofern Glück, als dass er heute keine weiteren Aufgaben vor sich hatte, also auch nicht in seiner Tätigkeit als Mitarbeiter des Seminars für Alte Geschichte unter Professor Baumann. Die beiden Jobs brauchte er zwar dringend, um irgendwie über die Runden zu kommen, aber er war wahrlich nicht böse, wenn es mal etwas lockerere Tage gab. Gerade heute war jede Pause wichtig.
Und so stellte er die Getränke an den Tisch, setzte sein freundlichstes Kellnerlächeln auf, zählte dabei jedoch in seinem pochenden Kopf die Minuten rückwärts bis zum Schichtende.
* * *
Verzweifelt strich Baumann sein verschwitztes und zerknittertes Hemd zurecht und murmelte dabei eine Menge Flüche – bei einem der Studierenden wäre ihm sein Aussehen zwar nicht egal, aber doch nicht als entscheidend vorgekommen, aber bei einem externen Besucher wollte er nicht unbedingt einen verlotterten Ersteindruck hinterlassen.
Warum hatte er sich nicht schon früher über den unbekannten Namen erkundigt, grummelte er in sich hinein. Das alles war nun mehr als ärgerlich. Mit einem tiefen Seufzer versuchte er, sich selbst ein wenig zu beruhigen, griff zu der eben eingeschenkten Tasse Kaffee und nahm einen großen Schluck daraus.
Eine Ordensschwester also, begann er zu überlegen. Was konnte die wohl von ihm wollen. Nicht, dass ihn der Umstand einer Nonne sonderlich beeindruckte – sein Leben war geprägt gewesen von katholischen Institutionen und Erziehung. Er war in Köln auf eine ursulinische Privatschule gegangen und hatte dort Abitur gemacht – geleitet und unterrichtet von Nonnen. Über jene Zeit konnte er absolut nichts Schlechtes berichten, sodass er auch nach dem Ende seiner Schullaufbahn Kontakt zu der Schule und dem Ursulinenorden gehalten hatte. Über die Jahre war eine Freundschaft entstanden, die ihm so manch tiefen Einblick in die Organisationsstruktur des weltweit agierenden Ordens gewährt hatte. Jaja, diese katholischen Seilschaften konnten ein Leben lang halten, lächelte er. Ein paar Mal, vor allem zu Studentenzeiten, hatte er kleinere bezahlte Aufgaben im Ordensarchiv in Köln ausgeführt und seit seiner Zeit hier an der Universität tauschte man ab und an E-Mails aus oder er war vor einigen Jahren einmal zu Besuch hingefahren: Aber niemals war jemand vom Orden zu ihm gekommen. Mittlerweile war das Kloster, ähnlich wie viele andere, auch überaltert – sodass es langsam, aber sicher ausstarb.
* * *
„Professor Baumann, ich weiß, ich bin zu früh. Ich hoffe, ich störe nicht“, erklang eine angenehme Stimme mit einem deutlichen italienischen Einschlag.
Baumann unterbrach hektisch seine Restaurationen und ging nahtlos dazu über, die eintretende Person verwundert anzustarren.
„Haben Sie mit etwas anderem gerechnet?“, sprach die Ordensschwester mit einem ironischen Unterton.
„Vielleicht ein wenig ...“, brachte Baumann heraus, der sich nur langsam fing.
„Professor, nicht jede Nonne ist automatisch alt.“
Er grinste etwas verlegen – ihm gegenüber nahm die Frau in Ordenstracht Platz, die vielleicht Anfang dreißig sein mochte, mittelgroß war und das Aussehen einer jungen, hübschen italienischen Studentin besaß. Ihre braunen Augen blitzten ihn belustigt an, das schwarze Haar war unter ihrer Haube zur Gänze bedeckt.
„Auf meiner früheren Ordensschule schon“, erwähnte er und bot ihr etwas zu trinken an, was sie mit einem Nicken bejahte.
„Schwester Monica, was genau kann ich für Sie tun – was führt Sie zu mir?“, eröffnete er das Gespräch, nachdem er zwei Tassen mit Kaffee gefüllt hatte.
„Professor, wir haben mit Schwester Griseldis eine gemeinsame Bekannte.“
Er nickte, während er in seinem Gedächtnis nach einem Bild der Dame suchte.
„Ja, sie war meine Direktorin, als ich in Köln auf die Ordensschule der Ursulinen gegangen bin.“
„Sie wissen, dass Schwester Griseldis in unserem Orden, sagen wir, einen gewissen Bekanntheitsgrad hat.“
Er schmunzelte und ergänzte gedanklich: Nennen wir es mächtig und einflussreich.
„Ja, das weiß ich – ich halte seit meiner Schulzeit zu ihr Kontakt. Sie müsste mittlerweile fast neunzig Jahre alt sein ...“
Monica lächelte. „Sie ist dieses Jahr sechsundachtzig geworden und erfreut sich bester Gesundheit. Aber das ist nicht der Grund meines Besuchs. Wir haben bei unserem Konvent in der Nähe von Venedig ein kleines Problem und Sie wurden uns von Schwester Griseldis gewissermaßen empfohlen.“
Baumann stutzte: „Ein Problem? Sie wissen hoffentlich, dass ich Professor für Alte Geschichte bin, mehr auch nicht.“
„Ja, das ist uns klar – aber es könnte in Ihren Bereich fallen.“
Er wurde langsam neugierig und kratzte sich an seinem langsam kahl werdenden Hinterkopf.
„Da bin ich aber gespannt ...“, brummte er und richtete sich in seinem Schreibtischstuhl gespannt auf.
„In einem kleinen Dorf bei Santi Angeli in der Umgebung von Venedig besitzt unser Orden seit 1945 ein Konvent, welches aber bereits in den frühen 1960ern wieder geschlossen wurde und seitdem verfällt“, begann die junge Nonne. „Neben einer kleineren Kapelle und dem eigentlichen Konventsgebäude gehört dazu noch ein recht großer Garten. Im Grunde ist es eher eine parkähnliche Anlage, die nun über die Jahre komplett zugewuchert und verwahrlost ist. Im Zuge unserer wirtschaftlichen Neustrukturierung planen wir den Verkauf des Geländes an eine Hotelkette, die den Ort touristisch erschließen möchte. Das ganze Areal wird praktisch seit Jahrzehnten nicht mehr genutzt und die Gebäude bergen auch keinen hohen künstlerischen oder historischen Wert, vor allem nicht in ihrem derzeitigen Zustand. Hinzu kommt, dass die Gegend immer interessanter für ausländische Reisende wird, sodass dieses über Jahrzehnte nahezu unverkäufliche Gelände nun doch sehr gewinnbringend sein könnte ...“
Baumann lächelte: „Klingt gut und vor allem nach einem sehr guten Geschäft – wo komme ich ins Spiel?“ Die Nonne rügte seine Ungeduld mit einem Blick, er verstummte augenblicklich.
„Die Rodungsarbeiten des Gartens haben vor zwei Wochen begonnen. Der Orden übernimmt diesen Teil der Geländeerschließung, während der Abriss der Gebäude dann vom neuen Besitzer veranlasst werden soll. Eventuell kann die Kapelle sogar in einer noch nicht näher bestimmten Form erhalten werden ... Aber ich schweife ab. Nun, die Einebnung des Parks wurde jedoch bereits nach zwei Tagen wieder eingestellt.“
Baumann kräuselte die Stirn.
„Es trat ein eher ... ungewöhnliches Phänomen auf ...“
Er sah sie fragend an und nahm einen Schluck aus seiner Tasse, während die Schwester sichtlich bemüht nach Worten suchte.
„Als man einen großen Baum am Rande des Geländes fällen wollte, begann dieser Baum nun ... wie soll ich es ausdrücken, ohne dass es zu abstrus wirkt ... er begann zu bluten.“
Ihr Gegenüber atmete zischend aus: „Zu bluten? Also rotes Harz oder wie kann ich mir das vorstellen?“
Die Nonne hob eine Braue: „Herr Baumann, unser Orden ist auch im 21. Jahrhundert angekommen. Natürlich haben wir bereits eine biologische Untersuchung durchführen lassen – es ist definitiv keine pflanzliche Absonderung. Weder Harz noch Saft noch sonst irgendetwas – es handelt sich um Menschenblut.“
„Blut?“ Baumann stieß sich ein wenig von seinem Schreibtisch ab und brachte Distanz zu seiner Gesprächspartnerin.
„Menschenblut? Was gab es hierzu für wissenschaftliche Ergebnisse?“
„Das ist es ja. Eine genauere Analyse des Blutes blieb ergebnislos. Die DNA-Untersuchung brachte nichts, die Blutgruppe ist 0. In den letzten zehn Tagen waren die besten Naturwissenschaftler, die wir in Norditalien kriegen konnten, an diesem Phänomen dran.“
Baumann starrte sie weiter an: „Und wozu brauchen Sie dann ausgerechnet mich?“
„Nun ...“ die junge Frau rang sichtlich mit sich. „Wir vermuten mittlerweile ein historisch-religiöses Problem.“
Baumann verstand immer weniger: „Historisch-religiös? Was soll das bedeuten? Außerdem: Sie haben den Vatikan quasi um die Ecke – da haben Sie diesbezüglich jede Menge sehr gut ausgebildeter Leute!“
Die Nonne schenkte ihm ein gequältes Lächeln: „Das ist nicht so einfach – wir sind bemüht, dies zunächst als Problem unseres Ordens zu behandeln, ohne die kirchlichen Instanzen einzuschalten, daher sind wir auch sehr an einer nicht öffentlichen Arbeit interessiert.“
„Was befürchten Sie diesbezüglich?“
„Sagen wir es vorsichtig. Wir würden das Rätsel gerne lösen und es nicht unter den Teppich kehren!“
„Mein Gott, Sie vermuten ja wirklich ein religiöses Problem!“
„Professor, der Baum ist etwa vierhundert Jahre alt und gehört zur Gattung Cercis. Ein sogenannter Judasbaum.“
Jetzt lachte Baumann kurz auf: „Wie passend! Und was soll ich für Sie genau tun?“
„Wir möchten, dass Sie herausfinden, woher dieser Baum kommt – und daraus hoffen wir ergründen zu können, woher dieses ... Phänomen ... rührt.“
Sie öffnete die lederne Tasche neben sich, fischte behände einen Ordner heraus und legte ihn vor Baumann auf den Schreibtisch. Sie schien, nachdem der unangenehme Teil des Gesprächs vorüber war, wieder sichtlich selbstbewusster und verkündete: „Wir fliegen morgen gemeinsam zurück. Ihr Chef, Professor Rothaus, wurde bereits heute Vormittag schriftlich von unserem Orden informiert ...“
„Wie bitte?“, rief Baumann erstaunt aus. „Ich habe noch nicht einmal Interesse an dem Projekt bekundet!“
„Oh, Ihr Chef schon ...“ Sie lächelte ihn fast ein wenig keck an. „... was vor allem daran liegt, dass der Orden sich dieses kleine Forschungsprojekt ordentlich was kosten lässt.“
„Sie meinen ...“ Er stockte. „... Sie habe mich quasi gekauft?“ Er sprach das letzte Wort bewusst gedehnt aus. „Rothaus hat das mitgemacht?“ Ein wenig persönliche Kränkung schwang in der Stimme mit.
„Ich soll Sie schön grüßen.“ Die Nonne lachte erneut. „Alle gesammelten Informationen sind hier in ausgedruckter Form, aber auch digital auf Stick.“
„Er hat mich glatt verscherbelt ... für ein paar Euro Forschungsgelder.“ Er war immer noch fassungslos.
„Es waren ein paar Euros mehr – nur so viel dazu.“ Sie zwinkerte.
„Und die ganze Reiseorganisation?“ Langsam fing er sich wieder und ordnete seine Gedanken.
„Reise und Hotel sind gebucht – Sie können eine Person als Assistenz mitnehmen.“ Ruckartig stand die Ordensschwester auf.
Baumann ächzte: „Sie verschwenden keine Zeit, wie?“
„Moderne Nonnen, Professor, haben nie Zeit zu verschenken!“
* * *
Als sein Smartphone in der Gesäßtasche seiner Hose summte, hatte Konstantin schon ein ungutes Gefühl gehabt. Als er den Namen seines Chefs Professor Baumann gesehen hatte, war seine Laune regelrecht abgestürzt. Die Mittagsschicht war gerade beendet gewesen und er hatte sich vorgenommen, zielsicher nach Hause zu wanken, um dort in einen komatösen Nachmittagsschlaf zu fallen. Doch der aufleuchtende Name auf dem Display hatte ihm verraten, dass daraus nichts werden würde.
Verschwitzt und immer noch verkatert schloss er das Fahrrad vor dem Gebäude des historischen Instituts an. Baumann hatte nicht lange gesprochen und auch keine konkreten Aufgaben genannt, er sollte nur möglichst schnell in sein Büro kommen. Konstantin seufzte: Das klang nach etwas Großem, vor allem nach viel Arbeit. Bestimmt hatte der Alte wieder einen Abgabetermin für einen Aufsatz vergessen, der nun übers Wochenende schnell fertig werden musste und für Konstantin ermüdende Literaturrecherche bedeutete. Betont langsam ging er das Treppenhaus zum historischen Seminar hoch und begann, den Tag zu verfluchen ...
* * *
Baumann betrachtete seinen Mitarbeiter mit einem skeptischen, fast ein wenig wütendem Blick – sein Zustand schien ein wenig malade zu sein, als der junge Mann in der offenen Tür seines Büros ankam und sich im Türrahmen abstützen musste. Sein Gesicht wirkte etwas grünlich und er schöpfte stoßweise Atem.
Baumann kannte den jungen Studenten nun schon seit zwei Semestern, damals hatte er sich auf die eben freigewordene Stelle des wissenschaftlichen Mitarbeiters beworben – wobei er eigentlich für diesen Job nicht infrage gekommen war, da Baumann gerne jemanden gehabt hätte, der bereits im Masterstudiengang war oder sogar bei ihm promovieren wollte. Doch Konstantin hatte bei dem Vorstellungsgespräch einen guten Eindruck gemacht. Baumann schätze seine wache Intelligenz und seine ehrliche, manchmal etwas zu schnörkellose Art. Gerade im universitären Bereich gab es zu viele Ja-Sager, Speichellecker und Opportunisten, die mehr gegen ihren Chef als für ihn arbeiteten. Daher hatte Baumann sich für den eigentlich nicht qualifizierten Mann entschieden.
Dennoch wusste er über seine Herkunft nicht allzu viel. Bei einer der letzten Semesterfeiern war er bislang einmal mit ihm ein wenig privat ins Plaudern gekommen, da hatte er erfahren, dass er irgendwo von der Küste stammte. Sein Heimatdorf lag im friesischen Nichts – hatte auch nur ein paar hundert Einwohner. Dort war, wie Konstantin damals sagte, die Welt noch in Ordnung, aber eben auch die meisten Stammbäume rund. Er hatte dort immer weggewollt, war bereits als Gymnasiast in ein Internat in Süddeutschland gegangen. Seine Eltern waren recht wohlhabend – der Vater war wohl Bauunternehmer und hatte viel Landbesitz, was er aber auch nur andeutete, und hatten große Hoffnungen in ihn gesetzt. Der Junge sollte Jurist werden und das Geschäft des Vaters übernehmen – der erste Akademiker der Familie, der Bildungsaufsteiger, der es aus dem Dorf schafft.
Doch er entschied sich gegen eine Großstadt, gegen das Jurastudium – er wollte Lehrer für Geschichte und Deutsch werden und landete in Kassel. An der Universität schlug er sich gut, soweit Baumann das beurteilen konnte – sein Studentenleben ging ihn als Chef nur bedingt etwas an: So hatte er aber durchaus mitbekommen, dass Konstantin seine Freiheit hier genoss, was man an wechselnden Damenbekanntschaften und an seiner gelegentlichen Feierwütigkeit ablesen konnte.
Baumann sah ihm das alles nach, solange er seine Arbeit nicht vernachlässigte – doch so wie er jetzt gerade aussah, hatte er ihn bislang noch nie angetroffen.
„Was ist denn mit Ihnen passiert?“, entfuhr es Baumann, der verschiedene Papiere auf seinem Schreibtisch ordnete.
„Nun, äh ... Professor, es scheint heute nicht mein Tag zu sein ...“, brachte Konstantin hervor und griff fast ein wenig gierig nach dem Glas Wasser, das Baumann ihm anbot.
Baumann sah ihn weiterhin grimmig an.
„Der gestrige Abend war ein wenig ... ausschweifend ... Ich hoffe, Sie brauchen mich heute nicht allzu lange.“
„Oh ... Konstantin, da muss ich Sie enttäuschen!“ Baumann lachte auf. „Ich fürchte, Sie werden heute Nachmittag noch packen müssen.“
Man konnte buchstäblich im Gesicht des Studenten ablesen, dass er mit dieser Information so gar nichts anzufangen wusste.
„Wir beide fliegen morgen in aller Frühe nach Italien.“
„Eine Tagung? Ein Vortrag?“, brachte Konstantin hervor.
„Nein.“ Baumann machte eine wegwischende Handbewegung. „Wir sollen eine Art ...“ Er stockte kurz, als würde er ein geeignetes Wort suchen „... Phänomen historisch untersuchen.“
„Ein Phänomen?“ Konstantin zog den Begriff fragend in die Länge. „Wie lange soll das dauern?“ Er ließ sich in den Stuhl fallen, auf welchem vor kurzer Zeit Schwester Monica gesessen hatte.
„Ja, eine Art religiöses Rätsel könnte man sagen, die Einzelheiten gibt’s später. Wie lange das dauert? Ich schätze ein paar Tage – aber ich habe eben mit der Institutsleitung gesprochen, Ihre Überstunden wurden alle von unserem Auftraggeber übernommen – ein großzügiger Reisebonus wurde auch noch draufgerechnet.“
„Das ist alles ... etwas schnell ...“, stockte der junge Mann und rieb sich mit der rechten Hand übers Gesicht.
Baumann grinste ihn an: „Aber, aber, Konstantin! Moderne Professoren haben nie Zeit zu verschenken!“
Zwischenspiel
Santi Angeli im Juli 1947
Das altersschwache Radio schepperte bedenklich, als die junge Schwester den Lautstärkeregler hochdrehte. Es bildete im Moment den größten Besitz des Ordens – es war praktisch ihr Tor zur restlichen Welt – die Brücke, die ihr kleines Reich mit dem restlichen Italien verband.
Ihr kleines Reich – Schwester Lucrezia musste lächeln, als sie über diesen Begriff nachdachte. Vor ihr war eine mehr als schlecht gepflasterte Terrasse, auf der über ein Dutzend Holzliegen standen. In der Regel waren sie von gebrechlichen Männern belegt – Männern, die noch immer gegen die Folgen des Krieges ankämpften, und das, obwohl dieser schon über zwei Jahre vorbei war.
Müde wischte sich die junge Frau über die Augen. Ihre braunen Haare waren unter der Nonnentracht verborgen, auch wenn sie für ihre Arbeit ein leichtes Gewand tragen durfte und nicht in schwarzer Tracht gekleidet war. Sie blickte auf die unzähligen Menschen vor ihr: Sie kamen aus aller Herren Länder, die meisten waren natürlich Italiener, aber sie hatten auch ehemalige Wehrmachtssoldaten, Rumänen, Ukrainer und sogar ein paar faschistische Spanier hier – alles Soldaten, die nach der alliierten Invasion auf Sizilien gegen die Italiener und ihre Verbündeten gekämpft hatten. Für sie hatten sie diesen Konvent überhaupt im Sommer 1945 aufgemacht – Erstversorgung von den Soldaten, die aus den unzähligen Lazaretten ins Land strömten, einerlei welcher Nationalität. Die Alliierten selbst hatten bereits in den ersten Wochen nach Kriegsende ihre Verwundeten herausgeholt. Geblieben waren vor allem die Heimatlosen oder die, die zu schwach waren, um zu gehen. Die akuten Verwundungen waren alle bereits verheilt – geblieben waren Entkräftung, Hunger, Verkrüppelung und diverse Krankheiten.
Im unteren Stockwerk hatten sie eine Quarantänestation eingerichtet – es gab Fälle von Tuberkulose. Doch sie hatten auch schon die Ruhr und einige Arten von Fieber und Typhus hier gehabt. Ein deutscher Soldat, kaum siebzehn, hatte sogar die Windpocken eingeschleppt.
Hinzu kamen die, die nur kurzzeitig hier waren, auf der Durchreise in die Heimat – sie wurden verpflegt und vor allem entlaust. Im vorderen Teil des Gartens hatten sie eine Art Hygienestation aufgebaut – dort wurde die Kleidung ausgekocht, die Männer gewaschen und desinfiziert. Gegen Lausbefall half jedoch nur das Scheren der Haare.
Doch nach den Soldaten waren die Flüchtlinge gekommen: Zivilisten, die alles verloren hatten und sich auf den Weg machten zu einem neuen Glück. Es waren etwa Menschen, die vom Balkan flohen, um in den Westen zu gelangen, oder verzweifelte Zwangsarbeiter, die nur nach Hause wollten. Am schlimmsten war es mit den Kindern – das Leid der Kleinsten erfasste sie alle am meisten. Doch sie dankte jeden Tag ihrem Schöpfer – gerade, was diese speziellen Patienten anging, wurden sie gut mit Material versorgt. Sie erinnerte sich an den ersten Winter, als sie hier die ersten fünf Flüchtlingskinder mit süßer Kondensmilch hochgepäppelt hatten. Neben dem Leid und Tod gab es immer wieder auch Lichtblicke – für diese war sie ja gerade hier.
Ja, das war ihr kleines Reich. Lucrezia war stolz darauf, was sie hier alles erreicht hatten – wie viele Menschen sie bereits gerettet hatten. Doch sie hatten auch viel Leid gesehen und noch mehr gehört. Viele Soldaten wollten einfach nur ihre Erlebnisse loswerden, ihre Schuld jemandem beichten, wenn sie fieberten oder gar starben.
Sie hatten so viele wie möglich nach draußen gebracht, da es ein warmer Juli-Tag werden sollte, zur Unterhaltung hatten sie das Radio aufgestellt. Das Radio war ein Geschenk der neuen italienischen Regierung gewesen, verbunden mit ein paar Hilfsgütern. Es sollte für eine positive Stimmung sorgen, hatte ihnen der Bürgermeister erzählt, wohl vermeidend, sich jemals selbst im Konvent umzusehen.
Nicht, dass es hier zu irgendeinem Zeitpunkt zu Ärger gekommen war – im Gegenteil, man spürte fast das gemeinsame Glück des Überlebens, das alle auf eine sonderbare Weise verband. Natürlich gab es ab und an Streit oder Zank, aber man vermied es tunlichst, alte Gräben wieder zu öffnen. Neulich hatte sie im Garten sogar unter einem Baum einem ehemaligen Wehrmachtssoldaten und einem jugoslawischen Widerstandskämpfer eine Flasche Pflaumenschnaps abnehmen müssen. Beide hatten im Krieg auf dem Balkan praktisch gegeneinander gekämpft, beide waren kriegsversehrt und hatten unter dem Baum ihren persönlichen Waffenstillstand begossen – woher sie den Schnaps hatten, wollten beide nicht verraten, Alkohol war hier streng verboten.
Das bedeutete aber nicht, dass es im Konvent keine Not gab – im Gegenteil. Die Versorgungslage war nach wie vor schlecht: Lebensmittel, Medikamente und ärztliche Versorgung blieben ein Problem. Gerade im ersten Winter nach dem Krieg hatten sie eine hohe Todesrate gehabt. Erst als zusätzlich zu den Paketen vom Roten Kreuz die Alliierten die Versorgung ausbauten, begann sich die Lage zu stabilisieren.
Seit drei Wochen hatten sie auch endlich einen richtigen Arzt vor Ort. Angelo Toldo war ein seltsamer Kauz, dachte Lucrezia bei sich. Er war bereits weit in den Sechzigern und hatte sein ganzes Leben als Sanitätsarzt bei der Armee verbracht. Er stammte aus einer sehr religiösen Familie, hatte drei Brüder, die alle Priester geworden waren. Mehr wussten sie über das kleine Männlein nicht, das auch nicht sonderlich gesprächig schien und ihnen allen irgendwie aus dem Weg ging. Er war aus Deutschland gekommen – laut seinen Papieren hatten ihn die Nazis als Arzt zwangsverpflichtet, nachdem er mit den deutsch-italienischen Truppen aus dem Afrika-Desaster zurückgekehrt war. Danach war er praktisch an jeder Front Europas gewesen. Er selbst sprach darüber nicht – er hatte nur angedeutet, dass das Kriegende ihn in Süddeutschland ereilt hatte und er nicht lange in Gefangenschaft gewesen war.
Auch er gehörte zu diesem seltsamen Reich, das eine Mischung aus vielem Guten und Leid und Elend war.
„Können Sie mal lauter machen, wir wollen ihn hören!“, riss eine Stimme sie aus den Gedanken. Ein junger Bursche, der mit drei anderen auf einer Gruppe der Holzliegen lag, grinste sie keck an. Das war einer der Jüngsten hier – Fabrizio. Angeblich war er schon zwanzig, aber sie vermutete, dass er mit knapp sechzehn zum Militär gekommen war. Ein Granatsplitter, den er sich wenige Tage vor Kriegsende eingefangen hatte, hatte eine Infektion ausgelöst, die ihn fast umgebracht hätte – zumindest hatte sie dafür gesorgt, dass er sein rechtes Knie nie mehr benutzen würde – es war steif wie ein Brett. Er war vor einem knappen halben Jahr aus einem Feldlazarett hierhergekommen, abgemagert und halb tot. Jetzt klemmte eine amerikanische Zigarette in seinem Mundwinkel und er spielte mit den anderen Karten.
Lucrezia drehte das Radio noch weiter auf, sodass die Stimme des italienischen Ministerpräsidenten Alcide De Gasperi über die Terrasse dröhnte. Lucrezia wandte sich ab. Politik interessierte sie nicht sonderlich, auch wenn der Weg, den Italien nun einschlug, ihr durchaus zusagte.