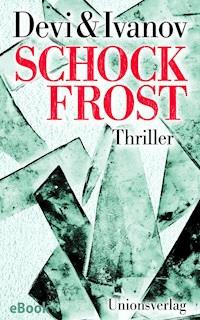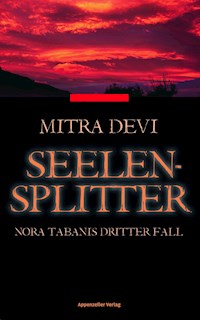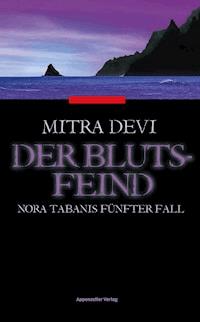
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Appenzeller
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Nora Tabanis grösste Herausforderung: Die Zürcher Detektivin gerät in die Hände von Bankräubern. Zwei Maskierte halten sie mit andern Kunden und den Angestellten im Tresorraum fest. - Zufall, oder wurde Nora in eine Falle gelockt? Und warum hasst einer der Räuber sie so sehr? Der Plan der Täter geht schief, der erste Mord geschieht. Draussen folgt Nora Tabanis Partner Jan Berger der Spur eines Komplizen, was ihn in Lebensgefahr bringt. Während dem ist die sonst so aktive Detektivin zur Untätigkeit verdammt und wird mit den Schatten ihrer Vergangenheit konfrontiert
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 365
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mitra Devi
DER BLUTSFEIND
Mitra Devi
DER BLUTSFEIND
Nora Tabanis fünfter Fall
Appenzeller Verlag
Die Autorin dankt der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia
für die grosszügige Förderung ihrer Arbeit an diesem Buch.
1. Auflage, 2012
© Appenzeller Verlag, CH-9101 Herisau
Alle Rechte der Verbreitung,
auch durch Film, Radio und Fernsehen,
fotomechanische Wiedergabe,
Tonträger, elektronische Datenträger und
auszugsweisen Nachdruck sind vorbehalten.
Umschlaggestaltung: Eliane Ottiger
Umschlagbild: Bea Huwiler
ISBN eBook: 978-3-85882-647-3
ISBN Buch: 978-3-85882-636-7
www.appenzellerverlag.ch
eBook-Herstellung und Auslieferung: HEROLD Auslieferung Service GmbHwww.herold-va.de
07.00
Als der Wecker schrillte, griff Parker nach seiner Pistole.
Der durchdringende Ton bohrte sich in seine Ohren und machte ihn schlagartig wach. Er setzte sich auf, schwang seine Füsse aus dem Bett und klatschte sie aufs Parkett.
Er starrte auf die Taurus in seiner Faust. Es war das PT908-Modell. 9 Millimeter Para-Kaliber, schwarz und schwer. Nick, der Typ, von dem er die Knarre hatte, hatte seine Ex damit umlegen wollen, eine Irre, die ihn mit ihrer Eifersucht in den Wahnsinn getrieben habe, wie er sagte. Nick hatte ihr in den Kopf geschossen. Sie hatte überlebt und vegetierte in einem Heim vor sich hin, während er mehrere Jahre wegen versuchten Mordes gesessen hatte. Die Waffe sei verflucht, behauptete Nick. Parker hatte sie fast umsonst gekriegt. Er glaubte nicht an verfluchte Waffen. Auch nicht ans Schicksal oder an Gerechtigkeit. Das ganze Leben war nichts als absolute Willkür. Bis jetzt hatte er, verdammt nochmal, mehr als genug Pech gehabt. Irgendwann musste sich das Ganze zum Besseren wenden.
Nein, nicht irgendwann. Heute.
Er drückte den Sicherungshebel der Taurus nach unten und löste das Magazin aus dem Schaft. Es glitt in seine Hand. Er drehte es, nahm den metallischen Geruch wahr, fühlte die Macht, die die Waffe ihm gab. Neun Kugeln. Neunmal die Möglichkeit, jemanden auszulöschen. Nicht, dass es bei seinem Plan darum ging, möglichst viele Leute kaltzumachen. Aber wenn er gezwungen würde zu töten, würde er es tun.
Er schob das Magazin zurück. Klickend rastete es ein. Dann zog er den Schlitten am Lauf ruckartig nach hinten. Die Pistole war schussbereit. Er drehte sich um und zielte auf den Spiegel an der Wand. Die Mündung war auf seine Stirn gerichtet.
«Peng», sagte er.
Er betrachtete sich selbst, den athletischen Mann Mitte dreissig in glänzenden Boxershorts. Drei Narben zeichneten seinen Körper. Die hässlichste, ein dunkelroter Wulst, der sich über die rechte Schulter zog, stammte vom Feuerhaken seines Vaters, mit dem dieser ihn traktiert hatte. Die zweite Narbe – quer über dem Fuss – war das Überbleibsel einer Verletzung, die Parker sich beim Fluchtversuch aus der mexikanischen Strafanstalt «San Miguel José Cristóbal de Alcázar» zugezogen hatte. Die dritte hatte er sich selbst zugefügt. Die feine Linie, die vom Handgelenk bis fast zur Armbeuge reichte, war kaum mehr zu sehen. Gillette extra sharp – fuhr durch Fleisch wie durch Butter. Parker war in letzter Minute gefunden und der klaffende Schnitt mit zwanzig Stichen genäht worden.
Noch immer richtete er die Waffe auf sein Spiegelbild. Auf seiner Brust glänzte ein Schweissfilm. Bizeps und Trizeps zeichneten sich deutlich ab. Kein Fett, alles Muskeln, durch jahrelanges Training aufgebaut. Parker fixierte seine dunklen, dichten Haare, die braunen Augen, blieb an den zusammengekniffenen Brauen hängen, die ihm ein diabolisches Aussehen hätten verleihen sollen.
Taten sie aber nicht.
Andere konnte Parker täuschen, sich selbst nicht. Andere sahen Gefahr und Grausamkeit in seinem Blick. Parker sah Schmerz. Sah Tausende von Erniedrigungen, die ihre Spuren hinterlassen hatten. Und hasste sich dafür.
Er liess den Arm sinken, sicherte die Waffe und legte sie auf die Matratze. Erst dann stellte er den Wecker ab.
07:51
Vorsichtig hielt Nora Tabani die Heuschrecke zwischen Zeigefinger und Daumen, um sie nicht zu verletzen. Was unsinnig war. In wenigen Sekunden wäre das Insekt in einem gierigen Rachen verschwunden. Es zappelte mit seinen giftgrünen Beinchen und hatte hoffentlich keine Ahnung, was auf es zukam. Hätte Nora einen Hund oder eine Katze besessen, hätte sie mit gutem Gewissen eine Futterdose öffnen können, und der Inhalt wäre tot gewesen. Doch sie nannte ein verwöhntes Chamäleon ihr Eigen, das seit neuestem darauf bestand, seine Nahrung lebendig zu verspeisen. Zuerst hatte sie auf seine Macke nicht eingehen wollen, doch dann war ihr nichts anderes übriggeblieben, als nachzugeben, denn Gregor hatte angefangen zu kränkeln.
Das schillernde Reptil hob den Blick, als sie den Terrariumdeckel zur Seite schob. Sie setzte die Heuschrecke auf ein Rindenstück neben dem Wassertrog.
«Hier, mein Kleiner», gurrte Nora, «dein Frühstück.»
Dass sie für ihn je etwas anderes sein würde als eine Fütterungsmaschine, glaubte sie nicht mehr. Sie hatte alles versucht. Leises Zureden, exotische Delikatessen, eine wärmere Temperatur. Einmal hatte sie sogar homöopathische Globuli, welche die Kommunikation zwischen Tier und Mensch fördern sollten, unter sein Fressen gemischt – es hatte nichts genützt. Ihr Chamäleon war und blieb verstockt.
In Sekundenschnelle schoss Gregors imposante Zunge aus seinem Maul und heftete sich an das Insekt. Dann zog er die Beute in seinen Schlund und sah Nora auffordernd an. Nora wiederholte die Prozedur mit drei weiteren armen Kreaturen, die sich Gregor ohne Anzeichen schlechten Gewissens einverleibte. Als er merkte, dass nichts mehr folgte, kletterte er auf seinen Lieblingsast und kehrte ihr das Hinterteil zu.
«Bitte, gern geschehen», sagte Nora.
Gregor enthielt sich einer Antwort, rollte seinen Schwanz ein und verfärbte sich blau.
Nora schloss das Terrarium.
Sie sah zum Bistrotischchen in ihrer Küche hinüber, wo neben einer angebissenen Tafel Schokolade und dem aufgeschlagenen «Züritipp» das Couvert lag, das sie gestern erhalten hatte. Es war nicht per Post gekommen, jemand hatte es in den Briefkasten gelegt. Ohne Marke, ohne Absender. Auf einer weissen Karte stand die Nachricht: «Ich möchte Sie engagieren. Treffen Sie mich morgen um 9 Uhr beim Hauptsitz der Zurich Credit Bank.»
Es kam immer wieder vor, dass sich ein potenzieller Klient nicht persönlich zu Nora traute und sich stattdessen anonym meldete. Entweder war die Sache so delikat, dass er nicht im Büro einer Privatdetektivin gesehen werden wollte, oder es war ihm wichtig, dass das Ganze von Anfang an nach seinen Regeln lief. Nora hatte nichts dagegen.
Sie arbeitete momentan an zwei kleineren Fällen, die nicht viel Zeit in Anspruch nahmen, und konnte einen neuen Auftrag gut gebrauchen. Vor allem die damit verbundenen Einnahmen. Nicht, dass sie am Hungertuch nagte, aber um ihre Finanzen war es nicht gerade rosig bestellt.
Der Hausbesitzer hatte die Miete von einem Tag auf den andern um 200 Franken erhöht und rechtfertigte dies mit irgendwelchen Reparaturarbeiten im Keller, von denen Nora nie etwas gesehen hatte. Sie hatte sich beim Mieterschutzverband beraten lassen und erfahren, dass sie gegen die Erhöhung vorgehen könnte. Doch auf einen monatelangen Streit hatte sie keine Lust, darum liess sie es bleiben. Zudem war es nur noch eine Frage der Zeit, bis allen Hausbewohnern gekündigt und auch dieses Gebäude, wie so viele andere im Zürcher Seefeldquartier, ausgehöhlt, renoviert und für den doppelten Betrag ausgeschrieben würde. Kürzlich hatten zwei Männer mit Messgeräten beim Eingang herumgestanden und danach Fotos von der Fassade gemacht. Nora hatte die Satzfetzen «dringend nötig» und «Bruchbude aufwerten» aufgeschnappt. An die statistisch verschwindend kleine Wahrscheinlichkeit, in Zürich eine zahlbare Wohnung zu finden, durfte Nora gar nicht denken. Geschweige denn an den Umzugsstress.
«Das wird für dich auch schwierig werden», sagte sie zu ihrem Chamäleon. «Ein neues Heim, eine andere Aussicht und fremde Gerüche.»
Gregor umklammerte mit seinen Krallen einen dünnen Ast und richtete den Blick auf einen Punkt in der Ferne.
Nora zog ihre Lederjacke an, steckte das Handy ein und stieg von ihrem Mansardenzimmer zum Büro hinunter. Sie würde sich in einer halben Stunde zur Bank aufmachen und war gespannt, wer dort auf sie wartete. Als geborener Morgenmuffel war sie trotz der zwei Tassen Kaffee, die sie intus hatte, müde, doch die Aussicht auf einen neuen Fall belebte sie.
Im Treppenhaus roch es nach Nikotin, Haarspray und Färbemitteln. Gaby, die Coiffeuse vom Untergeschoss, lüftete ihren Salon wieder mal nicht übers offene Fenster, sondern ins Innere des Hauses. Der beissende Mief zog wie in einem Kamin die Stockwerke hoch. Die Friseurin und ihre Kundinnen rauchten Kette. Das hatte vor einer Weile zu beträchtlichen Unstimmigkeiten im Haus geführt. Um diese zu klären, hatte Nora sich geopfert und sich von Gaby die Haare wasserstoffblond färben lassen. Sie hatte geglaubt, beim gemütlichen Zusammensein mit ihr ins Gespräch zu kommen und die Wogen zu glätten.
Doch weder war es gemütlich gewesen, noch hatte sich irgendwas geglättet. Ausser ihrem Portemonnaie. Eisiges Schweigen hatte geherrscht, während sich das aggressive Bleichmittel unter der Wärmehaube in Noras Kopfhaut gefressen hatte. Das war über ein Jahr her, inzwischen waren ihre Haare wieder dunkel nachgewachsen, sie trug sie kurzgeschnitten mit widerspenstigen Strähnchen, die überall abstanden.
Sie kam im ersten Stock an und trat ins Detektivbüro, das aus drei Räumen bestand, wenn man den Eingangsbereich als Zimmer zählte. Zwei knallrote Sessel standen darin, auf denen die Klienten Platz nehmen konnten. Was bisher noch niemand getan hatte. Irgendetwas stimmte wohl mit der Farbintensität nicht. Im Brockenhaus «Tigel» gleich um die Ecke, in dem sie die Sessel gekauft hatte, hatten diese in dezentem Bordeaux überzeugt. Kaum im Büro aufgestellt, leuchteten sie aus unerfindlichen Gründen wie Feuerwehrautos.
Angrenzend lagen Noras Arbeitsraum mit dem überquellenden Schreibtisch, hell, gross, mit Blick zur Seefeldstrasse, und das kleine Eckbüro ihres Partners Jan Berger.
Um diese Zeit erwartete Nora, die Detektei leer vorzufinden. Doch Jan sass am Computer und schaute erstaunt hoch. «Nanu? Was sind denn das für neue Sitten, Chef? Leidest du an Schlaflosigkeit?»
Nora lehnte sich an den Türrahmen. «Bist du immer so früh im Stollen?»
«Seit du mich eingestellt hast, mit wenigen Ausnahmen», antwortete er mit unüberhörbarer Genugtuung in der Stimme. Erfreut fuhr er fort: «Weisst du, was für ein Tag heute ist?»
Nora gähnte ausgiebig. «Keine Ahnung.»
«Wir feiern ein rundes Jubiläum.»
«Ein rundes – tatsächlich? Ich dachte, wir arbeiten etwa anderthalb Jahre zusammen.»
«Es sind haargenau 541 Tage!» Seine Augen leuchteten. Als sie nicht reagierte, meinte er: «Klingelt bei dir nichts?»
Sie schüttelte begriffsstutzig den Kopf. «Was soll daran rund sein?»
«Chef! 541 ist eine Primzahl! Und zwar die Hundertste. Wenn das nicht was Besonderes ist! Ich finde, das sollten wir festlich begehen, was meinst du?»
Nora lachte ungläubig. «Ehrlich, Jan, manchmal kommst du mir vor wie ein Alien.»
«Wieso? Erkennst du denn die Schönheit von Primzahlen nicht?»
Sie setzte sich an ihr Pult und betrachtete das Durcheinander: «Ich erkenne die Schönheit von Kaffee an einem frühen Morgen.»
«Okay, ich hab den Wink verstanden.» Jan stand auf, ging in die Büroküche und kam bald darauf mit einer dampfenden Kanne zurück.
Nora rümpfte die Nase. «Das ist kein Kaffee.»
«Das ist Grüntee», gab er zurück. «Gesünder und besser fürs Oberstübchen. Ausserdem hattest du schon zwei Kaffee.»
«Warum weisst du das?»
«Weil ich dich kenne.»
08:14
Bashkim Rahmani band seine dunkelblaue Krawatte. Vor Aufregung hatte er fast die ganze Nacht nicht geschlafen. Heute war sein erster Arbeitstag bei der Zurich Credit Bank. Die Lehrabschlussprüfung hatte er mit guten Noten bestanden. Der Personalleiter der Bankfiliale am Stadtrand hätte ihn gern behalten. Doch Bashkim hatte anderes vor. In den Ferien hatte er sich in diversen Kursen weitergebildet und schon ein Jahr vorher unzählige Bewerbungen geschrieben. Die Absagen waren stapelweise hereingeflattert. Es lag an seinem Namen, das wusste er. Kosovo-Albaner rangierten in diesem Land auf dem hintersten Platz auf der Sympathieliste. Doch Bashkim hatte nicht aufgegeben, bis man ihm diesen Superjob angeboten hatte. Er konnte es kaum fassen.
Sein Vater war vor dem Balkankrieg als einfacher Saisonnier in die Schweiz gereist, hatte auf dem Bau gearbeitet und seinen Kindern klare Richtlinien mitgegeben. «Wir sind hier nur geduldet», hatte er oft gesagt. «Fallt nicht auf und arbeitet hart.» Die vier Geschwister hatten sich daran gehalten.
Bashkim war der Zweitgeborene. Sein älterer Bruder Florim war nach Pristina zurückgekehrt und hatte ein kleines Reisebüro eröffnet, seine jüngere Schwester Arjeta hatte es als Einzige ihrer Klasse ins Gymnasium geschafft, und der kleine Luan verblüffte seine Kindergärtnerin immer wieder mit seinem umfangreichen Wortschatz.
Bashkim zupfte sein weisses Hemd in Form, zog den dunklen Anzug an und schlüpfte in die frischgeputzten Lederschuhe. Er machte eine halbe Drehung und begutachtete die Bügelfalte seiner Hose. Er wirkte erwachsen. In den nächsten Tagen würde er sein Zimmer der neuen Situation anpassen. Das «Pirates of the Caribbean»-Poster kam in den Abfall, ebenso der Setzkasten mit den bunten Traktoren drin, die er seit seiner Kindheit angehäuft hatte. Dafür war er inzwischen zu alt. Die Dübellöcher des Sammelgestells würde er zuspachteln, vielleicht sogar die Wände frisch streichen. Von seinem ersten Lohn wollte er sich ein Bild kaufen. Eine Schwarzweissfotografie, die er einmal in einer Ausstellung gesehen hatte. Sie zeigte einen Kran, der hoch über die Häuser von New York ragte, und ein Dutzend Arbeiter, die darauf sassen und in schwindelerregender Höhe zu Mittag assen. Das Bild war ziemlich berühmt, das wusste er. Er wollte in eine Galerie gehen und es professionell rahmen lassen, damit es richtig zur Geltung käme.
Bashkim riss sich aus den Gedanken. Er musste präsent sein für das, was ihn heute erwartete. Vater war bereits bei der Arbeit, seine Schwester in der Schule, und der Kleine schlief noch. Mutter stand in der Küche und bereitete sein Frühstück vor. Der Duft von gebratenem Teig stieg ihm in die Nase.
In einer Dreiviertelstunde würde er den Dienst am Bankschalter antreten. Er hätte nicht nur hinter den Kulissen mit Zahlen, Renditen und Zinssätzen zu tun, sondern würde an der Front Kunden begegnen. Er freute sich sehr darauf. Kommunikation und Beratung entsprachen ihm. Immer wieder hatte er gehört, wie umgänglich und höflich er sei.
Frau Zink, die er bereits kennengelernt hatte, würde ihn langsam in sein neues Metier einarbeiten. Und er gäbe sich Mühe und stiege die Karriereleiter hoch. Irgendwann wäre er derjenige, der die Lehrabgänger einarbeitete. Er täte es freundlich und verständnisvoll, gäbe ihnen aber Werte wie Ordnung und Disziplin weiter, die ihm vermittelt worden waren. Und irgendwann wären die Sprüche, die er während seiner Kindheit hatte ertragen müssen, von denen «Scheiss-Albaner» noch der Harmloseste war, von seiner Seele getilgt.
«Essen, Bashkim!», rief seine Mutter aus der Küche.
«Ich komme, Mam.»
Er war fertig mit seiner Garderobe, sah aus wie aus dem Ei gepellt, wie jemand, den man ernst nehmen musste. Er trat in die Küche und setzte sich an den Tisch. Seine Mutter war dabei, die Petla im heissen Öl zu braten. Sie dufteten unwiderstehlich. Als sie auf beiden Seiten goldgelb waren, schaufelte sie die Rauten aus Teig mit einer Holzkelle aus der Pfanne und legte sie auf seinen Teller. Sie gab Fetakäse, in Streifen geschnittene Peperoni, Tomatenschnitze und Gurkenscheiben dazu.
«Ju bëftë mirë!», sagte sie.
Bashkim wünschte ihr auch einen guten Appetit wie jeden Morgen, obwohl sie nie frühstückte. Er nahm ihre Befangenheit wahr. Ob er ihr in seinem Anzug fremd vorkam? Daran würde sie sich gewöhnen müssen.
Eigentlich hatte er geglaubt, vor lauter Nervosität keinen Bissen runterzukriegen, doch plötzlich merkte er, dass er einen Mordshunger hatte. Er verschlang die heissen Petla und trank zwei Tassen Tee dazu. Als sein Teller leer war, wischte er sich mit der Serviette die Ölreste vom Mund und stand auf. Er trug das Geschirr zum Waschbecken, spülte es ab und stellte es auf das Abtropfgitter. Seine Mutter beobachtete ihn, das spürte er. Verstohlen wischte sie sich eine Träne aus den Augen. Bashkim versuchte, cool zu bleiben.
Plötzlich umarmte sie ihn ungestüm. Ein paar Sekunden liess er es geschehen, dann murmelte er: «Du kannst mich loslassen, Mam, ich gehe nicht auf eine Weltreise.»
Sie trat etwas zurück und betrachtete ihn so lange, dass es ihm unangenehm wurde. «Der Schritt, den du heute tust, ist viel bedeutender als eine Weltreise.» Sie strich ihm über den Kopf.
«Mam, ich bin kein kleines Kind mehr!»
Sie lächelte und gab ihm einen Klaps. «Geh jetzt, damit du beizeiten in der Bank bist.»
«Es ist noch viel zu früh.»
«Besser zu früh als zu spät.»
Auch so eine Sache. Das mit der Pünktlichkeit. Bashkim kannte keinen Schweizer, der es in dieser Hinsicht mit der Familie Rahmani aufnehmen konnte. Sein Freund Shaban spottete oft, die Rahmanis hätten die Grenze der Überanpassung längst überschritten und bewegten sich gefährlich in Richtung Spiessigkeit. Doch Bashkim war das egal. Er hatte einen Job, und was für einen! Während Shaban für ein Taschengeld bei seinem Onkel in der Werkstatt aushalf und es wohl nie weiterbringen würde.
Bashkim Rahmani verliess das Haus, den Blick seiner Mutter im Rücken, und sein Puls ging schneller als sonst. Vor Aufregung, vor Vorfreude, vor Stolz.
08:29
«Hoppla», entfuhr es Greta Hollenstein, als sie auf dem Kopfsteinpflaster ausrutschte und um ein Haar stürzte. Im letzten Moment konnte sie das Gleichgewicht wieder finden.
«Glück gehabt, meine Liebe», murmelte sie.
Greta sprach ausgesprochen gern mit sich selbst. Es gab ihr das Gefühl, nicht allein zu sein, die eigene Stimme beruhigte sie und klang wohl in ihren Ohren.
Wacker schritt sie über den Lindenhof und die Strehlgasse hinunter. Es war bedeckt, der Wind trieb die Wolken von Westen her über die Stadt. Zwei Kirchturmuhren schlugen kurz hintereinander halb neun. Heute hatte ihre Schwester Mathilda Geburtstag. Greta hatte sich mit ihr zum Abendessen verabredet und wollte vorher noch einige Besorgungen in der Stadt machen und ein Geschenk für sie kaufen. Als begeisterte Donna-Leon-Leserin würde sich die Schwester über den neuen Venedig-Krimi freuen. Mathilda hatte ihre Flitterwochen in der Lagunenstadt verbracht und schwärmte immer noch – zwanzig Jahre, nachdem ihr Mann gestorben war – von den Gassen, Kanälen und den charmanten italienischen Gondolieri. Greta hatte Venedig nie gesehen und konnte mit den Krimis von Donna Leon nichts anfangen, sie las mit Vergnügen die nordischen Autoren. Die beiden Schwestern teilten nicht nur die Vorliebe für spannende Bücher, sondern vieles mehr. Sie hatten sich stets stark miteinander verbunden gefühlt und sich kaum je gestritten. Mathilda hatte akzeptiert, dass Greta die Ältere war und das Recht hatte, ihr hin und wieder etwas vorzuschreiben, und Greta hatte ihre Verantwortung ernst genommen und dafür gesorgt, dass Mathilda nach dem frühen Tod der Mutter eine Lehre als Schneiderin machen konnte.
Bei einem guten Glas Wein konnten sie immer noch über das Leben philosophieren wie in früheren Jahren. Greta hatte nie geheiratet und diese Tatsache kein einziges Mal bereut. Unabhängigkeit war ihr wichtiger gewesen. Als sie jung gewesen war, hatten die Mädchen ihre Freiheit oft zugunsten der Ehe aufgegeben und ein Leben geführt, das weit unter ihren Möglichkeiten lag. Greta war Lehrerin geworden. Bis zu ihrer Pensionierung hatte sie im Schulhaus «Waidhalde» die Oberstufe unterrichtet. Das war nun auch schon mehr als fünfzehn Jahre her. Heute wurde Mathilda achtundsiebzig, und sie, Greta, feierte in zwei Monaten ihren achtzigsten Geburtstag.
Sie war noch immer gut zu Fuss und machte jeden Tag einen stündigen Spaziergang dem See entlang. Auch bei Regen. Dann hüllte sie sich jeweils in ihre Allwetterjacke «South Pole Extra Condition», die sie ein Vermögen gekostet hatte, und die, wie ihr der Verkäufer eifrig versichert hatte, auch für antarktische Temperaturen geeignet war. Doch heute regnete es nicht. Greta hatte ihre weinrote Jacke angezogen und ein lila Halstuch dazu gewählt. Ihre grauen Haare waren noch immer dicht, und die dünne, goldumrandete Brille passte gut dazu.
Greta kam zur St. Peterhofstatt, wo auf der grünen Holzbank, die rings um den dickstämmigen Laubbaum verlief, ein Obdachloser übernachtete.
«Nanu», sagte sie.
Er schlief, sich der Form der Bank anpassend, auf ausgebreiteten Zeitungen. Neben ihm befand sich ein braungraues Stoffbündel, das wohl seine Habseligkeiten enthielt. Sein Brustkorb, auf dem der verfilzte Bart lag, hob und senkte sich regelmässig. Greta empfand Mitleid mit ihm. Ende September konnte es um die Mittagszeit noch recht warm werden, aber nachts fielen die Temperaturen in den einstelligen Bereich.
«Dich habe ich hier noch nie gesehen», flüsterte sie. «Das ist kein typischer Platz für Clochards.»
Sie blieb einen Moment stehen, dann ging sie zu dem Schlafenden hin. Als sie neben ihm stand und sein leises Schnarchen hörte, merkte sie, dass er streng roch. Nach Bier, Knoblauch und ungewaschenen Kleidern.
«Viel Speck hast du nicht auf den Rippen», überlegte sie laut.
Sie öffnete ihre Handtasche, nahm ein Fünffrankenstück hervor und legte es neben den Mann.
«Aber nicht für Alkohol.»
Greta Hollenstein ging die Schlüsselgasse hinunter. Sie hatte vor, Mathilda zum Essen in die «Kronenhalle» einzuladen. Dazu musste sie noch zur Zurich Credit Bank, um etwas Geld abzuheben.
08:42
Parker faltete den Plan zusammen und steckte ihn in die hintere Hosentasche. Er hatte ihn seit Wochen studiert. Er kannte die Haupthalle der Bank in- und auswendig. Die Anzahl Schalter und Besprechungsnischen für die grossen Transaktionen. Die Standorte der Überwachungskameras und der unsichtbaren Alarmauslöser. Er war vertraut mit der Treppe, die ins Untergeschoss zu den Safes führte, in denen die Reichen Schmuck und Gold aufbewahrten, das sie dem Steueramt verheimlichten.
Er wusste, wie viele Angestellte er im Erdgeschoss anträfe. Montagmorgen, kurz nach Türöffnung, waren es gerade mal drei. Schalter A bis C würden besetzt sein, Schalter D bis F erst zwei Stunden später geöffnet werden. Kunden hätte es um diese Zeit nicht mehr als ein halbes Dutzend, vielleicht weniger. In den oberen Stockwerken lagen die Büros, doch zu denen gelangte man nur durch die Tür im Nebengebäude. Die einzige wirkliche Schwierigkeit, auf die sie stossen würden, war der bewaffnete Sicherheitsmann links des Eingangs. Doch Parker und sein Kumpel Tony hatten die Situation unzählige Male durchgespielt. Sie wussten, in welcher Reihenfolge sie die Bank betreten würden, wer den Uniformierten ausschalten und wer die anderen in Schach halten würde. Montagmorgen war perfekt. Optimal für eine schnelle, unkomplizierte Aktion. Tony und er wären verschwunden, bevor die Tussi von Schalter C «Hilfe!» kreischen könnte. Er schätzte, das Ganze würde eine Sache von zwei Minuten werden.
Dennoch hatte Parker vorgesorgt. Auf Tony konnte er in dieser Beziehung nicht zählen. Der war zu einfach gestrickt, um sich einen Plan B auszudenken. «Knarre hoch, Kohle kassieren und weg!», das war Tonys Devise.
Konnte klappen, durchaus. Doch Parker wusste, dass die Dinge oft nicht so liefen, wie man wollte. Was, wenn einer der Kunden Widerstand leistete? Wenn die Schalter-C-Zicke die Bullen rief, ohne dass sie es merkten?
Zuerst hatten sie sich die Credit Suisse oder die UBS vornehmen wollen. Da mussten Millionen in allen Währungen rumliegen. Doch die Hauptsitze am Paradeplatz waren viel zu gross und zu gut gesichert. Daraufhin hatte Tony die Zürcher Kantonalbank vorgeschlagen. Parker hatte abgewinkt. Das Haus befand sich im Umbau. Gerüste waren aufgestellt, überall standen Maschinen und lagen Werkzeuge herum, die ganze Halle war ausgehöhlt und voller Gipsstaub. Der Betrieb wurde bis zum Bauende in einem Provisorium bei der Rentenanstalt weitergeführt, das Parker noch nicht hatte auskundschaften können.
Sie hatten sich für die Zurich Credit Bank entschieden. Die ZCB, vor kurzem noch direkt am Paradeplatz gelegen, war inzwischen eine Strasse weiter Richtung Limmat gezogen und befand sich nun an der Fraumünsterstrasse neben der «Old Fashion»-Bar, genau gegenüber dem Hintereingang der Fraumünsterpost. Die ZCB war kleiner, überschaubarer und bot bessere Möglichkeiten abzuhauen. Ihre beiden Motorräder hatten Parker und Tony schon gestern strategisch gut plaziert. So schnell konnten die Bullen gar nicht sein, wie Parker und sein Kumpel die Kohle abtransportieren, auf ihre Kawasakis springen und davonbrausen würden.
Parker zündete sich eine Zigarette an und rauchte mit tiefen Zügen. In diesem Moment vibrierte sein Handy. Er legte die Zigarette in den Aschenbecher und sah auf die Uhr. 8.45 Uhr. Tony meldete sich auf die Sekunde genau.
«Mach mich auf den Weg», lautete das SMS. «Bei dir alles in Ordnung, Frankenstein?»
«Alles ok, Dracula», schrieb Parker zurück.
Er schnürte seine schwarzen Sportschuhe. Von Kopf bis Fuss war er schwarz gekleidet. Er ging in die Küche, öffnete den Kühlschrank und trank einen grossen Schluck Multivitaminsaft aus dem Tetrapack. Dann schwang er seinen Rucksack über die Schulter, steckte die geladene Taurus in seinen hinteren Hosenbund und zog seine Jacke darüber. Ein Lächeln lag auf seinen Lippen. Eines, von dem er wusste, wie stahlhart es auf andere wirkte.
08:47
Das 4er-Tram hielt am Bellevue, und Nora entschied sich spontan, doch noch eine Art Frühstück zu sich zu nehmen. Im «Belcafé» kaufte sie ein Käsebrötchen. Damit es besser hinunterrutschte, half sie mit Kaffee nach. Einen Moment tauchte Jan vor ihrem inneren Auge auf, der ob ihres exzessiven Kaffeegenusses seinen netten, rundlichen Kopf schüttelte und sich um ihre Gesundheit sorgte. Ohne ihn, der ihr immer wieder Salat und Gemüse unterjubelte, würde Nora – so behauptete er – an einem General-Vitamindefizit leiden. Was sich über kurz oder lang durch vermehrte Faltenbildung, frühzeitige Ergrauung und geistige Einbussen bemerkbar machen würde. Falten und graue Haare waren bestimmt frei erfunden, aber die geistigen Einbussen gaben Nora zu denken. Erst kürzlich hatte sie nach einem Wort gesucht, und es hatte ihr partout nicht einfallen wollen. Die Folgen eines Vitamin-B-Mangels? Oder erste Anzeichen von Altersdemenz? O.k., bei dem Wort hatte es sich um Chromosomenmutationsstruktur gehandelt, doch ihre Schwierigkeit, den Begriff auf Anhieb zu finden und ihn stattdessen mit «Dings» zu umschreiben, war kein gutes Zeichen. Ausserdem hatte sie vergessen, warum um alles in der Welt sie das Wort Chromosomenmutationsstruktur überhaupt hatte verwenden wollen.
Nun, sei’s drum. Sie trank den Kaffee aus, überquerte die Tramschienen und gelangte zur Quaibrücke. Der See war dunkel, fast unheimlich, der Wind blies kräftig in die Wellen. Vereinzelt lagen noch Nebelschleier über den Ufergemeinden. Ein Dutzend Schwäne schwamm um die mit Planen überdeckten Segelboote, die an den Bootsplätzen vor Anker lagen.
Nora bog am Bürkliplatz rechts ab, kam an der Frauenbadi vorbei und erinnerte sich an den Sommer, als sie sich zwischen plantschenden jüdischen Mädchen, verschleierten muslimischen Frauen und schnatternden Studentinnen in der Sonne geräkelt und in der Limmat abgekühlt hatte. Das schien so weit weg. Nach ihrem freiwilligen Aufenthalt in der psychiatrischen Klinik «Seeblick» zwecks Aufklärung eines Mordfalles war es mit der Arbeit gleich weitergegangen. Die Aktivität hatte ihr geholfen, die Schrecken des Klinikerlebnisses etwas zu verarbeiten.
Kurz vor Türöffnung erreichte sie die Zurich Credit Bank. Ein Geschäftsmann wartete bereits vor dem Eingang und betrachtete die Werbung in den Schaufenstern, die höhere Zinsen, grosszügigere Kredite und bessere Anlegemöglichkeiten als die Konkurrenz versprach. Neben ihm stand eine junge Frau mit Rasta-Locken, fast noch ein Mädchen. Sie hielt einen struppigen, grossen Hund an der Leine. Die ZCB hatte die Finanzkrise vor ein paar Jahren nicht nur unbeschadet überstanden, sondern sogar davon profitiert. Viele enttäuschte Kleinkunden hatten ihrem Finanzinstitut, nachdem sie mit unseriösen Börsenempfehlungen um ihre Ersparnisse gebracht worden waren, den Rücken gekehrt und zur ZCB gewechselt. Nora hatte selbst ein Konto hier. Ob ihr zukünftiger Klient bei dieser Bank arbeitete? Vielleicht war er in Schulden verstrickt oder hatte beunruhigende Beobachtungen an seinem Arbeitsplatz gemacht.
Sie setzte sich auf die niedrige Steinmauer, in welche das Bankenlogo, ein roter Tiger im Sprung, in regelmässigen Abständen eingemeisselt war. Vom Paradeplatz her war das entfernte Quietschen der Trams zu hören. Abgesehen von einigen Büroleuten, die mit Aktenkoffern vorbeieilten, war es in der Fraumünsterstrasse ruhig.
Nora schaute auf die Uhr. Hatte der Geschäftsmann, der nervös neben ihr auf und ab ging und rauchte, sie hierher bestellt? Sie blickte ihn prüfend an, doch er schien in Gedanken versunken und schenkte ihr keine Beachtung. Vielleicht wurde sie drinnen empfangen.
Gleich würde die Bank öffnen.
Ein kühler Wind fegte über die Strasse. Dürres Laub wirbelte auf. Nora fröstelte.
Die andere Wartende, die junge Frau, hatte iPod-Stöpsel in den Ohren und bewegte ihren Kopf mit geschlossenen Augen im Takt der Musik. Sie schien direkt dem Woodstock-Festival entsprungen zu sein, trug einen bodenlangen rostroten Rock mit eingenähten Spiegelchen, die im Morgenlicht glitzerten, und einen orangen Pullover mit psychedelischen Mustern. Sie war von einer Sandelholz-Duftwolke umgeben. In ihre hennagefärbten Haarsträhnen hatte sie weisse Kaurimuscheln geflochten, und an jedem ihrer Finger steckte ein Ring. Sie blickte kurz in Noras Richtung, grinste ihr hanfselig zu, während ihr Hund ausgiebig seine Pfoten leckte. Nora nahm nicht an, dass sie die Auftraggeberin war.
Nun näherte sich eine ältere Dame mit lila Halstuch, die Handtasche mit festem Griff umklammert und leise mit sich selber plaudernd. Sie stellte sich zu den anderen Bankkunden. Als sie zu Nora hinübersah, lächelte sie.
Nora lächelte zurück.
Die Uhr der Fraumünsterkirche schlug neun.
Die Entriegelung klickte, ein Surren war zu hören, und das metallene Schutzgitter glitt hinauf. Als es oben eingerastet war, öffneten sich die zwei Glastüren nach beiden Seiten und gaben den Blick in die Schalterhalle frei, die ganz in schwarzem Marmor gehalten war. Der Geschäftsmann schnippte seine Zigarette auf den Boden, drängte sich an der jungen Hippie-Frau vorbei und sagte auf Hochdeutsch: «Lassen Sie mich mal durch, ich hab’s eilig!» Diese zuckte nachsichtig die Schultern, zog die Ohrstöpsel heraus und verstaute ihren iPod in der Rocktasche.
Die ältere Dame trippelte die Treppe hinauf und ermunterte sich mit einem fröhlichen: «Rein mit dir, meine Liebe.»
Nora betrat als Letzte die Bank. Der uniformierte Mann der Security, der beim Eingang stand, nickte ihr zu. Unzählige golden eingefasste Deckenleuchten spiegelten sich wie Sterne auf dem Marmorboden. Dieser roch nach Zitrus-Reinigungsmittel und schimmerte an einer Ecke noch feucht. Das Putzpersonal schien seine Arbeit soeben beendet zu haben. An der Rückwand, hinter den Schaltern, prangte das Bankenlogo in imposanter Grösse. Der rote Tiger aus eingelegtem Marmor sah so lebendig aus, als spränge er tatsächlich quer durch die Halle.
Zielstrebig steuerte der Geschäftsmann auf den linken Schalter A zu und wurde vom Angestellten mit «Guten Morgen, Herr Hagen» empfangen. Die Rasta-Frau schlenderte mit ihrem Hund zum mittleren Schalter B, der von einer tamilischen Bankangestellten mit langen, schwarzen Haaren bedient wurde. Die alte Dame stellte sich vor den Schalter C, wo eine spröde wirkende Mittvierzigerin mit blondem Pagenschnitt und ein junger Mann in schickem Anzug sie begrüssten. Wahrscheinlich ein Neuer und seine Vorgesetzte, dachte Nora.
Sie hatte erwartet, dass jemand sie zu sich winken oder sich sonstwie zu erkennen gäbe. Doch als niemand sie beachtete, setzte sie sich in einen der schwarzen Ledersessel auf der rechten Seite; von dort konnte sie die ganze Schalterhalle überblicken.
«Kommt gar nicht in Frage!», hörte sie Geschäftsmann Hagen ausstossen. «Das wäre ja ein Viertelprozent weniger! Machen Sie mir einen anderen Vorschlag.» Die Stimmen von Hagen und dem Angestellten klangen wieder gedämpfter.
Dann hörte Nora, wie die Rastalockige sagte: «Ich möchte mein Konto auflösen, mein ganzes.»
Die dunkelhaarige Schalterangestellte nickte, warf einen Blick auf den Computer: «Das wären dann 123 Franken.»
«Genau.»
Die Akustik in dem riesigen Raum war so gut, dass Nora nicht anders konnte, als auch noch den Rest mitanzuhören.
«Darf ich fragen», fuhr die Angestellte fort, «ob Sie mit unseren Dienstleistungen nicht zufrieden waren?»
«Doch, schon», gab die Rasta-Frau widerwillig zu. «Obwohl ich Ihre Bank nur gewählt habe, weil Hunde bei Ihnen erlaubt sind. Aber ich will nicht, dass mein Geld weiter in irgendwelche dubiosen Aktien investiert wird, was am Schluss zur Ausbeutung der Dritten Welt, zu Krieg und Waffenhandel führt. Und Hunger.» Sie holte tief Atem und tätschelte den Nacken ihres struppigen Hundes. «Und Armut.»
Nora lehnte sich zurück. Der Wachmann schaute gelangweilt auf die Strasse hinaus. Die Geschäfte an den Schaltern wurden abgewickelt, mehrstimmige Gesprächsfetzen waren zu hören. Nora nahm sich vor, eine halbe Stunde zu warten und dann den Rückzug anzutreten, falls ihr potenzieller Klient sich bis dann nicht gezeigt hatte.
Sie sah sich in der Halle um. Es war ein schönes Gebäude, sorgfältig renoviert, so dass der Charme des alten Baustils erhalten geblieben war; die modernen Materialien sorgten für einen zeitgemässen Eindruck. Auf einigen Chromstahlständern waren Informationsbroschüren ausgelegt. Dickblättrige Pflanzen, so grün, dass Nora nicht wusste, ob sie echt oder künstlich waren, ragten aus den Töpfen, die um die beiden Sitzgruppen standen. An den Wänden hingen mehrere Bilder. Obschon sie von verschiedenen Kunstschaffenden zu stammen schienen, strahlten sie alle eine ähnliche Atmosphäre aus. Es handelte sich bei allen um Naturbilder in Aquarell.
Sonjas Bild befand sich nicht darunter. Noras Mutter hatte während ihrer letzten Ausstellung etliche Bilder verkauft, darunter auch eines an die ZCB, doch anscheinend hing es in einem anderen Raum.
Nora schaute auf die grosse Wanduhr. Es war noch kaum Zeit vergangen, aber Warten machte sie ungeduldig. Konnte es sein, dass ihr Auftraggeber sie längst beobachtete? Vielleicht handelte es sich um eine äusserst heikle Angelegenheit, und wer auch immer die Absicht hegte, sie zu beauftragen, wollte sich vergewissern, dass Nora der Sache gewachsen war. Sicherheitshalber richtete sie sich auf, streckte den Rücken durch und versuchte, kompetent zu wirken.
Wer hatte sie in die Bank beordert? Der Wachmann? Unwahrscheinlich. Nora sah ihm zu, wie er gedankenverloren auf seiner Unterlippe herumkaute. Hagen, der deutsche Geschäftsmann? Der war noch immer in irgendeine Anlageberatung vertieft. Die Rastalockige schien weder das Geld noch das nötige Alter zu haben, um eine Detektivin anzuheuern, und die ältere Dame vermittelte den Eindruck, als käme sie mit ihren Problemen gut alleine zurecht. Gerade legte sie ihre Handtasche auf den Tresen, nahm ihre Geldbörse heraus und schob ein paar Scheine hinein.
Vielleicht hatte jemand vom Bankpersonal Nora hierher bestellt, um ihr den Auftrag am Schalter zu übermitteln. Aber an welchem? A, B oder C? Der Angestellte links war damit beschäftigt, Hagen zufrieden zu stellen, die tamilische Schalterangestellte in der Mitte war ganz in die Auflösung des 123fränkigen Kontos vertieft, und diejenige am rechten Schalter arbeitete den Neuling ein. Dieser allerdings schaute sich immer wieder um. Er schien alles in sich aufzusaugen, blickte zu Nora, zum Wachmann, zu den Kunden, dann wieder zu seiner Vorgesetzten, die ihm etwas erklärte. Nora schätzte ihn auf kaum zwanzig. Mit seinen dunklen Haaren mochte er Süditaliener oder Spanier sein oder aus dem Balkan stammen. Ob er Schwierigkeiten an seiner neuen Stelle hatte und Noras Hilfe brauchte?
Plötzlich riss er die Augen auf und starrte zum Eingang.
Nora fragte sich, was in ihn gefahren sein mochte. Dann wurde sie jäh aus ihren Gedanken gerissen.
Ein Schrei hallte durchs Gebäude.
Nora schnellte herum und bemerkte, wie der Wachmann eine ruckartige Bewegung machte.
Laute Schritte ertönten. Etwas Dunkles prallte gegen die Glastür, jemand fluchte. Zwei schwarz gekleidete Männer stürmten in die Bank. Der eine, ein athletischer Typ mit Rucksack, trug eine Frankenstein-Maske mit blutunterlaufenen Augen. Der andere war dünn und schlaksig, sein Gesicht wurde von einer Dracula-Maske mit spitzen Eckzähnen verdeckt. Das Ganze ging so schnell und wirkte so abstrus, dass Nora nervös herauslachte. Erst dachte sie an Halloween, dann an Filmaufnahmen.
Bis die beiden Männer ihre Pistolen zückten.
Und Nora die 9-Millimeter-Taurus erkannte.
Sie hielt den Atem an. In Fernsehkrimis war dies die Stelle, wo normalerweise geschrien und gekreischt wurde, doch hier herrschte Totenstille. Die Kunden und Angestellten waren erstarrt. Mit grossen Schritten preschten die Maskierten auf den Security-Mann zu. Dieser griff nach seiner Walther P22. Der eine riss sie ihm aus der Hand und schlug sie ihm auf den Kopf. Stöhnend sank der Uniformierte zu Boden. Der Mann mit der Frankensteinmaske schaute zu den Überwachungskameras hoch, feuerte mehrere Schüsse ab, bis alle zerstört waren. Dann lief er zur alten Dame und hielt ihr die Pistole an den Kopf. «Keiner bewegt sich! Sonst blas ich der Lady das Hirn aus dem Schädel! Kapiert?» Die Worte klangen gedämpft unter der Maske hervor.
Die Frau wurde bleich.
Die Rastalockige drückte ihren Hund an sich, der den Schwanz eingezogen hatte und sich hinter seinem Frauchen versteckte.
Frankenstein herrschte sie an: «Kapiert?»
Sie nickte.
«Du auch!» Er starrte Nora an. Nora sah durch die Maskenschlitze seine dunklen Augen. «Komm her! Sofort! Ich will euch alle im Blick haben! Stellt euch in eine Gruppe!» Er deutete mit der Pistole auf einen Punkt vor sich. Die Leute versammelten sich ängstlich. Nora schloss sich ihnen an.
«Okay. Keinem passiert was, wenn ihr ruhig bleibt. Das ist eine Sache von zwei Minuten.» Er überliess seinem Kumpanen das Bewachen der Gruppe und hechtete zum Schalter C, schwang sich über die Glastrennwand auf die andere Seite des Tresens. «Pfoten weg!», schrie er der blonden Angestellten zu, die anscheinend versucht hatte, den Alarmknopf zu drücken.
Die Frau verharrte reglos, ihr Blick ein einziges Entsetzen.
Nora starrte zum Ausgang.
«Denk gar nicht daran!», fuhr der Dracula-Kerl sie an.
Er scheuchte alle zusammen und befahl: «Legt euch hin!»
Als sie zögerten, schrie er: «Wird’s bald! Auf den Boden mit euch!»
Nora wünschte, sie hätte ihre Smith & Wesson dabei gehabt. Doch heute morgen hatte sie keinen Grund gehabt, die Pistole mitzunehmen. Sie legte sich auf den Bauch. Die anderen taten es ihr nach. Die ältere Dame brauchte etwas länger.
«Und jetzt die Arme auf den Hinterkopf! Na los!»
Die Kunden gehorchten.
Nora warf einen Blick zum Security-Mann. Um ihn hatte sich eine kleine Blutlache gebildet. Seine Augen waren geschlossen, doch er atmete. Dracula hielt seine Waffe in der Hand und steckte die des Sicherheitsmannes in seinen Hosenbund. Er stellte sich vor die Leute und zielte abwechselnd auf den einen, dann den anderen.
Währenddessen forderte Frankenstein alle drei Schalterangestellten auf, ihre Notenschubladen zu öffnen. Er nahm aus seinem Rucksack eine Sporttasche, entfaltete sie und zog den Reissverschluss auf. Der junge Angestellte von Schalter C nutzte die Gelegenheit, bewegte sich unauffällig zur Seite, als suche er den Notknopf.
«Du da!», fauchte Frankenstein. «Wie heisst du?»
Der andere zuckte zusammen und zog seine Hand zurück. «Bashkim Rahmani.»
Frankenstein drückte ihm die Pistole in die Wange. «Ein Albaner. Willst du den heutigen Tag überleben, Bashkim Rahmani?»
Dieser nickte.
«Dann beweg deinen Arsch zu den anderen und leg dich hin!»
Rahmani schielte auf den Lauf der Pistole, der sich in seine Haut bohrte, verliess den Schalterbereich durch einen Seitendurchgang und ging auf die Mitte der Schalterhalle zu.
«Runter mit dir!», empfing ihn Dracula und wies ihn an, sich neben die Rastalockige zu legen.
Rahmani tat es.
Der Hund winselte. Die Frau versuchte flüsternd, ihn zu beruhigen.
Nora spürte die Kälte des Bodens an ihrer Wange. Sie suchte Blickkontakt, erkannte die Angst in den Augen des Geschäftsmannes, die Empörung der alten Dame, den Trotz des jungen Albaners. Im Moment konnte sie nichts anderes tun, als die Anweisungen der Bankräuber zu befolgen. Es war nicht der Zeitpunkt für tollkühne Aktionen. Die Täter hatten kein Motiv, jemanden zu töten, da niemand ihre Gesichter gesehen hatte. Wenn sie Glück hatten, war das Ganze tatsächlich in zwei Minuten überstanden. Dennoch raste Noras Herz, und ihr Mund war staubtrocken. Sie wagte kaum zu atmen. Ein Gedankte drängte sich ihr auf: Wer war ihr Auftraggeber? Was wollte man von ihr? War dies ein unglaublicher Zufall, oder hatte ihr geplantes Treffen etwas mit diesem Bankraub zu tun?
Der Sicherheitsmann stöhnte und öffnete langsam ein Auge. Unbeholfen tastete er nach seinem Funkgerät. Dracula riss es aus seinem Gürtel und kickte es gegen die Wand, wo es zersplitterte. Der athletische Maskierte stiess die drei Schalterbeamten, nachdem die Geldschubladen offen waren, zur Gruppe und befahl ihnen, sich ebenfalls hinzulegen. Dann riss er ein Geldbündel nach dem anderen aus den Schubladen und stopfte sie in die Sporttasche.
Da griff der Schalter-A-Bankangestellte nach seinem Handy.
Dracula bemerkte es. «Her damit!»
«Entschuldigung», sagte der Banker leise und schob ihm das Mobiltelefon zu. Nora sah, wie er zitterte.
Der Bankräuber nahm es und warf es in die Ecke, in der schon das Funkgerät in seinen Einzelteilen lag. «Hast du Angst?»
«Ja.»
«Das solltest du auch, Mann! Versuch hier nicht, den Helden zu spielen. Nochmal so was und du bist tot. Dein Name?»
Der Angestellte murmelte etwas.
«Ich hab dich nicht verstanden, Mann! Red lauter!»
«Furrer. Reto Furrer.»
«Hast du Kinder?»
«Ja.» Er schaute zu Boden. «Eine Tochter.»
«Soll sie ohne Vater aufwachsen?»
Furrer schwieg.
«Ich hab dich was gefragt.»
Nora litt mit dem Mann, der mit Tränen in den Augen flüsterte: «Nein, sie soll ihren Vater nicht verlieren.»
«Und an wem liegt das?»
«An mir», gab Furrer kläglich zurück.
«Ich seh, du hast kapiert.» Dracula fuchtelte mit der Waffe herum. «Das gilt für euch alle! Eine falsche Bewegung und ihr kriegt eine Kugel ab! Wenn ihr tut, was wir sagen, seid ihr uns in Kürze los.»
Niemand rührte sich.
Nur das Scheppern der Schubladen und das Rascheln der Geldbündel, die der Räuber mit der Frankensteinmaske in die Tasche stopfte, waren zu hören. Nora atmete flach. Sie hatte ihren Kopf auf die linke Seite gelegt und schaute die alte Dame an, die ihren Blick erwiderte. Wache, hellblaue Augen hinter einer feinrandigen Brille. Nora nahm keine Panik in ihrem Gesicht wahr, sondern einen eindrücklichen Lebenswillen. Die Dame würde an dieser Situation nicht zerbrechen.
Nora blickte weiter nach hinten und beobachtete den Bankräuber, der die Kassen leerte. Er bewegte sich geübt und locker. Ein Sportler. Einer, der bestimmt bereits vor diesem Raub kriminell gewesen war. Vielleicht kleinere Sachen. Betrug, Diebstahl, Einbruch. Ganz klar war dies nicht sein erstes Mal. Er war derjenige, der den Coup geplant hatte. Nora hatte keine Ahnung, wie sie darauf kam, aber sie war sich sicher. Frankenstein war das Hirn, Dracula der Ausführende.
Ein unterdrücktes Schluchzen war zu hören. Es kam von Hagen, dem deutschen Geschäftsmann.
«Halt die Schnauze!», brüllte sein Bewacher.
Doch der Mann konnte seine Gefühle nicht mehr zurückhalten und weinte nun lauter.
«Ich hab gesagt, Klappe halten!» Der Maskierte marschierte auf Hagen zu, richtete die Pistole auf ihn und drückte ab.
Der Knall war ohrenbetäubend. Die Kugel traf den Boden eine Handbreit neben dem Geschäftsmann. Dieser zuckte wie von einem Blitz getroffen zusammen und verstummte. Die kommenden Stunden würde er taub auf dem rechten Ohr sein.
«Das nächste Mal ziel ich genauer!», brüllte Dracula.
«Was machst du für einen Scheiss?», schrie Frankenstein von hinten seinen Kumpel an. «Halt die Leute ruhig und reiss dich verdammt noch mal zusammen!»
«Der Typ hat geplärrt wie ein Kind», verteidigte sich Dracula, «so was ertrag ich nicht. Da denk ich mir – »
«Hör auf zu denken und mach deinen Job!», rief Frankenstein und stopfte weiter gebündelte Geldscheine in die Tasche.
Nora schaute zur Uhr. Es waren gerademal drei Minuten verstrichen. Doch bei den Betroffenen würde sich dieses Erlebnis einbrennen, als wären es Jahre gewesen. Nora wusste das. Sie wusste, was traumatische Situationen mit einem Menschen machen konnten. Sie hatte, als sie noch bei der Polizei arbeitete, täglich mit Opfern von Gewalt zu tun gehabt. Viele waren für den Rest ihres Lebens gezeichnet. Doch einige wurden erstaunlicherweise stärker, in ihnen steckte eine Auflehnung gegen die Bedrohung, die sie selbst überraschte.
Der athletische Räuber hatte seine Tasche vollgepackt. Er schwang sich über den Schaltertresen: «Lass uns verschwinden!»
Er lief um die tamilische Bankangestellte, warf einen kurzen Blick auf Nora, stutzte, als sähe er sie zum ersten Mal richtig. Und erstarrte. Durch den Schlitz der Maske bohrte sich sein Blick in den ihren. Langsam kam er auf sie zu, bewegte sich geschmeidig wie ein Panther.
Noras Puls raste. Das maskierte Gesicht kam näher. Sie roch sein Aftershave, sah das Aufblitzen in seinen Augen.
Ganz leise, fast kindlich erstaunt, und gleichzeitig eiskalt, flüsterte er: «Nora Tabani?»
09:07
Bashkim schaute zu seiner Vorgesetzten. Ihre Gesichter lagen nur eine Armlänge voneinander entfernt auf dem kalten Marmor. Barbara Zinks Brille war verrutscht, ihr Lippenstift verschmiert. Er hörte ihren flatternden Atem, der nach Pfefferminze roch.
Hatte sie gesehen, was er getan hatte? Ihr Blick wanderte unruhig hin und her. Dann, als sie sicher war, nicht beobachtet zu werden, nickte sie ihm mit der Andeutung eines Lächelns zu. Ja, sie wusste es! Sie hiess es gut. Darüber war er froh. Einen Moment lang hatte er befürchtet, er hätte schon am ersten Arbeitstag das Falsche gemacht und sie alle in Gefahr gebracht. Kurz bevor der Kerl mit der Frankensteinmaske ihn nach seinem Namen gefragt hatte, war es Bashkim gelungen, den stillen Alarm unter der Tischplatte zu betätigen. Dieser wurde direkt an die Nummer 117 geleitet. In wenigen Minuten würde es hier von Polizisten wimmeln, und dieser Albtraum hätte ein Ende. Die Täter würden gefasst und ins Gefängnis gesteckt, und er, Bashkim, wäre der Held des Tages. Frau Zink würde ihn immer mit Respekt behandeln, wissend, dass sie ihm ihr Leben verdankte, morgen erschiene vielleicht ein Artikel über den «mutigen, jungen Kosovo-Albaner» im «Tages-Anzeiger», womöglich käme sogar das Fernsehen. Mam wäre stolz auf ihn, und Pap würde beiläufig sagen, von seinem Jungen habe er nichts anderes erwartet. Das war das Schönste für Bashkim, die Selbstverständlichkeit, mit der sein Vater immer das Beste von ihm annahm. Nie hatte es geheissen «das kannst du nicht» oder «dazu taugst du nicht». Bashkim war mit dem Gefühl aufgewachsen, in ihm stecke Grosses, und wenn er sich anstrenge, könne er fast alles erreichen.