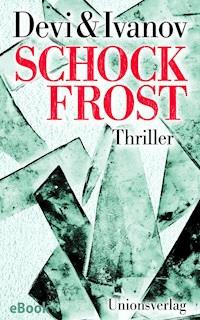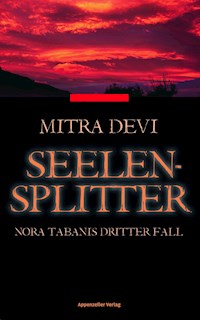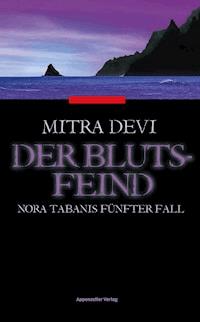Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Appenzeller
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Drei Tage vor Heiligabend in der Stadt Zürich. Die neunjährigen Zwillinge Lukas und Lorena werden aus ihrem Elternhaus am Zürichberg entführt. Die Kidnapper verlangen Lösegeld. Verzweifelt wenden sich die Eltern an die Zürcher Privatdetektivin Nora Tabani. Am selben Tag kommt am Bahnhof Stadelhofen ein junger Mann zu sich, der niedergeschlagen wurde und nun unter einer Amnesie leidet. Auf der Suche nach sich selbst irrt er durch die Stadt. Als sein Gedächtnis langsam zurückkehrt, ahnt er Schreckliches: Ist er einer der Kidnapper? Während
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 356
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mitra Devi
FILMRISS
Mitra Devi
FILMRISS
Nora Tabanis zweiter Fall
Appenzeller Verlag
Die Autorin dankt der
Kulturförderung Uster für den Werkbeitrag.
1. Auflage, 2009
© Appenzeller Verlag, CH-9101 Herisau
Alle Rechte der Verbreitung,
auch durch Film, Radio und Fernsehen,
fotomechanische Wiedergabe,
Tonträger, elektronische Datenträger und
auszugsweisen Nachdruck sind vorbehalten.
Umschlaggestaltung: Anna Furrer
ISBN Buch: 978-3-85882-500-1
ISBN eBook: 978-3-85882-588-9
www.appenzellerverlag.ch
eBook-Herstellung und Auslieferung: HEROLD Auslieferung Service GmbHwww.herold-va.de
1
Der Geschmack von Blut in seinem Mund holte ihn aus der Bewusstlosigkeit. Kopfschmerzen, stechend wie Blitze, jagten von seinem Nacken quer über den Schädel bis zur Schläfe und trieben ihm die Tränen in die Augen. Wo zum Teufel war er?
Irgendjemand hatte ihn mit einem harten Gegenstand niedergeschlagen, das wusste er noch. Verschwommen erinnerte er sich an matschiges, braunes Laub auf dem Asphalt, das plötzlich viel zu schnell nähergekommen war, und an den dumpfen Aufprall, als seine Stirn auf dem Boden aufschlug. Dann war es schwarz um ihn geworden.
Warum war es immer noch stockfinster?
Einen Moment lang befürchtete er, erblindet zu sein. Da entdeckte er einen schmalen Lichtstreifen am Boden. Das Pochen in seinem Kopf machte es ihm unmöglich, einen klaren Gedanken zu fassen. Er wollte die Lichtquelle berühren, doch seine Arme liessen sich nicht bewegen. Eine Welle von Angst überrollte ihn, als er merkte, dass seine Hände hinter seinem Rücken gefesselt waren. Seine Füsse waren straff zusammengeschnürt und an seinen verkrümmt sitzenden Leib gebunden, so dass er seine Beine nicht strecken konnte.
Er versuchte, um Hilfe zu schreien, doch er brachte keinen Ton heraus. Irgendetwas presste seinen Mund zusammen, verklebte seine Wangen, seinen Kiefer, seine Haare. Es fühlte sich an wie ein Klebeband, das um seinen ganzen Kopf gewickelt war. Panik überwältigte ihn.
Mit grösster Anstrengung rutschte er auf seinem knochigen Hintern etwas nach rechts und stiess mit der Schulter an eine metallene Wand. Links dasselbe. Über ihm, unter ihm, rings um ihn Metallwände. Er sass wie ein Tier in einem stählernen Käfig, in dem es nach seinem eigenen Schweiss roch.
In diesem Augenblick hörte er weit entfernt eine Stimme irgendetwas von «Verspätung» und «Entschuldigung» sagen, Worte, die in seinem matten Hirn keinen Sinn ergaben. Er wand sich in den Stricken, warf sich hin und her, wollte sich befreien, doch sein Bewegungsradius betrug nicht mehr als ein paar Zentimeter. Er rammte die Wand, schlug seinen Hinterkopf ans Metall, versuchte, seiner Verzweiflung Herr zu werden, einen Ton von sich zu geben, doch alles, was er zustande brachte, war ein dumpfes Grunzen. Irgendjemand musste ihn doch hören, musste ihn aus dieser unsäglichen Lage befreien! Die Luft wurde muffiger und dünner, er würde in diesem verdammten Loch ersticken, wenn nicht bald jemand käme!
Wieder ertönte aus der Ferne die Stimme. Sie klang wie aus einem Lautsprecher: «Die S 12 Richtung Brugg hat fünf Minuten Verspätung. Wir bitten um Entschuldigung.»
Die Einsicht traf ihn wie ein Hammer.
Die Metallwände. Die Dunkelheit. Die Enge. Mit einem Schlag wurde ihm klar, dass er in einem Gepäckschliessfach eines Bahnhofs eingesperrt war.
Das Klebeband dämpfte den Schrei, der sich seiner Brust entrang, zu einem kläglichen Winseln.
Nora Tabani räkelte sich wohlig in ihrem warmen Bett und versuchte, den Anschluss an ihren abrupt unterbrochenen Traum wieder zu finden, dann gab sie auf. Irgendetwas hatte sie geweckt. Sie erinnerte sich verschwommen, im Halbschlaf eine Krankenwagensirene gehört zu haben, die sich eine Weile lang optimal in ihren Traum eingefügt hatte, bis das Geheul zu aufdringlich wurde. Oder hatte sie das auch nur geträumt? Sie linste aufs Zifferblatt ihres Weckers. Sieben Uhr morgens und noch dunkel. Durch den Fensterspalt drang die Winterkälte. Sie fröstelte.
Jetzt, wo sie hellwach war, konnte sie auch gleich aufstehen, Sonntag hin oder her. Sie schlug die Decke zurück, tapste barfuss zum Fenster, schloss es und drehte die Heizung auf. Auf dem Tisch fand sie ein halbes Glas Orangensaft und trank es aus. Es schmeckte schal. Einen Moment stand sie unentschlossen zwischen der offenen Küche und dem einzigen Zimmer ihrer Mansarde und schaute an ihren Beinen hinunter, die in einem schlabbrigen, blauen Männerpyjama steckten.
Sie hätte darauf gewettet, dass heute etwas Besonderes passieren würde. Irgendwie spürte sie das. Eine unerklärliche Ahnung, die sie allerdings fast täglich heimsuchte, wenn sie es sich genau überlegte. Der Lockruf des Abenteuers. Sie grinste vor sich hin und erlaubte sich eine halb verschlafene Tagtraumszene, in der sie die Welt vor Betrügern und Ganoven rettete. Meistens wurde es ja doch nur ein öder Tag, an dem sie Rechnungen bezahlte, Spam-Mails löschte und hoffte, jemand würde ihre Dienste als Detektivin in Anspruch nehmen. Einen einzigen wirklich grossen Fall hatte sie bis jetzt gehabt. Einen, der sie beinahe das Leben gekostet hatte. Unwillkürlich berührte sie die Narbe an ihrem Hinterkopf, die sich noch immer etwas höckerig anfühlte. Deutlich spürte sie die sieben Stiche, mit denen die Wunde genäht worden war. Das ausrasierte Haar war inzwischen wieder etwas nachgewachsen, doch die Haut war immer noch empfindlich.
Das höchste der Gefühle in letzter Zeit war ein eifersüchtiger Ehemann gewesen, der sie angeheuert hatte, seine untreue Gattin zu bespitzeln. Noras Kasse war so bedrohlich leer gewesen, dass sie all ihre Bedenken über Bord geschmissen und den Auftrag angenommen hatte. Um nach gründlichen Recherchen herauszufinden, dass sich die Dame nicht auf unkeuschen Wegen befand, sondern ihre freien Abende in einer teuren Privatschule verbrachte, um chinesische Kalligraphie zu lernen. Allerdings nannte der werte Gemahl seit vielen Jahren eine Geliebte sein Eigen. Aber das war ein anderes Thema und füllte Noras Kasse auch nicht wirklich.
So viel zu Abenteuer und Errettung der Welt. Nora gähnte noch einmal ausgiebig, dann ging sie ins Badezimmer.
Er wusste nicht, wie lange er schon in diesen stählernen Sarg eingepfercht war, es schienen ihm Tage zu sein, doch war es vielleicht nicht einmal eine Stunde. Sein linkes Bein war von der Leiste abwärts taub, sein rechtes war gerade dabei, sich zu verabschieden – es kribbelte wie tausend Ameisen. An seinem Kinn klebte vertrockneter Rotz vom Weinen. Natürlich hatte er geweint, verdammt noch mal, so gut es geknebelt eben ging. Sah ja keiner hier drin, und wenn, wär’s ihm auch egal gewesen. Die Platzangst, die Atemnot und die Finsternis machten ihn fast wahnsinnig. Wenn er die Kerle zu fassen kriegte, die ihn hierher verfrachtet hatten, würde er sie umlegen. Solche wie die hatten nichts Besseres verdient. Daran, dass es mehrere gewesen waren, nein, zwei, um genau zu sein, erinnerte er sich plötzlich wieder. Einer war so ein megacooler Typ gewesen, hatte eine schwarze Brille und einen schwarzen, fledermausähnlichen Mantel getragen. Der andere war kahlgeschoren gewesen, mit den tätowierten Worten «born to fight» auf seinem grobporigen Hals. Wer waren die beiden? Was wollten sie von ihm? In welcher Scheisse steckte er da bloss?
Er bewegte sich millimeterweise, versuchte, mit seinen Füssen an die Gepäckfachtür zu treten, zu hämmern, irgendeinen Lärm zu veranstalten, doch es klappte nicht. Der Strick, der seine Waden an die Oberschenkel und diese an seinen Bauch presste, war erbarmungslos geschnürt. Sein Arsch schmerzte vom harten Boden, auf dem er sass. Verzweifelt dachte er nach, wollte weitere Erinnerungen hervorkramen, doch es kam immer nur das gleiche Bild: die beiden Männer – Fledermaus und Kahlkopf – die ihn anstarrten, der schwarze Schlagstock in der Hand des Tätowierten und das feuchte Laub auf dem Asphalt, in das er kopfvoran knallte. Dann der Filmriss.
Was war vorher gewesen? Wie war er an die beiden Typen geraten – oder sie an ihn? Wo hatte er sie getroffen? In einem Hinterhof, auf einem Parkplatz? Er zermarterte sich das Hirn, versuchte, seinem Unterbewusstsein weitere Bilder zu entreissen, Fragmente, Puzzleteile, irgendetwas. Doch da war nichts. Er sah keine Strasse, die er begangen, keine Wohnung, die er verlassen hatte, kein Bett, dem er morgens entstiegen war. Er fand keine Gesichter – keine Eltern, Geschwister oder Kinder. Keine Freunde, keinen Job, keine Stadt, in der er lebte. Die Erkenntnis, dass er nicht einmal seinen Namen wusste, traf ihn wie ein Fausthieb.
Wer um alles in der Welt war er?
Klaffende Leere. Totalausfall. Er wusste es nicht. Das konnte nur eins bedeuten: Diese gottverdammten Kerle hatten ihm sein Gedächtnis aus dem Hirn geprügelt. Das Ganze war ein einziger Alptraum.
Nora duschte, wusch sich die Haare, zog ihren bequemen Trainingsanzug an und stellte sich ein bescheidenes Frühstück zusammen. Viel war es nicht. Etwas trockenes Brot, ein Rest Appenzellerkäse, eine Banane, die schon leicht ins Bräunliche überging. Wieder einmal hatte sie vergessen, beizeiten einzukaufen. Sie öffnete das Marmeladeglas und schnupperte daran. Aprikose, am Rand schon leicht… nun ja, komisch. Sie stellte es zurück in den Kühlschrank. Einen Moment dachte sie daran, im Coop beim Bahnhof Stadelhofen frische Brötchen zu besorgen, der hatte auch am Sonntagmorgen geöffnet. Zu Fuss wäre sie in einer Viertelstunde dort gewesen. Doch sie entschied sich dagegen. Zu früh, zu kalt, zu dunkel. Es musste reichen für heute. Wenigstens war der Kaffee frisch. Sie braute sich eine starke Tasse, ohne Zucker, ohne Milch, und das wunderbare italienische Aroma weckte ihre Lebensgeister.
Er fühlte sich sterbenselend. War es der Sauerstoffmangel, die zusammengeklappte Haltung, die Angst? Sein ganzer Körper brannte, Ströme von glühender Lava pulsierten in seinen Adern. Sein Rücken war hart, in Beton gegossener Schmerz, sein Gaumen ausgetrocknet.
Plötzlich zupfte ihn etwas am Schnürsenkel. Das war keine Einbildung – ein mehrmaliger Zug an seinem rechten Schuh, dann ein Loslassen. Kurze Pause. Zupfen. Pause. Zupfen.
Ratten!, dachte er im ersten Moment. Die Bastarde haben mich mit hungrigen Ratten eingesperrt, die mich anknabbern und bei lebendigem Leib fressen sollen.
Da war es wieder! Nein, das waren keine Ratten. Irgendetwas riss an seinem Schuh. Er gab einen leichten Gegendruck, zog sein Bein ein winziges Stück zu sich heran, mehr ging nicht, doch es reichte. Das Zupfen wurde stärker. Nun hörte er ganz deutlich eine Frauenstimme, die mit leicht ungeduldigem Unterton sagte: «Lass das sein, Lea, du machst dich nur schmutzig.»
Ein Kind!, dachte er aufgeregt. Die beiden Typen hatten ihn wohl so eilig ins Schliessfach reingepfercht, dass sie ein Stück Schnürsenkel, das herauslugte, übersehen hatten. Aber ein Mädchen hatte es entdeckt – dem Himmel sei Dank für die kleine Lea! Hier bin ich!, wollte er schreien, holt mich raus! Doch er brachte nur dumpfe Töne hervor, die wie Hundeknurren klangen. Er wand sich hin und her, versuchte alles, was irgendein Geräusch verursachte, grunzte, brummte, zerrte an seinen Stricken, doch es war viel zu wenig laut.
Das Zupfen hörte auf, die Frauenstimme sagte: «Komm jetzt endlich, Lea», entfernte sich dann, und er hätte heulen können vor Enttäuschung.
Der Schweiss rann ihm von der Stirn, lief in seine Augen. Er wollte aufgeben und sterben, dann bäumte sich etwas in ihm auf. Nein, draufgehen in dieser metallenen Schachtel, diesen Triumph gönnte er den beiden Typen nicht, wer immer sie waren. Er würde kämpfen, weiterleben, sich rächen.
Da war es wieder. Ein kurzes Ziehen an seinem Schuh. Er zog ihn mit einem Ruck zurück. Es musste gereicht haben, der Schnürsenkel war drin.
«Siehst du, Mama!», hörte er eine helle Kinderstimme sagen.
«Was ist denn los? Es ist immer das Gleiche mit dir!» Die Frau war genervt und würde sich keine Sekunde länger hier aufhalten, das spürte er.
«Da drin lebt was», sagte das Mädchen.
«Ach Quatsch! Nun komm endlich.»
Er konnte die Frau beinah vor sich sehen, wie sie ihre Lea von den Schliessfächern wegziehen wollte.
«Da drin lebt was und will raus», beharrte das Kind, «ich schwör’s, ich hab’s gesehen!»
Die Mutter wurde laut und sagte: «Ohne Luft kann dort nichts überleben», was ihm einen Stich versetzte. Sie hatte recht, verdammt! Das Mädchen murrte, ein Zank entstand, bei dem die Erwachsene die Oberhand gewann. Die Kleine setzte zu einem Geheul an, hörte mittendrin auf. Ein Schlag war zu hören, wahrscheinlich hatte sie gegen die Schliessfachtür getreten. Die Stimmen entfernten sich, wurden undeutlich und dünn. Danach war es still. Still wie in einem Grab.
Das durfte doch nicht wahr sein! Voller Verzweiflung schlug er seinen Kopf an die Metallwand, wieder und immer wieder. Dann sank er erschöpft in sich zusammen.
Wie lange es gedauert hatte, bis er ein Hantieren an der Schliessfachtür vernahm, konnte er im Nachhinein nicht sagen, vielleicht waren es nur Minuten gewesen. Aber es waren die längsten Minuten seines Lebens, so viel war sicher, auch wenn sich sein bisheriges Leben in einer einzigen Bildsequenz erschöpfte, die darin gipfelte, dass er bewusstlos geschlagen wurde.
Es klickte. Ein Schlüssel wurde umgedreht, die Tür geöffnet. Helligkeit blendete ihn. Eine Frau mit kirschrot geschminkten Lippen, ein Mädchen, das eine grüne Mütze trug, und ein Bahnangestellter standen auf einem verwaisten Perron und starrten ihn entsetzt an. Schon liefen ihm wieder die verdammten Tränen hinunter, vor Erleichterung, vor Erschöpfung, vor Wut. Hände griffen nach ihm, halfen ihm auf, zerschnitten seine Stricke. Er riss sich mit halb tauben Fingern die Kleberolle vom Mund, torkelte wie ein Betrunkener auf eingeschlafenen Beinen weg von seinem Gefängnis und erbrach sich über ein Fahrrad, das an einer Mauer lehnte.
2
Nachdem Nora fertig gefrühstückt hatte, kam Gregor, ihr Chamäleon, an die Reihe. Sie füllte den Fressnapf in seinem Terrarium mit appetitlichen Heuschrecken, das Trinkgefäss mit frischem Wasser und brachte etwas Ordnung in seine Umgebung. Die Kletterwurzel schob sie mehr nach rechts und verteilte die künstlichen Lianen strategisch besser unter dem Glasdach.
Gregor dankte es ihr mit Nichtbeachtung. Er hatte sich am höchsten Ast festgekrallt, seine Glupschaugen starrten bockig geradeaus, sein grün-gelber Nasenhöcker ragte arrogant zum Himmel. Nora seufzte. Ihr Chamäleon hatte einen etwas schwierigen Charakter. Aber sie war zuversichtlich, irgendwann würde Gregor schon auftauen. Bis dann hiess es durchhalten und an der Einseitigkeit der Beziehung nicht verzweifeln.
Er keuchte, japste nach Luft, wischte sich den Mund mit dem Ärmel ab, hörte die besorgten Stimmen der Frau und des Bahnarbeiters, vernahm das Wort «Polizei» und wusste mit absoluter Sicherheit, dass er damit nichts zu tun haben wollte. Er schüttelte benommen den Kopf, brachte ein heiseres «keine Bullen, alles in Ordnung» hervor, das bei den beiden ungläubiges Staunen auslöste. Noch immer hielten sie ihn fest, sprachen beruhigend auf ihn ein, der Bahnarbeiter zückte sein Handy und machte Anstalten zu telefonieren. Alles drehte sich vor seinen Augen. Er stiess die helfenden Arme von sich, schrie «lasst mich endlich in Ruhe!» und wankte dem Perron entlang.
Wo war er?
Kleiner Quartierbahnhof, drei Geleise, die in beiden Richtungen in einem Tunnel verschwanden, moderne Architektur. Zwischen stählernen, geschwungenen Trägern, die eine gewölbte Betondecke trugen, las er die weisse Schrift auf blauem Grund: Zürich Stadelhofen.
Nie gehört.
Zürich, das wusste er, lag in der Schweiz, diese in Europa, das sich von Lappland bis Portugal, von Island bis Griechenland zog; sieben mal sieben war neunundvierzig; die drei Grundfarben waren rot, blau und gelb; die Beatles hatten sich 1970 getrennt; die Titanic war gesunken, der Himalaya 8846 Meter hoch, und Wale waren Säugetiere und keine Fische. Alles noch da. Alles, ausser ihm selbst.
Er griff in seine Hosentasche. Kein Ausweis, kein Name. Etwas Kleingeld fand er, ein Stück Schnur, ein Taschentuch, an dem Blut klebte, eine Streichholzschachtel und eine zerknautschte Packung Marlboro.
Er stolperte eine Rolltreppe hinunter, welche in eine Art Einkaufsstrasse unter dem Bahnhof führte, kam an einer Boutique mit farbigen Winterjacken vorbei, einem hell erleuchteten Coop, aus dem es nach frischen Backwaren roch. Vor dem Eingang lagen zwei leere Coladosen. Alle anderen Geschäfte waren geschlossen, der Kiosk, die Kleiderreinigung, die Buchhandlung. Die Schaufenster waren voll mit Weihnachtsdekorationen, überall glänzende Kugeln, goldene Sterne, kleine, kitschige Christbäumchen, auf denen fette Engel sassen und Nikoläuse aus Schokolade. Doch kein Mensch ausser ihm in diesem ausgestorbenen Untergeschoss. War heute Weihnachten? Oder Silvester?
Und warum hatte er solche Schmerzen? Überall, am ganzen Körper. Jetzt hatte er doch genügend Sauerstoff. Hatten ihn die beiden Schläger so übel zugerichtet? Er brauchte eine öffentliche Toilette, musste sich anschauen, seinen Körper kontrollieren, Wasser trinken. Eine dunkle Welle schwappte in ihm hoch, und er brauchte einen Moment, bis er merkte, dass es Angst war. Irgendetwas war ganz und gar nicht in Ordnung. Er lief im Kreis, sah sich um, eilte an einem Kopiergeschäft vorbei und einem Coiffeursalon, an dessen Glastür orthographisch falsch stand, man könne sich auch ohne Anmeldung die Haare schneiden lassen. Während er das WC suchte, fragte er sich, weshalb ihn die Orthographie interessierte. War er womöglich Lehrer? Kaum, er fluchte zu viel, Scheisse noch mal. Er irrte weiter, schaute in die Auslagen der Läden, die Seite an Seite aneinandergereiht und mit Unwichtigem und Unnötigem gefüllt waren für einen, der nicht wusste, wer er war.
Dann fand er die Herrentoilette. Drei Waschbecken, weisse Kacheln. Er eilte auf den Spiegel zu. Und blickte in ein vollkommen fremdes Gesicht. Das erschütterte ihn zutiefst. Irgendwie hatte er erwartet, dieser ganze Horror würde sich augenblicklich auflösen, wenn er nur wieder sein vertrautes Äusseres gesehen hätte. Die Gedächtnislücke würde sich als kurzer, aber verständlicher Aussetzer herausstellen, entstanden in einer aussergewöhnlichen Situation, der er zum Glück entronnen war. Er würde heimkehren zu Frau und Kindern, sich im Büro bei seinem Boss für sein Fehlen entschuldigen und den Alltag wieder in den Griff kriegen.
Doch dieses Gesicht, das ihn anstarrte, war nicht das Gesicht eines zufriedenen Ehemannes und Vaters, nicht das eines Büroangestellten – es war eine bleiche, totenkopfähnliche Maske eines Kerls Ende zwanzig. Eingefallene Wangen, tiefe Augenringe, ausgetrocknete, spröde Lippen. Er sah aus wie einer, der direkt aus der Unterwelt kam.
Er fuhr sich mit den Fingern über seine Bartstoppeln, strich durch seine strähnigen, maisgelben Haare und konnte den Blick nicht von diesen Augen lassen. Er weigerte sich, sie als die seinen anzuerkennen. Dieser Mann im Spiegel war nicht er! Das war ein Fremder, ein Niemand. Er befeuchtete seine Hände, wischte sich das Blut vom Kopf und zuckte zusammen. Auf seiner Stirn klaffte eine hässliche Delle.
«Darf ich mal, bitte!», drängte ein älterer Herr, der eingetreten war, und drehte den Wasserhahn auf. «Andere wollen sich auch mal die Hände waschen», fuhr er fort, sah ihn mit einer Mischung aus Mitleid und Abscheu an und fügte hinzu: «Täte Ihnen auch gut.»
«Tut mir leid. Ich… ich weiss nicht, wer ich bin.» Als würde das seinen Zustand erklären. Er musste sich idiotisch anhören.
Doch es entlockte dem Älteren ein Schmunzeln. «Ja, ja, ich weiss, was Sie meinen, geht mir manchmal auch so.» Das Lächeln erstarb so schnell, wie es entstanden war, so, als hätte er dieser seltsamen Vogelscheuche schon zu viel Freundlichkeit entgegengebracht. Der Herr trocknete sich die Hände und verliess die Toilette.
Nun war er, der Namenlose, wieder allein. Seine Schmerzen wurden immer schlimmer. Er zitterte, sein Körper zog sich krampfhaft zusammen. Was um alles in der Welt war los mit ihm? Er sah nicht nur furchtbar aus, er fühlte sich auch furchtbar. Er war krank, das musste es sein. Mit einem Mal war er überzeugt, an Diabetes zu leiden und ohne Insulin zu sterben. Natürlich! Er war komplett unterzuckert. Daher diese Schmerzen. Er musste eine Apotheke aufsuchen, dringend. Hatte er erst mal sein Insulin, würde er wieder klar denken können und seine Erinnerungen zurückbekommen.
Er quälte sich die Rolltreppe hoch, verliess den Bahnhof und warf einen Blick auf die Uhr gegenüber: Es war halb neun. Welcher Monat? Welches Jahr? Jedenfalls irgendwann um Weihnachten, November oder Dezember. Zwischen pampigem Laub lagen Reste halb geschmolzenen Schnees, kleine, schmutzige Häufchen, in welchen die Hunde ihre gelben Spuren hinterlassen hatten. Der Himmel über ihm war bedeckt mit grauen Wolken und Nebelfetzen. Es roch nach Sonntagmorgen. Er wusste nicht, wie er darauf kam, aber plötzlich war er sich sicher. Diese Verschlafenheit der Stadt, die geschlossenen Geschäfte, das Fehlen von Verkehrslärm und Kindergeschrei – es musste Sonntag sein.
Ein einsames blaues Tram der Linie 11 quietschte mit einem einzigen Fahrgast um die Kurve, dahinter tuckerte ein oranger Putzwagen und fegte aufgeweichte Zigarettenstummel vor sich her. Er überquerte einen parkähnlichen Platz. Ein paar Punks lümmelten frierend auf mit Zeitungen belegten Bänken herum und rieben sich den Morgenmief aus den Augen, zwei zerzauste Hunde spielten mit einer Bierflasche.
Er zog sein rechtes Bein nach, sah an seinen zerschlissenen Hosen hinunter und entdeckte getrocknetes Blut auf Kniehöhe. Dann kam er an einem grossen, halb vereisten Brunnen vorbei, verscheuchte dabei ein paar Tauben und bog rechts ab. Er erreichte eine Strasse, die nicht von Autos befahren war. Tramschienen liefen ihr entlang und mündeten weiter vorn in eine überdachte Haltestelle. Auf der anderen Strassenseite war eine grosse, morastige Wiese. Abgasgraue, aufgeschichtete Schneehaufen waren an den Rand eines Steinmäuerchens geschaufelt worden. Daneben standen Hunderte kleinere und grössere Christbäume zum Verkauf. Weihnachten war also noch nicht vorbei.
Hinter der Wiese erkannte er einen See und in der Ferne einen verschneiten Berg, auf dessen höchstem Punkt eine Art Antenne in den Himmel ragte, nur undeutlich zu sehen zwischen den Nebelschwaden. Einige Sonnenstrahlen fanden ihren Weg durch die feuchte Luft in die Stadt. Das musste Zürich sein.
Zürich. Vollkommen unbekannt.
Eine Woge von Schmerz überwältigte ihn. Er stützte sich an einer Wand ab. Ein Mann, der seinen Dalmatiner an straffer Leine hielt, runzelte die Stirn, eine dünne Frau, die an ihm vorbeijoggte, starrte ihn abschätzig an, und er rief ihnen hinterher: «Noch nie einen Diabetiker gesehen?»
Er rappelte sich auf, wankte weiter, kam an einem Kiosk vorüber, einer Pizzeria, einem Kino. Endlich. Neben einem kleinen Tabakladen fand er die Bellevue-Apotheke, die von sich behauptete, Tag und Nacht geöffnet zu sein. Sie war gerammelt voll. Wieso mussten sich all die Verschnupften und Verstopften ausgerechnet den Sonntagmorgen für ihren Apothekengang aussuchen? Er drängte sich mit den Ellbogen an zwei Frauen vorbei ins Innere und stolperte vor die hölzerne Theke.
«Bitte…», krächzte er.
«Hinten anstehen», fauchte eine Grauhaarige empört und wies mit ihrem arthritischen Zeigefinger Richtung Tür.
«Ich bin ein Notfall!», brachte er heraus und konnte sich kaum mehr auf den Beinen halten.
«Das sind wir alle, junger Mann», gab sie eisig zurück, «ich sagte: hinten anstehen!»
Er wich zurück. Neben einem kleinen Waschbecken standen Gläser auf einem Tablett. Er nahm sich eins, füllte etwas Wasser hinein und trank mit gierigen Zügen. Verschluckte sich, spuckte aus, liess sich auf einen Stuhl fallen und versuchte, die missbilligenden Blicke zu ignorieren. Er starrte auf ein Tischchen mit Werbebroschüren, auf denen eine lachende Familie abgebildet war. «Fühlen Sie sich geschwächt?», stand darunter. «Ginseng hilft.»
Kalter Schweiss tropfte ihm vom Gesicht, seine Zunge fühlte sich schwer und dick an, sein Herz raste. Er würde hier krepieren! Vor den Augen rheumatischer Greise und übernächtigter Teenies, die sich über die Vorzüge der neuesten Pickelsalbe aufklären liessen. Seine Zähne begannen hörbar zu klappern, er zog seinen Hemdkragen höher. Wieso trug er keine Jacke, Teufel noch mal? Wo waren seine Handschuhe, seine Mütze, sein Schal? Saukälte in diesem Laden. Warum drehte keiner die Heizung auf, was war bloss los mit allen? Wo blieben die mit der Insulinspritze, die müssten doch sehen, wie es ihm ging, die konnten doch nicht einfach… Das Licht war so hell, die Geräusche so laut, alles drehte sich in seinem Kopf. Die Gesprächsfetzen aus den viel zu weit geöffneten Mündern der Kunden jagten spitz und scharf in seine Ohren, und es stank, es stank ganz grässlich hier drin, wonach, konnte er nicht feststellen. Alle hatten sich gegen ihn verschworen, wollten ihn sterben sehen, das war doch nicht normal! Wo ging’s hier zum Ausgang? Alles kreiste, schwankte, schrillte, gellte, er zog sich vom Stuhl hoch, wankte zur Theke, schob einen Mann grob zur Seite und packte eine weissgekleidete, extrem Orangehaarige am Kragen. «Insulin!»
Die Frau lächelte unsicher, sah hilfesuchend von einer Seite zur anderen, und erst jetzt merkte er, dass es nicht orange Haare, sondern eine Kappe war, rot, wie die von Rotkäppchen. Da eilte eine andere herbei, braun, mit tiefliegenden Augen, öffnete ihr Gebiss und dröhnte: «Ihr Rezept bitte», und ihre Zähne wurden grösser und reissender, wurden zu den Zähnen eines Wolfes. Sie zog die Lefzen hoch, ihr weisser Kittel wurde zu einem braunen, zottigen Fell, und wo war Rotkäppchen? Er stiess den Wolf von sich weg, brüllte: «Ich habe kein Rezept!» Das war ein Alptraum, manifest gewordener Nachtmahr eines zornigen Gottes – was geschah hier mit ihm? Wer waren all die Leute? Was schauten die ihn an, als wäre er ein Aussätziger? Endlich kam einer. Das musste der Jäger sein, er fasste den Wolf, rettete die Grossmutter, fragte Rotkäppchen: «Macht er Ihnen Probleme?» Sie nickte, der Jäger zog ihn zur Seite, jetzt war er, der Namenlose, allein mit ihm und hauchte seinem Retter zu: «Ich brauche Insulin! Oder etwas gegen die Schmerzen!»
Der Jäger rümpfte die Nase. «Ich kenne Sie, junger Mann. Sie versuchen es immer wieder, aber jetzt reicht’s. Verlassen Sie bitte unsere Apotheke!»
«Mörder!», schrie er, «ihr wollt mich alle umbringen! Ihr wollt –»
«Halt die Klappe, Jeff!», zischte ihm eine Stimme ins Ohr.
Er drehte sich um und blickte in ein dunkelbraunes Gesicht. Begriffsstutzig starrte er es an. Hatte er eben seinen Namen erfahren? Hiess er Jeff? War er Amerikaner, Engländer, Austra –
«Hey, white boy!», machte der Dunkelhäutige, «hörst du wohl auf, mich so anzuglotzen, als wär ich ein verdammtes Gespenst?»
«Heisse ich Jeff?», krächzte er, und sein Rücken brach fast vor lauter Schmerz. Rotkäppchen und der Jäger kümmerten sich um die anderen Kunden, der Wolf war verschwunden.
«Was?»
«Heisse ich Jeff? Ist das mein Name?»
«Natürlich, du Blödmann! Mach nicht so einen Aufstand. Ich hab was für dich, komm raus.»
Der Fremde zog ihn am Ärmel um die Apotheke herum, an einem grünen Marronihäuschen vorbei in eine Seitengasse, wo er stehen blieb, sich kurz umschaute und dann ein durchsichtiges Plastiktütchen aus der Innentasche seiner Jacke holte. Ein weisses Pulver war darin. «Erstklassige Ware», sagte er. «Thai-Sugar.»
«Was um alles in der Welt ist das?», fragte er, der nun Jeff hiess. «Und wer bist du?»
«Willst du mich verschaukeln oder was?» Der andere verdrehte die Augen. «Nur, weil du auf dem Turkey bist, kennst du plötzlich deine Kumpel nicht mehr! Oder bist du jetzt auch einer dieser weissen Arschgesichter geworden, die finden, alle Afrikaner sähen gleich aus? Ich heisse Sal, falls du das nicht mehr weisst! Kommt von Salomon. Heiliger Name, kapiert! Was ist jetzt? Willst du was abhaben? Sechzig Franken das Gramm.»
Jeff schnürte es den Magen zusammen.
Langsam machte das Ganze Sinn. Sein ausgemergeltes Gesicht, seine schmuddeligen Kleider, die leeren Hosentaschen, sein furchtbarer Zustand. Die Puzzleteile fügten sich zu einem Bild des Grauens zusammen. Er hatte nicht nur sein verdammtes Gedächtnis verloren und irrte wie ein Zombie durch die fremde Stadt – er war ein Junkie auf Entzug.
3
Nora stieg die Treppe von ihrer Mansarde hinunter in den ersten Stock. Noch immer empfand sie Stolz, wenn sie das Schild «Nora Tabani & Jan Berger, Privatdetektive. Ermittlungen und Nachforschungen» las.
Sie betrat ihr Büro und wusste, was sie in den nächsten Stunden zu tun hatte. Jans Arbeitsraum war pingelig aufgeräumt, Computer abgestaubt, Lineal im rechten Winkel zur Schreibtischkante, Kugelschreiber und Markierstifte farblich sortiert. Ganz zu schweigen von der Aufstellung seiner Ordner, deren ausgeklügeltes System Noras Verstand überstieg. Ihr Partner fand mit einem einzigen Griff jede Akte, was bei Nora je nach Situation Neid, Bewunderung oder Befremden hervorrief.
Leicht überfordert betrachtete sie ihren eigenen Arbeitsplatz. Kreatives Durcheinander wäre eine nette Umschreibung gewesen. Hoffnungsloses Chaos traf es besser. Sollte sie zuerst die Protokolle der erledigten Fälle alphabetisch ablegen? Oder chronologisch oder thematisch oder wie auch immer. Jan wüsste das besser.
Vielleicht erst mal die eingetrockneten Kaffeetassen spülen. Das neue Faxgerät anschliessen. Den Stapel ungeöffneter Briefe liess sie für heute noch einmal durchgehen. Sie krempelte die Ärmel hoch und griff nach dem überquellenden Papierkorb, um ihn zu leeren. Nur keinen Stress. Sie hatte ja den ganzen Tag Zeit.
«Nun, white boy, entscheid dich mal, ich hab Wichtigeres zu tun. Brauchst du was, oder willst du mich hier nur verarschen?»
Jeff starrte das schwarze Gesicht mit den leuchtend weissen Zähnen an, und alles vermischte sich. Die Bellevue-Apotheke mit dem Gepäckschliessfach. Das pampige, braune Laub mit Fledermaus und Kahlkopf. Er holte sich in die Realität zurück. Sal. Das hier war Sal, sein Dealer. Und er, Jeff, war ein Drogensüchtiger.
«Hilft…», begann Jeff, räusperte sich, da er vor lauter Trockenheit im Mund kaum sprechen konnte. «Hilft mir das, was du da hast, gegen die Schmerzen?»
Sal lachte auf. «Das will ich hoffen!»
«Dann gib mir was ab.»
«Erst die Kohle.» Sal streckte die Hand aus.
«Ich hab kein Geld.» Jeffs Zähne klapperten, die Worte kamen abgehackt heraus. Seine Eingeweide krümmten sich.
Sal schob die Augenbrauen zusammen. «Dann verpiss dich, white boy. Freundschaftsdienste liegen nicht drin.»
Er wandte sich ab.
Jeff rannte ihm nach. «Sal! Mir geht’s echt beschissen! Wo krieg ich was umsonst? Oder auf Pump? Kenn ich einen, der mir noch was schuldet?»
Sal schnaubte. «Bin ich dein verdammter Sozialarbeiter oder was?» Er kam ganz nah an Jeff heran, Nase an Nase, und sagte sehr leise und sehr langsam: «Ich hab’s nicht gern, wenn man mich zum Idioten macht. Versuch’s mal bei Lenny, der ist grad in Spenderlaune, hat neue Connections.»
«Wer?», stöhnte Jeff. «Wo?»
«Was ist eigentlich los mit dir, Käsegesicht? Hat dir einer eine Knarre übern Schädel gezogen? Siehst echt Scheisse aus, weiss du das? Lenny. Brauerstrasse 11b, und jetzt hau ab, bevor ich deine hässliche Fresse bearbeite.»
Nora kam besser voran als erwartet. Das helle Holz ihres Schreibtisches schimmerte bereits grossflächig zwischen den Papieren hindurch, in die Protokolle und Berichte war so etwas wie Ordnung gekommen, sogar die Pinwand war jetzt von den alten Notizzetteln befreit. Einzig ein grellgelbes Post-it mit der unerklärlichen Aufforderung «B. Tel! Termin!» flatterte noch unter einem Reissnagel. Sie liess es hängen. Es sah so anregend aus. Befriedigt schaute sie sich um. Die vor einem halben Jahr dazugemietete Wohnung wirkte wieder wie ein richtiges Detektivbüro. Jans Zimmer war sowieso perfekt, ihr eigenes immerhin akzeptabel, der Warteraum beim Eingang sogar richtiggehend einladend mit den beiden roten Sesseln aus dem Secondhand-Laden. Jetzt konnten die Aufträge reinkommen.
Jeff stand schlotternd an der Haltestelle, trat von einem Bein aufs andere und versuchte, im Gedächtnis zu behalten, was die alte Dame vorhin gesagt hatte: Tram Nummer 4 bis Limmatplatz. Dann die Langstrasse entlang, danach sei es nicht mehr weit bis zur Brauerstrasse.
Lenny. Der würde ihn erlösen.
Es hatte zu schneien begonnen. Ein eisiger Wind wehte ihm um die Ohren. Mechanisch griff er in seine Hosentasche, zog die zerdrückte Zigarettenpackung hervor und zündete sich mit zittrigen Fingern die einzige Zigarette an, die seine Gefangenschaft heil überstanden hatte. Die anderen waren zu Papier- und Tabakbröseln geworden. Gierig zog er daran, rauchte sie bis zum Filter hinunter, warf die Kippe auf die Tramschienen. Das Tram kam, nur wenige Fahrgäste waren darin, er stieg zuhinterst ein und hielt sich krampfhaft an einer Stange fest. Er setzte sich nicht, blieb am Fenster stehen, um eine mögliche Billettkontrolle früh genug zu bemerken. Es kam ihm so vertraut vor, als hätte er es immer schon getan, als wären gewisse Verhaltensmuster in ihm gespeichert, in seinen Zellen eingraviert, Amnesie hin oder her. Sein rascher Blick in alle Richtungen, sein Misstrauen, als er einen Mittvierziger mit Ledermappe entdeckte, der sich unauffällig umsah wie ein Kontrolleur, sich dann aber als harmlos erwies; sein sechster Sinn für Gefahr – all das war so bekannt. Er musste seit Jahren diese Art von Leben führen.
Das Tram ruckelte los, der Boden unter Jeff verwandelte sich in ein schwankendes Schiff, er hatte Angst, vom Meer überrollt zu werden, presste seine Hände an die Schläfen, versuchte, an irgendetwas anderes zu denken als an den Schmerz, der seinen ganzen Körper peinigte. Seine Sehnen waren zum Zerreissen gespannt. Sein Blut raste beissend durch seine Adern. In seinem Kopf tanzten Irrlichter. Das war also ein Entzug. Sterben wäre besser gewesen.
Er starrte nach draussen, wo Schaufenster von Kleider-, Souvenir- und Uhrenläden an ihm vorbeirasten, ein verwirrendes Kaleidoskop von Farben und Formen. Eine doppeltürmige Kirche. Menschen, Hunde, Fahrräder. Eine Stadt am Aufwachen, fremd, so fremd. Er schloss die Augen, rieb sie, riss sie wieder auf, schaute auf die andere Seite. Ein Fluss. Vier Ruderer in zitronengelben Trikots in einem Sportboot. Enten. Schwäne. Raben. «Central», ertönte die Stimme aus dem Lautsprecher, dann quietschte das Tram über eine Brücke. «Hauptbahnhof.»
Zwei Jugendliche stiegen ein, die Jeff einen schnellen, wissenden Blick zuwarfen. Einer von ihnen hatte violette Strähnen in seine Haare gefärbt. An der Art, wie die beiden miteinander sprachen, wie sie sich bewegten, erkannte Jeff intuitiv die Seelenverwandtschaft. Zwei Junkies. Süchtige, wie er. Ausgestossene der Gesellschaft.
Wie hatte es nur so weit kommen können mit ihm? Wie war er in diesem Sumpf gelandet? Er hätte verzweifeln können über sein verpfuschtes Leben. Über das er nichts wusste. Dealte er mit Drogen? Raubte er alten Damen die Handtaschen? Brach er in Arztpraxen ein? Würde er es je erfahren?
Erst jetzt, zuhinterst im Tramwagen, wo ihn niemand beobachtete, wagte er es, seine Hemdärmel hochzukrempeln und sah an beiden Armen die Einstiche. Dutzende roter Punkte, verkrustetes Blut überall, Schorf, Striemen, blau unterlaufene Stellen, die seine Armbeugen in eine Landschaft der Selbstzerstörung verwandelten.
Der Junkie mit den bunten Strähnen drehte sich um, machte eine fragende Handbewegung in Jeffs Richtung. Jeff verstand. Das eingravierte Muster. Er schüttelte den Kopf. Er brauchte nichts von den beiden, er hatte Lenny.
«Limmatplatz», verkündete die Stimme aus dem Lautsprecher.
Jeff stieg aus, schleifte seine Beine über den Platz, humpelte über die Kreuzung und quälte sich durch die Langstrasse. Jetzt konnte es nicht mehr weit sein. Hier befand er sich in einem ganz anderen Stadtquartier. Es gab viele von seiner Sorte. Immer wieder wurde er gefragt, ob er Stoff brauche, immer wieder schüttelte er den Kopf. Einer, der ihn zu kennen schien, winkte ihm zu. Jeff grüsste halbherzig zurück und ging durch eine graffitiversprayte Bahnunterführung. Kam an zwei Huren vorbei, die so aussahen, als könnten sie sich nach einer langen Nacht kaum mehr auf den Beinen halten, an Dealern, Stripteaselokalen, Kebabbuden. Ein Mann mit schwarzem Schnauzbart öffnete seinen Teppichladen, aus dem es nach Wasserpfeife roch. «Heute Sonntagsverkauf», stand auf einem Plakat, das er an die Scheibe klebte. Dann schob er quietschend das Eisengitter hoch, spuckte vor Jeff auf den Boden und arretierte das Gitter mit einem Holzkeil.
Wo zur Hölle lag diese Brauerstrasse? Jeff fror wie ein Hund. Die verdammten Schneeflocken fielen in wilden Wehen in seinen Nacken, durchnässten sein Hemd, bedeckten seine Haare. Er wankte am McDonald’s und einem Sexkino vorbei, kam an der St.Pauli Bar und der Piranha Bar vorüber. Und da, endlich, die gesuchte Strasse. Hinter einem thailändischen Restaurant ein dunkler Backsteinbau, die Nummer 11b. Nicht sehr gross, etwas zurückversetzt. Die ebenerdigen Fenster waren Kellerluken, eine davon zerbrochen, spitze Glaszacken ragten sternförmig zur Mitte. Vier Klingeln waren neben der Tür angebracht. Keine Namen. Neben die oberste Klingel hatte jemand mit einem schwarzen Filzstift unleserliche Initialen gekritzelt, neben der untersten klebten Überreste eines Etiketts, das nicht mehr zu erkennen war, die zwei dazwischen waren leer.
Wo wohnte Lenny?
Die Haustür war nur angelehnt. Jeff trat ein. Muffiges, dunkles Treppenhaus, das einmal weiss gewesen sein musste. Jetzt war es nikotingelb. Es roch nach Bier und kalter Pizza. Ein Stapel alter Zeitungen, kreuz und quer aufeinandergeschichtet, lag links vom Eingang, daneben ein kaputter, aufgespannter Schirm in spinatgrün.
Jeff kämpfte sich die Treppen hoch. Es war ihm völlig egal, wildfremde Leute aus ihren Wohnungen zu klopfen, wenn nur Lenny darunter war. Aufs Geratewohl hämmerte er an die erste Tür, auf der ein Kleber mit der Aufschrift «fuck off or die» stand. Aus dem Innern dröhnte ein Fernseher.
Es dauerte ein paar Sekunden, dann riss ein übergrosser Dicker mit nacktem Oberkörper die Tür auf. «Was?», bellte er.
«Bist du Lenny?», brachte Jeff hervor.
«Seh’ ich so aus? Kannst du nicht lesen? Hier!» Er tippte erst auf den Kleber, dann auf Jeffs knochigen Brustkorb. «Das gilt auch für dich!» Er schmetterte die Tür ins Schloss.
Jeff hörte die schlurfenden Schritte, bis sie im Fernsehlärm untergingen. Er stieg einen Stock höher, klopfte, wartete, polterte mit den Fäusten an die Tür – nichts. Gott, dachte er, falls es dich gibt, mach, dass Lenny zu Hause ist und mir hilft.
Im dritten Stock öffnete ihm endlich ein drahtiger Typ mit verschlafenem Blinzeln. «Jeff, du? Ich dachte, die hätten dich gekriegt.»
4
Lautlos kletterte Paco Ramirez die Regenrinne hinauf. Bald würde es dämmern. Er hatte die Taschenlampe ausgeknipst und zwischen die Zähne geklemmt. Sein linker Fuss fand sicheren Halt auf einem Mauervorsprung, der rechte schob sich leise zur nächsten Erhebung. Seine mit Noppen versehenen Kunststoffhandschuhe hinterliessen keine Fingerabdrücke. Geschmeidig wie ein Panther bewegte er sich empor.
Er warf einen Blick hinunter, wo Hektor Kant auf dem Rasen stand, und gab ihm ein Zeichen mit nach oben gerichtetem Daumen. Hektor gehorchte und kam hinterher. Seine Glatze schimmerte in der frühmorgendlichen Dunkelheit, sein massiger Körper arbeitete sich erstaunlich wendig nach oben. Er hatte sich im Kraftraum des Gefängnisses nicht nur eine ungeheure Muskelmasse antrainiert, sondern auch eine Ausdauer, die ihresgleichen suchte. Paco hatte ihn erlebt, wie er es mit drei Schlägern gleichzeitig aufgenommen hatte, wie er sich furchtlos in den Kampf gestürzt und ihn gewonnen hatte. «Born to fight», so lächerlich der tätowierte Spruch auf Hektors Hals war, so sehr passte er zu ihm. Er war die perfekte Kampfmaschine, gut abzurichten, verlässlich, ohne die lästige Angewohnheit, selber zu denken. «Born to win» hätte Paco sich auf seine Haut geschrieben, wäre er je so dumm gewesen, sich tätowieren zu lassen.
Er war auf der Höhe des ersten Stockwerks angekommen. Hier schliefen sie, die süssen Kleinen. Das Fenster war einen Spalt breit geöffnet, wie jede Nacht. Damit die Zwillinge frische Luft bekämen. Damit sie gross und stark würden und gesund blieben. Lukas und Lorena, neunjährig, vom Leben verwöhnt, wie es nur die Reichen sind. Er wusste alles über sie. Er kannte ihre hellen Gesichter, als wären es seine eigenen Kinder, er wusste von Lorenas Wangengrübchen, von Lukas’ widerspenstigem Haarwirbel, er kannte ihre Schule, ihre Spielsachen, ihre Lieblingsbücher.
Geschickt schwang er sich aufs Fenstersims und stieg ins Zimmer ein. Hektor kletterte ihm hinterher.
Fluoreszierende Sterne schimmerten von der Zimmerdecke und hüllten den Raum in ein schwaches, grünliches Licht. Von beiden Seiten war leises Atmen zu hören. Paco schaltete die Taschenlampe ein. Der Lichtstrahl tanzte über ein Regal, auf dem neben vielen kleinen Oldtimerautos mehrere Plüschtiere lagen. Ein Elefant, ein Känguru, ein flauschiger Hase und ganz aussen ein weisser Teddy, der ein grosses Stoffherz in seinen Pfoten hielt. Nett. Paco fragte sich, ob er ein Kuscheltier für die Kleinen einpacken sollte, damit sie sich in den kommenden Tagen weniger fürchteten, verwarf den Gedanken aber wieder. Kinder in Angst waren fügsamer. Und hübscher anzusehen.
Der Lichtstrahl tastete weiter einem Schreibtisch mit Farbstiften entlang, über ein Poster des Films «Finding Nemo». Dann streifte er die Silhouette eines Bettes, verweilte auf einem blonden Haarschopf, der unter einem zerwühlten Daunenwulst hervorschaute und sich regelmässig hob und senkte.
Paco nickte Hektor auffordernd zu. Dieser griff in seinen Rucksack und holte die Schutzmasken hervor. Er warf Paco eine hinüber, und beide schnallten sich einen Atemschutz vor die Nase. Hektor nahm das Fläschchen heraus, drehte den Verschluss auf und träufelte eine gehörige Portion der farblosen Flüssigkeit auf zwei Taschentücher. Augenblicklich wurde das Zimmer von einem stechenden, süsslichen Geruch erfüllt, der durch die Masken drang. Paco fühlte einen Anflug von Schwindel.
«Los jetzt!», befahl er. «Bevor wir selber zusammenklappen.»
Hektor trat einen Schritt nach vorn. Ein lautes Scheppern war die Folge. Er musste über irgend etwas gestolpert sein, das aus unzähligen kleinen Teilen bestand. Es klang nach Plastik, klapperte und rumpelte mehrere Sekunden, die Paco wie Ewigkeiten vorkamen.
«Verdammt!»
«Hm?», machte es verschlafen vom Bett des Mädchens.
Paco leuchtete mit der Lampe hinunter und sah die Bescherung. Dutzende blaue, rote und weisse Legoteile waren über den Boden verstreut. Das Bauwerk schien eine Burg gewesen zu sein, einzelne Schiessscharten und die Zugbrücke waren noch zu erkennen. Nun sah sie aus wie von Kanonen bombardiert. «Hast du keine Augen in deinem Schädel, du Schwachkopf? Nun mach schon! Das Mädchen zuerst!»
«Mama?», murmelte es nun schläfrig vom anderen Bett.
Hektor machte einen Satz nach vorn, packte die Kleine grob an den Haaren und drückte ihr den durchtränkten Lappen aufs Gesicht. Sie wehrte sich mit erstaunlicher Kraft, zappelte und strampelte und schaffte es, mit ihren Fingernägeln zwei hässliche Kratzer auf seinem Gesicht zu hinterlassen. Ein paar letzte dumpfe Töne gab sie von sich, dann erschlaffte sie. Ihre Arme fielen zur Seite, ihr Kopf kippte nach hinten, ihr Atem war nicht mehr zu hören.
«Scheisse!», flüsterte Hektor aufgeregt, «sie ist tot!» Er hielt das Kind wie eine Marionette in seinem Griff.
«Quatsch! Mit dieser Dosis ist es unmöglich, jemanden –»
«Und warum zum Teufel atmet sie dann nicht?»
«Psst! Nicht so laut, du Trampel!», zischte Paco. Dann betrachtete er das Mädchen mit seinen blonden Locken. Niedlich sah es aus, wie es so in Hektors starken Armen hing. Nein, mehr als niedlich – unverdorben, unberührt. Ein vertrauensvolles, offenes Wesen. Ein Engel, der das Böse der Welt noch nicht erlebt hatte. Paco liebte Unschuld.
Ein leises Pfeifen kam aus dem offenen Mund des Mädchens.
«Na also!», sagte Paco. «Und nun weiter! Bevor der Junge aufwacht.»
Er drehte sich zur anderen Seite. Und da sass er, der Kleine. Stocksteif in seinem Bett. Starrte ihn mit angstverzerrten Augen an.
«Wir tun dir nichts, wenn du schön ruhig bist», versprach Paco und brachte ein Lächeln zustande. Das schien den Jungen noch mehr zu erschrecken, er erwachte aus seiner Erstarrung, verzog seinen Mund zu einer Grimasse und setzte zu einem hohen Ton an.
«Nun mach schon, Hektor!», forderte Paco leise.
Wie ein Bulle stürzte der sich auf den Jungen, presste ihm den feuchten Stoff ins Gesicht und fauchte mit unterdrückter Stimme: «Wieso muss ich immer die Drecksarbeit machen?»
«Weil du mit Muskeln gesegnet bist und ich mit Hirn. Das hatten wir schon tausend Mal. Ist er hinüber?»
Hektor nickte. «Ich wette, gleich tauchen die Alten auf, weil sie den kleinen Satansbraten kreischen gehört haben. Dann kannst du dein beschissenes Hirn sonstwohin –»
«Komm wieder runter. Die Eltern wohnen auf der anderen Gebäudeseite.»
«War’s das? Können wir raus hier?»
«Das war’s. Und, Hektor?»
«Was denn?» Hektor schien den drohenden Unterton bemerkt zu haben. Er schaute kurz zum Jungen, der schlaff quer über der Bettdecke lag, dann wieder zu Paco.
«Wer hat das Sagen?»
«Ist ja gut, ich hab’s kapiert.»
«Hektor.» Pacos Stimme wurde schneidend, als er jedes Wort einzeln betonte. «Wer hat das Sagen?»
«Du hast das Sagen, Paco.»
Ein paar Sekunden herrschte Stille.
Dann packte Hektor das Mädchen, trug es die Regenrinne hinunter und deponierte es wie einen Kartoffelsack an der Hausmauer. Er kletterte erneut herauf und schleppte den Jungen nach draussen. Ihr Transporter stand gleich hinter dem gusseisernen Gartentor, Klebeband und Fesseln waren bereit. Sie würden ihren Zielort erreicht haben, bevor es richtig dämmerte. Sonntagmorgen in Zürichs reichem Stadtkreis 7. Die Strassenlaternen gaben hier nur ein bescheidenes Licht, um die gern in Anonymität lebenden Anwohner nicht mit nächtlicher Helligkeit zu stören. In keinem Haus brannte eine Lampe, alles schlief.
Paco Ramirez blieb noch einen Moment im Kinderzimmer stehen. Ein eisiger Morgenwind blies herein und bauschte den Vorhang auf. Er legte den computergeschriebenen Zettel gut sichtbar auf den Schreibtisch. «Ihre Kinder wurden entführt. Keine Polizei, sonst sehen Sie sie nie wieder. Verarschen Sie uns nicht. Wir beobachten Sie. Details folgen.»