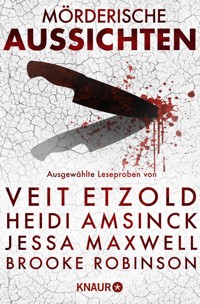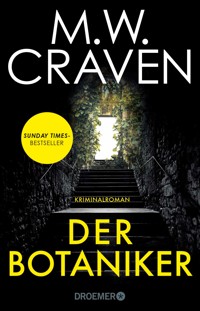
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Washington Poe und Tilly Bradshaw ermitteln
- Sprache: Deutsch
Getrocknete Blumen, Gedichte – und Gift: Wehe dem, der Post vom Botaniker erhält … Der clevere Krimi des britischen Bestseller-Autors M.W. Craven begeistert mit einem Ermittler-Team voller Frauen-Power, gleich zwei scheinbar unlösbaren Rätseln und typisch englischem Humor. Clever und hochspannend - ein Mystery-Meisterwerk Er schickt seinen Opfern Gedichte und getrocknete Blumen, bevor er sie vergiftet – und er kann offenbar durch Wände gehen, denn selbst Polizeischutz rund um die Uhr kann ihn nicht stoppen. »Der Botaniker«, wie ihn die Presse nennt, hat bereits drei Opfer auf dem Gewissen und ein viertes ausgewählt. Für DS Washington Poe von der NCA kommt der scheinbar unmögliche Fall zur Unzeit: Seine Freundin und Kollegin, die geniale Pathologin Estelle Doyle, wird verdächtigt, ihren Vater erschossen zu haben. Dieser Fall wiederum ist eindeutig, glaubt man den Spuren. Zusammen mit seiner durchsetzungsfreudigen Chefin Stephanie Flynn und der brillanten, aber sozial inkompatiblen Analystin Tilly Bradshaw versucht Poe, zwei Rätsel zu lösen, die vermeintlich nichts miteinander zu tun haben. Auftakt der preisgekrönten Krimiserie aus Großbritannien Der britische Bestseller-Autor M.W. Craven wurde unter anderem mit dem Crime Writersʼ Association Gold Dagger ausgezeichnet. In bester englischer Tradition bietet "Der Botaniker" - Auftakt der preisgekrönten britischen Krimiserie in Deutschland - spannende, temporeiche und klugeKrimispannung zum Miträtseln, - für alle Fans von Martha Grimes, Nicci French und Elizabeth George. »Fesselnd, makaber und zugleich mörderisch komisch. ›Der Botaniker‹ ist M.W. Craven in Bestform.« Chris Whitaker
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 558
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
M. W. Craven
DerBotaniker
Kriminalroman
Aus dem Englischen von Marie-Luise Bezzenberger
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Er schickt seinen Opfern Gedichte und getrocknete Blumen, bevor er sie vergiftet – und er kann offenbar durch Wände gehen, denn selbst Polizeischutz rund um die Uhr kann ihn nicht stoppen. »Der Botaniker«, wie ihn die Presse nennt, hat bereits drei Opfer auf dem Gewissen und ein viertes ausgewählt.
Für DS Washington Poe von der NCA kommt der scheinbar unmögliche Fall zur Unzeit: Seine Freundin und Kollegin, die geniale Pathologin Estelle Doyle, wird verdächtigt, ihren Vater erschossen zu haben. Dieser Fall wiederum ist eindeutig, glaubt man den Spuren.
Zusammen mit seiner durchsetzungsfreudigen Chefin Stephanie Flynn und der brillanten, aber sozial inkompatiblen Analystin Tilly Bradshaw versucht Poe, zwei Rätsel zu lösen, die vermeintlich nichts miteinander zu tun haben.
Inhaltsübersicht
Widmung
Motto
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
72. Kapitel
73. Kapitel
74. Kapitel
75. Kapitel
76. Kapitel
77. Kapitel
78. Kapitel
79. Kapitel
80. Kapitel
81. Kapitel
82. Kapitel
83. Kapitel
84. Kapitel
85. Kapitel
86. Kapitel
87. Kapitel
88. Kapitel
89. Kapitel
90. Kapitel
91. Kapitel
92. Kapitel
93. Kapitel
94. Kapitel
95. Kapitel
96. Kapitel
97. Kapitel
98. Kapitel
99. Kapitel
100. Kapitel
101. Kapitel
102. Kapitel
103. Kapitel
104. Kapitel
105. Kapitel
106. Kapitel
107. Kapitel
108. Kapitel
109. Kapitel
110. Kapitel
111. Kapitel
112. Kapitel
113. Kapitel
114. Kapitel
115. Kapitel
116. Kapitel
117. Kapitel
118. Kapitel
119. Kapitel
120. Kapitel
121. Kapitel
122. Kapitel
123. Kapitel
124. Kapitel
125. Kapitel
126. Kapitel
127. Kapitel
128. Kapitel
129. Kapitel
130. Kapitel
131. Kapitel
132. Kapitel
133. Kapitel
134. Kapitel
135. Kapitel
136. Kapitel
137. Kapitel
138. Kapitel
139. Kapitel
140. Kapitel
141. Kapitel
Danksagung
Für Bracken
»Was gibt es, das kein Gift ist? Alle Dinge sind Gift, nichts ist ohne Gift. Allein die Dosis macht, dass ein Ding kein Gift ist.«
Paracelsus (1493–1541)
1. Kapitel
Es gab hier richtig gemeine Bäume und es gab Warte-mal-Bäume und es gab ein Gebäude, das nicht existierte.
Die richtig gemeinen Bäume hatten massenweise fünfzehn Zentimeter lange Dornen, die ihre Stämme schützten. Wenn man einen davon anfasste, bekam man eine schmerzhafte Lektion erteilt. Die Warte-mal-Bäume waren nicht so stachelig, aber genauso lästig. Ihre dünnen, mit Hakenspitzen bewehrten Ranken hingen von den Ästen herab und fingen die Unvorsichtigen ein, fesselten sie und hinderten sie am Weiterkommen.
Doch es war das Gebäude, das jedermanns Aufmerksamkeit fesselte, nicht die Dornen. Wuchtig und grau, war es längst von der Natur zurückerobert worden. Dicke Wurzeln hatten das Mauerwerk gesprengt und eine der Wände einstürzen lassen. Guano der Fruchtfledermäuse, die sich im Blätterdach verbargen, hatte das Dach weiß getüncht.
Die Gruppe starrte voller Staunen.
»Was ist das?«, fragte Dora, eine Frau Anfang zwanzig. Sie hatte ihr Brückenjahr zur Hälfte hinter sich. In sechs Monaten würde sie tun, was ihr Vater wollte und eine Stelle in der City annehmen, dann den Portfoliomanager heiraten, mit dem sie verlobt war, und eine Horde langweiliger Kinder in die Welt setzen.
»Ich weiß es nicht genau«, antwortete Andrew Trescothic, ihr Tourguide. Er war bei der British Army in Belize gewesen und in der schwarzen Kunst der Dschungel-Navigation ausgebildet worden. »Wahrscheinlich ein Überbleibsel vom Krieg. Angeblich gibt’s hier auf der Insel noch ein paar Stützpunkte der Operation Ketsu-Go.«
»Ketsu-Go?«
»Eine Selbstmord-Verteidigungsstrategie aus dem Zweiten Weltkrieg, die entwickelt wurde, nachdem der Kaiser begriffen hatte, dass er nicht mehr gewinnen kann. Hat die ganze japanische Nation dazu aufgerufen, unter dem Banner ›Der ruhmreiche Tod von einhundert Millionen‹ Widerstand gegen eine Invasion zu leisten. Er dachte, wenn sich die Amerikaner mit katastrophalen Gefallenenzahlen konfrontiert sähen, würde das ihren Willen untergraben, bis zur bedingungslosen Kapitulation zu kämpfen. Damit sie sich auf einen Waffenstillstand einlassen, einen, bei dem das japanische Festland nicht besetzt werden würde. Ein Teil der Strategie bestand darin, Festungen im Inland zu errichten, um dort Treibstoff und Munition zu lagern. An dieses Gebäude kommt man mit Treibstoff nicht ran, also nehme ich an, dass es als Munitionslager genutzt wurde. Die Alliierten haben nach der Kapitulation alles leer geräumt, aber die Gebäude wurden meistens intakt gelassen.«
»Wow«, sagte Dora. »Dann hat das hier also seit dem Krieg niemand mehr zu Gesicht bekommen?«
»Wäre möglich.«
War es nicht. Trescothic war ein eher nüchterner Tourguide, und er führte jetzt schon seit fünf Jahren Reisegruppen über die Dschungelinsel. Er wusste genau, wo sämtliche Festungen der Operation Ketsu-Go waren, und sorgte bei jedem Trip dafür, dass die jeweilige Gruppe eine »entdeckte«. Nachdem die Leute ihre Fotos gemacht und ein bisschen herumgestöbert hatten, würde er diese hier ein Jahr oder so außen vor lassen. In einer so rauen Umgebung dauerte es nicht lange, bis das Gebäude aussah, als wäre es seit Jahrzehnten unberührt. Seiner Ansicht nach war das eine harmlose Täuschung, und ganz sicher sprangen dadurch größere Trinkgelder für ihn heraus, wenn sie wieder im Basislager ankamen.
»Können wir da rein?«, erkundigte sich Dora.
Trescothic zuckte die Achseln. »Wüsste nicht, was dagegenspräche.«
»Cool.«
»Aber schön aufpassen, wegen der Schlangen.«
Alles, was noch von der Holztür übrig war, waren rostige Angeln. Dora und die meisten anderen traten vorsichtig ein.
Der Letzte, ein Mann mit einer inakzeptablen Mütze, drehte sich um und fragte: »Kommen Sie nicht mit, Andrew?«
Er schüttelte den Kopf.
»Vielleicht später.« Andrew wusste, was dort drin war. Ein kastenartiger Raum und ein unterirdischer Lagerraum. Japanische Schriftzeichen an den Wänden und Tierkot auf dem Boden. Genau wie in all den anderen. Er schätzte, dass sie etwa eine Viertelstunde da drinbleiben würden. Fünf Minuten oben, fünf unten im Keller, und dann noch mal fünf für fröhliche Erinnerungsfotos. Reichlich Zeit, um sich einen Tee zu machen.
Er hatte noch nicht mal Zeit gehabt, den Teebeutel in den Becher zu schmeißen, als er Dora schreien hörte. Trescothic seufzte. Wahrscheinlich waren sie auf ein totes Tier gestoßen.
So was war vor ein paar Jahren mal in einem anderen Gebäude passiert. Eine Gruppe hatte den verwesten Kadaver einer Iriomote-Katze gefunden, eine Leopardenart, die nur auf der Insel vorkam. Sie war durch ein Loch im Dach gefallen und nicht mehr herausgekommen. Das arme Vieh war verhungert.
Trescothic erhob sich und betrat die alte Festung. Er konnte die Gruppe hören; sie waren in dem unterirdischen Lagerraum. Er trabte die Treppe hinunter, doch Dora kam ihm von unten entgegengerannt.
»Ich glaube, mir wird schlecht«, stieß sie hervor.
Wieder seufzte er. Diese feinen Pinkel aus der Großstadt mussten sich wirklich mal ein dickeres Fell zulegen. Genau dieser Gedanke kam ihm bei jedem Trip mindestens einmal. Die Möchtegern-Erforscher von heute waren nicht so robust wie die Soldaten, mit denen er vor all den Jahren gedrillt worden war. Bei der kleinsten Kleinigkeit kamen sie ins Schleudern. Ein totes Tier, ein fieser Kommentar auf Twitter, eine irgendwie anrüchige Statue …
Er setzte die Miene des strengen, nüchternen Soldaten auf, den die Gruppe erwartete, und trat in den Lagerraum.
Dreißig Sekunden später war er schwer keuchend wieder draußen und kramte hektisch in seinem Rucksack nach dem Satellitentelefon.
Dora hatte nicht wegen eines toten Tieres geschrien.
Das hier war etwas ganz anderes.
Etwas Monströses.
Zur selben Zeit, als Trescothic an seinem Satellitentelefon hing, stieg ein unscheinbarer, unauffällig gekleideter Mann auf einem Parkplatz eines Industriegeländes am Rand von Glasgow aus einem weißen Lieferwagen. Er betrat eine Filiale von Banner Chemicals Supplies und trat an den Verkaufstresen.
»Ich hätte gern zweihundert Liter Azeton, bitte«, sagte er zu dem Mann dahinter, der ein Poloshirt mit dem Firmenlogo darauf trug – ein stilisiertes B, von einem Reagenzglas unterstrichen.
»Haben Sie einen Lichtbildausweis?«, fragte der Mann. »Azeton ist eine Vorläufersubstanz der Kategorie C, weil man damit Sprengstoff herstellen kann. Dafür brauchen wir einen Ausweis, ist Vorschrift.«
Der unscheinbare Mann zeigte einen Führerschein mit einem Namen vor, den man sofort wieder vergaß. Der Mann hinter dem Tresen gab die Daten in seinen Computer ein. Nachdem das Azeton bezahlt war, fragte er: »Haben Sie draußen geparkt?«
»Ja.«
»Die Jungs bringen Ihnen das Zeug raus und helfen beim Einladen.«
»Danke.«
»Ach, eins noch. Ich muss hier im Computer irgendwas bei ›Grund für den Erwerb‹ eintragen.«
»Ich habe ein Ungezieferproblem«, sagte der unscheinbare Mann.
2. Kapitel
Die Scheinwerfer waren so eingestellt, dass sie heiß liefen. Das Interview lief noch heißer.
Zu heiß.
Sehr viel heißer als erwartet.
»Das ist zu kontrovers«, hatte der Produzent damals gesagt, vor all den Wochen.
»Ich ziehe ›provokant‹ vor«, hatte die Redaktionsleiterin geantwortet.
»Wir kriegen Hunderte von Beschwerden, vielleicht sogar Tausende.«
»Die Einschaltquote wird der Hammer.«
»Ich bin mir nicht sicher.«
»Und ich habe das letzte Wort, wenn es um redaktionelle Inhalte geht. Wir ziehen das durch.«
Natürlich hatte es schon lange bevor der Produzent und die Redaktionsleiterin ihr Tänzchen veranstaltet hatten, Besprechungen und Komitees gegeben. Wo es um Kane Hunt ging, war das zu erwarten. Kontroversen – allesamt sorgfältig kuratiert – folgten Hunt auf Schritt und Tritt. Liveauftritte im Fernsehen wurden immer seltener.
Doch The Morgan Soames Hour war noch nie vor Kontroversen zurückgescheut.
Letzten Endes ging es um zweierlei: darum, dass sie sich zu einer ausgewogenen Berichterstattung verpflichtet sahen, und darum, ob ihre Moderatorin Morgan Soames mit ihm fertigwerden würde oder nicht.
Das Argument in Sachen Ausgewogenheit lautete folgendermaßen: In der Woche vor dem avisierten Interview mit Hunt war Saffron Phipps eingeplant, und deren Ansichten waren genauso extrem, wenngleich am entgegengesetzten Ende des Spektrums. Phipps fand, Valerie Solanas, die Autorin des SCUM Manifesto von 1967, sei auf dem richtigen Weg gewesen. Dabei schlug Phipps nicht vor, dass Männer eliminiert werden sollten, wie Solanas es getan hatte. Doch sie behauptete, Solanas hätte recht gehabt, als sie geschrieben hatte, Männer seien genetisch defizitäre, unvollständige Frauen, weil sie nur ein X-Chromosom hatten. Dieses Defizit erkläre, warum Männer emotional eingeschränkt und egozentrisch seien, warum es ihnen an Empathie mangele und sie nicht in der Lage seien, sich mit irgendetwas anderem zu befassen als ihren eigenen körperlichen Empfindungen. Kane Hunt war der Anti-Phipps, der Kontrapunkt zum SCUM Manifesto. Er würde für die Ausgewogenheit sorgen, auf die The Morgan Soames Hour so stolz war.
Die Argumente derer, die dagegen waren, waren sehr viel weniger nuanciert – Kane Hunt war ein Frauenfeind, der seine widerwärtige Philosophie nicht vom Stapel ließ, weil er tatsächlich glaubte, Männer hätten ein grundsätzliches Anrecht auf Sex, sondern weil er damit Bücher verkaufte. Ihn in der Show zu haben würde dem Marketing für sein neues Buch gewaltigen Schwung verleihen.
Was die zweite Frage betraf – ob Morgan Soames mit ihm fertigwürde –, so hatte es keinerlei Unstimmigkeiten gegeben. In jedem Raum, in dem sie sich aufhielt, hatte sie das größte Paar Eier.
Es wurde per Abstimmung beschlossen – das erste Mal, dass das Produktionsteam über einen Gast abstimmte. Justine Webb, die Redaktionsleiterin, stimmte mit Nein. Sie war dafür verantwortlich, wie die Show aufgenommen wurde, und würde sich mit dem unvermeidlichen Fallout herumschlagen müssen. Auch der Chefautor stimmte dagegen. Er wollte seine Leute nicht den Löwen zum Fraß vorwerfen, falls Morgan am Schluss blöd dastand.
Die Social-Media-Managerin konnte natürlich gar nicht schnell genug Ja sagen. Sie wusste genau, wie ein heraufziehender Twitter-Sturm aussah. Der Sender sagte ebenfalls Ja. Die Einschaltquoten würden durch die Decke gehen, und sie alle würden richtig absahnen.
Der Rest des Produktionsteams hatte zu gleichen Teilen dafür und dagegen gestimmt. Die Stimme von Allan, dem Produzenten der Show, gab den Ausschlag. Tief im Herzen hatte er Ja sagen wollen. Ganz gleich, was diese kleine Knalltüte Hunt von Frauen hielt, Morgan stand am oberen Ende der Nahrungskette. Sie würde ihn bei lebendigem Leibe verschlingen, und 99,9 Prozent des Landes würden sich darüber freuen. Und das wäre durchaus relevant – Hunt war schon zu lange mit seiner Nummer durchgekommen. Seine Behauptung, er würde von den Medien zensiert, war eine sorgfältig kalkulierte Strategie. Wenn er empörend genug war, konnte er nicht im Fernsehen auftreten, und wenn er nicht im Fernsehen auftrat, konnten seine Ansichten nicht öffentlich infrage gestellt werden. Zensur war der Schild, hinter dem er sich versteckte. Er war geil auf Zensur, weil er darauf baute.
Doch Morgan hatte ihn schon seit Monaten aufs Korn genommen. Jeder Eröffnungsmonolog ihrer Show begann mit einem Seitenhieb gegen ihn. Jedes Schlusswort endete mit einem Witz auf seine Kosten.
Sie hatte ihn herausgefordert, in ihrer Show aufzutreten.
Zu jedermanns Verblüffung hatte Hunt zugesagt. Öffentlich. Er würde in ihrer Show auftreten, sofern er der einzige Gast war und die Fragen vorher zu sehen bekam. Doch so lief das bei Morgan nicht. Sie würde ihm Zeit für seine Antworten lassen, aber die Richtung würde er nicht vorgeben. Widerstrebend hatte Hunt eingewilligt. Wenn er jetzt einen Rückzieher machte, würde Morgan sich noch jahrelang darüber lustig machen, das wusste er.
Also hatte Allan Kane Hunt für diese Show haben wollen.
Und doch stimmte er dagegen. Allan hieß mit Nachnamen Webb, genau wie Justine, sie waren nämlich miteinander verheiratet. Seit zwanzig Jahren arbeiteten sie zusammen, und seit zehn Jahren waren sie ein Ehepaar. Sie waren sowohl im Studio als auch sonst ein Team, und sowohl beruflich als auch persönlich war es sein Job, ihr den Rücken zu decken.
Es war Justine zugefallen, Morgan vom Ausgang der Abstimmung in Kenntnis zu setzen. Sie hatte beschlossen, es ihr an jenem Abend erst kurz vor Showbeginn zu sagen, in der Hoffnung, dass dann vielleicht weniger Zeit für Beschimpfungen sein würde. Morgan hatte abgesetzte Präsidenten und in Ungnade gefallene Premierminister interviewt. Sie hatte Angehörige des Königshauses der Lüge überführt und Kriegsverbrecher in Tränen ausbrechen lassen. Sie war eine Frau, mit der man sich nicht anlegte.
Justine hatte an ihre Garderobentür geklopft und war eingetreten. Morgan hatte gerade in der Maske gesessen. Ihre Stylistin, zugleich seit Langem ihr Soundingboard, fuhrwerkte mit einer winzigen Bürste und einer kleinen Spraydose an ihrem Haar herum. Zwischen Kragen und Hals gestopfte Papiertaschentücher schützten ihren zweitausend Pfund teuren marineblauen Oscar-de-la-Renta-Blazer mit den Trompetenärmeln vor dem dicken Make-up, das sie tragen musste. Mit bloßem Auge betrachtet wirkte Morgan wie eine Superschurkin, vor der Kamera würde sie perfekt aussehen.
Morgan hatte sich umgedreht, Justine mit ihren stahlgrauen Augen angesehen und sie mit einem reservierten Nicken bedacht. Ihr Haar, von sattem, leuchtendem Kastanienbraun, bewegte sich dabei nicht.
»Haben Sie eine Sekunde, Morgs?«, hatte Justine gefragt.
»Schießen Sie los«, hatte Morgan geantwortet. »Bin gerade dabei, den Monolog für heute Abend zu proben: Ich will da einen Witz darüber einbauen, dass der Premierminister gestern in Hundekacke getreten ist.«
»Ich weiß gar nicht, warum sie sich die Mühe macht – das ist doch auch so schon echt lustig«, hatte ihre Stylistin eingeworfen.
»Es geht um Kane Hunt«, hatte Justine verkündet. »Wir kriegen’s nicht hin.«
»Ach?« Morgans Ton war scharf wie ein Rasiermesser gewesen.
»Das Produktionsteam ist sich einig; es ist einfach zu riskant. Falls es Sie tröstet, die Abstimmung ist sehr knapp ausgefallen.«
Morgan hatte sich wieder zum Spiegel gedreht und Justine darin scharf angesehen.
»Scheiß auf Ihre Abstimmung«, hatte sie gesagt.
Und damit hatte es sich. Justine war hinausgeschlichen und hatte sich auf die Suche nach dem Produzenten gemacht.
»Sieht echt heiß aus«, bemerkte Justine.
»Heiß?«, fragte Allan.
»Nicht ›heiß‹ im Sinne von sexy. Ich meine, er schwitzt.«
»Kein Wunder, er sitzt ja auch nur anderthalb Meter vor der Quarzlampe.«
»Quarzlampe? Ich wusste gar nicht, dass wir so was noch haben. Warum nehmen wir keine LEDs?«
Quarzlampen waren in der Filmindustrie jahrelang üblich gewesen, doch sie verbrauchten eine Menge Strom und produzierten enorme Hitze. Sie waren durch LED-Scheinwerfer verdrängt worden, die im Großen und Ganzen dasselbe leisteten, allerdings ohne die exzessive Hitze und die horrenden Stromkosten.
»Das ist Absicht«, meinte Allan. »Aber nur bei Hunt. Morgan will, dass er schwitzt.«
Justine dachte einen Augenblick lang darüber nach. »Verdammt, ist die gut«, stellte sie fest.
Sie standen in der Galerie, dem Raum, in dem The Morgan Soames Hour komponiert wurde. Das »Glascockpit« – die Wand aus Bildschirmen, die multiple Informationsquellen zeigten – beherrschte den Raum. Eigentlich zogen Justine und Allan es vor, unten im Studio zu sein und die Aufsicht über die Galerie einem der Assistenten zu überlassen, heute Abend jedoch wollten sie in der Nähe des Bildmischers sein. Er hieß Yosef, saß vor seinem Kontrollpult und entschied, welche Kamera zum Einsatz kam. Normalerweise ließen Justine und Allan ihn unter minimaler Aufsicht arbeiten. Morgan vertraute darauf, dass Yosef die richtige Mischung aus ihr und ihrem Gast fand, dass er wusste, wann sie zu sehen sein wollte, wenn sie eine Frage stellte, oder wann die Reaktion ihres Gastes wichtiger war.
Heute Abend war es anders. Als Einzige, die befugt war, eine Liveshow mittendrin abzubrechen, musste Justine hier sein, um Yosef die entsprechende Anweisung zu geben, und Allan wollte bei ihr sein, falls sie das mit jemandem besprechen musste. Eine Liveshow abzubrechen war die schwerwiegendste Entscheidung, die ein Studioleiter treffen konnte.
Die erste halbe Stunde war vorbei, und so weit war alles okay. Morgan hatte nichts zugelassen, und Kane Hunt war nicht besonders auf Krawall gebürstet gewesen.
Sie sahen, wie Morgan hinter sich griff und die einzige Requisite hervorholte, die für heute vorgesehen war. Es war ein Buch. Im Selbstverlag erschienen, aber sehr hochwertig produziert.
»Er sieht nicht gut aus, stimmt’s?«, fragte Justine.
Hunt verwendete zu viel Haargel und war unpassend gekleidet. Er trug eine Bomberjacke und zerrissene Jeans, als wolle er für eine Amateuraufführung von Denn sie wissen nicht, was sie tun vorsprechen und nicht in einer der renommiertesten Fernseh-Talkshows auftreten.
»Nein, wirklich nicht«, pflichtete Allan ihr bei. »Er wirkt blass, trinkt unheimlich viel Wasser und reibt sich andauernd die Augen.«
»Hauptsache, er kratzt uns nicht in den nächsten dreißig Minuten ab«, brummte Justine.
»Erzählen Sie mir etwas über Ihr neues Buch, Kane«, sagte Morgan. »Es heißt The Chad Manifesto. Meines Wissens bezieht sich ›Chad‹ auf attraktive, beliebte Männer, die bei Frauen in sexueller Hinsicht erfolgreich sind?«
»Richtig«, antwortete Hunt. »Chads sind die Gewinner in der genetischen Lotterie, und zwar durch pures Glück. Und eine Studie hat vor Kurzem angedeutet, dass sie, obwohl sie gerade mal zwanzig Prozent der männlichen Bevölkerung ausmachen, achtzig Prozent vom gesamten Sex haben. Für den Rest von uns stellt das ein rechnerisches Problem dar – es bleiben einfach nicht genug Frauen übrig. The Chad Manifesto soll diese Ungerechtigkeit beheben.«
»Ich verstehe«, meinte Morgan. »Und diese Theorie ist Teil der Incel-Bewegung?«
»Ja, ›involuntary celibate‹, unfreiwillig zölibatär.«
»Die Vorstellung, dass Frauenkörper Rohstoffe sind?«
»Genau.« Hunt beugte sich vor und wirkte höchst engagiert. »Im Augenblick werden Männer ohne eigenes Verschulden von etwas ausgeschlossen, was mittlerweile ein deregulierter sexueller Markt ist. The Chad Manifesto plädiert für ein faireres Verteilungssystem. Keinem Mann sollte im 21. Jahrhundert der Sex vorenthalten werden.«
»Der Sex vorenthalten?«, wiederholte Morgan mit ausdrucksloser Miene.
»Sie scheinen nicht überzeugt zu sein.«
»Bin ich auch nicht. Ihre Ansicht, dass Frauen nicht viel mehr sind als unglücklicherweise empfindungsfähige Körper, ist für mich schlicht und einfach lächerlich.«
»Tatsächlich?«, konterte Hunt. »Sie dürfen nicht vergessen, während neunundneunzig Prozent der Geschichte der Menschheit durften Frauen ihre Sexualpartner nicht frei wählen. So etwas wie Dating gab es nicht. Frauen wurden in arrangierten Ehen an Männer übergeben oder als Kriegsbeute beschlagnahmt. Diese relativ neue kulturelle Veränderung hat manche Männer entrechtet.«
Morgan nahm das Buch zur Hand und blätterte darin.
»Wie man hört, haben Sie eine Lösung dafür«, sagte sie.
In der Galerie sagte Justine: »Sie macht’s ihm leichter, als ich gedacht habe.«
»Stimmt«, antwortete ihr Mann. »Genau das macht mir Sorgen.«
»Mir auch.«
»Und sie wollte dir nicht sagen, was sie vorhat?«
Justine schüttelte den Kopf.
Allan trat näher an den Knopf heran, mit dem die Liveübertragung unterbrochen werden konnte.
»Unsere Lösung ist ganz einfach«, erklärte Hunt. »Wir wollen eine vollständige Revision des Sexualstrafrechts. Vor allem der Paragrafen, die sich mit Prostitution befassen.«
»Das ist alles?«, fragte Morgan. »Sie wollen Bordelle legalisieren?«
»Nein, aber diese drakonischen Gesetze zu ändern ist notwendig für das, was danach kommt. Damit unser Vorschlag funktioniert, müssen die Paragrafen, die die Bezahlung für sexuelle Dienstleistungen und die Bewerbung sowie die Kontrolle gewerbsmäßiger Prostitution regeln, vollständig abgeschafft werden.«
»Also wollen Sie doch Bordelle legalisieren.«
»Ganz und gar nicht«, widersprach Hunt. »Aber wir wollen den Sex-Markt revolutionieren.«
»Ich glaube, das sollten Sie lieber erklären.«
»Den Sex-Markt zu monetisieren ist heutzutage absolut sinnvoll. Es steht doch alles andere zum Verkauf, warum also nicht auch Sex? Und wenn man bedenkt, wie viel Geld dafür ausgegeben wird, Frauen zu umwerben, wäre das auch eine beständige und nicht unerhebliche Einnahmequelle für die Regierung.«
»Sie schlagen staatliche Prostitution vor?«
»Ganz sicher nicht. Die Regierung versemmelt ja schon die allerleichtesten Aufgaben. Was wir brauchen, ist die unsichtbare Hand des Marktes. Die Stärke dieses Landes waren schon immer seine Entrepreneure, und wir wollen, dass die den Sex-Markt übernehmen.«
»Und wie soll das funktionieren, Kane?«, erkundigte sich Morgan. »Megabordelle? Legalisierter Straßenstrich?«
»Sexuelle Dienstleistungen als Abo«, antwortete Hunt. »So ähnlich wie Netflix oder Amazon Prime. Männer würden eine monatliche Gebühr bezahlen und die Frauen bekommen ein Gehalt. So, wie man sich heute einen Film oder eine Fernsehshow aussucht, je nachdem, was man abonniert hat, würde man sich einfach die Frau aussuchen, die man will. Die wären bewertet, von eins bis fünf, und für höher bewertete Frauen geht eben mehr vom Guthaben drauf. Zum Beispiel würde ein Abonnent für ein Basispaket drei Stunden Sex im Monat mit einer Zwei-Sterne-Frau kriegen oder fünf Stunden mit einer mit einem Stern. Nicht in einem Bordell, sondern bei sich zu Hause. Für das Premiumpaket würde man natürlich mehr Stunden mit höher bewerteten Frauen bekommen.«
»Und wer würde die Frauen bewerten? Leute wie Sie?«
»Der Markt«, erklärte Hunt. »Und die Abonnenten würden auch bewertet werden. Genauso wie Uber-Kunden und Fahrer einander bewerten. Je schlechter deine Bewertung, desto mehr musst du zahlen. Schlechter bewertete Frauen würden natürlich weniger verdienen als besser bewertete, also wäre es in jedermanns finanziellem Interesse, jede Begegnung so zufriedenstellend wie möglich zu gestalten.« Hunt griff nach seinem Glas und trank es zur Hälfte aus. »Und wenn erst der Privatsektor da einsteigt, mit seiner Marketingexpertise, dann wird das Ganze schnell progressiv und dann Mainstream«, fuhr er fort. »Und auch wenn das Ganze anfangs als Service für Incels betrachtet wird, rechnen wir damit, innerhalb von zwei Jahren Abos für das ganze LGBTQXYZ-Alphabet zu sehen.«
»Wie vorbildlich.«
»Sie sind skeptisch, aber vergessen Sie nicht: Dasselbe haben die Leute übers Internetdating gesagt, und jetzt ist das ein milliardenschwerer Markt. Und nicht nur wird es der Regierung Millionen Pfund an Steuergeldern einbringen, es ist ja auch eine Frage der öffentlichen Gesundheit.«
»Inwiefern?«
»Frauen müssen verstehen, dass brave Hunde, die immer wieder getreten werden, zu bösen Hunden werden. Wir halten den Ausschluss von Männern vom Sex-Markt für die Hauptursache von Vergewaltigungen im UK, und in den USA ist ein Zusammenhang zu Massenschießereien hergestellt worden. Die politischen Ansätze in diesem Manifest gehen all das an.«
»Wollen wir mal eine Pause machen?«, fragte Allan Justine. »Damit Morgan sich neu sortieren kann. Irgendwie hat Hunt da eben gewonnen; Internetdating ist heutzutage völlig normal. Wer sagt, dass das nicht funktionieren würde?«
»Ich sage das«, gab Justine zurück. »Jede Frau sagt das. Jeder, der noch einen letzten Rest Würde hat, sollte das sagen.«
»Vollkommen richtig.« Allan erkannte ein Minenfeld, wenn er in eins hineingestiefelt war. »Es ist eine widerliche Idee.«
Seine Frau lächelte. »Keine Sorge«, sagte sie. »Morgan kriegt das schon gebacken.«
»Ich würde mich dann gern mit Ihnen persönlich befassen, wenn ich darf, Kane?«, sagte Morgan.
»Nur zu.«
»Sind Sie laktoseintolerant?«
»Bitte?«
»Das ist doch eine ganz simple Frage. Können Sie Milchprodukte verdauen?«
Hunt furchte die Stirn. »Ich bin mir nicht ganz sicher, worauf Sie hier hinauswollen, Morgan.«
»Da bist du nicht der Einzige«, sagte Justine zu ihrem Mann.
Der zuckte die Achseln.
»Was zum Teufel hat sie vor?«, fügte sie hinzu.
»Nein, ich bin nicht laktoseintolerant«, sagte Hunt. »Wie kommen Sie darauf?«
»Weil Sie eine Menge Milkshakes über den Kopf gekippt bekommen und ich mich frage, ob Sie wohl deshalb heute Abend einen Leibwächter für nötig gehalten haben.«
»Ich bin sehr bekannt. Ich bekomme Todesdrohungen.«
»Das wusste ich nicht. Haben Sie deswegen schon mal Anzeige bei der Polizei erstattet?«
»Die Polizei besteht zur Hälfte aus Frauen«, wehrte Hunt höhnisch ab. »Was glauben Sie, wie ernst die eine Drohung gegen mich nehmen würden?«
»Ungefähr so ernst wie der Rest von uns, nehme ich an.«
Hunt griff in die Innentasche seiner Jacke und zog ein zusammengefaltetes Blatt Papier heraus. »Hier, schauen Sie mal«, sagte er. »Das ist die Letzte – die kam vor ein paar Tagen.«
»Ranzoomen«, befahl Justine.
Yosef tat wie geheißen und der Hauptbildschirm wurde von Morgans Hand ausgefüllt.
»Was zum …?«, stieß Allan hervor.
Es war eine gepresste Blume. Zartlila. Sternförmig, mit fünf spitzen Blütenblättern. Hübsch. Alles andere als bedrohlich.
»Eine Blume«, stellte Morgan fest. »Na und?«
»Lesen Sie die Nachricht«, erwiderte Hunt.
Morgan war viel zu professionell, um irgendetwas laut vorzulesen, das sie gerade erst in die Hand gedrückt bekommen hatte. Sie überflog den Text, suchte nach etwas Verfänglichem, doch da war nichts. Es war ein Gedicht.
Sie hielt den Zettel so, dass Kamera 3 ihn erfassen konnte, dann las sie vor.
Unter des Gehängten Haupt,
Wo sein Blut tropft in das Laub,
Unter der Frucht, so leuchtend gelb,
Liegt die Wurzel, deren Schrei gellt.
Verschließ die Ohren, reiß sie aus,
Trockne sie und mahl drauflos.
Und schläfst du endlos, ohne zu träumen,
Wird niemand an deinem Sarge weinen.
»Ich verstehe nicht«, sagte Morgan, nachdem sie geendet hatte. »Wieso halten Sie das hier für eine Todesdrohung?«
»Wollen Sie etwa sagen, es ist keine? Da ist von einem Sarg die Rede.«
»Eine hübsche Blume, in ein schlechtes Gedicht verpackt. Ich glaube, damit brauchen wir die Antiterroreinheit der Army noch nicht zu behelligen.«
Hunt schwieg. Der Schweiß lief ihm inzwischen von der Stirn übers Gesicht. Morgan hoffte, dass Yosef das aufs Bild bekam. Eigentlich sollte sie eine Werbepause einlegen, doch sie beschloss, weiter Druck zu machen. »Obwohl es mich ja nicht überrascht, dass Sie meinen, Schutz zu brauchen.«
»Ich bin mir nicht sicher, ob ich Ihnen folgen kann.«
»Sagt Ihnen der Name Anita Fowles etwas?«
»Ich kann mich nicht …«
»Das war die Jurastudentin, die Sie erfolglos verklagt hat, nachdem ein Nacktfoto von ihr den Weg auf Ihre Website gefunden hatte.«
Hunt zuckte die Schultern. Feixte ein wenig. »Die Gerichte haben in dieser Angelegenheit bereits geurteilt.«
»Ja, das haben sie«, bestätigte Morgan. Sie hielt ganz kurz inne, dann fügte sie hinzu: »Haben Sie Angst vor Frauen, Kane?«
Hunt lachte. Ein Schweißtropfen fiel von seiner Nase und er hustete einmal trocken. »Natürlich nicht. Wovor soll man da Angst haben?«
»Sagen Sie’s mir?«
»Frauen sind nicht furchterregend, Morgan. Nicht einmal Sie. Aber nicht jeder ist in einer so vorteilhaften Position wie ich; manche Männer fühlen sich schon eingeschüchtert. Deswegen habe ich ja The Chad Manifesto geschrieben.«
»Aber so, wie ich es verstehe, schrumpft Ihr kleiner Freund jedes Mal zusammen, wenn Sie an Frauen denken. Es ändert nichts, dass Sie Viagra einwerfen wie M&M’s, Ihr Soldat steht nicht mehr stramm.«
»O Mann!«, stieß Justine hervor. »Die Kamera auf Hunts Gesicht. Sofort, Yosef.«
»Ist schon drauf.«
Selbst der grelle Schein der Quarzlampen konnte die Röte nicht verbergen, die Hunt vom Hals aus ins Gesicht schoss. Er presste die Kiefer zusammen. Eine Ader in seiner Stirn begann zu pulsieren.
»Wunderschön«, stellte Justine fest.
»Wovon zum Teufel reden Sie eigentlich?«, blaffte Hunt. »Ich habe noch nie Viagra genommen! Jede Frau, mit der ich mich einlasse, und das waren Hunderte, erlebt einen Abend, den sie nie vergisst. Und das ist hundert Prozent Natur.«
»Ich glaube, das ist das erste wahre Statement, das Sie heute Abend abgegeben haben«, entgegnete Morgan mit gefährlich liebenswürdiger Stimme. »Die Frauen, mit denen Sie sich einlassen, erleben wirklich einen Abend, den sie niemals vergessen können. Nicht einmal nach einer professionellen Therapie.«
»Ich weiß wirklich nicht, wo Sie das herhaben, aber an Ihrer Stelle würde ich Ihre Rechercheure feuern. Sonst könnten Sie ernsthafte juristische …«
Seine Stimme erstarb, als Morgan die Requisite präsentierte, die sie allen verschwiegen hatte, sogar Justine. Sie kippte einen Einkaufsbeutel aus Stoff aus, und etwas fiel auf den Glastisch.
Das Ding war penisförmig, bestand aus schwarzem Silikon und war an einem Geschirr befestigt. Es sah gleichermaßen anrüchig wie erbärmlich aus.
»Was zur Hölle ist das?« Allans Blick klebte an dem Bildschirm.
»O mein Gott, das ist eine Penismanschette!«, antwortete Justine. »Ein Typ, der impotent ist, steckt da seinen Schwanz rein, und das Ding wird mit den Gurten da festgemacht. So kann der dann penetrativen Sex haben. Jedenfalls so was in der Art. Was hat so was live im Fernsehen verloren?«
»Woher weißt du …?«
»Ich habe doch vor ein paar Jahren mal diese Doku über erektile Dysfunktionen gemacht, erinnerst du dich?«
Allan erinnerte sich. Es war nicht gerade eine Sternstunde des Fernsehens gewesen, aber auch keine schlechte Sendung.
»Sollen wir auf Werbung schalten?« Seine Finger schwebten über dem Knopf.
»Echt jetzt? Du willst Morgan jetzt abwürgen? Die zieht uns die Haut ab und trägt uns als Hut.«
»Auch wieder wahr.«
»Aber halte dich bereit«, sagte Justine. »Hunt sieht aus, als ob er gleich einen Herzinfarkt kriegt.«
Justine hatte nicht übertrieben. Hunt sah wirklich nicht gut aus. Morgan schob die Penismanschette über den Tisch. Sie benutzte dazu ein Papiertaschentuch.
»Das hier haben Sie bei Anita Fowles in der Wohnung liegen gelassen«, sagte sie. »Sie hat gefragt, ob ich’s Ihnen zurückgeben könnte.«
»D-d-das gehört mir nicht!«
»Nein?«
»Natürlich nicht!«
»Sieht aber aus wie Ihres.«
»Es sieht aus … Was zum Teufel meinen Sie damit, es sieht aus wie meins?«
»Oh, Entschuldigung, habe ich das nicht gesagt? Anita hat Sie ohne Ihr Wissen dabei gefilmt, wie Sie Ihren schlaffen kleinen Pimmel in dieses Ding gestopft haben. Als sie gefragt hat, warum Sie eine Penisprothese tragen, sind Sie in Tränen ausgebrochen.«
»Sie hat eine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben«, entgegnete Hunt. »Selbst wenn’s ein Video gäbe, und natürlich gibt es keins, dürfte sie es niemandem zeigen.«
»Sie haben natürlich recht, Anita hat eine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben«, bestätigte Morgan. »So etwas unterschreiben die Frauen alle. Deswegen ist bis jetzt auch noch nichts im Internet aufgetaucht. Nur ist Anita leider Jurastudentin, und auf dem Video, das sie gemacht hat, ist auch drauf, wie Sie Ihren Partytrick vorführen: sich eine Zigarette mit einem Elektroschocker anzünden. Klingelt’s da bei Ihnen, Kane?«
Hunt antwortete nicht. Er begann zu hyperventilieren.
»Also, das wissen Sie vielleicht nicht, aber wie alle Verträge dürfen Verschwiegenheitserklärungen nicht dazu benutzt werden, illegale Aktivitäten zu schützen. Wir haben uns juristisch beraten lassen, und es sieht ganz danach aus, als sei durch Ihren Besitz und die Handhabung einer illegalen Waffe die Verschwiegenheitserklärung nichtig.«
»Mir geht’s nicht gut«, sagte Hunt.
»Nein?«, fragte Morgan. »Tja, ich glaube auch nicht, dass Sie sich gleich besser fühlen werden. Denn da Sie bereits ein Foto von Anita online mit anderen geteilt haben, hat sie es nur für fair gehalten, sich zu revanchieren. Sobald wir auf Sendung gegangen sind, hat Anita ihr Video an einen ganzen Haufen Websites und Zeitungsredaktionen und …«
»Nein, wirklich, mir ist nicht …«
Hunt sackte in seinem Sessel zusammen. Einen Moment blieb er so, dann kippte er bewusstlos auf den blank gebohnerten Studioboden und übergab sich.
Entsetzt starrte Justine auf den Bildschirm. Yosef hatte die Liveübertragung auf Morgans entgeisterte Miene umgeschaltet, doch Kamera 3 war immer noch auf Hunts Gesicht gerichtet. Es war dunkelrot angelaufen. Erbrochenes sickerte aus seinem Mundwinkel.
»Werbung!«, schrie Justine.
Allan drückte auf den Knopf, und die Liveübertragung wurde abgebrochen.
Und auf dem Boden des Studios starb Kane Hunt inzwischen weiter …
3. Kapitel
Poe, warum sollte jemand meine Zehennägel kaufen wollen?«
Der größte Teil von Detective Sergeant Washington Poes Tee schoss ihm aus der Nase; den Rest prustete er sich übers Kinn und aufs T-Shirt. Neben ihm kicherte Detective Inspector Stephanie Flynn, die Augen fest gegen das Hightech-Fernglas gedrückt.
Es war nicht das Merkwürdigste, was Matilda »Tilly« Bradshaw je zu ihm gesagt hatte. Es reichte nicht einmal für die Top Five, aber so ohne Vorwarnung und ohne Kontext drängte es sich wahrscheinlich in seine Top Ten. Vielleicht Nummer neun. Abgedrehter als neulich, als sie gefragt hatte, welches seine Lieblingswolkenformation sei, aber nicht so schlimm wie damals, als sie ihn gebeten hatte, sich doch einmal den Leberfleck an ihrem Hinterteil anzusehen.
»Übernehmen Sie das, Boss?« Poe seufzte und schaute auf sein T-Shirt hinunter. Inzwischen hatte er nur noch ein sauberes übrig.
Flynn schüttelte den Kopf, sah dabei aber weiter durch das Fernglas. Ihr blondes Haar war zurückgebunden und schwang wie ein Pferdeschweif hin und her.
»Kommt nicht infrage«, sagte sie. »Sie hat Sie gefragt, und ich habe mir gerade eine Stunde lang angehört, warum ich eigentlich noch stillen sollte.«
»Sie sollten auch wirklich noch stillen, DI Flynn«, verkündete Bradshaw. »Die WHO sagt das ganz deutlich: Wenn man Babys achtzehn Monate lang stillt, bekommen sie mehr Nährstoffe und sind besser gegen Krankheiten geschützt. Das hilft das ganze zweite Lebensjahr lang, Krankheiten zu bekämpfen.«
»Ach ja? Na, es sind ja auch nicht Ihre Brustwarzen, auf denen er rumkaut.«
»Sind die wund? Haben Sie’s mal mit Muttermilch als Feuchtigkeitslotion probiert?«
Diesmal war es an Poe, hämisch zu kichern. Noch war Bradshaw keine Situation begegnet, die sie nicht noch etwas peinlicher gestalten konnte.
»Nein danke, Tilly«, antwortete Flynn. »Und ich habe mit meinem Arzt gesprochen; er hat nichts dagegen, dass ich anfange abzustillen.«
Bradshaw runzelte die Stirn. Soweit es sie betraf, standen Ärzte nur eine Stufe über Zahnärzten. Kaum funktionsfähige Volltrottel.
»Und außerdem«, fuhr Flynn fort, »wollten Sie Poe nicht gerade Ihre Zehennägel verkaufen …?«
4. Kapitel
Es war die sonderbarste Observierung, an der Poe jemals teilgenommen hatte.
Drei Tage in der Abstellkammer von Mr und Mrs Emsley, dem hochbetagten Paar, das gegenüber von ihrer Zielperson wohnte.
Drei Tage nichts und wieder nichts.
Keine Sichtungen, keinerlei Hinweise darauf, dass jemand in dem Haus lebte, das sie beobachteten. Drei Tage lang lediglich Regen, Wind und Graupel und hin und wieder Besuche von Colin, dem arthritischen und zu Flatulenzen neigenden Zwergschnauzer der Emsleys.
Weihnachten war vorbei, der Januarwind war kalt und die düsteren Wolken hingen so tief, dass man sie hätte berühren können. Die Temperaturen hielten sich knapp über dem Gefrierpunkt. Kalt genug, dass einem die Knochen wehtaten, nicht kalt genug, dass der Schnee liegen bleiben konnte. Ganz gleich, wie sehr sich Poe in Acht nahm, jedes Mal, wenn er ins Freie trat, waren die unteren zwanzig Zentimeter seiner Jeans hinterher mit schmutzigem Wasser bespritzt.
Selbst die Emsleys – anfangs voll Freude bereit, die Serious Crime Analysis Section zu beherbergen, die Einheit der National Crime Agency, die dafür zuständig war, Serienmörder und -vergewaltiger zur Strecke zu bringen – hatten inzwischen genug. Mrs Emsley hatte den ganzen Vormittag lang Andeutungen über die Billigkreuzfahrt gemacht, die man ihr und ihrem Mann angeboten habe.
Flynn hatte ihr gesagt, dass es nicht mehr sehr lange dauern würde. Das war nicht gelogen. Rund um das Haus der Zielperson waren fast dreißig Polizisten postiert, und ihr Budget war nicht grenzenlos.
Wenigstens saßen sie drinnen, dachte Poe. Die Abstellkammer der Emsleys war die Kommandozentrale der Überwachungsoperation. Flynn brauchte einen Ort mit anständigem Mobilfunknetz und freier Sicht auf das Haus der Zielperson. Außerdem musste es dort trocken sein, und sie brauchte Privatsphäre, um ihre Milch abzupumpen. Wenn sie das nicht regelmäßig tat, so hatte Bradshaw es Poe erklärt, schmerzten ihre Brüste. Er fragte sie nicht, woher sie das wusste.
Poe hatte schon bei vielen Observierungen mitgemacht. Hunderte Male. Er war schon lange Polizist, und so etwas war ihm in Fleisch und Blut übergegangen. Flynn hatte dergleichen schon fast ebenso häufig mitgemacht.
Aber so einen Einsatz hatte noch keiner von ihnen erlebt.
Einer der Gründe dafür war ihre Zielperson. Die Medien hatten ihn Jumping Jack getauft, und seit drei Wochen versetzte er die Frauen von Watford in Angst und Schrecken. Er war ein ganz übler Vergewaltiger, der hinter einer Guy-Fawkes-Maske versteckt am helllichten Tag eine Serie brutaler sexueller Missbrauchsverbrechen begangen hatte. Bei sechs von seinen acht Vergehen hatten Passanten versucht, ihn zu fassen. Und einmal war eine Hundestaffel der Polizei mit zwei Schäferhunden in der Gegend unterwegs gewesen.
Er war entkommen.
Mit Leichtigkeit.
Denn Jumping Jack war ein traceur. Jemand, der Parkour trainierte, die Kombinationsdisziplin aus unter anderem Freerunning, Springen und Klettern. Jedes Mal, wenn er verfolgt worden war – und Poe war sich sicher, dass verfolgt zu werden der eigentliche Kick für Jumping Jack war –, war er von Überwachungs- und Handykameras gefilmt worden. Wie er an Gebäuden hinaufkletterte, riesige Entfernungen mit einem Satz überwand und über seine Verfolger hinwegsprang, wenn er in die Enge getrieben worden war, das war fast nicht zu glauben.
Deswegen waren auch so viele der Cops bei dieser Operation jung und athletisch. Eine der Kolleginnen war bei den Olympischen Spielen angetreten. Und deswegen bekam Poe trotz des tatenlosen Herumsitzens und des miesen Wetters auch nie eine einzige Klage zu hören, wenn er sich nach dem Befinden der anderen erkundigte. Sie wollten Jumping Jack von der Straße haben, und sie wollten ihm klarmachen, dass er nicht der Einzige war, der tolle Tricks draufhatte.
Außerdem war diese Observation seltsam, weil Bradshaw dabei war. Sie war Analystin, und Analysten beteiligten sich normalerweise nicht an Überwachungsoperationen. Poe hatte noch nie jemanden im Beisein einer Zivilistin observiert. Das war kein beruflicher Snobismus. Zivilisten durften einer Gewerkschaft beitreten, Polizisten nicht.
Diesmal hatte Bradshaw darauf bestanden.
Sie und ihr Team, wohlwollend »die Maulwürfe« genannt, weil sie dazu neigten, heftig zu blinzeln, wenn sie ins Freie traten, hatten das Computerprogramm geschrieben, das die Moves, die Jumping Jack auf den Videoaufnahmen zum Besten gab, analysiert und bewertet hatte. Sie hatten sie mit unzähligen Aufnahmen von Freerunning-Cracks und traceurs auf YouTube und anderen Websites abgeglichen. Ihre nicht unsinnige Ansicht war, dass jemand mit Jumping Jacks Parkour-Fertigkeiten diese wahrscheinlich nicht verbergen würde. Wenn er beim Vergewaltigen eine Rampensau war, dann war er wahrscheinlich auch eine Rampensau, wenn er gerade niemanden vergewaltigte.
Und es funktionierte.
Die Maulwürfe hatten – innerhalb ihrer Fehlertoleranz – eine Liste mit sechs Personen erstellt. Gute Polizeiarbeit reduzierte diese Liste auf einen einzigen Verdächtigen: Patrick »The Trick« Barnetson.
Flynn entschied, ihn zu Hause festzunehmen. Ein Undercover-Team, das sich Zutritt verschaffte, fand ihn dort nicht vor; allerdings bestätigten DNA-Proben von seiner Zahnbürste, dass Barnetson tatsächlich Jumping Jack war. Statt dies öffentlich zu machen, beschloss Flynn, zu warten. Damit riskierte sie weitere Opfer, doch wenn sie ihn enttarnten, könnte ihn das zur Flucht zwingen. Und wegen seiner Parkour-Kontakte in Ländern, die nicht ins UK auslieferten, war es möglich, dass er für alle Zeit verschwand.
Bradshaw hatte eine Umgebungskarte für Barnetsons Adresse erstellt und diese in ein 3-D-Computermodell konvertiert. Sie hatte eine Reihe Simulationen durchgeführt, die vorhersagten, wohin er fliehen und welcher Moves er sich dabei bedienen würde, falls es ihm gelang, den Polizisten zu entwischen, die ihn in seiner Wohnung festnehmen wollten. Sie müsse bei der Observierung dabei sein, hatte sie gesagt, damit sie die Kollegen bei der Verfolgung anleiten könne.
Der wahre Grund wurde offenkundig, als sie sich auf eine längere Wartezeit eingerichtet hatten. Entsetzt über Poes Geschichten von der Verpflegung bei Observierungen, hatte Bradshaw es übernommen, dafür zu sorgen, dass Flynn, eine stillende Mutter, sich weiter ausgewogen ernährte. Und da sie es nicht fair fand, dass Poe Pommes, Kebab und chinesisches Take-out-Essen futterte, während Flynn Obst, Gemüse, Sprossen und fetten Fisch aß, hatte sie die Dinge selbst in die Hand genommen. Sie hatte Poe gesagt, Flynn sei für die Verpflegung zuständig, und Flynn hatte sie erzählt, das sei Poes Sache. Und da Bradshaw in ihrem ganzen Leben noch nie jemanden vorsätzlich getäuscht hatte, waren beide gar nicht auf die Idee gekommen, den anderen zu fragen.
Das erste Anzeichen dafür, dass irgendetwas nicht stimmte, bemerkte Poe, als er in die Abstellkammer trat: Da drin roch es nicht wie ein Kebab-Imbiss.
Flynn warf einen Blick auf seine leeren Hände und fragte: »Wo ist das Scheißcurry, Poe?«
Anstelle der gebackenen, frittierten und zuckerhaltigen Snacks, auf die sie sich gefreut hatten, hatte Bradshaw Müsliriegel mit Goji-Beeren und Datteln gekauft, außerdem frisches Obst, Hummus mit Karottenraspeln, ungesalzene Nüsse und merkwürdig riechendes Brot.
Außerdem hatte sie einen Minikühlschrank mitgebracht, damit sie nicht den der Emsleys benutzen mussten.
»Da ist Joghurt drin, Boss«, hatte Poe gejammert. »Bei ’ner Observierung kann man doch keinen Joghurt essen.«
»Aber der enthält aktive Bakterien, Poe«, hatte Bradshaw ihn wissen lassen.
»Warum steckst du dir deine Bakterien nicht …«
»Das reicht, Poe«, ging Flynn dazwischen. »Und Tilly, hören Sie auf, ihn in Wallung zu bringen.«
»Wo sind die Chips?«, hatte Poe gefragt, sobald Bradshaw die Kammer verlassen hatte. »Die Billig-Wurstbrötchen, die süße Limo, das Fleisch mit diesen komischen kleinen Röhren drin?«
»Wir gehen einkaufen, wenn sie schläft«, versprach Flynn.
»Sie schläft nicht, und wir hocken hier mitten in einer verdammten Sozialsiedlung. Der einzige Laden, der zu Fuß erreichbar ist, ist ein Zeitungskiosk, und wir können hier kein unbekanntes Auto in der Nähe rumstehen lassen, weil Barnetson dann Lunte riechen könnte.«
Flynn hatte geseufzt.
»Wir kommen schon irgendwie klar, Poe.«
Bradshaw war mit einer braunen Papiertüte zurückgekehrt. Poe funkelte die Tüte böse an – sie hatte noch nicht einmal den Anstand, Fettflecken aufzuweisen.
»Möchtest du eine Mungobohne mit Wasabi-Überzug, Poe?«, erkundigte sich Bradshaw. »Die sind aus dem Bioladen.«
»Es muss doch eine einfachere Möglichkeit geben, sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen«, brummte Flynn vor sich hin, während Poe eine weitere Tirade vom Stapel ließ.
5. Kapitel
Tilly Bradshaw war ein menschlicher Sonderfall. Ein Mathematikgenie auf einem Gebiet, das das Wort Genie nicht gern verwendete. Und obgleich die Mathematik ihre erste Liebe war, war sie eine echte Universalgelehrte – ein Mensch, der auf komplexe Wissensbestände zurückgreifen konnte, um facettenreiche Probleme zu lösen. Das hatte sie getan, seit sie mit dreizehn aus der Schule genommen worden war und ein Vollstipendium in Oxford bekommen hatte, wo ihr einmaliger Verstand gedeihen und sein wahres Potenzial entfalten konnte.
In akademischer Hinsicht hatte sie jedermanns kühnste Erwartungen übertroffen. Als sie mit dem Studium fertig war, blieb sie, um zu forschen. Unternehmen aus aller Welt bombardierten sie mit Geld. Ihre erleichterten Eltern glaubten, ihre intellektuell absonderlich geformte Tochter habe eines der wenigen absonderlich geformten Löcher gefunden, die es für sie gab.
Und jahrelang hatte ihr das auch genügt.
Bis es ihr eines Tages nicht mehr genügt hatte.
Ohne es irgendjemandem zu sagen, bewarb sie sich erfolgreich um eine Stelle als Profilerin bei der Serious Crime Analysis Section. Nachdem sie bei der schriftlichen Aufnahmeprüfung drei der Fragen korrigiert hatte, reichte sie etwas ein, das sich als das beste jemals erreichte Ergebnis erweisen sollte, ein Resultat, das erreicht, aber niemals übertroffen werden konnte. Bei einer Prüfung, bei der die durchschnittliche Punktzahl dreiundsechzig von hundert betrug, heimste sie glatte hundert Punkte ein.
Sie fing bei der SCAS an.
Und zu jedermanns Verblüffung tat sie sich schwer.
Sie war brillant, konnte Dinge tun, die andere nicht konnten. Dinge, die niemand sonst auch nur zu denken vermochte. Sie konnte maßgeschneiderte Lösungen entwickeln und Muster in einer Datenmasse schneller erkennen als jeder Computer. Auf fast jedem Feld der Kriminologie wurde sie zur führenden Expertin. Forensische Buchhaltung, Fingerabdruckanalyse und Blutfleckmuster sowie digitale und multimediale Analysen, Schusswaffen- und Werkzeugspurenbestimmung, geografisches Profiling, Ganganalyse. Sie studierte sogar forensische Astronomie, um das Aussehen des Himmels zu einem spezifischen Zeitpunkt in der Vergangenheit bestimmen zu können.
Eigentlich hätte sie der wertvollste Aktivposten der Polizei des ganzen Landes sein sollen.
Doch was die Hochschullehrer und Gastprofessoren und nicht einmal ihre Eltern verstanden hatten, war, dass es Konsequenzen gehabt hatte, Bradshaw in so jungen Jahren die Bildung einer Erwachsenen angedeihen zu lassen.
Sie hatten ihr ihre Kindheit gestohlen.
Und was noch wichtiger war, sie hatten sie der Chance beraubt, mit Menschen zu interagieren, die nicht so waren wie sie. Sie hatte keinerlei Sozialkompetenz entwickelt, glaubte alles, was man ihr sagte, war unfähig, Ironie oder Sarkasmus zu erkennen. Und weil sich das, was sich in ihrem Kopf abspielte, nicht leicht in Worte übersetzen ließ, die andere Menschen verstanden, wurde ihre arglose Ehrlichkeit irrtümlich für Unhöflichkeit gehalten.
Es war nicht leicht, mit ihr auszukommen.
Sie war anders.
Und ganz gleich, wo man ist, Menschen, die anders sind, werden gemobbt.
Manche SCAS-Angestellten, die neidisch auf ihre Fähigkeiten waren, klauten ihre Privatsachen. Sie forderten einander heraus, sie zu immer unmöglicheren Dingen zu verleiten. Sie beschimpften sie.
Bradshaw zog sich immer mehr in sich zurück. Sie war todunglücklich.
Und dann war Poe in ihr Leben getreten. Nach anderthalb Jahren Suspendierung war er in den Dienst zurückgekehrt und hatte den besten Profiler der SCAS an seiner Seite gebraucht. Flynn, die inzwischen auf Poes ehemaligen Posten als DI befördert worden war, hatte ihm Bradshaw empfohlen. Poe hatte mit ihr gesprochen und zweierlei begriffen. Erstens, dass sich hinter all der Ungeschicklichkeit und unbeabsichtigten Unhöflichkeit eine extrem freundliche und brillante junge Frau verbarg.
Zweitens, dass sie gemobbt wurde.
Und Poe hasste Mobber.
Hatte sie immer schon gehasst, würde sie immer hassen.
Solche Typen lösten bei ihm einen urzeitlichen Reflex aus, eine gewaltige Überreaktion.
Die Leute von der SCAS merkten bald, dass sie genauso gut Poe gemobbt haben könnten, wenn sie Bradshaw schikanierten. Tatsächlich wäre ihnen das besser bekommen. Die Konsequenzen wären nicht ganz so drastisch.
In Sachen Lebenserfahrung lagen Welten zwischen ihnen – er hatte welche, sie hatte keine –, und intellektuell konnten sie sich einander kaum verständlich machen. Eigentlich hätten sie nicht miteinander klarkommen sollen.
Taten sie aber.
Denn unter all der kindlichen Unbeholfenheit, den taktlosen Bemerkungen und der fehlenden Bescheidenheit war Bradshaw der netteste Mensch, dem Poe jemals begegnet war. Loyal bis zur Sturheit – eine Eigenschaft, die sie gemeinsam hatten – und kampflustig wie ein Honigdachs, wenn es darum ging, Poe zu verteidigen. Zweimal hatte sie ihm das Leben gerettet, hatte einmal verhindert, dass er wegen Mordes angeklagt wurde, und ihm geholfen, unzählige Schurken zu fassen. Außerdem hatte sie ihm dabei geholfen, mit seinen Dämonen zurande zu kommen. Hatte ihm gezeigt, dass der finstere, selbstzerstörerische Pfad, auf dem er sich befand, nicht der einzige Weg war. Es gab eine hellere Straßenseite, auf der man gehen konnte.
Und als Gegenleistung half er ihr, in einer komplizierten und nuancierten Welt zurechtzukommen, mit der sie sich noch immer nach und nach vertraut machte. Er zeigte ihr, wie sie mit ihren Kollegen kommunizieren konnte, ohne sie vor den Kopf zu stoßen. Sie wurde besser darin, Körpersprache zu deuten und Sarkasmus und Ironie zu erkennen.
Doch sie war immer noch Bradshaw. Die wunderbar unschuldige soziale Handgranate, dieselbe Person, die dem Bischof von Carlisle mitgeteilt hatte, dass sie keinen Kamillentee trank, weil sie davon Durchfall bekam. Nie trug sie etwas anderes als T-Shirt und Cargohosen, und obwohl sie sich eine moderne Brille hätte leisten können, zog sie ihr Harry-Potter-Modell vor, dessen dicke Gläser ihre grauen Augen riesengroß aussehen ließen.
Wenn sie also behauptete, dass jemand ihre Zehennägel kaufen wolle, dann war das kein Aufmacher für einen Witz.
Irgendjemand wollte das tatsächlich.
6. Kapitel
Erzähl mir genau, was passiert ist«, sagte Poe.
»Ich habe gestern Abend Dragon Lore gespielt, und Nedski42 hat angeboten, mir meine Zehennägel abzukaufen«, erklärte Bradshaw. »Wenn ich einen von jedem Zeh schicke, gibt’s mehr Geld.«
»Und der ist einer von den anderen Mitspielern?«
»Ja. Er ist nicht besonders gut.«
»Du bist ihm nie begegnet?«
»Natürlich nicht.«
»Und deine Identität ist verschlüsselt, nehme ich an?«
Bradshaw schnaubte. Ihre Onlinesicherheit nahm sie sehr ernst.
»Und wer ist der Typ?«, wollte Poe wissen.
»Ich weiß es nicht, Poe. Soll ich’s rausfinden? Ich dachte, ich frag erst mal, ob das irgendwie schräg ist.«
»Das ist definitiv schräg. Aber vielleicht nicht gefährlich schräg. Besorg mir seinen Namen, und ich hole mal ein paar Erkundigungen ein.«
»Aber wofür will er die denn haben? Das ist doch nur verhärtetes Protein.«
Poe wollte nicht spekulieren. »Für nichts Gutes«, knurrte er. »Nur mal so aus Neugier, wie viel hat er denn geboten?«
»Hundert Pfund, Poe.«
»Meine Fresse. Sag ihm, er kriegt meine für fünfzig. Ich schicke sie noch heute Abend ab.«
Flynn sprang auf. »Okay, mehr von diesem Bullshit ertrage ich nicht. Übernehmen Sie das Fernglas, Poe, ich muss mir die Beine vertreten. Ich gehe zum Kiosk; die Milch ist alle.«
»In dem Minikühlschrank ist noch was von Tillys Mandelmilch«, sagte er. »Ganz schön süß, aber im Tee geht’s.«
»Die habe ich heute Morgen für mein Müsli verbraucht, Poe«, widersprach Bradshaw.
Poe schaute seinen Becher an. »Und was ist dann das hier in meinem Tee?«
Flynn starrte ihn an. Ihre Augen wurden riesengroß. »O Mann, das soll doch wohl ein Witz sein«, stieß sie hervor.
Allmählich dämmerte es Poe. »Ich hab doch nicht etwa …«
»Doch, Sie haben, verdammt noch mal!«, fuhr Flynn ihn an. »Vierzig Minuten habe ich zum Abpumpen gebraucht!«
»Was?«, fragte Bradshaw. »Was hat Poe gemacht, DI Flynn?«
»Er hat meine Muttermilch in seinen Tee gekippt, Tilly.«
»Warum denn das?«
Flynn riss die Arme hoch. »Warum tut Poe überhaupt irgendwas?«, gab sie zurück und stapfte aus der Kammer. Auf dem Weg die Treppe hinunter murmelte sie Obszönitäten vor sich hin.
»Keine Sorge, Poe«, meinte Bradshaw. »Wenn das Zeug gut genug für DI Flynns Baby ist, dann ist es auch gut genug für dich, stimmt’s?«
Poe machte ein finsteres Gesicht. »Nein, stimmt nicht«, erwiderte er und stand auf. »Schau doch mal fünf Minuten durch dieses Fernglas, ja?«
»Wo willst du denn hin? DI Flynn hat doch gesagt, du musst da durchgucken.«
Er schmiss seinen Becher in den Mülleimer. »Ich geh mir fünfzehnmal die Zähne putzen.«
Zehn Minuten später kam Poe mit aschfahlem Gesicht zurück. Flynn saß wieder am Fernglas.
»Seien Sie nicht so eine Dramaqueen, Poe«, sagte sie. »In Covent Garden gibt’s einen Laden, wo sie Muttermilcheis verkaufen.«
»Igitt!«, ekelte sich Bradshaw. »Das würde ich nicht mal probieren, wenn ich keine Veganerin wäre.«
Poe antwortete nicht.
»Was ist denn los, Poe?«, fragte Bradshaw, die in letzter Zeit mehr auf seine Stimmungen eingestellt war.
»Ich muss weg«, sagte Poe.
»Jetzt?«, fragte Flynn.
»Ja, jetzt.«
»Das geht nicht. Ich muss ab und zu mal Pause machen, und Tilly kann den Jungs da draußen keine Befehle erteilen.«
»Ich muss sofort weg, Boss.«
»Warum denn, um Himmels willen?«
»Die Polizei von Northumberland hat mich gerade angerufen.«
»Wenn’s um eine Empfehlung geht, das muss warten.«
»Es geht nicht um eine Empfehlung.«
»Und was wollten die dann?«
»Es geht um Estelle Doyle«, antwortete Poe.
»Was ist mit ihr?«
»Sie ist verhaftet worden, wegen Mordes.«
Flynn zögerte weniger als eine Sekunde lang.
»Ab mit Ihnen«, befahl sie.
Ungefähr um dieselbe Zeit, als Poe nach Norden raste, um herauszufinden, was genau seiner Freundin passiert war, fand der Ehrenwerte Parlamentsabgeordnete des Wahlkreises Sheffield South East eine gepresste Blume in seiner Post …
7. Kapitel
Poe konnte seine Freunde an einer Hand abzählen. Und dann war immer noch der Daumen übrig.
Bradshaw natürlich.
Und Flynn kannte er schon seit Jahren.
Seine Vollzeit-Nachbarin und Teilzeit-Hundesitterin Victoria Hume betrachtete er ebenfalls als Freundin.
Und dann war da noch Estelle Doyle.
Genau wie Bradshaw war sie brillant. Anders als Bradshaw, die stets auf der Sonnenseite der Straße dahinmarschierte, drückte sich Doyles Persönlichkeit im Schatten herum, im Zwielicht. Sie galt in ganz Europa als führende forensische Pathologin und war Poes Anlaufstelle, wann immer er Fragen zu irgendetwas Feuchtem, Organischem hatte.
Normalerweise begegnete sie Polizisten mit Verachtung. Ihre legendäre scharfe Zunge hatte dazu geführt, dass manche Detectives sich weigerten, mit ihr zu arbeiten. Aus irgendeinem Grund jedoch tolerierte sie Poe. Nahm sich die Zeit sicherzugehen, dass er verstand. Sie machte für ihn Überstunden, wenn es nötig war. Erschien sogar an seinen Tatorten, und das tat sie sonst nie. Einmal hatte sie ihn als ewig zu kurz Gekommenen mit capraesken Eigenschaften bezeichnet. Poe hatte sich zu sehr gefürchtet, um zu fragen, was das heißen sollte.
Und sie flirtete schamlos mit ihm. Sie sagte Sachen, die ihn erröten ließen. Trug enge Klamotten, bei denen ihm ganz schwummrig wurde. Ihre Absätze und ihre Wangenknochen waren hoch, ihr Lippenstift scharlachrot. Ihre Augenbrauen hätten mit einem Skalpell geschnitzt sein können.
Poe war gleichermaßen verängstigt und bezaubert.
Aber er mochte sie. Betrachtete sie als Freundin. Wusste ganz tief im Bauch, dass sie für ihn da sein würde, wirklich da sein würde, wenn es drauf ankam.
Der DI, mit dem er gesprochen hatte, hatte keine Details preisgeben wollen. Hatte nur gesagt, Doyle sei wegen Mordes verhaftet worden und habe nur fünf Worte von sich gegeben, seit sie in Gewahrsam genommen worden war: Sagen Sie Washington Poe Bescheid.
»Bitte betrachten Sie diesen Anruf als Bescheid«, hatte er gesagt.
»Ich bin in fünf Stunden da.«
»Das hier ist ein Höflichkeitsanruf, Sergeant Poe. Es geht um einen Fall der Polizei von Northumberland – halten Sie sich da raus.«
»Ich bin in fünf Stunden da«, hatte er wiederholt.
Poe warf einen Blick auf die Uhr am Armaturenbrett und beschloss, dass er in vier Stunden da sein wollte. Er trat das Gaspedal durch.
8. Kapitel
Bradshaw rief an, als er gerade am Angel of the North vorbeikam, der zwanzig Meter hohen Stahlskulptur, die in der Nähe von Gateshead über der A1 aufragte.
»Bist du schon da, Poe?«
»Noch nicht, Tilly. Was gibt’s denn?«
»Jumping Jack ist verhaftet worden.«
»Ihr habt ihn geschnappt?«, fragte er verblüfft.
»Ja. DI Flynn hat ihn über seinen Gartenzaun klettern sehen. Sie glaubt, er hat einen von den Polizisten bemerkt, die sein Haus beobachtet haben, aber er brauchte seinen Pass. Der war in seiner Tasche, als er festgenommen wurde.«
»Haben sie ihn drinnen erwischt?«
»Gott, nein«, wehrte Bradshaw ab. »Er ist aus einem Fenster im obersten Stock gesprungen und hat dann die siebzehnte Simulationsroute genommen, die ich geplant hatte.«
»Sag mir noch mal, welche das war.«
»Die, bei der er in das Haus drei Grundstücke weiter eingebrochen, die Treppe hochgerannt und dann aus dem Fenster an der Rückseite auf einen Apfelbaum gesprungen ist. Von da konnte er auf das Dach des Ladens neben den Gleisen springen.«
»Und wer hat ihn dann geschnappt?«
»DI Flynn hat ihn verhaftet«, antwortete Bradshaw. »Ich bin natürlich hinterher für den Fall, dass er türmt. Ich habe gesehen, wie sie ihn geschnappt hat.«
»Hat er Widerstand geleistet?« Poe hoffte es. Flynn hatte einen schwarzen Gürtel in Krav Maga und war jemandem, der gut springen konnte, mehr als gewachsen.
»Ja, hat er.«
»Ist Flynn okay?«
»Sie humpelt.«
»Ist sie hingefallen?«
»Nein, Poe. Sie hat Jumping Jack so fest in die Hoden getreten, dass sie sich den Fuß verstaucht hat.«
»Autsch.«
»Und dann hat sie gesagt: ›Und jetzt versuch mal, große Sprünge zu machen, du S-Wort W-Wort.‹«
Poe lachte. Also war heute wenigstens etwas Gutes passiert.
»Weißt du mehr darüber, was Estelle Doyle passiert ist?«
»Die aus Northumberland sagen nichts. Könnte sein, dass ich irgendwann deine Hilfe brauche.«
»Ich fahre gleich los.«
»Nein, holen wir uns erst die Erlaubnis von …«
»Ich fahre gleich los, Poe. Wir müssen Estelle Doyle helfen. Sie würde uns auch helfen.«
»Das stimmt.«
»Und sie hat dich sehr gern.«
»Sie hat uns alle gern, Tilly. Ich weiß nicht, wieso, wir machen ihr doch nichts als Ärger.«
»Nein, Poe«, erwiderte Bradshaw. »Uns hat sie gern, aber dich hat sie richtig gern.«
»Wie kommst du denn darauf?«
»Sie hat’s mir gesagt.«
Sobald Bradshaw aufgelegt hatte, rief Poe Flynn an. »Boss, ich hab Mist gebaut«, gestand er. »Ich habe Tilly um Hilfe gebeten.«
»Lassen Sie mich raten, sie ist schon losgefahren.«
»Tut mir leid.«
Flynn seufzte. »Ich trage Sie beide als beurlaubt ein, bis wir mehr wissen«, sagte sie.
9. Kapitel
Estelle wurde in der Newcastle City Centre Police Station festgehalten. Das Revier befand sich in der Forth Banks, in der Nähe des Centre for Life, dem Wissenschaftsmuseum am Times Square. Poe fuhr daran vorbei zu dem mehrstöckigen Parkhaus des nahen Copthorne Hotel. Es gab nähere Parkplätze, aber er würde eher einen Stock mit nur einem Ende finden als begreifen, wie er mit seinem Handy fürs Parken auf der Straße bezahlen konnte. Er zog sein Ticket aus der Maschine mit der elektrischen Schranke, parkte und ging den Hügel wieder hinauf.
»Ich möchte zu Estelle Doyle«, sagte er zu der Frau hinter dem Tresen. »Ich glaube, sie ist hier in Gewahrsam.«
»Kann ich bitte einen Ausweis sehen, Sir?«
Poe schob seinen NCA-Ausweis durch den Schlitz unter der Glasscheibe. Obgleich er eine Dreifachberechtigung hatte, also sämtliche Befugnisse von Polizei, Zoll und Einwanderungsbehörde, war ihm klar, dass das hier nichts zu sagen hatte. Er trieb sich hier im Hinterhof anderer Leute herum, und die würden für ihn bestimmt keine Willkommensfeier veranstalten.
Die Frau gab seine Daten in den Computer ein, dann griff sie nach dem Hörer ihres Telefons und flüsterte etwas hinein, während sie Poe immer wieder verstohlene Blicke zuwarf. Nicht lange danach erschien ein Sergeant mit fleischigem Gesicht. Er hatte Rugbyspieler-Ohren, eine Biertrinkernase und ein Muttermal am Kinn, das wie eine Rosine aussah. Auch er wollte Poes Ausweis sehen.
»Ich dachte, man hätte Ihnen gesagt, Sie brauchen nicht zu kommen?«
»Trotzdem bin ich hier«, stellte Poe fest.
»Dann sag ich wohl mal besser jemandem Bescheid, den das interessiert«, brummte der Mann. Er brachte ihn in den Haftzellenblock und zeigte auf ein paar am Boden festgeschraubte Stühle mit Plastiksitzschalen. »Warten Sie hier. Könnte ’ne Weile dauern.«
Poe sah sich um. Hier sah es aus wie im brandneuen Check-in-Bereich eines Flughafens. Bei Weitem der modernste Zellenblock, den er je gesehen hatte. Die Arrestzellen waren in Zehnergruppen angeordnet. Auf dem Schild über ihm stand, dass er bei Zelle einundvierzig bis fünfzig saß. Er fragte sich, bis wohin die Zahlen wohl gingen.
Es herrschte Betrieb wie in einem Ameisenhaufen, und zwar genauso gut organisiert. Cops, manche in Uniform, manche in Zivil, marschierten zielstrebig umher. Niemand beachtete ihn. Er checkte seine E-Mails und rechnete damit, eine von Flynn vorzufinden, in der sie ihm berichtete, wie sie es mal wieder geschafft hatte, einem Verdächtigen in die Eier zu treten. Allmählich wurde das bei ihr zur lieben Gewohnheit. Zu seiner Überraschung war keine eingegangen. Und auch keine von Bradshaw. Gerade wollte er Bradshaw eine SMS schicken, um zu fragen, wo sie war, als eine offenbar ziemlich gestresste Asiatin auf ihn zukam.
Sie trug einen Hosenanzug von der Sorte, wie er ihn auch getragen hatte, als er beim CID – der Abteilung für Schwerverbrechen – von Northumberland gewesen war. Smart, aber maschinenwaschbar. Ihr Haar war kurz geschnitten – bei einem Anruf mitten in der Nacht würde das Frisieren nicht lange dauern. Wahrscheinlich Detective Inspector, möglicherweise ein noch höherer Dienstgrad. Müde genug sah sie jedenfalls aus.
»Sergeant Poe?«, fragte sie und nahm neben ihm Platz.
»Richtig.«
»Ich bin Detective Chief Inspector Tai-young Lee. Ich habe gehört, Sie wollen zu Professor Doyle?«
»Stimmt.«
»Sind Sie ihr Anwalt?«
»Ich denke, Sie wissen sehr gut, dass ich das nicht bin.«
»Genau, das sind Sie nicht. Sie sind von der National Crime Agency.«
Poe nickte. »Ich bin der DS in der Serious Crime Analysis Section.«
»Die Serienmörder-Einheit?«
»So ungefähr.«
»Darf ich fragen, welches Interesse die NCA hier verfolgt?«
»Ich weiß es nicht.«
»Bitte?«