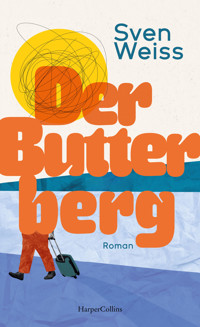
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ecco Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Schwere Lasten – und der Mut, sie abzulegen
147 Kilo aber eigentlich kein echtes Problem …Das denkt Jan, bis er in eine Klinik für Adipositas kommt. Dort trifft er Franziska, die ihn dazu bringt, den Satz „Ich bin dick“ auszusprechen – der Beginn vieler Aha-Momente. Zwischen Gruppentherapien, skurrilen Übungen und emotionalen Rückschlägen lernt Jan, dass es nicht nur ums Abnehmen, sondern auch um Gefühle geht. Doch als er scheitert und aufgibt, helfen unerwartete Wendungen und die Unterstützung anderer, ihn zurück auf Kurs zu bringen.
Eine bewegende Geschichte über Selbstakzeptanz, persönliche Entwicklung und den Mut, neu anzufangen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 249
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Zum Buch
147 Kilo aber eigentlich kein echtes Problem … Das denkt Jan, bis er in eine Klinik für Adipositas kommt. Dort trifft er Franziska, die ihn dazu bringt, den Satz „Ich bin dick“ auszusprechen – der Beginn vieler Aha-Momente. Zwischen Gruppentherapien, skurrilen Übungen und emotionalen Rückschlägen lernt Jan, dass es nicht nur ums Abnehmen, sondern auch um Gefühle geht. Doch als er scheitert und aufgibt, helfen unerwartete Wendungen und die Unterstützung anderer, ihn zurück auf Kurs zu bringen.
Eine bewegende Geschichte über Selbstakzeptanz, persönliche Entwicklung und den Mut, neu anzufangen.
Zum Autor
Sven Weiss ist Werbetexter und Journalist. Er hat für TV und Radio, Web-Portale und Blogs, Zeitungen und Broschüren geschrieben. Seine eigene Erfahrung in einer psychosomatischen Klinik ist die Grundlage für diesen Roman.
Sven Weiss
Der Butterberg
Roman
HarperCollins
Originalausgabe
© 2025 HarperCollins in der
Verlagsgruppe HarperCollins Deutschland GmbH
Valentinskamp 24 · 20354 Hamburg
Covergestaltung von wilhelm typo grafisch
Coverabbildung von Roman Samborskyi / Shutterstock.com
E-Book Produktion von GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 9783749909513
www.harpercollins.de
Jegliche nicht autorisierte Verwendung dieser Publikation zum Training generativer Technologien der künstlichen Intelligenz (KI) ist ausdrücklich verboten. Die Rechte des Urhebers und des Verlags bleiben davon unberührt.
Prolog
In guten Momenten konnte man denken, das alles hier sei nur ein Spaß. Eine Sommerfreizeit auf dem Land mit netten Menschen, ein wenig Programm und viel Müßiggang. Bis wieder jemand aus heiterem Himmel einen Heulkrampf bekam. Frisches Blut an einem Unterarm zu sehen war. Oder Menschen verschwanden.
Das Verschwinden war das Schlimmste. Vielleicht hatte man noch morgens mit jemandem gesprochen, und nachmittags war er plötzlich weg. Einfach so. Dann brodelten die Gerüchte. Das Herz, der Magen oder – das war es meist – die Psyche. Bald tauchten Verwandte auf, um die Habseligkeiten abzuholen, das Namensschild am Zimmer wurde ausgetauscht, und noch am selben Tag zog jemand Neues ein. Es musste ja weitergehen.
Nach sechs Wochen war alles vorbei. Und doch fühlte es sich an wie ein ganzes Leben. Mit Höhen und Tiefen, Glück und Verzweiflung, Hoffnung und vielen Rückschlägen. Am Ende hatten wir ein paar Kilo weniger, aber nicht selten ein ganzes Paket an Problemen mehr.
Draußen ging es dann erst richtig los. Vor diesem Draußen hatten wir alle Angst. Auch wenn der Moment natürlich kommen musste. Ein fast unvorstellbarer Gedanke!
Ich ziehe ein paar Briefchen aus meiner Gute-Laune-Box. Seltsam, wie kalt sie mich mittlerweile lassen. Dabei stehen dort nur positive Dinge.
Auf dem Sideboard im Aufenthaltsraum standen viele dieser Boxen. Wenn man jemandem etwas Gutes tun wollte, warf man einen Zettel mit einer Nachricht in dessen Box. Mit einem Kompliment, ein paar tröstenden Worten, einem aufbauenden Sinnspruch – was auch immer, nur positiv musste es sein.
Meine Gute-Laune-Box war ein mit babyblauem Geschenkpapier beklebter Schuhkarton. Auf der Oberseite mein Name, drei Buchstaben mit dickem schwarzem Edding: JAN. Ich erzähle immer den Witz, dass ich mich nicht auf meine vier Buchstaben setzen könne, ich hätte ja nur drei.
»Du bringst mich zum Lachen« steht auf einem der Papiere. Wir haben viel gelacht. Meistens, um die Traurigkeit zu ersticken.
»Du bist ein unheimlich wertvoller Mensch. Ich wünsche dir, das du das irgendwann akzeptieren kannst.« Ich denke über den Schreibfehler nach. Bisher war er mir gar nicht aufgefallen.
Komplimente wie die in der Gute-Laune-Box hatte ich draußen nie erhalten. Und auch nie verteilt. Auf dem Butterberg war das einfacher. Kein Wunder, denn das wahre Leben macht hier einfach Pause. Das Leben mit all seinen Erwartungen und vielen kleinen Gemeinheiten. Das Leben, in dem ein Schreibfehler eine Rolle spielt.
Die einzigen Fehler, nach denen ich hier suchen musste, waren die in meinem Kopf. Das waren auch wirklich genug.
Woche 1: 147 kg
Franziskas kleine Freunde / Das ist deine Zahl / Nilpferd im Stuhl / Nowhere Man
Franziskas Zimmer war ein Schlaraffenland. Hier gab es alles, was es nicht geben durfte. Auf dem Schreibtisch stand eine große Plastikbox mit Fruchtgummi. Eine Keramikschüssel mit Schokonüssen. Eine angefangene Prinzenrolle. Ein Fünferpack Snickers, ein Fünferpack Mars. An der Schreibtischlampe lehnte eine aufgerissene Tüte Chips. Eine Flasche Schwip Schwap, noch verschlossen, thronte in der Mitte des zuckerbombigen Ensembles.
»Das sind meine kleinen Freunde«, sagte Franziska. Ich stand da mit offenem Mund und wusste nicht, was ich sagen sollte.
Unsere Station war die einzige in der Klinik, in der es erlaubt war, Essen auf dem Zimmer zu lagern. Sogar ein Kühlschrank gehörte zur Einrichtung. Warum das ausgerechnet auf der Adipositasstation so war? Ganz einfach: Wir sollten lernen, mit Essen umzugehen. Wenn wir nach sechs Wochen wieder ins reale Leben zurückkehrten, mussten wir fähig sein, die Kontrolle über unsere Essgewohnheiten zu übernehmen. Franziska war davon noch weit entfernt.
Plötzlich hatte sie es eilig und holte die DVD aus dem Regal, die sie mir versprochen hatte. Mamma Mia!, ihr Lieblingsfilm. Fürchterlich. Aber sie drängte ihn mir geradezu auf. »Bestimmt gut«, sagte ich lahm. Es fiel mir zunehmend schwerer, irgendetwas Negatives zu sagen, deshalb konnte ich mich auch gegen Mamma Mia! nicht wehren.
»Sag mal …« Ich zeigte mit dem Daumen in Richtung des Süßwarengebirges, aber Franziska schob mich aus dem Raum und schloss die Tür ab.
»Sag besser nix. Ich weiß doch.«
Franziska war die erste Mitpatientin, die ich auf der Station getroffen hatte. Nachdem der ganze Papierkram erledigt war, hatte mich die Stationsschwester Frau Wörner auf mein Zimmer geführt. Ein Bett mit billiger Matratze, Kleiderschrank, Schreibtisch, Stuhl, ein kleines Regal. Bad mit Dusche und extragroßer Klobrille.
Ich räumte meine wenigen Sachen ein – Klamotten, Sanitärzeug, meine Ukulele. In das schmale Regal stellte ich die zwei Bücher, die ich mitgenommen hatte – The Shining von Stephen King und Die 13½ Leben des Käpt’n Blaubär von Walter Moers. Dann setzte ich mich aufs Bett. Das also war der Ort, an dem sich mein Leben grundlegend ändern sollte.
Nach ein paar Minuten zog ich ein frisches T-Shirt über und ging hinaus in den Gemeinschaftsbereich, der Living Room genannt wurde. Dort gab es nicht viel mehr als einen langen Tisch, bunt zusammengewürfelte Stühle, einige Sofas und ein Sideboard, das seine besten Tage anscheinend kurz nach dem Krieg erlebt hatte.
Auf einem Sofa saß eine junge Frau mit gewaltigem Oberkörper und strahlte mich aus kugelrunden blauen Augen an.
»Hallo, ich bin Franziska, und ich bin dick.«
»Äh, ich bin Jan.«
»Schön, dich zu treffen. Bist du auch dick?«
»Schätze schon«, druckste ich herum.
»Dann sag’s doch!«
Wir kannten uns erst 20 Sekunden, und schon verlangte sie so etwas von mir. War das hier eine Art Aufnahmeprüfung? Franziska schaute mich erwartungsvoll an. Mein Gesicht brannte. Ich sah mich um – links, rechts –, aber da war niemand, der mir beistehen konnte.
Dass ich dick war, hatte ich so noch nie gesagt. Wenn es unvermeidlich war, jemandem meine körperliche Konstitution zu beschreiben, dann verwendete ich Begriffe wie »etwas untersetzt« oder »kompakt gebaut«. Wohl weil ich insgeheim hoffte, ich würde nicht zu den Dicken gehören, solange ich das Wort »dick« nicht aussprach.
Denn ich selbst hatte mich nie so wahrgenommen. Irgendwann hatte ich begonnen, Größe XL zu tragen. Aus XL wurde XXL und dann 3XL. Ich kaufte nur noch in Geschäften für Übergrößen, aber dick? Ich? Kurzzeitig außer Form vielleicht, aber das würde schon wieder werden.
Dass ich ein ernsthaftes Problem hatte, überspielte ich mit Witzen. Wenn ich mit Freunden aß, klopfte ich gern auf meine Plauze und sagte: »Ich sollte nicht mehr ganz so Gas geben.« Einmal verabredeten sich Kollegen zum gemeinsamen Joggen. Ich zog mich aus der Affäre, indem ich meinen Bauch nach vorne schob und sagte: »Hab gerade einen Fitnessrückstand.«
Insgeheim erwartete ich, dass man mir widersprach – »Aber, Jan, du bist doch nicht dick!« – oder zumindest mit mir lachte. Und obwohl das nie passierte, behielt ich meinen ironischen Ton bei. Von echten Dicken unterschied ich mich eben doch.
Ich war früher immer sportlich gewesen, hatte Tennis gespielt und eine Zeit lang in der A-Mannschaft unseres Dorfs gekickt. Rennen konnte ich aber schon lange nicht mehr. Erst recht nicht gegen einen Ball treten – mit einem Knie, dessen Knorpelschicht längst Geschichte war.
Und doch: Ganz tief drinnen träumte ich davon, noch einmal eine Saison zu spielen. Wenn das alles vorbei war. Wenn ich wieder zum Normalzustand zurückgekehrt war. Denn ich war ja kein Dicker. Sondern ein sportlicher Normalo, der sich etwas hatte gehen lassen.
Selbst als ich in die Klinik eingewiesen wurde, sah ich mich noch so. Es war mir klar, dass es gute Gründe gab, die nächsten Wochen auf der Adipositasstation zu verbringen. Aber die unterschieden sich vollkommen von denen aller anderen. Das waren schließlich echte Dicke.
»Und?« Franziska schien nicht aufgeben zu wollen.
Ich schluckte, senkte den Kopf, atmete tief durch. Dann streckte ich mich und schaute ihr direkt in die Augen.
»Ich bin dick.«
Es waren nicht einfach nur drei Wörter, die ich Franziska geradezu entgegenschleuderte. Dieser Satz veränderte alles für mich. Von einem Moment auf den anderen war ich dick geworden. Und damit voll und ganz hier angekommen.
Und noch etwas war passiert. Ich kannte diese junge Frau erst ein paar Minuten, aber ich hätte sie am liebsten in den Arm genommen und nie mehr losgelassen. Mich an ihren gewaltigen Busen gelehnt und einfach losgeheult. Was war denn plötzlich los mit mir?
Als könnte sie Gedanken lesen, sagte Franziska: »Hier drin kommen ganz neue Gefühle auf.«
Das konnte ja heiter werden. Gefühle waren eigentlich nie mein Ding gewesen.
»Du wirst dich bald zurechtfinden, wirst sehen. Brauchst keine Angst haben, hier sind alle nett.«
Das hielt ich für eine Floskel. Doch schon bald sollte mir auffallen, wie ernst es tatsächlich gemeint war. Meine Bauchgegend entspannte sich merklich. Es dauerte ein paar Minuten, dann wurde mir klar, was geschah: Zum ersten Mal seit vielen Jahren zog ich, wenn andere dabei waren, den Bauch nicht mehr ein.
147.
Ich blinzelte zweimal in der irrigen Hoffnung, diese groteske Zahl würde sich dadurch ändern. Aber da stand sie weiterhin: 147. Und zwar Kilogramm. Es könnten auch Schläge in die Magengrube sein. Wahrscheinlich würde sich das genauso anfühlen.
Frau Wörner verzog keine Miene und notierte die Zahl. Ich widerstand dem Reflex, von der Waage zu springen und ihr das Clipboard aus der Hand zu reißen. Die Waage war kaputt, das war doch offensichtlich! Anders war diese Zahl nicht zu erklären. Als ich mich das letzte Mal gewogen hatte, waren es zehn Kilo weniger gewesen.
Das war, bevor ich die Zusage für einen Klinikplatz bekommen hatte. Als mein Aufnahmetermin feststand, nutzte ich die verbleibende Zeit, um noch einmal hemmungslos zu schlemmen. Pizza, Pasta, Schokolade zum Abendessen – das volle Programm. Schließlich war es wahrscheinlich das letzte Mal. Hier in der Klinik würde man mir Zucker ab- und Gemüse antrainieren. Davon ging ich zumindest aus. Da war es doch logisch, mich noch einmal an Schoki und Co. zu erfreuen.
Aber zehn Kilo? In dieser kurzen Zeit? Das konnte nicht stimmen. Die Waage war kaputt, so viel stand fest.
»Wie groß sind Sie?«, fragte Frau Wörner.
»1,75 – fast für jeden Zentimeter ein Kilo.«
Der Witz kam nicht an. Frau Wörner ergänzte stoisch meine Basisdaten, die der Therapeut erhalten würde: Größe, Gewicht, Blutdruck. Wenn es noch eine Chance gab, diesen völlig irrwitzigen Fehler zu korrigieren, dann musste ich jetzt handeln. Ich hob den rechten Fuß etwas an, doch mein Gewicht änderte sich nicht. Stattdessen verlor ich die Balance. Ich riss die Arme hoch und stützte mich an der Wand ab.
»Was machen Sie da?«
Ich spürte, wie mir heißes Blut in den Kopf schoss, und drehte mich weg. Mir blieb nichts anderes übrig: Ich musste diese Zahl akzeptieren. Und wenn es einen Ort auf dieser Welt gab, an dem ich mich nicht dafür schämen musste, dann war es ja wohl dieser hier.
Frau Wörner selbst war natürlich schlank wie eine Kompassnadel. Wahnsinnsfigur, toller Hintern, kein Gramm Fett. Ein wandelndes Mahnmal für alle Patienten, die noch mit dem Gedanken spielten, so weiterzuleben wie bisher.
Aber auch vor dieser Elfe wollte ich mich nicht schämen. Schließlich ging es hier um mich. Um diese verdammten 147 Kilo. Egal, ob die Waage mein Gewicht richtig anzeigte oder nicht, ab jetzt durfte es nur noch eine Richtung geben: nach unten.
»147 Kilo«, sagte ich laut, obwohl Frau Wörner die Zahl längst eingetragen hatte.
»Hab ich«, sagte sie und verließ den Raum.
Ich stand in Unterhose vor dem Ganzkörperspiegel an der Schranktür. Eine widerliche, behaarte Fettkugel quoll über den ausgeleierten Hosenbund. Ich hatte große Lust, den Spiegel mit der Faust zu zertrümmern. Stattdessen schrie ich ihn an:
»Du Scheißbauch, du Kackwanst! Ich mach dich fertig! Eklige Quetschwurst! Du stinkender vergammelter Schinken! Du Hasslappen!«
Ich spürte, wie mir eine Träne über die Wange rann.
»Du Arschloch!«
Es klopfte an der Tür. Ich zog mir schnell Trainingshose und Shirt über und öffnete. Vor mir stand eine junge Frau mit wuscheligen blonden Haaren und einer Colaflaschenbrille. Unter ihrem eng anliegenden grauen T-Shirt zeichneten sich zwei pralle Fettringe ab.
»Alles okay bei dir?«
»Äh, ja, ich bin neu.«
»Und ich bin Nina.«
»Kein schöner Einstieg von mir.«
»Wird schon.«
Ein paar leere Sekunden standen wir einfach da. Dann streckte sie den Arm nach mir aus. Im selben Moment hob ich meine Hand zu einem lässigen Gruß und stieß dabei aus Versehen ihren Arm weg.
»Sorry.«
»Wie gesagt: wird schon.«
Damit drehte sie sich um und stapfte davon.
Jeden Morgen um acht versammelten sich die Patienten der Station im Living Room zum Morgenappell. So nannten wir die tägliche Visite mit allen Therapeuten. Ich war schon am ersten Tag spät dran. Müde bog ich um die Ecke und prallte gegen eine Wand. Zumindest fühlte es sich so an. Denn dort saßen ungefähr 30 Menschen – jeder Einzelne mit einer gigantischen Wampe. Hilfe suchend musterte ich die unbekannten Gesichter. Am liebsten wäre ich umgekehrt, zurück in mein Zimmer, unter die Bettdecke.
Da sah ich, wie mir Heiko, den ich am Vorabend kennengelernt hatte, zuwinkte. Schnell setzte ich mich neben ihn.
»Hallo, Heiko 135.«
Heiko bestand darauf, mit seinem aktuellen Gewicht angesprochen zu werden. Da sich dies jedoch – idealerweise – ständig verringerte, veränderte sich auch sein Name. Er habe einen flexiblen Namen, sagte Heiko und war stolz darauf.
»Hey, Jan, was meinst du, wie viele Kilos sitzen hier wohl beisammen?«
Ich zuckte mit den Achseln.
»Ich glaube, es sind über vier Tonnen!«
»Niemals.«
»Doch, rechne es durch! Unfassbar. Stell dir das vor, vier Tonnen Menschenfleisch!«
Ich kam nicht mehr zum Rechnen, denn nun erschienen die Therapeuten und stellten sich vors Sideboard. Das waren sie also, die Menschen, die uns vor uns selbst retten sollten. Die innerhalb von sechs Wochen in den tiefsten Tiefen unserer Psyche graben und uns in dieser kurzen Zeit dazu bringen sollten, das aufzugeben, was uns bisher das Liebste war: die Fresserei.
Ganz vorn stand Doktor Holthausen, der auch mein persönlicher Therapeut werden sollte. Optisch eine Mischung aus Computernerd und Marathonläufer. In seinem Blick lag eine tiefe Ruhe, die auf alle ausstrahlte, die er anschaute. Das fand ich sehr angenehm.
Kaum zu erkennen hinter Holthausen, da höchstens halb so groß, stand Frau Chanthaphasouk. Natürlich war ihr Name für westeuropäische Zungen nicht zu meistern, weshalb wir sie »die Unaussprechliche« nannten.
Es folgten Frau Bogdanow, Frau Engelmann und Frau Roth. Letztere gab mir schwer zu denken, hatte sie doch selbst gut 15 Kilo zu viel auf den Rippen. Sollte ich von so jemandem Ratschläge für bessere Ernährung annehmen?
Und dann war da noch Doktor Brandes. Als Einziger trug er keinen weißen Kittel, sondern eine gewagte Kombination aus ausgebeulter Cordhose und Batikshirt. Alles an ihm schrie nach 1968.
Die Visite war eine Art Motivationsveranstaltung für den Tag. Man konnte Anliegen vorbringen, die die ganze Gruppe betrafen, oder um ein Einzelgespräch bitten. Eventuelle Änderungen im Kursplan wurden bekannt gegeben, Abgänger verabschiedet und neue Patienten begrüßt. Heute gab es davon zwei, weshalb die Therapeuten sich kurz vorstellten und ihre Rolle im Klinikalltag beschrieben. Dann sollten wir beiden Neuen uns vorstellen und darlegen, was wir uns vom Aufenthalt in der Klinik versprachen.
»Wo sitzen denn die Neuankömmlinge?«, fragte Doktor Brandes und schaute gespannt in die Runde. Ich hatte keine Lust, mich vorzudrängen. Was auch nicht nötig war, denn ein riesiger Typ mit brustlangem Bart ergriff das Wort. Er trug ein grünes Karohemd. Eigentlich mehr ein Karozelt. Der Riese räusperte sich, rutschte zum Rand des Sofas und sprach mit lauter, fester Stimme.
»Mein Name ist Jonas Hanke. Ich bin 37 Jahre alt. Meine Therapie gehe ich mit einer klaren Zielsetzung an. Bei der Selbstanalyse bin ich zwar einigen Triggern auf die Spur gekommen, die mein Essverhalten signifikant beeinflussen, aber ich merke, dass ich an eine Grenze gestoßen bin. Deshalb will ich in Kooperation mit den Therapeuten relevante Themengebiete identifizieren und Lösungsstrategien erarbeiten. Ziel ist es dabei, Werkzeuge an die Hand zu bekommen, die es mir ermöglichen, sowohl psychische Faktoren wie auch das damit verbundene Essverhalten nachhaltig unter Kontrolle zu bringen.«
»Danke schön«, sagte Brandes. »Und dann haben wir noch den Herrn Rose.«
Ich zuckte zusammen, obwohl ich gewusst hatte, dass ich als Nächster dran war. Eine Millisekunde erwog ich, mich einfach nicht zu erkennen zu geben. Sollten sie doch diesen Jan Rose suchen, war halt einfach nicht da. Da stieß mir Heiko 135 den Ellbogen in die Seite.
»Äh … also … ja.« Mein Kopf brannte wie eine Chilischote.
»Also, ich bin das. 32 Jahre. Ich bin hier, weil ich abnehmen will … äh … muss. Wie wahrscheinlich die meisten. Klar.«
Auch bei mir bedankte sich Brandes artig. Was danach besprochen wurde, bekam ich nicht mehr mit. Ich war damit beschäftigt, mein zinnoberrotes Gesicht zu verstecken, indem ich vorgab, mich an der Stirn zu kratzen. Nach ein paar Minuten standen alle auf. Heiko 135 stieß mich in die Seite und zwinkerte mir zu.
»Jetzt geht’s zum Schwimmen. Da siehst du die sexy Mädels in Badeklamotten.«
Ich war Heiko dankbar. Seine Sprüche lenkten mich ab. Trotzdem blieb ein unangenehmes Gefühl. Als hätte ich nackt vor einer glotzenden Menschenmasse gestanden.
Und noch ein Gefühl kam auf, das mich in diesem Moment überraschte. Doch es war nicht wegzuleugnen: Mein Magen grummelte. Da war er also wieder, mein guter alter Freund. Der Hunger.
Jeden Montag lag das Wochenprogramm in unserem Fach. Gruppentherapie, Ernährungstraining, Sport – alles minutiös durchgeplant. Dreimal pro Woche begann der Tag mit Schwimmen. Dreimal pro Woche sollte ich also meinen fetten Bauch präsentieren, dazu meine schwabbeligen Oberschenkel mit den hässlichen Dellen. Natürlich war mir klar, dass alle anderen ebenso fette Bäuche und ebenso hässliche Dellen hatten, aber mein erster – seit Jahren eingeübter – Reflex war, mich zu verstecken.
Die Option, einfach nicht teilzunehmen, verwarf ich schnell. So was würde nicht sechs Wochen lang funktionieren. Ich überlegte, ob ich mit T-Shirt ins Wasser gehen sollte. Aber damit würde ich wahrscheinlich nicht durchkommen. Andererseits – vielleicht hatte man ja gerade hier Verständnis dafür und drückte ein Auge zu. Verlassen konnte ich mich darauf aber nicht. Es bestand die Gefahr, mich lächerlich zu machen.
Die Sportkurse leitete Frau Bechtel. Gab es eine Möglichkeit, sie darum zu bitten, vom Sport befreit zu werden?
Ich beschloss, die Situation auf mich zukommen zu lassen. Allerdings mit einer Absicherung. Unten in meine Tasche packte ich ein Notfallshirt, das ich im Wasser tragen konnte. Selbst wenn ich das nicht tun würde, beruhigte es mich, dass es da war. Ich warf mir die Tasche um den Hals und machte mich auf den Weg zur Schwimmhalle im Untergeschoss.
Im Umkleideraum zogen sich Tobias und Carlo gerade aus. Kein schöner Anblick. Carlos Körper war fast komplett überwuchert von schwarzen Haaren. Nur in seiner Körpermitte platzte eine kahle Kugel aus dem Urwald. Was seine Beine und Schultern anging, war Carlo fast schlank. Nur die Riesenkugel, die er vor sich herschob, fiel völlig aus dem Rahmen. Sie war auch der Grund für Carlos monströses Hohlkreuz. Wenn er durch die Gänge schlurfte, sah es aus, als müsste er jeden Moment umkippen.
Tobias hatte keine Wampe wie die meisten von uns, sondern einen riesigen Fettlappen, der den Kampf gegen die Schwerkraft schon vor Langem verloren hatte. Er hing ihm nun bis weit über die Badehose. Seine Beine waren geschwollen und um die Knöchel schwarz angelaufen.
»Beeil dich, gleich geht’s los«, sagte Tobias und schnappte sich sein Handtuch.
»Auf geht’s!«, rief Carlo.
In der Oberstufe musste ich einmal ein Referat über die Weimarer Verfassung halten. Ich war nervös wie ein Eimer Zitteraale. Doch mein Freund Klaas hatte einen hilfreichen Rat. »Stell dir deine Zuhörer einfach nackt vor! Du wirst sehen, es gibt dann keinen Grund mehr, nervös zu sein.«
Zuerst wollte ich an so etwas nicht glauben. Aber als ich bibbernd vor der Klasse stand, probierte ich es einfach. Plötzlich erschien vor meinem geistigen Auge ein vollkommen realistisches Bild. Da saßen sie alle mit nackten Ärschen auf ihren Schulbänken und schauten mich erwartungsvoll an. Was für ein Anblick! Ich konnte mir das Lachen nicht verkneifen.
Frau Mühlhäuser, unsere Geschichtslehrerin, fragte mich, was los sei, und da war es um mich geschehen. Ich stellte mir auch sie nackt vor. Meine Fantasie lief Amok und löste einen Lachkrampf erster Güte aus.
Leider hatte Frau Mühlhäuser dafür kein Verständnis und schickte mich zurück an meinen Platz. Wegen des nicht gehaltenen Referats kassierte ich eine glatte Sechs. Und doch hatte ich etwas gelernt: dass die Methode von Klaas funktionierte. Mit etwas mehr Selbstbeherrschung sollte sie mir noch durch einige Situationen helfen.
Auch jetzt hatte ich Angst. Dabei brauchte ich meine Fantasie nicht mal anzustrengen. Es standen ja bereits alle nackt vor mir. Und das war definitiv kein Anblick, der mich einschüchtern müsste.
Also los, Jan! Rein in die Fluten!
»Wo bleiben Sie denn?«, rief mir Frau Bechtel zu. »Die anderen sind alle schon im Wasser.«
In kurzer Trainingshose und Polohemd stand sie mit verschränkten Armen am Beckenrand. Ich tapste vorsichtig über die breite Treppe ins Wasser. Es war nicht tief, vielleicht 1,20 Meter. Das erklärte auch, warum niemand schwamm. Stattdessen gingen alle durchs Becken. Sie kämpften sich zu Fuß von einem Ende zum anderen und wieder zurück.
»Worauf warten Sie, Herr Rose?«, rief Frau Bechtel. »Los, Wasser treten, Wasser treten!«
Ich marschierte los und schob fleißig Wasser vor mir her. Franziska kam mir entgegen und zwinkerte mir zu. Sie trug einen roten Badeanzug mit Rüschen und Blümchenapplikationen. Ihre kurzen Ärmchen hielt sie seitwärts über den Wellen und stemmte ihre ganze Körperkraft gegen das Wasser. Sie wirkte wie eine Figur aus einem Zeichentrickfilm.
Nach der Hälfte der ersten Bahn konnte ich nicht mehr und blieb stehen.
»Was soll das, Herr Rose? Sie sind nicht zum Vergnügen hier. Auf geht’s, Wasser treten, Wasser treten! Und atmen nicht vergessen!«
Heiko 135 holte mich ein.
»Mit der ist nicht zu spaßen«, raunte er mir zu und war schon wieder einen halben Meter vor mir. Das wollte ich mir nicht gefallen lassen und gab Gas.
»Na, wie fandste die Mädels?«, fragte mich Heiko 135, als wir unter der Dusche standen. Ich wusste nicht, was ich antworten sollte. Ich war viel zu sehr damit beschäftigt, nicht auf Marcos gigantischen nackten Arsch zu glotzen, den er direkt vor mir einseifte. Dieses Monstrum wog wahrscheinlich alleine so viel wie manches Mädel auf der Anorexiestation.
Genüsslich hob Marco mit einer Hand die rechte Arschbacke an und rieb die Seife tief in die Ritze. Dann ließ er los, und der Fleischbrocken flappte zurück, während seine Hand noch am Seifen war. Marcos halber Arm verschwand unter dem Lappen.
»So was siehste in keinem Porno«, raunte mir Heiko zu, der meinem Blick gefolgt war.
Ich schüttelte mich und wusch mir die Haare aus.
Heiko und ich gingen zusammen nach oben.
»Hey, haste Lust, nachher noch ’n bisschen Sport zu machen?«
»Wie bitte?«
»Nur Spaß«, lachte Heiko, »aber lass uns nachher zusammen abhängen. Ich hab erst um fünf Fresstraining.«
Wir verabredeten uns auf ein Kartenspiel im Living Room. Ich zog mich aufs Zimmer zurück und hängte die nassen Sachen auf eine Leine im Bad. Eigentlich hatte das Schwimmen Spaß gemacht. Es war herrlich, sich fast schmerzfrei im Wasser zu bewegen. Irgendwo hatte ich mal gelesen, dass man im Wasser nur noch ein Zehntel seines Gewichtes hatte. Wahnsinn. Das hieß ja, dass ich nur noch 14 Kilo wog.
Und noch etwas anderes fiel mir auf: Das Notfallshirt lag noch unbenutzt in meiner Tasche.
»Gehst du mit essen?«
Vor der Frage, die mir Heiko 135 so beiläufig entgegenwarf, hatte ich Angst gehabt. Vor allem, weil es im Speisesaal – das wusste ich bereits – ein Büfett gab. Ich liebe Büfetts. Was für ein Vergnügen, sich durch die verschiedenen Köstlichkeiten zu fräsen. Ganz langsam mit einem kalten Vorspeisenteller zu beginnen und dabei die Vorfreude auf das zu genießen, was noch alles vor einem liegt. Danach – je nach Angebot – ein kleines Süppchen oder etwas Salat, nur um den Höhepunkt noch hinauszuzögern. Dann kommen die Hauptspeisen. Natürlich probiere ich alle – Fleisch, Fisch, Auflauf, was immer es gibt. Herrlich. Auch die Desserts reichen meist für zwei oder drei Teller. Kuchen, Pudding, Eis … Noch ein Stück Käse, um den Magen zu schließen?
Das Büfett ist meine Welt. Es ist alles da, man muss es nur freudig annehmen. Als ob ich mit Kopfsprung ins Paradies eintauchen würde.
Aber hier? Wie sollte das ablaufen? Mir war klar, dass ich in den nächsten Wochen nicht wie gewohnt Vollgas geben konnte. Warum gab es hier überhaupt ein Büfett? Sollte damit unsere Willensstärke getestet werden?
Ich war verunsichert. Drückte man bei mir als Neuling vielleicht ein Auge zu, wenn ich mehrmals Nachschlag holte? Und wie oft würde man dieses Auge zudrücken – zweimal, dreimal? Das Risiko, danebenzuliegen, wollte ich nicht eingehen. Doch was war die Alternative? Ich konnte mir den Teller mit Salat vollhauen und darauf eine Weile herumkauen. Durch den Tag würde ich damit aber niemals kommen.
Der Speisesaal war riesig. Massen von Leuten umschwirrten das Büfett in der Mitte des Raumes. Kleine, dünne Mädchen, die mit ernster Miene ihr Tablett trugen, auf dem ein paar verlorene Salatblätter herumlagen. Schwabbelige Klöße, die sich verschämt umschauten, bevor sie eine weitere Portion auf ihren Teller häuften. Kleine Gruppen, die sich angeregt unterhielten. Einsame Gestalten, die angestrengt ihre Traurigkeit zu verstecken suchten.
»Auf ins Getümmel, es ist genug für alle da – zumindest bis ich komme!« Heiko 135 schnappte sich ein Tablett und forderte mich mit einer Geste auf, das Gleiche zu tun. Bevor wir uns bedienten, nahm er mich jedoch mit auf einen kurzen Rundgang.
Es war alles wohlgeordnet. Jede Station hatte ihren eigenen Bereich. Zwei Tische waren für uns reserviert, daneben logierten die Depris. Dann kamen die ADHSler, die chronischen Schmerzen und hinten in der Ecke die Borderliner. Am anderen Ende des Saals saßen die Magersüchtigen. Ich fragte mich, ob sie absichtlich so weit wie möglich entfernt von uns Dicken platziert waren. Außerdem waren da noch Panikstörungen, Sozialphobiker und posttraumatische Belastungsstörungen. Aber die konnte selbst Heiko 135 nicht eindeutig zuordnen.
Eines der Phänomene, die ich nie verstehen werde, ist die Tatsache, dass es ausgerechnet im Krankenhaus immer ungesundes Essen gibt. Wenigstens die Auswahl war reichhaltig. Es gab paniertes Schnitzel, dazu Kartoffel- und grünen Salat. Als vegetarische Variante wurde Spaghetti mit undefinierbarer roter Pampe angeboten. Außerdem gab es industriell gefertigtes Gummigemüse. Wem das alles nicht zusagte, der konnte sich am kalten Büfett an den Frühstücksresten bedienen – Brot, Käse, Wurst, aufgeschnittene Gurken, etwas Paprika.
Ich linste zu Heiko 135, der sich ein Schnitzel auf den Teller packte und einen ordentlichen Batzen Kartoffelsalat daneben platzierte. Ich tat es ihm gleich, nahm auch ein Schnitzel und versuchte, ungefähr die gleiche Menge Kartoffelsalat zu erwischen. Dann setzten wir uns zu Tobi und Carlo, die bereits am Spachteln waren.
»Nimm das!« Heiko 135 drückte mir ein Blatt Papier in die Hand. Darauf eine Tabelle mit fünf Spalten: Datum, Hungergefühl, Mahlzeit, Sättigungsgefühl, Emotionen.
»Hier wird Protokoll geführt. Du glaubst doch nicht, dass du das Essen einfach nur essen kannst.«
Ich schaute ihn verständnislos an.
»Du kriegst das noch ausführlich erklärt. Im Prinzip musst du nur auf die 75 achten. 75 – das ist deine Zahl! Und damit meine ich nicht dein Gewicht. 75 Kilo wirst du nie mehr wiegen.«
Das System war einfach. Jeder sollte die Intensität seines Hungers auf einer Skala von null bis 100 Prozent einordnen. Wenn er einen Wert von 75 Prozent erreichte, wurde es Zeit, etwas zu essen. Darunter war der Hunger noch nicht groß genug. Doch er sollte auch möglichst nicht über 75 Prozent steigen, denn dann drohte ein Fressanfall. Nicht zu viel, nicht zu wenig: Das war das ganze Geheimnis der Essenstherapie.
Auch beim Sättigungsgefühl war 75 Prozent optimal. Also gut gesättigt, kein Hunger mehr, aber auch kein Spannen im Magen. Blieb man unter den magischen 75, würde man bald wieder essen wollen und so aus dem Rhythmus kommen. 80 oder 90 Prozent waren dagegen zu viel. Dann hatte man sich überfressen. Und das sollten wir uns abgewöhnen.
Ich schaute auf das Papier, dann auf meinen Teller und wieder auf den Zettel. Mir kam ein Gedanke, aber sollte ich ihn aussprechen? Ich blickte zu Heiko, der die Backen voll hatte. Dann sagte ich, was mir durch den Kopf ging.
»Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal bei 75 Prozent aufgehört habe.«
Heiko 135 schluckte herunter und blickte mich an. Auch Tobi und Carlo hatten sich mir zugewandt. Mir wurde kalt.
»Hm, kenne ich nur zu gut«, sagte Tobi. Carlo kniff die Lippen zusammen und nickte.
»Bei 75 fang ich doch erst an zu zählen«, sagte Heiko und schob sich ein großes Stück Schnitzel in den Mund.
75 – diese Zahl sollte meinen Alltag in den nächsten Wochen bestimmen. Und wenn ich sie ernst nahm, mein ganzes restliches Leben.
Tobi und Heiko 135 holten sich noch ein kleines Schälchen mit Schokopudding. Ich verzichtete, obwohl ich noch Platz gehabt hätte. Ich wollte es nicht gleich am ersten Tag übertreiben. Oder war genau das ein Fehler? Es würde wohl noch dauern, bis ich das richtig beurteilen konnte.
Wir protokollierten, was wir gegessen hatten. Ein Schnitzel, etwas Kartoffelsalat – eigentlich war ich weit weg von 75 Prozent. Sollte ich noch etwas essen? Ich traute mich nicht. Also schrieb ich einfach 75 Prozent auf den Zettel.
Noch schwieriger wurde es in der letzten Spalte, »Emotionen«. Ich hatte keine. Außer Hunger. Heimlich guckte ich auf den Zettel von Heiko 135. »Bin nervös, weil wir heute im Kurs über Depressionen reden werden.«





























