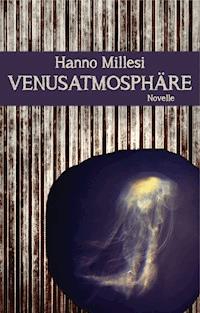Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Atelier
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Was wie die Laserkanone am Raumschiff Außerirdischer klingt, ist in Wirklichkeit Glasreiniger, der auf eine erhitzte Herdplatte gesprüht wird. Wenn sie das Hauptsegel setzen, damit es sich prall im Wind bläht, hört man einen Regenschirm, der auf Knopfdruck von alleine aufgeht. Hanno Millesi erzählt die tragikomische Geschichte eines Geräuschemachers alter Schule und von einer Welt, in der kaum etwas so ist, wie es scheint. Wo es um die Glaubwürdigkeit der Bilder geht, die dem Publikum vorgesetzt werden. Wo die Wege mitunter lang sein können, jedoch im Studio zurückgelegt werden, so lange hinter den Kulissen verlaufen, bis sie eines Tages in die Flucht vor einer voranschreitenden Schwerhörigkeit münden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 223
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
HANNO MILLESI
DER CHARMEDER LANGEN WEGE
ROMAN
Er aber hörte etwas, das wir nicht hörten.
Mit Tränen in den Augen erheben sich einige im Zuschauerraum von ihren Sitzen und winken dem zotteligen kleinen Kerl zu, als er am Ende seines turbulenten Aufenthalts auf diesem Planeten sein Raumschiff, die Dexter Transfer, achtern besteigt, um sich auf die Heimreise zu begeben – in eine Galaxie, so weit abgelegen, so fantastisch, dass niemand mit halbwegs intaktem Herzen ihre Existenz auch nur einen Moment lang bezweifeln würde. Im Verlauf der vergangenen anderthalb Stunden ist allen im Saal klar geworden, dass hier auf Erden niemals der richtige Ort für eine arglose Kreatur sein wird, schon gar nicht, sofern diese ein klein wenig anders geraten ist als der überwiegende Teil der Erdenbewohner und -bewohnerinnen.
Wer nicht mit Winken beschäftigt ist, hält sich an der Lehne des Sitzes eine Reihe weiter vorne fest, verlagert sein Gewicht von einem Bein auf das andere oder wippt mit dem Oberkörper vor und zurück. In ihrem Übermut klettern ein paar – was gar nicht so einfach ist – auf den Klappsitz, den man ihnen zu Beginn der Vorstellung zugewiesen hat. Sie tun das, um ihrem außerirdischen Freund Respekt zu zollen, sie tun das, obwohl die meisten von ihnen noch nicht einmal wissen, was das Wort zollen bedeutet. Sie wollen ihre Bereitschaft demonstrieren, alles zurückzulassen und mitzukommen, müssten sie zum Abendessen nicht zu Hause sein und im Anschluss daran gleich ins Bett – so sieht der Deal nun mal aus. Es ist der Kummer darüber, dazu verurteilt zu sein, hier zurückzubleiben und sich in Erwachsene zu verwandeln, der immer mehr Kinder dazu bringt, sich zu erheben. Sie stehen auf, um auszudrücken, dass die Arglosigkeit, die ihr Wesen einstweilen noch bestimmt, an Bord der Dexter Transfer besser aufgehoben wäre als in einem Kinderzimmer.
Als die Kinoleitung ihn darum gebeten hat, im Anschluss an eine Spätnachmittagsvorstellung ein paar seiner Kunststücke vorzuführen, ist er davon ausgegangen, es würde ihm mühelos gelingen, die kleinen Zuschauer zu verblüffen und ein wenig davon abzulenken, dass mit der Abreise ihres extraterrestrischen Helden, spätestens jedoch mit dem Angehen der Saalbeleuchtung ein berührendes Fantasyabenteuer zu Ende gegangen sein wird. Da nun aber die meisten Kinder, mit der Wirkungslosigkeit ihrer Demonstration konfrontiert – eine Wirkungslosigkeit, in der ihre unverdorbene Intuition ein erstes Anzeichen der ihnen bevorstehenden Zukunft zu vermuten scheint –, auf ihren Klappsitzen balancierend in Tränen ausbrechen, befürchtet er, ein Blick hinter die Kulissen könnte alles nur noch schlimmer machen.
Wie würden die Kinder damit umgehen, dass die Dexter, dieses bereits im Vorspann des Films als legendär bezeichnete Raumschiff, auf dem alle Arglosen ihre Arglosigkeit in Sicherheit wissen, akustisch von einem ordinären Flip-Flop angetrieben wird, den ausgerechnet jemand wie er in seinem Studio ein paar Mal gegen seine Fußsohle hat flappen lassen? Wäre es für sie nicht enttäuschend, erfahren zu müssen, dass eine alles andere als galaktische Technik im Grunde nur die Intervalle zwischen dem Flappen verkürzt und die Abspielgeschwindigkeit auf ein Tempo gebracht hat, in dem es sich mit Flip-Flops auch in noch so ferner Zukunft und noch nicht einmal auf dem Heimatplaneten der Arglosigkeit laufen lassen wird?
Mit einem Auftrag wie dem vor den Kindern hatte er nicht mehr gerechnet, und er geht wohl auch nicht unbedingt auf seinen einstigen Ruf in der Branche zurück. Es handelt sich dabei um etwas, worin die Betreiber einiger Lichtspieltheater eine originelle Werbemaßnahme erkannt zu haben meinen. Sie putzen damit die Vorstellung an ein paar Sonntagnachmittagen auf und unterstreichen gleichzeitig die Absicht des Regisseurs, diesem Film etwas Altmodisches zu verpassen (»Wie die Filme damals, als ich in dem Alter war«).
Ungefähr bei der Hälfte seines Auftritts angekommen, nimmt er eine Espressokanne so lange nicht von einer Kochplatte, bis eine Säule weißen Dampfes mit voller Kraft johlend aus ihrem brodelnden Inneren herausgeschossen kommt. Er möchte damit rekonstruieren, wie der von den Triebwerken erzeugte Schub, der ein Raumschiff in eine sagenhafte Galaxie befördert, zu seiner Zeit zustande gebracht wurde (»soweit es die Geräusche betrifft jedenfalls«). Im Zuschauerraum sorgt das für betretene Stille. Eine Stille, in der die vorgeschriebene Raumtemperatur – jetzt, da alle wieder ordnungsgemäß auf den ihnen zugewiesenen Plätzen sitzen – sämtliche Tränen trocknet. Eine Stille, über die hinweg ihm der der Kanne entweichende Dampf zuraunt, die Enthüllung, ein derart simpler Trick habe mitgeholfen, aus der Sequenz einiger Bilder etwas zu machen, das einlädt, ihre Hoffnungen darauf zu projizieren, werde sich nie wieder aus dem Gedächtnis dieser jungen Menschen tilgen lassen.
Ausgerechnet er, der in seiner aktiven Zeit so stolz darauf war, mit seinen fantasievollen Geräuschkulissen an der Vorstellung von einer zukünftigen Welt mitzuwirken – die Gestaltung einer solchen Welt zählte sogar zu seinem bevorzugten Betätigungsfeld –, kommt sich bei einem Auftritt vor ein paar Kindern wie ein Schwindler vor. Ob das daran liegt, dass er sich, anders als früher, bereit erklärt hat, seine Trickkiste zu öffnen? Was eine unterhaltsame, vielleicht sogar lehrreiche Präsentation hätte werden sollen, entpuppt sich als Fingerzeig, wie wenig es doch benötigt, um ein paar Minderjährige hinters Licht zu führen. Worin das junge Publikum eine wenn auch unerreichbare, so doch zumindest vorstellbare Erlösung gesehen hat, basiert in Wirklichkeit auf den Einfällen eines hinterhältigen alten Mannes, dem sie, sobald sie sich damit abgefunden haben, was ihnen blüht, gefälligst ihre Anerkennung zollen mögen, wie sich das für faire Verlierer gehört (»Was bedeutet zollen?«).
An dieser Stelle folgt sonst immer der Höhepunkt seiner kleinen Show, das Ausschlüpfen des Publikumslieblings, wofür er nichts weiter benötigt als eine Eistüte und klebrige Finger, aber, obwohl er beides dabei hat, beschließt er, diesen Kunstgriff heute Nachmittag ausfallen zu lassen. Die hier versammelten Zuschauer, sagt er sich, haben mit ihrer Eintrittskarte, die einige ihr gesamtes Taschengeld gekostet haben dürfte, das Recht erworben, der Welt ihrer Eltern vorübergehend zu entfliehen – wenn schon nicht an Bord eines Raumschiffs, dann zumindest in ihren arglosen Herzen und vielleicht sogar über die Dauer einer Kinovorstellung hinaus.
Ein kleiner weißer Ball, ein Kunststoffrequisit mit einem Kern aus Hartgummi, von einer Vielzahl winziger Dellen überzogen, nähert sich eines Nachmittags mit hoher Geschwindigkeit einem Spaziergänger, trifft ihn mit voller Wucht am Hinterkopf und bringt ihn auf diese Weise abrupt zum Stillstand. Gedanklich bei sämtlichen dem Gehen innewohnenden Revolutionen – dem Auszug aus Ägypten, dem Sturm auf die Bastille, den ersten Schritten auf dem Mond, dem langen Marsch nach sonst wohin – bemerkt der Getroffene zunächst nicht viel mehr, als dass sein Gedankengang ins Stocken gerät. Mit einer gewissen Verzögerung verspürt er eine noch nicht einmal schmerzhafte Berührung, von der ausgelöst, als habe jemand den Stecker gezogen, erst alles in ihm zusammenbricht. Ein Anrainer, der den Spaziergänger – zu diesem Zeitpunkt nicht mehr eindeutig in dieser Eigenschaft zu erkennen – am Gehsteig liegen sieht (»Das müssen zwei, drei Stunden gewesen sein«), wird später erzählen, dass ein Halbwüchsiger den Ball aufgehoben habe, ohne dem offensichtlich davon niedergestreckten, besinnungslosen Mann auch nur die geringste Beachtung zu schenken. Der Einschätzung dieses Anrainers zufolge muss es sich dabei allerdings nicht zwangsläufig um denjenigen gehandelt haben, der den Ball auch geschlagen hat (»Für das Einsammeln der Bälle sind meist ihre Kinder zuständig«).
Die Behauptung, niemand im Viertel sei überrascht gewesen, was da passiert ist, verleiht dem Golfballtreffer den Charakter eines zweifellos unglücklichen, deswegen jedoch noch lange nicht ungewöhnlichen Zufalls, und um einen Zufall dürfte es sich dabei auch gehandelt haben – Grund genug, keiner Partei die alleinige Schuld daran zu geben.
Da es seitens des Golfers jedoch noch nicht einmal ein Bekenntnis zu einer Form von Mitschuld gegeben haben dürfte, bleibt der Spaziergänger mit seinem Anteil an Schuld allein, bleibt liegen, und zwar, da niemand eine Ambulanz verständigt (»So etwas macht hier keiner mehr«), so lange, bis er ohne fremde Hilfe wieder zu sich kommt, was erst nach Einbruch der Dunkelheit geschieht – und Dunkelheit wiederum bedeutet hier draußen nichts anderes als Finsternis.
Ob nun aufgrund mangelnder Beleuchtung oder angespornt durch die Besinnungslosigkeit, aus der er gerade erst zurückgekehrt ist, der Weg vom Unglücksort zu ihm nach Hause macht sich auf alle Fälle einen Spaß daraus, den Spaziergänger an der Nase herumzuführen. Während die ganze Zeit über ein stechender Schmerz in seinem Kopf rotiert wie eine außer Kontrolle geratene Kompassnadel, gibt sich jede Richtung, die er einschlägt, nach den ersten paar Metern, auf denen sie noch einen vielversprechenden Eindruck erweckt hat, als die falsche zu erkennen. Der Gehsteig auf der gegenüberliegenden Straßenseite nähert und entfernt sich rhythmisch wie die Brandung eines Ozeans. Die Strecke verläuft bergauf, während es mit der Bebauung rundherum bergab geht. Einem urbanen Instinkt folgend richtet der Spaziergänger seinen Blick einmal sogar zum Himmel, wo er einem Firmament begegnet, wie er es in dieser Intensität noch nie zuvor gesehen hat. Der schimmernden Verzierung an der Innenseite des Deckels einer Schatulle nicht unähnlich – einer Schatulle, aus der freilich zuvor alles Wertvolle entfernt worden ist. Bei seinem Versuch, nach Hause zu finden, hilft ihm der Sternenhimmel zwar nicht unbedingt weiter, sein Herumirren weiß der Spaziergänger indes von diesem Zeitpunkt an von einem einzigartigen Funkeln überwölbt.
Als schließlich die Aussichtswarte in seinem Blickfeld auftaucht, muss sich der Spaziergänger eingestehen, endgültig von seinem Weg abgekommen zu sein. Außerdem ist es ihm irgendwie gelungen, das Stadtgebiet zu erreichen, ohne etwas vom Überqueren der Umfahrungsstraße bemerkt zu haben. Um kein weiteres Risiko einzugehen, beschließt er, sich bis zum Tagesanbruch nicht mehr von der Stelle zu rühren, schläft, gegen den verbarrikadierten Eingang der Aussichtswarte gelehnt – von wo aus einst eine hölzerne Treppe emporgestiegen ist, ragen nur noch ein paar Latten aus der backsteinernen Ummantelung –, sogar ein Weilchen, allerdings recht unergiebig, sodass er sich später kaum daran erinnern wird.
Jenseits der Umfahrungsstraße ist er seit geraumer Zeit nicht mehr gewesen. Für gewöhnlich enden seine Streifzüge an Orten, von denen der Rückweg vernünftigerweise ganz von selbst zu ihm nach Hause verläuft. Was nicht heißen soll, dass sich der Spaziergänger, seit er außerhalb der Umfahrung wohnt, nicht bereits mehrmals vorgenommen hätte, die breite Fahrbahn zu überqueren. Sämtliche seiner bisherigen Versuche sind jedoch kläglich gescheitert. Am dichten Verkehr, an den Übergängen, die so weit auseinanderliegen, dass er, nach einem von ihnen Ausschau haltend, den Grund, weshalb es eben noch so wichtig zu sein schien, nach drüben zu gelangen, jedes Mal aus den Augen verloren hat. Nach Z, wie man die Gegend innerhalb der Umfahrungsstraße mittlerweile nennt, als könne sie sich ihren vollständigen Namen nicht mehr leisten, als habe sich mit jedem bankrotten Betrieb, mit jeder öffentlichen Institution ein weiterer Buchstabe verabschiedet. Sollte demnächst auch noch der Rest seine Zelte abbrechen, würde bald niemand mehr eine Bezeichnung für diesen Teil der Stadt benötigen.
Ob von seinem Namen eines Tages ebenfalls nur noch der Anfangsbuchtstabe übrig sein würde? L – das müsste den wenigen, denen daran gelegen war, ihn anzusprechen, von da an reichen. Frau Hauptmann, wenn er ihrem Staubsauger wieder mal im Weg steht, oder Giovanni, um ihn darauf aufmerksam zu machen, dass etwas, das L frittiert haben wollte, bereit sei, verzehrt zu werden.
Aus seinem vollständigen Namen hat er sich aber ohnehin nie viel gemacht. Zeitlebens hat er das Gefühl gehabt, er sei für jemand anderen vorgesehen gewesen, dem ähnlich zu werden ihm allem Anschein nach nicht gelingen wollte. Lambert. Zwei Silben, deren Kombination früher einmal eine Bedeutung gehabt haben dürfte, über die heute niemand mehr Bescheid weiß. L in Z … nur noch einem Grüppchen Zurückgebliebener verständlich. Einer, den niemand mehr kennt, in einer Gegend, an die sich kaum noch jemand erinnert – LZG –, in absehbarer Zeit wohl nicht einmal mehr er selbst.
Im Morgengrauen macht Lambert sich alles andere als ausgeruht, dafür nass, durchgefroren und wacklig auf den Beinen auf den Heimweg, und der führt ihm vor Augen, wie er die Umfahrungsstraße hat überwinden können, ohne etwas davon zu bemerken. Die Strecke verläuft durch eine Unterführung, und im Anschluss an eine Passage im Dunklen – das muss die Schatulle gewesen sein – findet Lambert sich auch schon in seiner Nachbarschaft wieder.
Hier ist der Morgen bereits fortgeschritten, und der Nieselregen hat sich in die Sprühflut zahlreicher Sprinkleranlagen verwandelt, die selbst der grimmigen Fassade von Lamberts Wohnhaus, zumal in ihrem unübersehbaren Wunsch, ihr etwas Unvergängliches anzusehen, eine geradezu niedliche Note verleihen. Unvoreingenommene Lichtverhältnisse unterstreichen, dass dieses Gebäude im Laufe der Jahre einen beträchtlichen Teil seiner ehemaligen Ausstrahlung eingebüßt hat. Die Dachrinne baumelt nur noch lose verankert von der Traufe wie ein am Nasenrücken heruntergerutschtes Brillengestell. Ein unbekümmerter Wind lässt sie an manchen Tagen auf und ab wippen, was ihr ein geradezu jämmerliches Quietschen abverlangt. Der Anstrich ist seit geraumer Zeit nicht erneuert worden, als bestehe keine Notwendigkeit mehr, die physischen Anzeichen fortgeschrittenen Alters darunter zu verbergen. In einem der Fensterrahmen klemmt ein Stück Vorhangstoff, was aussieht, als sei dem ganzen Haus die Luft ausgegangen. Zwei vom Borkenkäfer befallene Winterlinden flankieren den Eingangsbereich, als handle es sich bei ihren hölzernen Stämmen um die Nachkommen bürgerlicher Totems. Ihre vergilbten Blätter erinnern an wertlos gewordene Eintrittskarten. Ungezählt liegen sie zusammengeknüllt auf dem Gehsteig, bereit, demjenigen, der auf sie drauftritt, mit heiseren Kinderstimmen zu antworten.
Das Rohr ihres Staubsaugers im Anschlag blickt Frau Hauptmann Lambert aus dem Wohnzimmer heraus einfach nur an und bringt ihn auf diese Weise dazu, eine eilig zusammengeflickte Geschichte, derzufolge er gerade von einem morgendlichen Spaziergang zurückkehre, für sich zu behalten. Frau Hauptmann erweckt den Anschein, ohnedies Bescheid zu wissen. Als lasse sich mit ihrem Haushaltsgerät, sofern man sich darauf verstehe, damit umzugehen, die unmittelbare Vergangenheit auf sämtliche Unregelmäßigkeiten hin untersuchen.
Der Wissensvorsprung seiner Haushälterin überrascht Lambert in Anbetracht seines dröhnenden Schädels nicht im Geringsten. Frau Hauptmann weiß eben eine ganze Menge und darunter auch Dinge, von denen er keine Ahnung hat. Ihre Spezialität ist die ungeschminkte Einschätzung der Verhältnisse, wie sie sich in ihren Augen darstellen (»Ich bin ja hier nur die Putzfrau«).
Äußerlich erinnert Frau Hauptmanns dralle Erscheinung an die erdige Fruchtbarkeit einer Kartoffel, einer Kartoffelpatronin, wie sie in ländlichen Gegenden früherer Tage gleichermaßen verehrt wie gefürchtet wurde. Mit Schmuck aus grobem Wurzelwerk und einem staubigen Kleid aus getrocknetem Lehm. In letzter Zeit weist ihre Fülle, als wäre hier und da schon mal ein wenig Luft entwichen, möglicherweise etwas Schlaffes auf – aber ein großes Herz offenbart sich bekanntlich nicht im Faltenreichtum der Haut, sondern in einem Lächeln auf den Lippen.
Frau Hauptmanns Lippen lächeln nicht. Auf das mächtige Rohr ihres betriebsbereiten Staubsaugers gestützt, beansprucht sie das Zentrum des Wohnzimmerteppichs, dessen Muster sich unter den Korksohlen ihrer Gesundheitssandalen in den mannigfaltigen Zierrat einer ihr geweihten Kultstätte verwandelt. Etwas versöhnlich Pummeliges hat sich in Frau Hauptmanns Physiognomie mit dem feisten Zubeißen kleiner Nager vermischt. Im Anschluss an eine ihrer gehässigen Bemerkungen taucht sie für gewöhnlich ihren Putzlappen in einen Eimer und hält einige Sekunden lang inne, als gäbe sie – ihre Hände im lauwarmen Aufwaschwasser – ihrem Arbeitgeber Gelegenheit, abzuwägen, ob er über ausreichend Schneid verfügt, um etwas zu seiner Verteidigung vorzubringen.
Lambert beteuert, die Sache sei halb so wild gewesen, sein Schädel brumme auch nicht mehr so arg. Gestern Abend sei es ihm nur eben vernünftiger erschienen, jegliches Risiko zu vermeiden und am Unfallort abzuwarten. Anstatt näher darauf einzugehen, worauf er vernünftigerweise gewartet habe, bückt sich Lambert und präsentiert seinen Hinterkopf, an dem ihn der Golfball getroffen hat. Einen Kommentar entlockt er seiner Haushälterin mit dieser Demutsgeste allerdings nicht. Wahrscheinlich übersieht Frau Hauptmann die ihr dargebotenen Spuren sogar absichtlich, als befürchte sie, sich ansonsten darum kümmern zu müssen und, würde sie sich erst einmal darum kümmern, der diesen Spuren zugrunde liegenden Leichtsinnigkeit mit so etwas wie Nachsicht zu begegnen. Lambert weiß nur zu gut, was Frau Hauptmann auf der Zunge liegt. Er hat es schon so oft von ihr gesagt bekommen, dass es bereits ausreicht, seine Aufmerksamkeit auf die Arabesken zu ihren Füßen zu richten, um es einmal mehr zu vernehmen: Wer sich in seiner Nachbarschaft nicht mehr zurechtfinde, bleibe in Zukunft besser daheim, ehe er sich und andere in Gefahr bringe (»Ein alter Hund darf eben nicht mehr allein vom Hof«). Ob mit den anderen die gelangweilten Bewohner der Vororte gemeint sind oder ein Arbeitsplatz wie der ihre als seine Haushälterin, verschweigt Frau Hauptmann mit der gleichen Geflissenheit, mit der sie die Spuren des Golfballtreffers auf Lamberts Hinterkopf übersieht.
Mag Lambert sich von Frau Hauptmanns Schweigen auch überhart beurteilt fühlen, so weiß er doch, dass sie nicht völlig unrecht hat. Immerhin hat er es in ihrer Person mit einer eingeschworenen Bewohnerin dieser Region zu tun, mit einer, die vor zig Jahren aus Z – das damals noch über einen Namen in seiner gesamten Länge verfügte – hierher übersiedelt ist.
Während über Z bald darauf eine schlimme Zeit hereinbrach, hielt in den Vororten – gemeinsam mit Frau Hauptmann – ein ansehnlicher Wohlstand Einzug. Frau Hauptmann hat den wirtschaftlichen Ruin also nicht bloß kommen sehen – das haben viele, im Nachhinein sogar mehr oder weniger alle –, Frau Hauptmann hat rechtzeitig die Konsequenz daraus gezogen und sich selbst dafür belohnt, was ihrer Übersiedlung nicht nur ihrer eigenen Auffassung nach etwas beinahe schon Gesegnetes verleiht, als habe sich darin ein uralter Orakelspruch erfüllt. Der Wirkung einer solchen geradezu magischen Dimension kann sich auch Lambert nicht vollends entziehen, weshalb jede mit Z und seinen Vororten zusammenhängende Behauptung seiner Haushälterin, egal wie bizarr oder unglaubwürdig, ob ausgesprochen oder nicht, in seinen Augen etwas Unbestreitbares an sich hat.
Zuletzt erhebt Frau Hauptmann dann doch noch ihre Stimme, zumindest hat Lambert den Eindruck, etwas zu hören, aber da meldet sich auch schon ihr Staubsauger zu Wort, verschluckt was immer Frau Hauptmann sagt in seinem Getöse und betont damit, dass keine Silbe davon Wert darauf legt, kommentiert zu werden. Gleich darauf dringt das lange Staubsaugerrohr, von Frau Hauptmanns kräftigen Händen dirigiert, in die schmale Lücke unterhalb des Sofas, was den auf einem Tischchen daneben positionierten Fernseher veranlasst, Lambert einen unschuldigen Blick zuzuwerfen, als beschränke sich seine Aufgabe nun mal darauf, das Nichts von unterhalb des Sofas auf seinen Bildschirm zu übertragen.
Mit Sicherheit hat sich unter Frau Hauptmanns letzten Worten die Aufforderung befunden, Lambert möge in Zukunft darauf achten, dass ihn keiner seiner Streifzüge mehr aus seinem Vorort hinausbringe. Von nun an hätten sie allesamt an der Ortsgrenze zu enden, da Lambert es von dieser aus ungeachtet etwaiger Beeinträchtigungen infolge einer neuerlichen Unachtsamkeit (»Als Unfall bezeichne ich einen Baum, der gegen einen alten Mann läuft«) bis nach Hause schaffen und, falls nicht, zumindest nicht allzu weit von dort entfernt liegen bleiben würde. Eine Vereinbarung könnte man sagen, andere hätten es ein Verbot genannt, Frau Hauptmann zum Beispiel, und wahrscheinlich hat sie ihren vom Staubsaugergetöse unkenntlich gemachten Worten ohne Begleitung hinzugefügt, was wie eine Milderung klingen mag, tatsächlich jedoch eher einer Verschärfung gleichkommt. Schließlich lassen sich Lamberts Streifzüge als letzte Abzweigungen auf einem von ihm eingeschlagenen Lebensweg bezeichnen. In ihnen münden nicht nur sämtliche Formen des Weiterkommens, die es ihm in der Vergangenheit gestattet haben, fragwürdigen Konstellationen auszuweichen, verpassten Chancen hinterher- und vor sich zusammenbrauenden Unannehmlichkeiten davonzulaufen, mit Hilfe seiner Streifzüge ist es Lambert gelungen, stets in Bewegung zu bleiben, ein Spezialist des aufrechten Gangs, schlendernd oder marschierend, auf Zehenspitzen, Einbahnen entlang, unausgesetzt in Kontakt mit dem Erdboden.
Auch beruflich hatte sich Lambert – in der Branche besser bekannt als Bert – zuletzt vor allem mit der Inszenierung verschiedener Spielarten der Fortbewegung befasst: nächtlichen Schritten auf regennassem Asphalt, Schritten, die sich als die letzten herausstellen sollten, bürokratischen auf Linoleum, sterilen auf Keramikfliesen, majestätischen über Marmorimitat sowie Schritten, die binnen einer Schrecksekunde in ein Laufen übergingen. Ein gedemütigter Mensch geht anders als ein verliebter. Jemand, der den Kopf verloren hat, hört sich vorübergehend nicht so an wie ein Gewinner, der triumphierend einherschreitet, während ein Besiegter taumelt, ein Leichtgläubiger auf den Holzweg gerät, ein Uneinsichtiger gegen eine Wand rennt und ein Nachtwächter eine weitere Runde dreht, ehe ihm von einem Dieb, der sich unhörbar angeschlichen hat, eins übergebraten wird (ein Sack Zement aus ein, zwei Metern Höhe fallen gelassen). In seinem ehemaligen Studio (»mein Kinderzimmer«) hat Lambert sich auf heiklem Parkett bewegt, ist durch Schnee gestapft, Zweige knickend und Käfer zermalmend über Waldböden gerobbt. Am Ende seiner beruflichen Laufbahn verfügte er über eine ganze Batterie jeweils etwa eineinhalb Quadratmeter großer sogenannter Laufställe mit einer Auswahl aller erdenklichen Bodenbeschaffenheiten. Da gab es Mehl (Schnee), Gras (Rasen), Laub (Herbst), Betonsand (Prärie), Pflasterstein, Kacheln, knöcheltiefes Wasser bis hin zu Holzdielen (verräterisch knarrend oder vornehm verschwiegen), und für jeden Bodenbelag stand die passende oder entsprechend unpassende Auswahl an Schuhwerk bereit: Stiefel, Stiefeletten, Herren- und Damenschuhe, zum Schnüren oder mit hohen Absätzen. Hinzu kamen Schwimmflossen, Raubkatzenpfoten, Hufeisenhufe, Schlangenetuis, glühende Kohlen und Gänsefüßchen.
Als es für Bert schließlich an der Zeit war, dem Studio den Rücken zu kehren und sich – einen von Zs Buchstaben im Gepäck – an einen Ort zu begeben, der Umherstreifende in Spaziergänger verwandelt, die, sind erst einmal Spaziergänger aus ihnen geworden, unaufgeregt auf eine Wunschlosigkeit zusteuern, lag demnach bereits eine ansehnliche Strecke hinter ihm. Mit urbanen Versatzstücken kommuniziert Bert hier draußen, wo Gehsteig und Fahrbahn zu einer uferlosen Fußgängerzone ineinanderfließen, allerdings, wenn überhaupt noch, dann bestenfalls erinnerungshalber. Beim Warten an einer Ampel, beim Überqueren eines Zebrastreifens, wenn ihm eine Straße zwei Himmelsrichtungen offeriert, wenn ein Kreisverkehr ihn dazu einlädt, alles noch einmal zu überdenken oder ein Geflecht von Nebenstraßen sich ob seiner voranschreitenden Verwirrung vor Lachen schüttelt. Versperrt Lambert ein Schlagbaum, den er im Dämmerlicht übersehen hat, den Weg, zweifelt er nicht einen Moment daran, dass ihm das Holz, aus dem sein Balken gefertigt worden ist, etwas mitteilen möchte – beispielsweise, dass es sich um eine Grenze handle und damit um eine geeignete Stelle, den Rückweg anzutreten.
Ein mageres Fingergelenk klopft behutsam auf Holz, Regentropfen fabrizieren Morsezeichen auf dem Blech der Dachrinne, bald stotternd, dann wieder einigermaßen flüssig. Jemand hustet, jemand gurgelt. Wind lässt einen undichten Fensterrahmen pfeifen. Irgendwo fliegt eine Tür zu, ein Rohr reagiert mit einem Pochen, was ein Heizkörpergehäuse zu einem Echo inspiriert. Eine Flasche wird abgestellt. Briefkästen scheppern hämisch. Nach wiederholten Anläufen überwindet sich eine Therme dazu, ihre Arbeit aufzunehmen.
Es gibt Tage, an denen das ganze Gebäude einem vorbeidonnernden Lastwagen schon mal mit einem Ruck antwortet. An diesem Morgen aber: nichts. Lambert fühlt sich erwacht und doch noch nicht im Zustand der Wachheit angekommen. Rundherum Stille. Nichts, um von ihm zur Kenntnis genommen zu werden, nichts, das auf ihn eindringt. Kein Klopfen, keine Morsezeichen, noch nicht einmal eine Klospülung. Als wäre die Zeit stehen geblieben. Lambert weiß zwar nicht, warum, aber er weiß, dass sein Körper, stiege er jetzt aus dem Bett, liegen bleiben würde, und Lambert weiß, glaubt zumindest zu wissen, dass das, was dann an seiner statt das Bett verließe, wohl so etwas wie sein eigenes Gespenst sein müsste. Eine Durchsichtigkeit, imstande, durch Hindernisse aller Art hindurchzugehen, aber eben auch körperlos und daher derart unbedeutend, dass kein Gegenstand, keine Tür, keine Wand es der Mühe wert fände, sich ihm in den Weg zu stellen.
Lambert greift mit beiden Händen in die Bettwäsche, klammert sich an ihren Stoff, kriegt diesen auch zu fassen – und schon ist die Welt aufgewacht, die Zeit wieder angebrochen oder war zuvor gar nicht wirklich stehen geblieben. Aber was hat diese unerträgliche Lautlosigkeit zu bedeuten? Nirgendwo Holz, das knackend atmet, kein Schlucken einer der Wände, noch nicht einmal das Geräusch von Feuchtigkeit, die in Mauerwerk eindringt. Sollte das Haus über Nacht verstummt sein? Hat es sich dazu entschlossen, den Rest für sich zu behalten? Lambert bekommt es mit der Angst. Er greift noch einmal in die Laken, diesmal so, als lasse sich ihnen auf diese Weise ein Ton abringen. Irgendein Geräusch, nur nicht nichts. Aber die Bettwäsche bleibt stumm. Die Zimmerdecke sagt nichts. Alle vier Wände schweigen. Lambert fühlt sich lebendig begraben, vorzeitig in einen Sarg gesteckt, der ganz aus Stille besteht.
Als seine Sehkraft nachzulassen begann – das muss Jahre her sein –, ist das bei Lambert auf eine fast schon sportliche Neugier gestoßen. Die gelegentliche Unauffindbarkeit eines bestimmten Begriffes oder Namens versteht es mitunter heute noch, ihm ein Schmunzeln abzuringen, und als er anfing, Dinge zu vergessen, ist Lambert das eine Zeit lang noch nicht einmal aufgefallen. Seine immer häufiger ermüdenden Beine, verbunden mit einem vorübergehenden Aussetzen der Kommunikation zwischen Oberkörper und unteren Extremitäten, stimmen ihn zwar regelmäßig nachdenklich, diese Nachdenklichkeit hat aber eher etwas von der Pragmatik eines Einbahnschilds, darauf bedacht, seine fortschreitende Vergesslichkeit daran zu erinnern, dass es sich beim Altern um einen nicht umkehrbaren Prozess handelt, der in eine einzige Richtung verläuft.
Dass sein Gehör schwächer werden oder gar ausbleiben könnte, ehe sein Lebensweg an ein ihm angemessenes Ende kommen würde, hat Lambert hingegen stets für ausgeschlossen gehalten. Funktioniert sein Gehör denn nicht wie ein organischer Verbrennungsmotor, darauf ausgerichtet, akustische Eindrücke in lebensspendende Energie umzuwandeln?
Anders als Augenlicht, Geruchs- und Geschmackssinn, Sprachvermögen und Gedächtnis – alles hervorragende Eigenschaften, die Lambert jedoch immer als geborgt empfunden hat –, anders als seine Beweglichkeit, von der er nur hoffen kann, dass sie ihn bis zum Schluss begleiten wird, hat Lambert das Gehör seit jeher nicht nur als existenzielle Kraft empfunden, als eine Form von Herzschlag, Puls oder Atmung, sondern als von ihm gemacht und gleichzeitig ihn ausmachend.
Soll das etwa ein Protest gegen Frau Hauptmanns unausgesprochene, um nicht zu sagen ungerechtfertigte Bestrafung sein? Handelt es sich um eine Folge der bei der Aussichtswarte verbrachten Nacht? Vielleicht ist aber auch der Golfball schuld an Lamberts Zustand.
Das muss es sein! Der Golfball hat Schaden angerichtet, hat etwas kaputt gemacht. Wie ein Geschoss ist er in Lambert eingedrungen, befindet sich nun in seinem Kopf und verstopft dort sämtliche Gehörgänge. Das hieße, dass da gar kein Kind gewesen ist, um den Ball aufzuheben, dass es sich bei dem Anrainer genauso gut um den Schützen gehandelt haben könnte und bei seinen angeblichen Beobachtungen um ein Ablenkungsmanöver – und Lambert ist prompt darauf hereingefallen, hat es geschluckt.
Am liebsten würde er vor Wut brüllen, unterdrückt dieses Bedürfnis jedoch aus Angst, sein eigenes Gebrüll nicht hören zu können und die Stille dadurch nur umso deutlicher zu spüren zu bekommen. Schlagartig wird Lambert klar, dass er sich damit selbst zum Schweigen gebracht hat, und gerade als sich alles in ihm zusammenzieht – als plane sein Organismus, sich in Form einer Implosion zu verabschieden –, ist da auf einmal ein Getöse.