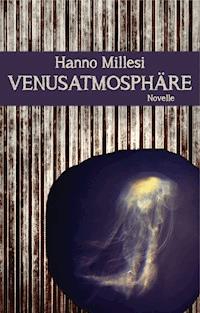Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Atelier
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im Gegensatz zu seinem alten Vorgänger hat sich der junge Mann in Hanno Millesis Buch entschieden, sein Leben an Land zu verbringen. Sofern er sich mal aufs Meer hinauswagt, dann als Gast und nur in Küstennähe. Dennoch gerät er eines Urlaubstages an einen Meeresbewohner, der ihn einen Tag lang durch die Stadt begleitet und zu einer alles entscheidenden Herausforderung für den jungen Mann wird. Hanno Millesi schreibt in seinen Erzählungen virtuos und hintergründig über die Entfremdung zwischen dem Individuum und der Welt, in die es gerät– und welche Kaskaden an skurrilen Gedanken und Möglichkeitsräume die Wahrnehmung der Welt hervorzubringen vermag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 153
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
It’s odd that people don’t hate the sea
Thomas d’Angleterre, Tristan-Fragment
Der junge Mann und das Meer
Wer jetzt noch auf den Beinen ist, dem verabreicht der morgendliche Nieselregen einen ernüchternden Gutenachtkuss. Dem jungen Mann, der sich zu dieser frühen Stunde schon wieder auf die Socken macht, vermittelt der feuchte Schleier hingegen den Eindruck, eine versehentlich nicht abgeschlossene Badezimmertür geöffnet und jemanden bei der Körperpflege überrascht zu haben. Genau genommen nicht jemanden, sondern die paar Straßenzüge, von denen er – ein wenig voreilig, wie sich jetzt herausstellt – angenommen hat, mit ihnen verbinde ihn bereits eine gewisse Vertrautheit.
Als wäre das um diese Uhrzeit einigermaßen viel verlangt, springt sein Auto erst nach allerhand Würgen an, und während er dem Motor einen Moment gibt, fahrbereit zu werden, zieht der junge Mann den Reißverschluss an seiner Jacke bis unter das Kinn. Zehn, vielleicht auch zwanzig Meter weit entfernt reagiert ein Müllwagen darauf, indem er mit Hilfe seiner hydraulischen Hebevorrichtung, die einen ächzenden Laut von sich gibt, den Inhalt einer Tonne in seinen Laderaum kippt.
Der junge Mann ist schon so früh unterwegs, weil er sich vorgenommen hat, dem Fischerhafen einen Besuch abzustatten. Der Fischerhafen ist seiner Gastgeberin, nach jenen Sehenswürdigkeiten ihrer Stadt befragt, die in einem Reiseführer nicht unbedingt Erwähnung finden, als Erstes eingefallen. Auf diesen Hafen ist die Stadt nicht unbedingt stolz – angeblich, weil dort keinerlei hygienische Vorschriften eingehalten werden. Noch dazu spielt sich am Hafen alles in den frühen Morgenstunden ab. Für den jungen Mann Grund genug, ihn als Ziel ganz oben auf seine Liste zu setzen.
Beim Fischerhafen angekommen, bleibt dem jungen Mann nichts anderes übrig, als sein Auto auf einem der laut Bodenmarkierungen Anrainern vorbehaltenen Parkplätze abzustellen. Einige Kleinlaster blockieren die Zufahrt zu dem für Besucher vorgesehenen Bereich. Weshalb, wird dem jungen Mann erst klar, nachdem er ausgestiegen ist und sich ein wenig umgesehen hat. Die Fischerboote sind soeben eingetroffen, und die Einkäufer der verschiedenen Restaurants, denen die Kleinlaster gehören, können es nicht erwarten, sich die besten Stücke der fangfrischen Ware zu sichern.
Im Gegensatz zu den chaotisch abgestellten Autos präsentieren sich die Fischerboote gewissenhaft nebeneinander vertäut, und begleitet vom dumpfen Klopfen der hölzernen Planken, die immer wieder den Steg berühren, verwandeln sich die Seeleute in Händler.
Obwohl zum ersten Mal Zeuge einer derartigen Metamorphose, bildet sich der junge Mann ein, mitzubekommen, wie es diejenigen, die auf See das Kommando innehaben, im Hafen in den hinteren Bereich ihrer Boote zieht. Es ist, als wollten sie mit dem, was da aus dem Landesinneren auf sie zuströmt, so wenig wie möglich zu schaffen haben. Wer eben noch die Netze geflickt und das Deck geschrubbt hat, übernimmt jetzt das Verkaufsgespräch. Die ganze Zeit über bewegt sich die Glut unzähliger Zigaretten in unzähligen Mundwinkeln wie ein Meer von Funktionslichtern auf einem im Dämmerlicht der Brandung schwankenden Armaturenbrett. Was da kurzfristig stärker und dann wieder schwächer leuchtet, liefert die Energie hinter verschiedenen, dem jungen Mann völlig unbekannten Begriffen. Putzige Dampfschiffe vergangener Tage fallen ihm ein, antiquiert wie im Grunde auch diese Fischer. Er denkt an die heiteren Fontänen der Wale, damals, als weder diese Tiere noch diejenigen, die sie gejagt haben, vom Aussterben bedroht waren. Mit einem Mal bekommen die leuchtenden Punkte in den Mundwinkeln der Seeleute etwas geradezu Sentimentales – in ihren Bann zu geraten, fällt nicht schwer. Der junge Mann fixiert einen von ihnen, dann einen zweiten, und folgt diesem auf seinem Kurs zwischen Angebot und Nachfrage.
Ob die Fischer ihn für den Einkäufer eines Restaurants halten? Wahrscheinlich unterscheidet sich in ihren Augen eine Landratte nur unwesentlich von der anderen. Ein Händler auf einem der Boote bietet ihm einen Fisch an, aber der ist so hässlich, dass der junge Mann seinen Blick abwendet. Es folgt ein Hummer, dessen verzweifelt ins Leere schnappende Scheren geloben, bis zum letzten Atemzug ums Überleben zu kämpfen. Gerührt schüttelt der junge Mann seinen Kopf. Schließlich wird ihm das Knäuel eines Tintenfisches gezeigt, der wenigstens friedlich entschlafen zu sein scheint. Das weitaus kooperativste Tier, denkt sich der junge Mann, und der Fischer, der das seinem Gesicht abzulesen scheint, hebt die andere Hand und streckt zweimal hintereinander alle fünf Finger aus, als übermittle er einen Abschiedsgruß des Meeresbewohners. Nein, entgegnet der junge Mann mit Nachdruck.
Kurz darauf steht er mit einem weißen Plastiksack, in dem sich ein schwabbeliger Leichnam befindet, auf dem altmodisch gepflasterten Pier, von dem aus sich mehrere Landungsstege wie hölzerne Finger dem Horizont entgegenstrecken. Auch wenn er den Sack gegen den anbrechenden Tag hält, erkennt der junge Mann nicht mehr als die Umrisse des jeden Kubikzentimeter ausfüllenden Kadavers. Der Sack sieht aus wie vollgefüllt mit Tintenfisch.
Das Tier ist ebenso unvorhergesehen in seine Hände geraten wie zuvor in die Maschen eines Fischernetzes. Der junge Mann hat allerdings gar nicht vorgehabt, etwas zu erwerben. Der Fischhändler hat es darauf angelegt, ihn falsch zu verstehen. Es scheint ihm nur darum gegangen zu sein, seine Ware anzubringen. Was die Gastgeberin des jungen Mannes wohl dazu sagen würde? Wahrscheinlich würde sie sich fragen, wie um alles in der Welt ein junger Mann wie er in den Besitz einer solchen Delikatesse, deren Weg normalerweise direkt aus dem Fischernetz in den Kochtopf eines Feinschmeckerlokals führt, habe kommen können. Eigentlich schade, dass sie ihn jetzt, hier auf der Mole stehend, nicht sehen kann. Zwischen den altmodischen Pflastersteinen haben sich Unmengen von Fischinnereien, Teile von Krustentieren und Zigarettenstummel angesammelt. Der junge Mann könnte behaupten, angesichts der einnehmenden Atmosphäre und eines kulinarischen Angebots, wie er es bisher noch nie gesehen hat, schwach geworden zu sein. Den toten Tintenfisch auf seiner Tour mitzuschleppen, hält er für keine so gute Idee. Er wird zusehen müssen, ihn unterwegs irgendwo loszuwerden.
Als die Prélude ablegt und zu einer Rundfahrt durch die alte Hafenanlage aufbricht, hat der junge Mann den Eindruck, der einzige Passagier an Bord zu sein. Kein Wunder, sagt er sich: Es ist noch früh am Tag, das Wetter ist unfreundlich, und die Hafenrundfahrt soll – so hat sich seine Gastgeberin ausgedrückt – nicht unbedingt das geeignete Setting für unvergessliche Selfies bieten.
Den Plastiksack mit dem Tintenfisch hat er, unmittelbar nachdem er an Bord gegangen ist, an einem der Karabiner, in denen die Rettungsringe an der Reling hängen, befestigt und sich, erleichtert, das tote Tier auf stilvolle Weise angebracht zu haben, ein paar Meter davon entfernt, auf eine der für Passagiere vorgesehenen Metallbänke gesetzt. Als habe seine Aufgabe darin bestanden, den Plastiksack möglichst unauffällig auf das Schiff zu bringen und dort sich selbst zu überlassen.
In der Folge kann sich der junge Mann allerdings des Gedankens nicht erwehren, dass es reichlich absurd anmutet, ausgerechnet mit der Leiche eines Tintenfisches an einem Rettungsring in einem Hafen herumzuschippern. Ob es früher einmal auf einem Rundfahrtschiff wie der Prélude eine Kombüse gegeben hat, in der man sich über eine kulinarische Spende in Form eines solchen Tieres gefreut hätte? Kurz darauf empfindet der junge Mann das Bedürfnis, den Inhalt des Plastiksacks über Bord gehen zu lassen, eine innere Stimme sagt ihm jedoch, dass er damit den Fluch sämtlicher Fischer sowie Küchenchefs der Region auf sich ziehen würde. Schließlich hätte das Tier in diesem Fall ohne jeden Grund sterben müssen.
Die Rundfahrt bietet tatsächlich nicht viel Sehenswertes. Das Schiff gondelt Kanäle entlang, die allem Anschein nach angelegt wurden, als die Hafenanlage noch florierte. Übrig geblieben sind Speicher, die vor Leere gähnen, Kräne, die aufgehört haben, sich nach besseren Zeiten umzusehen und ein Trockendock, bei dessen Anblick dem jungen Mann das Gerippe eines gigantischen Meeresbewohners einfällt. An Bord der Prélude ist inzwischen ein Junge vor das an der Reling befestigte Bündel mit dem toten Tintenfisch getreten und betrachtet es mit knabenhafter Neugier. Der junge Mann sagt sich: Sollte das Kind einen Schreck bekommen, sobald es merkt, dass sich eine Leiche darin befindet, wird er einfach so tun, als gehöre der Plastiksack jemand anderem. Vielleicht ergibt sich daraus sogar eine Gelegenheit, als Retter aufzutreten und das lästige Tier mehr oder weniger in Notwehr, immerhin jedoch zum Schutz eines Kindes ins Wasser zu werfen. Der junge Mann könnte behaupten, ihm sei gar keine andere Wahl geblieben. Und außerdem: Wer, abgesehen von ihm selbst, sollte sich denn darüber beschweren – von dem Fluch der Fischer und Küchenchefs einmal abgesehen?
Noch ehe der junge Mann ausreichend Gelegenheit gehabt hat, abzuwägen, ob er sich nicht doch als jemand zu erkennen geben sollte, der weiß, dass von einem Tierkadaver in einem Plastiksack keinerlei Gefahr ausgeht, ist eine Frau hinter das Kind getreten und hat ihre Hände auf seine Schultern gelegt. Sie will damit versichern, dass sie, was immer auch geschehen möge, hinter ihm stehen werde.
Zunächst wundert sich der junge Mann darüber, dass ein totes Meerestier – noch dazu auf einem Schiff, das in einem Fischerhafen abgelegt hat – ihre Aufmerksamkeit erregt. Ein Blick über die Reling ruft ihm allerdings in Erinnerung, dass es an Land außer Leere und Beschäftigungslosigkeit kaum etwas zu sehen gibt, und mitten in diese betrübliche Erkenntnis ertönt – ebenso unerwartet wie unpassend – plötzlich ein Kichern. Als hätte jemand einen Eimer Heiterkeit über den Planken an Deck ausgeleert. Erst sickert es stellenweise durch den stotternden Lärm des Schiffsantriebs, dann schwillt es an und ergießt sich schließlich – nunmehr das Gelächter von mindestens Zweien – über die gesamte Situation.
Das Kichern rührt von dem Kind und seiner Mutter. Sie stehen vor dem Plastikbeutel und verhalten sich, als biete er einen ulkigen Anblick. Der junge Mann kann nicht begreifen, was, um alles in der Welt, an einer toten Kreatur ulkig sein sollte. Erst als ihm etwas auffällt, das eigentlich gar nicht passieren dürfte, wird ihm klar, was die Mutter und ihren Sohn dermaßen amüsiert. Es hat mit dem toten Tintenfisch zu tun, denn es ragt aus dem Plastiksack, der doch von nichts anderem als diesem Tier und seinem Tod ausgefüllt werden sollte.
Was der junge Mann sieht, ist ein Tintenfischarm, der einigermaßen zögerlich in der Welt da draußen, in der Welt außerhalb seines Plastiksacks herumstochert. Wie ein Mensch – ein junger Mann zum Beispiel, denkt der junge Mann –, der, am Ufer stehend, eine seiner Zehenspitzen in den Ozean hält.
Ungeachtet des Umstands, dass so etwas nicht vorgesehen gewesen ist, bewegt sich dieser Arm – Fangarm, wie die zoologische Bezeichnung lauten dürfte – wie eine, soviel steht für den jungen Mann fest, alles andere als tote, wie eine im äußersten Fall unter Hypnose stehende Schlange. Ein Anlass zum Kichern ist das seiner Auffassung nach dennoch nicht unbedingt.
Ein derartiges Lebenszeichen aus den Untiefen eines Plastiksacks, noch dazu von einem Tintenfisch, den er sich überhaupt nur in der Annahme, er sei leblos, hat andrehen lassen, erscheint dem jungen Mann unwirklich. Nach einer vorübergehenden Sprachlosigkeit kommt er zu der Erkenntnis, in dem Plastiksack müsse sich die ganze Zeit über etwas Lebendiges befunden haben – höchstwahrscheinlich an einem der Saugnäpfe des Tintenfischarms haftend. Die erst mit der geschmeidigen Eleganz einer Schlange assoziierte, jetzt wieder reichlich komisch im Nichts herumtorkelnde Gliedmaße kommt dem jungen Mann beinahe so absurd vor, wie es ihm bereits absurd vorgekommen ist, dass eine solche, seiner Vorstellung nach tote Kreatur in den Besitz eines jungen Mannes, wie er einer ist, gelangen konnte und in seiner Begleitung eine Hafenrundfahrt angetreten hat. Andererseits passt – und das liegt wohl ebenfalls am Absurden – das Gekicher des Kindes und seiner Mutter gut zu der aus dem Plastiksack ragenden Tintenfischgliedmaße. Wie Kichern zum Fehlen der richtigen Worte passt oder aber zu einer liebenswerten Attraktion im Programm eines Wanderzirkus.
Kichernd macht die Frau, mag sein von einem mütterlichen Instinkt dazu veranlasst, ein paar Schritte rückwärts und zieht ihr Kind, auf dessen Schultern ihre Hände immer noch ruhen, mit sich. Ihr Rückzug erfolgt jedoch nicht unbedingt aus den gleichen, durchaus nachvollziehbaren Motiven, die den jungen Mann sprachlos haben werden lassen. Allem Anschein nach begegnen in der Mutter und ihrem Kind einander so Widersprüchliches wie übertriebene Ängstlichkeit und immense Belustigung. Der Knabe hat das mit der Angst offenbar als Erster verdaut. Er möchte den Tintenfisch berühren. Was die Mutter betrifft, so kann sie sich nicht recht entscheiden, was für ein Verhalten sie in einer Situation wie dieser für angebracht halten soll. Einerseits besteht – allein aufgrund der Beispiellosigkeit – berechtigter Anlass, sich zu ängstigen, andererseits muss sie nach wie vor kichern. Schließlich aber entscheidet sich die Mutter für die Vorsicht und gegen das Amüsement. Gemeinsam mit ihrem aufgrund eines Rests an Ängstlichkeit nur verhalten protestierenden Kind wendet sie sich von dem gleichermaßen fröhlichen wie ein wenig ungehörigen Anblick ab. Erst als die beiden beim Überqueren des Aussichtsdecks an ihm vorbeigehen, schickt die Frau einen zweideutigen Blick in Richtung des jungen Mannes. Unverständnis prägt diesen Blick, er ist vorwurfsvoll, birgt aber auch einen unübersehbaren Anteil an Bewunderung. Der Knabe schaut hingegen sehnsüchtig zurück zu dem Plastikbündel, in dem etwas zum Leben erwacht zu sein scheint. Für das Kind sieht das wohl gar nicht nach einer Schlange aus, der Anblick dürfte es vielmehr an den Rüssel jenes jungen Elefanten erinnern, den es sich seit jeher zum Spielkameraden gewünscht hat.
Der Vorwurf der Frau und Mutter – in ihren Augen hat er gegen seine Aufsichtspflicht verstoßen – lastet auf dem jungen Mann. Ein davon ausgelöstes Schuldgefühl bildet ein Gegengewicht zu der vorangegangenen Erleichterung darüber, zumindest eine Zeit lang nichts mit dem Plastiksack zu tun gehabt zu haben. Bei einem aus einem Sack herausschauenden Fangarm scheint es sich jedoch um eine Angelegenheit zu handeln, die er gefälligst unter Kontrolle zu halten habe. Ganz egal, ob die Kreatur, zu der dieser Arm gehört, überhaupt noch unter den Lebenden weilen sollte. Woher die Frau und Mutter bloß weiß, dass der Tintenfisch gemeinsam mit ihm an Bord gekommen ist? Außer dem jungen Mann befindet sich jedoch keine Menschenseele auf dem Aussichtsdeck des Rundfahrtschiffes.
Als die Prélude an ihren Ausgangspunkt zurückgekehrt ist, bringt es der junge Mann nicht übers Herz, den Plastiksack, in dem ein Tintenfisch zum Leben erwacht ist, an Bord zurückzulassen. Ihn an sich zu nehmen, kostet ihn allerdings ebenfalls eine Menge Überwindung. Anders als beim ersten Mal, als ihm das Tier im Grunde gegen seinen Willen ausgehändigt wurde, bekennt sich der junge Mann, indem er das Bündel von dem Karabiner herunternimmt, zu so etwas wie einer Verantwortung.
Im Inneren herrscht nach wie vor Bewegung. Der junge Mann kommt sich vor, als hantiere er mit einem Kessel, in dem es, wenn auch gemächlich, so doch brodelt. Erst einer, dann sogar ein zweiter Arm versuchen daraufhin seinen Oberschenkel zu umfassen, als hätte es der Tintenfisch darauf abgesehen, ihn aus Dankbarkeit zu sich in den Sack zu ziehen. Obwohl das beim Verlassen der Prélude für ein paar komische Blicke sorgt, bleibt dem jungen Mann nichts anderes übrig, als das, was er da mit sich trägt, möglichst weit von sich zu halten, so als gehe übler Geruch davon aus.
Als nächste Station steht das Museum für Heeresgeschichte auf seiner Liste. Die Gastgeberin des jungen Mannes hat von den skurrilen Dingen, die es dort zu sehen gibt – darunter angeblich der blutige Waffenrock eines Prinzen, der einem Attentat zum Opfer gefallen ist –, geradezu geschwärmt. Den Plastiksack mit dem Tintenfisch trägt der junge Mann mittlerweile verhältnismäßig unauffällig, sodass man glauben könnte, er beinhalte herkömmliche Einkäufe. Er hat herausgefunden, dass das Schaukeln, in das der Beutel, sobald er sich in Bewegung setzt, ganz von allein verfällt, den Tintenfisch schläfrig werden lässt. Es könnte sein, dass das Hin und Her das Tier an das Wogen des Ozeans erinnert, in dem es zu Hause ist. Die Schläfrigkeit dürfte es ihm überdies erträglicher machen, dass es sich nicht mehr in dessen Tiefen, zwischen Algen, Plankton und Korallen befindet, sondern in einer Art U-Boot, einer Kapsel aus stabilem, gleichzeitig aber auch nachgiebigem Plastik über Land getragen wird.
An der Bushaltestelle, die seine Gastgeberin ihm aufgeschrieben hat, angekommen, bleibt der junge Mann zwar stehen, bewegt seinen Arm indes weiterhin gleichmäßig hin und her, was, stellt er sich vor, aussehen muss, als handle es sich bei dem Plastiksack in seiner Hand um einen Weihrauchschwenker. Da außer ihm niemand wartet, wundert sich allerdings auch niemand darüber. Als der Bus schließlich in die Station einfährt, hat der junge Mann Bedenken, der Fahrer könnte sein Schwenken so auffassen, als wolle er ihm ein Zeichen geben, und um einer möglichen Konfrontation auszuweichen, steigt er am anderen Ende des Fahrzeugs ein. Dann begibt er sich in die obere der beiden Etagen. Der junge Mann möchte möglichst viel von der Aussicht, die sich den Fahrgästen von dort bietet, mitbekommen.
Da dieser Stadtteil nicht gerade als Anziehungspunkt für Touristen gilt, und die Einheimischen, die zumeist nur kurze Strecken zurückzulegen haben, auf das Stufensteigen verzichten können, sind die Plätze oben nur spärlich besetzt. Wie ein Kinosaal während einer Vormittagsvorstellung, fällt dem jungen Mann ein, und er steuert mit seinem Bündel einen Platz ganz vorne am Panoramafenster an.
Von hier aus lässt sich fast der gesamte Verlauf der Straße, die der Bus entlangfährt, einsehen. Es ist, als werde man als Fahrgast bereits im Voraus darüber informiert, was alles auf den Busfahrer zukommt. Statt der Auslagen der Geschäfte und der Eingangsbereiche der Häuser sieht man die oberhalb der Läden angebrachte Reklame und dazwischen immer wieder Fenster.
Der junge Mann hat sich nicht gemerkt, an welcher Station er den Bus wieder verlassen muss. Als er den Reißverschluss an seiner Jacke öffnet, um die Liste, die seine Gastgeberin für ihn angefertigt hat, herauszuholen, springt der schräg hinter ihm sitzende Fahrgast plötzlich auf und richtet in höchster Aufregung ein paar Worte an ihn. Der junge Mann versteht kein einziges davon, ihnen allen liegt jedoch die gleiche, mehr oder weniger unmissverständliche Empörung zugrunde.
Zunächst hat der junge Mann nicht die leiseste Ahnung, was er angestellt haben könnte, dann fällt sein Blick auf den Plastiksack mit dem Tintenfisch, den er, seit er am Panoramafenster Position bezogen hat, unter seinem Sitz hin und her hat baumeln lassen. Reflexartig hat er ihn an sich herangezogen, als der Fahrgast aufgesprungen ist und begonnen hat, auf ihn einzudringen. Kein Tintenfischarm, der herausschaut, obwohl das, denkt sich der junge Mann, unter den gegebenen Umständen vielleicht sogar einiges verständlich machen würde. Anscheinend ist der Fahrgast von etwas berührt worden, wobei es sich um den Plastiksack – die harmlosere