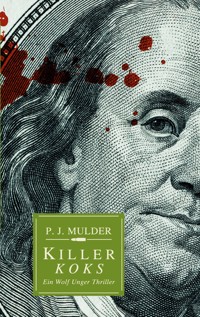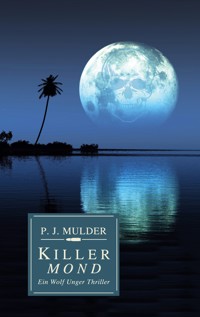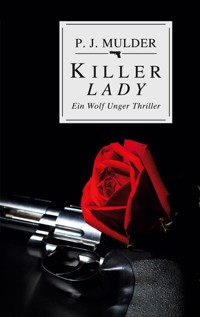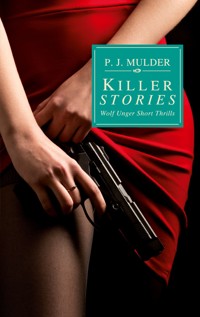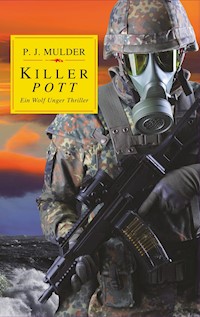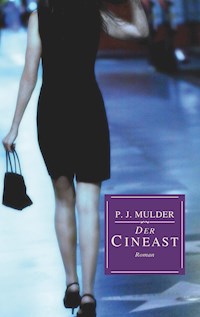
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
DER CINEAST ist die Geschichte eines deutschen "Mad Man", der die glamouröse Werbeszene in amerikanischen Werbeagenturen in Deutschland und New York City erlebt und mitgeprägt hat. Bei seinem Aufstieg vom Art Director, Werbefilmschreiber und Partner einer amerikanischen Werbeagentur zum erfolgreichen Drehbuchautor wird Paul Conrad von skurrilen Typen der Werbeszene, Filmstars, Agenten, Produzenten und der Hollywood-Entourage begleitet. Entwurzelt und maßlos konsumiert er das Leben und die Frauen. Was ihn antreibt, sind Erfolg, Geld und Sex. Neue, überarbeitete Auflage Juli 2019
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1084
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Für Susanne und Nina.
Und für alle Drehbuchautoren.
„Alle Literatur – von Biographien
über Essays bis zu Romanen und
Kurzgeschichten – ist Klatsch.“
Truman Capote
„Frei ab zwölf Jahren heißt,
der Held kriegt das Mädchen.
Frei ab sechzehn heißt,
der Bösewicht kriegt das Mädchen.
Frei ab achtzehn heißt,
jeder Darsteller kriegt das Mädchen.“
Michael Douglas
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Kapitel 72
Kapitel 73
Kapitel 74
Kapitel 75
Kapitel 76
Kapitel 77
Kapitel 78
Kapitel 79
Kapitel 80
Kapitel 81
Kapitel 82
Kapitel 83
Kapitel 84
Kapitel 85
Kapitel 86
Kapitel 88
Kapitel 89
Kapitel 90
Kapitel 91
Kapitel 92
Kapitel 93
Kapitel 94
Kapitel 95
Kapitel 96
Kapitel 97
Kapitel 98
Kapitel 99
Kapitel 100
Kapitel 101
Kapitel 102
Kapitel 103
Kapitel 104
Kapitel 105
Kapitel 106
Kapitel 107
Kapitel 108
Kapitel 109
Kapitel 110
Kapitel 111
Kapitel 112
Kapitel 113
Kapitel 114
Kapitel 115
Kapitel 116
Kapitel 117
Kapitel 118
1
MARIE LUISE
„Ich plane einen Ausbruch! Zuerst müssen wir raus aus dieser Bar, dann raus aus diesem Hotel, raus aus der Stadt und raus aus dem Land! Sind Sie dabei?“ Bill Murray als Bob Harris in „Lost in Translation.“
Saturday night at the movies
Who cares what picture you see
When you‘re hugging with your baby
In last row in the balcony
Barry Mann & Cynthia Weil
An jedem Sonntagmorgen stahl sich Paul Conrad davon, um seinen magischen Ort aufzusuchen. Nirgendwo sonst konnte man Affären mit den schönsten Frauen dieses Planeten haben, Gangster jagen oder Banken plündern, hemmungslos lachen, weinen, bangen und hoffen. Und nirgendwo sonst konnte man Dinge erleben, die für Fünfzehnjährige tabu waren. Jeder braucht einen Ort, einen Schlupfwinkel, wo man träumen, der Realität entfliehen und in Fantasiewelten abtauchen kann. Pauls magischer Ort war das Kino.
Der frühere Besitzer hatte es Roxy genannt, nach dem Roxy Theater in New York, dem elegantesten und größten Kinopalast der Welt. Auch wenn sich Pauls Roxy nicht im Geringsten mit dessen legendärem Namensgeber vergleichen konnte, für ihn war es Zufluchtsstätte, Asyl und Therapie, Fluchtburg und Hort seiner Fantasie. Andere in seinem Alter waren Mitglieder der katholischen Jugend, freiwilligen Feuerwehr, den Pfadfindern oder einem der zahlreichen Gesangs- oder Sportvereine. Paul hatte das Kino, in das er sich wie in eine warme Höhle zurückziehen konnte. Ohne das Roxy hätte Pauls Leben einen anderen Verlauf genommen.
Am einem Freitag dem Dreizehnten, im Volksglauben ein Unglückstag, wurde Paul Conrad in Burgweiler geboren. Burgweiler, eine Kleinstadt in der Pfalz, lag in einem Tal umgeben von roten Felsen und Wald, nicht weit entfernt von der französischen Grenze, die auch Grüne Grenze genannt wurde. Vielleicht weil sie über Wiesen und durch Wälder verlief. Vielleicht auch, weil es bis auf eine kleine Grenzstation keine weiteren Kontrollen gab, was dazu führte, dass nach dem Krieg heftig geschmuggelt wurde. Außerdem bot die nahe Grenze in der Region stationierten GIs die Möglichkeit nach Frankreich zu desertieren. statt in Vietnam vor die Hunde zu gehen.
Burgweiler hatte nicht viel zu bieten. Außer Veranstaltungen der Vereine, im Sommer im Wald, im Winter in Wirtshäusern, dem sonntäglichen Messebesuch in der katholischen Pfarrkirche, den die Burgweiler zum Sehen und Gesehen werden nutzten, und gelegentlichen Kneipenschlägereien, war nicht viel los.
„Die Leute in unserer Region haben vieles gemeinsam mit den Iren“, sagte Pauls Vater. „Sie singen gerne, sie saufen und raufen und sie sind katholisch.“
Für Männer gab es zwei Möglichkeiten, die Stadt zu verlassen. Diejenigen, die das Gymnasium in der benachbarten Kreisstadt besucht hatten, konnten Missionare werden und nach Afrika gehen. Die anderen liefen zu Fuß die paar Kilometer bis zur französischen Grenze und meldeten sich beim Rekrutierungsbüro der Fremdenlegion.
Für Frauen sah es schlechter aus.
Sie konnten Männer aus den Nachbardörfern heiraten und wegziehen. Oder sie wurden Nonnen und gingen nach Afrika.
Blieb noch das Kino, das während der Woche geschlossen und an Wochenenden immer ausverkauft war, egal welches Programm gezeigt wurde. Manche Filme erregten dermaßen die Gemüter, dass im Stadtrat hitzige Debatten geführt wurden, der Pfarrer von der Kanzel wetterte und gemeinsam mit einer der Kirche nahestehenden Partei, die bei Wahlen in schöner Regelmäßigkeit die absolute Mehrheit gewann, zum Boykott aufrief.
So wie damals, als Hildegard Knef in Die Sünderin für einen winzigen Moment ihre Titten zeigt. Die Reaktionen auf den Film zeigte die Doppelmoral der fünfziger Jahre. Der vom Kölner Kardinal Joseph Frings ausgelöste Veitstanz bei Priestern und Politikern war eine amüsante Abwechslung in der sonst eher tristen Adenauer-Ära.
Durchgeknallte Priester und selbsternannte Sittenwächter warfen Stinkbomben in Kinos und moralinsaure Politiker verteilten Flugblätter mit Texten wie Die Sünderin – ein Faustschlag ins Gesicht jeder anständigen deutschen Frau! Aufführungsverbote und öffentliche Verurteilung von den Kanzeln verhalfen dem Film zum größten Publikumserfolg der Nachkriegszeit.
„Goebbels wäre neidisch gewesen“, sagte Pauls Vater. „Eine bessere Propaganda hätte auch der nicht hingekriegt.“
Die Filme im Roxy beeinflussten Sexualverhalten, Weltanschauung und Bildungsniveau der Burgweiler.
Das Kino befand sich im zweiten Stock des Wirtshauses Zum Ochsen, einem Lokal, in dem gut gekocht, viel gegessen und noch mehr getrunken wurde. Kino und Gasthaus gehörten Herrn Tretter, den auch die engsten Freunde zwar mit du, aber Herr und Tretter anredeten. Das Roxy hatte den Krieg überlebt, doch sein Glanz war verblasst, der rote Plüsch verschlissen, die Lüster voller Staub und Fliegendreck. Obwohl es nach muffigen Körpern müffelte und man den Duft der Pissrinne bis in die letzte Reihe roch, hätte Paul mit keinem anderen Ort auf der Welt getauscht. Manchmal lief Dorte, Herrn Tretters Tochter, mit einer großen Sprayflasche durch die Sitzreihen. Dann duftete es nach Fichtennadeln, wie in den Badezimmern am Samstag, dem traditionellen Waschtag der Burgweiler.
Im Parterre, mit ungefähr hundert Plätzen, zahlte man für alle Sitze, egal ob in der ersten oder letzten Reihe, den Einheitspreis von fünfundfünfzig Pfennigen. Die Sitze hatten keine Nummern und das allgemeine Prinzip, wer zuerst kommt, mahlt zuerst, fand im Roxy keine Anwendung. Man stritt um die Plätze und manchmal flogen auch Fäuste. Gleich neben dem Eingang befanden sich die sogenannten Sperrsitze, sechs erhöhte, nummerierte und gepolsterte Sitzreihen. Von hier konnte man über die Köpfe derjenigen blicken, die auf den billigen Plätzen saßen. Die Halbstarken von Burgweiler bevorzugten den Balkonbereich, auch Fundbüro genannt, weil nach Vorstellungen ab und zu Schlüpfer, Büstenhalter oder Schlimmeres gefunden wurde.
Als diese skandalösen Zustände dem Pfarrer zu Ohren kamen, versuchte dieser, ein paar seiner Gläubigen als Sittenwächter einzuschleusen, ein Vorhaben, das gründlich misslang. Hatte Herr Tretter bisher geduldet, Mitglieder der katholischen Jugend, Spitzel Gottes genannt, das Alter der jugendlichen Kinobesucher überprüfen zu lassen – was in einer Kleinstadt, wo jeder jeden kannte, nicht schwierig war – verweigerte er diesmal strikt jegliche Kollaboration.
Vor Beginn der Vorstellung ging es im Roxy schlimmer zu als zur Stoßzeit im Ochsen. Drängelten sich Nachzügler durch die Reihen, erhob man sich widerwillig und unter Fluchen von den Sitzen. Kleinstadt-Tussis, die im Ruf standen, einer Fummelei im Dunklen nicht abgeneigt zu sein, wurden mit Pfiffen und Johlen begrüßt. Es wurde geschubst, gestoßen, geflucht, gebrüllt und gelacht. Gab es, was häufig der Fall war, Probleme mit dem Filmprojektor und Unruhe machte sich breit, stimmte jemand ein Lied an und schließlich sangen alle begeistert mit. Nicht umsonst hatte Burgweiler mehr Gesangvereine aufzuweisen, als die dreimal größere Kreisstadt.
Im Matinée-Programm am Sonntagmorgen wurden Filme vom Vorabend gezeigt, von der FSK nicht unter sechzehn, die meisten sogar erst ab achtzehn freigegeben. Vor dem Hauptfilm lief die Wochenschau, die man gespannt und aufmerksam verfolgte – nur wenige Burgweiler hatten einen Fernseher zu Hause – gefolgt von Propagandafilmen des United States Information Service, die über die amerikanische Politik im In– und Ausland informierten, natürlich aus Sicht der US-Regierung. Danach liefen Streifen mit Buster Keaton, Dick und Doof oder Abbott & Costello – bei denen sich das Publikum vor Lachen kugelte – oder Western mit Zorro oder Tom Mix, die in Burgweiler Cowboyfilme genannt wurden.
„Zorro, pass auf!“, wurde gebrüllt, wenn sich Gefahr abzeichnete oder man forderte die Darsteller gellend zu Mord und Todschlag an ihren Gegnern auf.
Paul liebte die Streifen mit Tarzan. Er wünschte sich, wie Johnny Weissmüller an einer Liane durch den Dschungel zu schwingen, und rätselte, ob Tiere miteinander in einer Geheimsprache kommunizieren, sich womöglich über die Menschen lustig machten. „Ich Tarzan, du Jane“, brachte er bei jeder sich bietenden Gelegenheit an den Mann.
In der Pause vor dem Hauptfilm wurde es wieder laut im Saal. Plätze wurden getauscht, vor der Toilette bildete sich eine Schlange und einige rannten noch schnell zur Kasse, um Pfefferminzbonbons oder Kaugummi zu kaufen.
Die Spitzel Gottes mussten bereits vor der Wochenschau die Kontrolle beenden und das Kino verlassen, schließlich sollten sie für ihre Spitzeldienste nicht auch noch mit einem kostenlosen Kinobesuch belohnt werden. Dorte geleitete die Spitzel die Treppe runter und verschloss die Tür, die erst nach Filmende wieder geöffnet wurde. Niemand kam mehr rein oder raus.
Außer Paul. Vom Treppenaufgang führte eine Tür ins Wirtshaus. Zu dieser Tür hatte allerdings nur Herr Tretter den Schlüssel. Mit seiner gallischen Nase und den weißen Haaren ähnelte er Jean Gabin. Paul hatte ihn noch nie ohne die weiße Garçon-Schürze gesehen, in der Hand ein gefülltes Weinglas.
Der Ochsen war Stammlokal des Gesangvereins Kurpfalz, in dem Fritz Conrad, Pauls Vater, ein wichtiges Mitglied war. Der Verein hatte das schöne Motto Dem Guten, Wahren, Schönen, soll unser Lied ertönen. Die Kurpfälzer, wie man die Sänger nannte, trafen sich zweimal wochentags zum Singen und Saufen und sonntags zum Saufen und Singen.
Zum sonntäglichen Frühschoppen erschien Fritz Conrad stets perfekt gestylt. Aus der Brusttasche seines grauen Nadelstreifenanzugs schaute ein weißes Einstecktuch, das Haar sorgfältig gekämmt, nach Pitralon und Birkenhaarwasser duftend, marschierte er mit Paul im Gefolge in den Ochsen, so als würde das Lokal ihm gehören.
Im Hauptraum stand der große, runde Stammtisch, der für Pauls Vater und seine Freunde, wichtige Kurpfälzer und die üblichen Honoratioren der Kleinstadt, reserviert war. Zu diesem erlauchten Kreis ehrbarer Bürger zählte auch Gustav Kolb, Fritz’ jüngerer Vetter. Gustav hatte vor einigen Jahren seine Firma, eine Fabrik für Damenschuhe, spektakulär an die Wand gefahren, nachdem ihn seine Frau ausgeplündert und verlassen hatte. Fritz war Eigentümer der Schuhmanufaktur Conrad & Sohn, die Pauls verstorbener Opa vor dem Zweiten Weltkrieg gegründet hatte. Die Fabrik produzierte hauptsächlich traditionelle, derbe und rahmengenähte Schuhe. In den guten Zeiten, vor dem Niedergang der Schuhindustrie, hatten in der Fabrik über zweihundert Menschen gearbeitet. Einer österreichischen Trachtenfirma war zu verdanken, dass das Geschäft wieder einigermaßen florierte. Die Österreicher beauftragten Fritz mit der Produktion der Kollektionen und verkauften die Schuhe unter eigenem Namen in den Alpenländern zum dreifachen Preis. Seit dem Bankrott seines Betriebes arbeitete Gustav für Pauls Vater, der die marode Firma aufgekauft hatte. Gustavs Ähnlichkeit mit Vetter und Neffe war unverkennbar: Das gleiche kurzgelockte Haar, die markante Nase, das Grübchen im Kinn, eine Art genetischer Fingerabdruck der Conrads. Sogar Gustavs Nichte Traudel, die in letzter Zeit in Begleitung ihres Onkels am Stammtisch aufkreuzte, zierte die kleine Mulde. Seit ihre Eltern geschieden waren, verbrachte sie die Sonntage bei ihrem Onkel, der die Rolle des Ersatzvaters übernommen hatte. Traudel, ein Jahr älter als Paul, wurde zur Feier ihres sechzehnten Geburtstages von ihrer Mutter, einer Gynäkologin, vollends in die Geheimnisse des weiblichen Körpers eingeweiht.
„Jemand muss einen Mann aus dir machen“, sagte Traudel zu Paul, ließ ihn ihren Körper erkunden und brachte ihm Petting bei.
Das Läuten der Glocken war das Signal, auf das Paul gewartet hatte. Im Kino über der Gaststube begann die Filmvorstellung, zeitgleich mit der Messe.
„Wenn die Kirchenglocken läuten, gehen die Atheisten von Burgweiler statt in die Kirche ins Kino“, hatte Fritz mal gesagt.
Schon mehrmals hatte der Pfarrer vergeblich versucht, eine Verschiebung der Vorstellung zu erreichen. Doch Herr Tretter blieb hart und sagte, es müsse auch einen Platz für die Gottlosen geben.
Paul blickte zu Traudel, kniff ein Auge zu und stieß seinen Vater an. Die Erlaubnis fürs Kino erschwindelte er sich mit der listigen Methode, nicht den Originaltitel, sondern eine vage Umschreibung zu nennen. Allerdings in einer Version für Fünfzehnjährige.
„Heute läuft ein Familienfilm“, beschrieb er fast wahrheitsgemäß ... denn sie wissen nicht, was sie tun mit James Dean und Natalie Wood, von der FSK ab sechzehn freigegeben. Danach beschäftigte die wunderschöne Natalie Wood seine erotischen Fantasien.
Fritz, den weder Filme noch das Programm im Roxy interessierten, fragte meist nebenbei, ob der Film für Jugendliche geeignet sei. Obwohl Paul wusste, dass die Frage eher rhetorisch gemeint war, antwortete er dennoch entrüstet: „Ja, frag Herrn Tretter.“ Natürlich würde Fritz nicht fragen. Außerdem war es Herrn Tretter völlig egal, welche Freigabe seine Filme hatten. Mit dem Okay seines Vaters ging er mit Traudel an den Tresen und fragte nach dem Schlüssel.
„Geht hoch“, sagte Tretter und nahm den Schlüssel vom Haken. „Sagt Dorte, dass sie euch reinlassen soll.“
Paul öffnete den Notausgang einen Spalt breit, wartete, bis die Spitzel Gottes durch den Haupteingang verschwunden waren und Dorte hinter ihnen abgeschlossen hatte.
„He, Paul“, sagte Dorte und winkte ihm zu. „Sperrsitz oder Fundbüro?“
Pauls Einfallsreichtum im Erfinden von Umschreibungen für Filme nahm manchmal skurrile Formen an. So betitelte er Pal Joey als Operette. In dem Musical, immerhin die amerikanische Form der Operette, spielt Frank Sinatra den Nachtclubsänger Joey, der sich zwischen zwei Frauen entscheiden muss. Kim Novak, blond, üppig und sexy, sticht ihre Rivalin aus und erobert Joey.
„Sie trägt ein unglaublich knappes Korsett“, sagte Paul hinterher zu seinen Freunden. „So eng, dass ihr fast die Möpse aus dem Ausschnitt hüpfen.“
Er kaufte sich die Single mit The Lady Is a Tramp und Bewitched, hörte Sinatra und sehnte sich Kim Novak herbei.
Als Abenteuerfilm bezeichnete er Gilda mit Rita Hayworth in der Rolle einer verführerischen, provozierenden Femme fatale. Die Szene, in der sie Put the Blame on Mame singt und dabei mit lasziven Bewegungen die ellenbogenlangen Handschuhe von den Armen streift, ließ Paul gebannt auf die Leinwand starren und bescherte ihm eine massive Erektion. Rita Hayworth war die Verführung par excellence und verdrängte Kim Novak aus seinen Fantasien.
Aus Alfred Hitchcocks Über den Dächern von Nizza machte er eine Gaunerkomödie. Grace Kelly spielt die kühle Blondine, die mit eisblauem Blick und leicht geöffnetem Mund, in einem Spiel aus Eleganz und verruchter Leidenschaft, Cary Grant zur Strecke bringt.
Grace Kelly wurde von Lana Turner abgelöst, die er in Die Rechnung ohne den Wirt bewunderte. Den Film noir-Klassiker verkaufte er seinem Vater unter dem Titel Die Drei von der Tankstelle als Komödie. Lana Turner spielt die Rolle der Cora, die frustrierte Frau eines alten Säufers. Durch ein raffiniertes Spiel aus Hingabe und Zurückweisung bringt sie ihren Liebhaber dazu, einen Mord zu begehen.
„Sie sündigt und mordet“, sagte Paul. „Sie ist gefährlicher als eine Klapperschlange und schärfer als Rettich.“
Billy Wilders Manche mögen’s heiß funktionierte er in einen Schlagerfilm um. Als Ukulele spielende Sängerin Sugar ist Marilyn Monroe das Naivchen im Körper einer Sexbombe. Sie singt I Wanna Be Loved by You und Paul stellten sich die Härchen an den Armen auf.
„In der Yachtszene mit Tony Curtis“, sagte er, „kannst du deutlich ihre Titten sehen.“
Wurden Breitwandküsse abrupt durch einen Schnitt beendet oder Bettszenen ausgeblendet, übernahm seine Fantasie die Regie und zeigte ihm die Dinge, die man auf der Leinwand nicht zu sehen bekam.
Dann liefen im Roxy an aufeinander folgenden Wochenenden zwei Filme mit Ava Gardner. In Geheimaktion Carlotta ist sie die heißblütige Barsängerin Elizabeth Hilton, in Rächer der Unterwelt spielt sie sinnlich-süffisant die Gangsterbraut Kitty Collins.
Beide Filme markierten einen Wendepunkt in Pauls Leben. Ava Gardner wurde zu seiner Obsession. Ihre dunkle, erotische Ausstrahlung ließ ihn ahnen, dass solche Frauen gefährlich waren und Männer in den Wahnsinn treiben konnten. In Magazinen wie Stern oder Quick las er alles über Gardners Affären mit Toreros und Filmpartnern, ihre exzentrischen Ausschweifungen und selbstzerstörerischen Alkoholexzesse, ihre turbulenten Ehen mit Mickey Rooney, Artie Shaw und Frank Sinatra.
Pauls System funktionierte bis zu jenem Sonntag, als ihm kein Titel einfallen wollte und er, inzwischen auch leichtsinnig geworden, einen Film umständlich so beschrieb: „Na ja, das ist ein Film über ein einsames Hotel, wo gruselige Dinge passieren.“
Worauf sein Vater, der niemals zuvor nach dem Titel eines Films gefragt hatte, ihn merkwürdig anblickte und fragte: „Wie heißt der Film?“
„Psycho“, hörte Paul sich sagen.
Seine Eltern hatten sich Hitchcocks Film am Vorabend angesehen und seine Mutter hatte sich noch immer nicht davon erholt.
2
Pauls Elternhaus, ein dreistöckiges Gebäude am Waldrand, vor dem Krieg aus roten Sandsteinquadern aus den Steinbrüchen der Umgebung gebaut, stand einsam und klotzig am Ende einer asphaltierten Zufahrtstrasse. Seine Eltern bewohnten das Erdgeschoss, im ersten Stock befanden sich Büros, Archivräume mit Schuhmodellen und die große Bibliothek. Im Stockwerk darüber hatten früher Pauls Großeltern gewohnt. Das Haus verfügte über vierzehn Zimmer, auf jeder Etage ein Bad.
„Die Conrads haben das erste Haus in diesem Kaff gebaut, in dem man zum samstäglichen Baden nicht mehr gemeinsam in den Wäschezuber steigen musste“, sagte Martha, Pauls Mutter. Martha hatte das Inferno der Bombardierung Kaiserslauterns überlebt und litt seitdem an einer rätselhaften Krankheit. Wenn es ihr schlecht ging, verschwand sie tagelang in ihren abgedunkelten Zimmern. Manchmal rief sie Paul zu sich und drückte ihn wortlos an ihre nassen Wangen. Wenn er fragte: „Mama, warum weinst du“, dann antwortete sie: „Mir ist etwas ins Auge geflogen.“
„Daran ist der scheiß Krieg schuld“, sagte sein Vater dann bitter, „im Krieg sind grauenvolle Dinge passiert, Dinge, über die man nicht reden kann.“
An guten Tagen war Martha wie ausgewechselt. Sie hörte Radio und trällerte die Schlager mit: Rote Rosen, rote Lippen, roter Wein von René Carol oder Lys Assias Arrivederci Roma. Sie machte sich hübsch, nahm Paul an der Hand und erledigte Einkäufe. Danach verschwand sie in der Küche und bald darauf verbreiteten sich wunderbare Düfte im ganzen Haus. Kam Pauls Vater von der Arbeit, eilte sie ihm entgegen und nahm ihn in die Arme. Der Tisch war gedeckt, Kerzen brannten und sie servierte aufgeregt das Essen. Hatte sie keine Lust zu kochen, holte sie ihren Mann von der Fabrik ab und bummelte mit ihm durch die Stadt. Sie verbrachten den Abend im Ochsen oder fuhren in Fritz’ Mercedes zum Essen nach Kaiserslautern.
Auf die Frage seiner Eltern, was er sich zum sechzehnten Geburtstag wünsche, antwortete Paul: „In den ersten Stock hochziehen.“
„Um Himmels Willen, was willst du da oben so ganz alleine?“, fragte seine Mutter, zu etwas Unsichtbarem über der Decke gestikulierend.
„Wir haben soviel ungenutzten Platz im Haus, ich könnte in Opas ehemaliges Büro umziehen.“
Für seine Mutter war ein Umzug in ein anderes Stockwerk fast so schlimm wie ein Auszug aus dem Haus.
„Fritz, sag was“, sagte sie und blickte zu ihrem Mann.
Fritz räusperte sich. „Also Martha, ich meine, Paul ist alt genug. Vielleicht ist die Idee gar nicht so schlecht“, sagte er vorsichtig. „Wir hätten unser Bad für uns, wenn er nachts mal wieder auf dem Klo sitzt und liest.“
„Mmh.“ Martha sah den Vorteil, war aber noch nicht überzeugt. „Da oben wohnt niemand. Da ist es unheimlich.“
„Es tut dem Haus gut, wenn die Etage bewohnt ist“, sagte Fritz sachlich. „Wir sollten das machen.“
Martha unternahm einen letzten Versuch: „Paul bräuchte neue Möbel. Er kann doch unmöglich mit diesen Artefakten leben.“
„Artefakte?“, fragte Paul.
„Alter Trödel.“
„Spitze. Ich mag Artefakte.“
„Hilfe, mein Sohn wird erwachsen“, seufzte Martha und gab auf.
Nachdem Paul seine Sachen in den ersten Stock geschafft hatte und alles so war, wie er sich das vorgestellt hatte, feierte er die Einweihung mit seinen Freunden Stubbi und Gackes. Niemand wusste, woher diese Spitznamen kamen. Sie gingen vom Großvater auf den Vater und von diesem wieder auf den Sohn über. Von allen Leuten, auch von den Lehrern, wurden sie nur mit ihren Spitznamen angeredet. Paul war nicht sicher, ob seine Freunde noch ihre eigenen Vornamen kannten.
„Vielleicht gehen diese bescheuerten Namen zurück bis auf die Kelten vom Stamm der Mediomatriker, die hier zu Urzeiten von den Bäumen geschissen haben“, hatte Fritz gemeint.
Mit einer großtuerischen Geste zeigte Paul rundum. „Okay, Herrschaften. Mein Zimmer, meine Möbel und dort geht’s zum Schlafzimmer.“
Stubbi und Gackes blickten sich um. Magazinseiten und Fotos von Pauls Idolen an den Wänden, darunter Elvis Presley, Ricky Nelson, Ava Gardner und das Filmposter mit James Dean in Giganten, das er Tretter abgeschwatzt hatte, Couch und Sessel sowie Schreibtisch und Drehstuhl.
Stubbi ließ sich auf die abgewetzte Ledercouch fallen.
Gackes zeigte auf den Siemens-Plattenkoffer, der wie eine Kloschüssel mit aufgeklapptem Deckel auf dem Schreibtisch thronte. „Das hat nicht jeder“, spottete er. „Ein Klo auf dem Schreibtisch.“
„Gackes, alte Napfsülze“, sagte Paul und zeigte lässig zur Tür. „Da du gerade davon sprichst. Gegenüber hab ich mein eigenes Bad.“
„Geiler Stilmix“, sagte Stubbi, bot eine Runde Zigaretten an und ließ sein Zippo klacken.
Paul suchte einen Aschenbecher, schließlich nahm er eine leere Cola-Flasche.
„Ich meine“, fuhr Stubbi fort, „vergleichsweise ist das ziemlich out.“
„Out ist in“, erklärte Paul und streift die Asche in die Flasche.
„In ist nicht mehr in?“, fragte Gackes.
„Nein, in ist out. Out ist in. Ganz einfach.“
„Ich flippe aus“, heulte Gackes.
„He, leg mal Elvis auf“, verlangte Stubbi.
Paul fingerte Elvis Is Back! aus seinem Plattenstapel, das erste Album nach Presleys Entlassung aus der Army. Das Gespräch drehte sich jetzt um Elvis’ Liebesabenteuer in Bad Nauheim und seine angebliche Affäre mit der erst fünfzehnjährigen Priscilla Beaulieu. Endlich war man bei dem Thema angelangt, das alle erhitzte: Mädchen.
Stubbi fummelte mit Amy rum, der sechzehnjährigen Tochter eines Captains der US-Army. Beim Küssen hatte er sich mit der Zunge vorgetastet und war ziemlich geschockt, als sie routiniert daran saugte. Amy steckte ihm die Zunge in den Mund und dann ins Ohr. Dabei bekam er einen Orgasmus, ohne dass sie seinen Schwanz berührte. Er steckte ihr den Finger in die Muschi und hinterher hatten beide nasse Unterhosen.
„Iiih! Mit der Zunge küssen“, sagt Gackes angewidert. „Das ist so – krank.“ Stubbi starrte ihn an. „Ein Zungenkuss ist krank?“ – „Da werden Millionen von Bazillen übertragen.“
„Fick dich ins Knie“, knurrte Stubbi.
„Du kriegst die Krätze“, sagte Gackes. „Du steckst uns alle an.“
„Gackes, alte Flachpfeife“, sagte Paul. „Bist du allergisch gegen Sex?“
„Wen nennst du hier Flachpfeife“, fauchte Gackes. „Ich finde doch nur, du kannst dir alles Mögliche holen.“
„Drauf geschissen“, blaffte Stubbi.
Gackes schrie: „Guck dir die kleinen roten Pünktchen auf deinen Armen an! Glaubst du wirklich, das sind Mückenstiche?“
Im Tausch gegen Pauls Zippo-Feuerzeug hatte Stubbi ein getragenes Höschen seiner Schwester Marie Luise besorgt. Paul legte sich den Slip übers Gesicht, sog den Duft ein und hatte den besten imaginären Sex seines Lebens.
Worauf Stubbi gesagt hatte: „Das ist nicht normal, Alter. Du wichst mehr als jeder andere auf diesem Planeten. Wenn du es tust, denkst du dabei an meine Schwester?“
„Nicht immer“, hatte Paul erwidert.
Marie Luise, rotblondes Haar, edle Nase und Augen, deren Farbe je nach Lichteinfall von graublau zu intensivblau wechselte, war sich ihrer Wirkung auf Paul mit einer spöttischen Überheblichkeit bewusst. Sie arbeitete bei den United States Air Forces auf der Ramstein Air Base, lernte Englisch in Abendkursen und poussierte, wie man in Burgweiler sagte, mit einem Ami namens George. In einem Teenagermagazin hatte Paul eine Abbildung von Sandra Dee in Pin-up-Pose entdeckt – Hände auf den Hüften, gepunkteter Bikini, den Blondschopf keck im Nacken, halboffener Mund und feuchte Lippen. So stellte er sich Marie Luise in Unterwäsche vor.
Schließlich unternahm Paul den Versuch, dem Gespräch eine andere Richtung zu geben. „Ich weiß nicht, was mein Vater im Krieg gemacht hat“, sagte er jäh und spuckte Tabakkrümel. „Er redet nicht darüber.“
Stubbi starrte auf seine Füße.
Gackes ruckte unbehaglich mit dem Stuhl.
„Ich dachte ... äh ...“, Paul zögerte. Dann sagte er: „Ich dachte, ich könnte von euch etwas erfahren.“
Stubbi hob den Kopf, räusperte sich und sagte leise: „Mein Alter wurde in einem Bunker in der Normandie verschüttet.“
Sein Vater kam querschnittsgelähmt aus dem Krieg zurück und saß im Rollstuhl. Er bekam eine kleine Rente und litt unter Depressionen. Soldaten der US-Armee hatten ihn mehr tot als lebendig ausgegraben. Er hatte mal gesagt, es wäre besser gewesen, man hätte ihn liegen lassen.
„Manchmal bin ich nachts von seinem Geschrei wach geworden“, sagte Stubbi. „Er brüllte, man solle ihm ein Gewehr geben, damit er endlich Schluss machen kann.“
Gackes Vater hatte es in der Wehrmacht zum Hauptmann gebracht. Seine Mutter hatte sich mehr in die Uniform verguckt, als in den Mann, der darin steckte. Heute arbeitete er bei der Stadtverwaltung. Gackes Mutter fuhr in die Kreisstadt, trieb sich in Ami-Kneipen rum und trank. Paul hatte sie einmal am Arm eines US- Offiziers aus einer Bar torkeln sehen.
Ohne Uniform, zum gewöhnlichen Zivilisten degradiert, schwang Gackes Vater im Ochsen reaktionäre Reden, schwatzte davon, dass er nicht die Chancen der Jugend von heute gehabt hätte, dass er mit siebzehn zum Arbeitsdienst zwangsverpflichtet wurde und schuften musste wie ein Maulesel. Danach hätte man ihm eine Knarre in die Hand gedrückt und plötzlich sei er Soldat gewesen.
„Er kämpfte für sein Vaterland mit der Waffe in der Hand“, sagte Gackes. „Sonst hätte man ihn an die Wand gestellt und erschossen. Das Gerede über die Vergangenheit kotzt ihn an. Er sagt, er hätte nur seine Pflicht getan.“
„Ich habe meinen Vater gefragt, ob er Soldaten erschossen hat“, meinte Stubbi. „Er sagte, nur wenn auf mich geschossen wurde, ansonsten habe ich extra danebengeschossen.“
Paul schüttelte den Kopf. „Gustav sagt, wenn alle vorbeigeschossen haben, wo kommen dann die Millionen Toten her?“
„Gustav hatte großes Glück, dass sie ihn nicht bei Nacht und Nebel abgeholt und einen Kopf kürzer gemacht haben“, ereiferte sich Gackes. „Der hat immer die Klappe aufgerissen und wenn dein Opa nicht mit dem Nazi-Leininger so gut gekonnt hätte, wär’s mit Gustav aus gewesen. Dein Opa hat den Leininger geschmiert. Was glaubst du, woher die Kohle für seine Villa kommt? Die Großen erwischt es nie, mein Vater hat den Kopf hingehalten und wurde danach wie ein Schwerverbrecher behandelt. Leute wie der Leininger sind sofort wieder auf die Füße gefallen.“
„Sagt wer“, fragte Paul.
„Mein Vater.“
„Das sagt meine Mutter auch“, stimmte Stubbi zu. „Der Adenauer hat die alten Naziratten wieder um sich versammelt, die kamen aus ihren Löchern und machten grad so weiter. Sie sagt, in diesem Land muss mal jemand die Fenster aufmachen und kräftig durchlüften.“
3
Wer in Burgweiler Glück hatte, arbeitete wie Marie Luise bei den US-Streitkräften, wichtigster Wirtschaftsfaktor und größter Arbeitgeber in der Region, oder hatte einen GI zum Freund, der die Familie mit unter der Hand beschaffter Marketenderware aus PX-Läden versorgen konnte. Im nahen Landstuhl befand sich das größte amerikanische Krankenhaus, in Kaiserslautern, auch K-Town genannt, die Vogelweh Housing Area, wo sogar die Straßennamen amerikanisch waren, mit Schulen, Kliniken, Kinos, Clubs und Kirchen. Hier lebten über zehntausend GIs mit ihren Familien in der größten amerikanischen Siedlung außerhalb der Vereinigten Staaten. Soldaten und Straßenkreuzer gehörten zum normalen Stadtbild. Jukeboxen in Bars und Kneipen wurden mit den neuesten Hits der amerikanischen Charts bestückt, viele Speisekarten waren zweisprachig und der Dollar als Zahlungsmittel akzeptiert. Junge Frauen träumten davon, einen GI zu heiraten, hofften auf eine bessere Zukunft in den USA. Die Soldaten brachten den American Way of Life nach Burgweiler.
Um Kindern aus bitterarmen Flüchtlingsfamilien mit einer Weihnachtsfeier eine Freude zu bereiten, hatte eine Einheit der US-Armee den großen Saal, wo sonst Maskenbälle der Burgweiler Karnevalsvereine, Laientheater oder Auftritte der Männerchöre stattfanden, im Gebäude des Ochsen gemietet. In der Schule wurden Namenslisten der Kinder ohne Väter, die gefallen oder als vermisst gemeldet waren, angelegt. Kinder, die mit ihren Müttern am Rande der Stadt unter menschenunwürdigen Verhältnissen in ausrangierten Waggons der Reichsbahn hausten.
Am ersten Weihnachtsfeiertag neunzehnhundertzweiundfünfzig bummelte Paul um die Mittagszeit zum Ochsen. Im Eingang lehnte ein baumlanger GI. Durch einen Türspalt drang Weihnachtsmusik. Paul wollte schnell vorüber gehen, doch der Soldat trat auf die Straße, packte ihn am Arm und schob ihn durch die Tür.
So kam der damals siebenjährige Paul zum ersten Mal mit einer Facette des American Way of Life in Berührung.
Der überfüllte Saal war knallbunt dekoriert. Unter einem riesigen Weihnachtsbaum bogen sich Tische, beladen mit Spielzeug und Süßigkeiten. Ein Weihnachtsmann, der wie die fröhliche Version von Knecht Ruprecht wirkte, forderte Paul durch Gesten und Worte auf, sich aus Bergen von Geschenken etwas auszusuchen, bot ihm Spielzeugpistolen, Panzer, die Funken spuckten, Jeeps, Schlachtschiffe oder Flugzeuge an. Aus einem Stapel mit Kleidungsstücken kramte er Jeans und T-Shirts hervor und setzte ihm eine Baseball Cap auf. Paul schüttelte den Kopf und hob abwehrend die Hände. Ratlos schleppte Santa Claus ihn durch das Kindergewimmel zur Essensausgabe, wo Kompaniekoch und Helfer Hackbraten und Kartoffelbrei austeilten. Man hielt ihm einen dampfenden Teller unter die Nase, öffnete eine Flasche Coca Cola und füllte einen riesigen Pappbecher mit heißem Kakao mit Marshmallows. Paul bewegte sich wie betäubt durch die Menge. Er hörte seinen Namen und sah einen Klassenkameraden auf den Knien eines Soldaten, in einer Hand einen Plastik-Superman, in der anderen ein Stück Kuchen. Er schaute in die strahlenden Augen und das glückliche Gesicht des Jungen, stolperte aus dem Ochsen und lief so schnell er konnte nach Hause.
4
Hätte man Paul gefragt, ob er in Stubbis Schwester verliebt sei, hätte er mit der Antwort gezögert. Tatsache war: Er hatte starkes sexuelles Interesse an Marie Luise. Die Vorstellung, was sie mit ihrem Freund im Bett trieb, erregte und deprimierte ihn zugleich. Ihr Freund George, Master Sergeant im 6th Infantry Regiment der US-Armee in Baumholder, hatte im Koreakrieg gekämpft, wo er zweimal verwundet wurde. Wenn er keinen Dienst hatte, trug er scharfe Zivilklamotten: lässige Sakkos, Button-Down-Hemden, Khaki-Chinos und Penny Loafer. George sah aus wie ein Filmstar, hatte Geld wie Heu und ging großzügig damit um. Paul kopierte seinen Kleidungsstil, seine Frisur und die schleppende Art zu sprechen. Aus dem PX-Laden, den Paul sich als eine Art Konsumparadies vorstellte, brachte George T-Bone-Steaks, Corned Beef, Bourbon, Schokolade, Zigaretten, Coca Cola, Comics und Kaugummi mit oder besorgte Schallplatten, Kleidung und Schuhe. Meistens weigerte er sich, Geld anzunehmen, oder nannte einen geringeren Betrag.
Bei den wenigen Gelegenheiten, bei denen er Marie Luise zu Hause abholte, nahm der Vater kaum Notiz von ihm und die Mutter schaute verlegen zur Seite. Für den Vater war George der Ami, der ihm Old Forester Bourbon und Viceroy Zigaretten mitbrachte. Für die Mutter war er ein Besatzungssoldat, der ihre Tochter fickte.
Als Stubbis Eltern zu einer Kur auf einer Nordseeinsel weilten und er einmal früher als erwartet nach Hause kam, hörte er in Marie Luises Zimmer die quietschende Matratze und Sexgeräusche. Er zeigte der verschlossenen Tür den ausgestreckten Mittelfinger und sagte leise: „Fuck you, Ami! Fuck you!“
Erregt und mit nassen Augen verließ er das Haus.
5
Anfang neunzehnhunderteinundsechzig wurden die Matinée-Vorstellungen im Roxy eingestellt und das Filmprogramm für Erwachsene auf den Nachmittag verlegt. Auch wachten die Spitzel Gottes nicht mehr über Moral und Sitte, nachdem man einige ordentlich vermöbelt hatte und scheinbar niemand mehr Lust verspürte, für Pfarrer und Kirche den Kopf hinzuhalten.
Die Frühschoppen mit seinem Vater und die Besuche im Kino gehörten der Vergangenheit an, für Paul begann ein neuer Lebensabschnitt. Mit knapp siebzehn war er ein Meter fünfundachtzig groß, hatte braunes Haar, graugrüne Augen und das gute Aussehen der Conrads. Er besuchte die höhere Schule, wie man in Burgweiler das Gymnasium in der Kreisstadt nannte. Paul machte seine Hausaufgaben, schnappte sich danach seine Malutensilien – von seinen Eltern bekam er zu jedem Anlass Zeichenblöcke, Stifte, Wasserfarben und Pinsel geschenkt – verzog sich in seine Bude, legte Platten auf und malte. Oder er holte sich Schmöker aus dem bunt bemalten Bus des Amerika Hauses, einer Einrichtung des United States Information Service, der einmal wöchentlich auf dem Marktplatz parkte und kostenlos Bücher verlieh. Paul speicherte Filme und Romane im Kopf, konnte Inhalte wie auf Knopfdruck nacherzählen, malte oder illustrierte Geschichten, die er las.
Im Grunde jedoch langweilte er sich abgrundtief. In seinem Leben herrschte Stillstand. Daran konnten weder Eltern, Freunde noch sein Umfeld etwas ändern. Immer mehr wurde ihm bewusst, dass er nicht für das Leben in der Kleinstadt geschaffen war.
Er musste fort. Fort, in eine andere Stadt. Eine größere, viel größere Stadt. Wo das Leben pulsierte und ihm der Kleinstadtmief aus den Knochen geblasen wurde. Wo er frei sein würde seinen Neigungen nachzugehen und wo er seine Talente einsetzen konnte. Paul hatte keine konkreten Pläne, aber ihm war glasklar: er musste weg von seinem Zuhause, weg von Eltern und Freunden, raus aus der Stadt. Sonst würde er verrückt werden. Dann, als er einmal eine unfertige Skizze zerknüllte und versuchte, den Papierball im Abfallkorb zu versenken, hatte er die rettende Idee. Sie sprang ihn direkt an.
6
Von dem anstehenden Gespräch mit seinem Vater erhoffte Paul sich eine Wendung seines bisherigen Lebens. Er holte ihn von der Fabrik ab und bummelt mit ihm zum Ochsen. Herr Tretter freute sich über den Besuch und nach dem üblichen: „Mein Gott, was bist du groß geworden“ und „Fritz, du kannst stolz auf deinen Sohn sein, der wird mal den Mädchen die Köpfe verdrehen“, bestellten sie Schweinekoteletts, Salzkartoffel, Erbsen und Möhrchen, das Leibgericht seines Vaters.
Nach dem Essen lehnte Paul sich zurück. „Ich möchte mit dir über meine Zukunft sprechen.“
„Mmh. Ich habe damit gerechnet. Du bist fast erwachsen, deine Mutter und ich haben es kaum bemerkt.“
„Die Fabrik ... “, fing Paul an und wurde von seinem Vater unterbrochen: „Ich weiß, dass du kein Interesse an der Fabrik hast.“ Fritz schnitt mit einem kleinen Klappmesser eine Zigarre an und paffte ein paar Züge. „Ich wäre gerne Pilot geworden, vielleicht bei der Lufthansa. Aber ich musste deinem Opa in der Fabrik zur Hand gehen. Ich wurde immer älter und plötzlich hatte ich keine andere Wahl mehr. Dann kam der Unfall, bei dem deine Großeltern ums Leben kamen und ich hatte die Fabrik endgültig am Hals.“ Fritz machte eine Pause und sagt dann: „Das soll dir nicht passieren.“
Paul suchte Blickkontakt. Hastig sagte er: „Ich möchte Grafiker werden!“
„Was?“
„Ich möchte auf eine Kunstakademie.“
Pause.
„Deine Mutter ist sehr stolz auf dein Talent,“ sagte sein Vater und lächelte plötzlich. „Sie wird sich freuen.“
„Und du?“
Fritz Conrad musste sich räuspern: „Ich bin immer für dich da.“
Pauls Talent, seine durch Filme und Bücher inspirierten Ideen in Zeichnungen und Illustrationen umzusetzen, wurde von seinem Kunstlehrer am Gymnasium gefördert. Einige seiner Arbeiten wurden von einer Kommission der Kultusbehörde prämiert und im Rahmen einer Wanderausstellung in den Schulen des Landes gezeigt. Der Lehrer empfahl den Besuch der privaten Kunstakademie Delhomme in Düsseldorf. Nach einem Telefonat zwischen seinem Vater und Karl Delhomme, reiste Paul mit einer Mappe seiner Arbeiten zu einem persönlichen Gespräch nach Düsseldorf. Drei Tage vor seinem siebzehnten Geburtstag war die Entscheidung gefallen: Paul würde die Aufnahmeprüfung für die Akademie machen und das Gymnasium verlassen.
7
„Du machst dich vom Acker“, sagte Stubbi und schnipste mit den Fingern. „Und uns lässt du sitzen.“
„Ich hab immer geglaubt, du übernimmst mal die Fabrik“, sagte Gackes deprimiert. „Ich hab immer geglaubt, du wirst mal mein Chef.“
Paul fühlte sich in der Defensive. „Hör zu, Mann. Das ist scheißwichtig für mich. Ich komm hier raus und kann endlich das tun, was ich wirklich will und wozu ich Lust habe. Das ist die Chance meines Lebens!“
„Scheiß Chance!“ Stubbi lief auf und ab. „Und wer gibt uns eine Chance?“
„Verdammt noch mal, Stubbi! Hör mit dem Rumgerenne auf“, rief Paul. Und: „Ich kann mein Leben doch nicht nach euch richten.“
„Kannst du nicht?“, fragte Stubbi mit zusammengekniffenen Augen. „Und was ist mit Marie Luise? Denkst du, sie weiß nicht, was mit dir los ist? Hältst du sie für blöd?“
„Hör auf mit dieser Psychokacke“, sagte Paul wütend. „Marie Luise fickt mit George!“
„Der Ami ist nicht ewig hier. In ein paar Woche schicken sie ihn nach Hause.“ Stubbi packte Pauls Schultern. „Kapierst du, was das heißt?“
„Ich – äh – weiß nicht so recht“, sagte Paul verwirrt.
„Wart’s ab, bis der scheiß Ami weg ist“, sagte Stubbi leise. „Und alles kommt ins Lot.“
„Ich hoffe, du besuchst uns“, stammelte Gackes.
„So oft ich kann“, log Paul.
8
Am Abend seines siebzehnten Geburtstages trafen sich Paul und seine Freunde mit Marie Luise und George in Kaiserslautern am Eingang zum Frontier Club. George trug seine Gala-Uniform: dunkelblaues Jackett mit Schulterstücken, die Brust bedeckt mit Orden, weißes Hemd, schwarze Krawatte, scharf gebügelte hellblaue Hosen, dunkelblaue Mütze mit poliertem Schirm.
„Kein Wunder, dass meine Schwester auf ihn abfährt“, raunte Stubbi.
Marie Luise trug einen Kaschmirpulli in der Farbe ihrer Augen, einen grauen Flanellrock, der sich über dem festen Hintern spannte und die langen Beine zeigte, ihre Füße steckten in flachen Ballerinaschuhen mit Schleifchen.
„Herzlichen Glückwunsch“, sagte sie in Pauls Gesicht – ihr Atem roch nach Juicy Fruit – küsste ihn auf die Wangen und drückte ihn. Auf Paul wirkte sie wie das Geburtstagsgeschenk für jemand anderen, der nur darauf wartete, es endlich auszupacken. Der Türsteher fragte nach dem Alter, fixierte dabei Georges Schulterstücke und Orden, wartete die Antwort erst gar nicht ab, trat respektvoll zur Seite und machte den Eingang frei.
Der Club war gerammelt voll.
Die kolossale, hufeisenförmige Bar wurde belagert von trinkenden GIs in scharfen Ausgehuniformen. Paul ersehnte jetzt nichts mehr, als eine dieser coolen Uniformen zu tragen, Kamerad unter Kameraden zu sein.
Barmänner nahmen die laut geplärrten Bestellungen der deutschen Cocktail-Kellnerinnen entgegen, griffen sich Flaschen vom Regal, mixten Drinks, öffneten Bierflaschen im Akkord, Getränke wurden über die Köpfe der in Reihen gestaffelten Trinker vor der Theke weitergereicht.
An den Wänden ein Portrait John F. Kennedys, der lächelnd auf das Treiben runterblickte, Militaria, gekreuzte Schuss- und Stichwaffen, Bataillons- und Regimentsflaggen, davor eine Reihe Slot Maschinen und die futuristisch aussehende Wurlitzer-Jukebox, aus deren Lautsprechern ohne Unterbrechung die aktuellen Charthits dröhnten. Deutsche Frauleins, Petticoats und Wonderbras unter Blusen mit üppigen Dekolletés, rockten mit GIs auf einer winzigen Tanzfläche.
George, der mit Gejohle begrüßt wurde, bestellte eine Runde Bourbon mit Ginger Ale, hob sein Glas und brüllte: „Happy Birthday!“
Daraufhin spendierte der Barmann eine weitere Runde aufs Haus und Georges Kameraden, denen wie allen GIs das Geld locker saß, schlossen sich an.
Es regnete Drinks.
Stubbi und Gackes hatten gerötete Gesichter, klopften den Takt zur Musik mit Händen und Füßen. Paul segelte auf einer Glückswoge zur Jukebox, drückte dreimal hintereinander Chubby Checkers Monsterhit The Twist, schnappte sich eine verblüffte Kellnerin und twistete sich die Seele aus dem Leib.
Marie Luise versuchte vergeblich George vom Trinken abzuhalten, packte seinen Arm und zog ihn auf die Tanzfläche, legte den Kopf an seine Schulter, schloss die Augen und hielt sich an ihm fest. Sie tanzten zu Elvis Presleys It‘s Now Or Never und Paul wünschte sich an Georges Stelle, dessen Gesicht glühte, entweder vom Alkohol oder vor Glück. George legte Marie Luise den Arm um die Schulter und warf den Kopf in den Nacken. Im Duett mit Elvis röhrte er den Refrain:
It‘s now or never
Come hold me tight
Kiss me my darling
Be mine tonight Tomorrow will be too late
It‘s now or never
My love won‘t wait
Seine Kameraden klatschten im Rhythmus und schließlich grölte die ganze Bar: „... my love won‘t wait – dadada!“
Alle johlten und pfiffen. George schaute mit irrem Blick in die Runde.
„Mit dem Lametta auf der Brust sieht er aus, als hätte er den Koreakrieg im Alleingang gewonnen“, sagte Gackes.
„Du hast du keine Ahnung, was in Korea abging“, sagte Stubbi. „Marie Luise sagt, George hat eine schlimme, unsichtbare Kriegsverletzung, die man Trauma nennt.“
„Krieg ist Scheiße“, sagte Gackes. „Was passierte in Korea?“
„Nach einer Patrouille wurde ein Kamerad vermisst“, fuhr Stubbi fort. „George stellte einen Suchtrupp zusammen. Als sie den Vermissten fanden, hat er noch kurz gelebt. Man hat ihn gefoltert, ihm den Schwanz abgeschnitten und in den Mund gestopft. Dann setzte man ihn auf einen zugespitzten Pfahl. Sein Körpergewicht zog ihn nach unten. Der tote Kamerad war Georges bester Freund. Sie kamen aus dem gleichen Kaff in Kalifornien. George kann das nicht vergessen.“
„O Gott!“, würgte Gackes. „Ich kotz gleich.“
„Gottverdammte Scheiße“, keuchte Paul.
Stubbi nickte und biss die Zähne zusammen. Dann sagte er: „George hat schwer gesoffen, die Ärzte im Lazarett in Landstuhl haben sich um ihn gekümmert. Seit er mit meiner Schwester zusammen ist, geht’s ihm besser. Er sagt, er liebt sie. Er spricht von heiraten.“
George schwankte zum Tresen, legte seinen Arm um Paul, redete radebrechend auf ihn ein, erwähnte öfter Marie Luises Namen, wiederholte eindringlich bestimmte Wörter und Sätze.
Paul verstand nichts. Die Kakophonie von Satzfetzen und gebrüllten Worten in zwei Sprachen dröhnte in seinem Kopf.
Marie Luise lehnte erhitzt mit dem Rücken an der Bar.
Stubbi starrte seine Schwester an. „Warum dreht der Ami durch?“
„Er ist glücklich.“
„Warum?“
„Geht dich nichts an.“
„Paul liebt dich“, sagte Stubbi.
Marie Luise zuckte die Schultern. „Paul hat keine Ahnung, was Liebe ist, er zu jung.“ Pause. „Er wird die Stadt verlassen.“
„Dann mach, dass er bleibt.“
„Ich kann nicht“, sagte sie leise und senkte den Kopf. Dann drehte sie sich zu Paul um und packte seinen Arm. „Lass uns tanzen.“
Sie hielt eine Handbreit Abstand zwischen ihren Körpern. Paul beugte sich über ihren Hals, nahm den Schweißfilm auf ihrer Haut wahr, schloss die Augen und atmet ihren Duft ein. Ihre Hüften berührten sich. Jäh war er nüchtern. Bevor er sie von sich schieben konnte, rieb sie ihren Schenkel an der Beule in seiner Hose. Einer Ohnmacht nahe, hörte er George brüllen: „Let’s have some fuckin’ drinks!“
George trank, bis sein Kopf irgendwann auf den Tresen sank. Man gab Marie Luise zu verstehen, dass sich die Kameraden seiner Einheit um ihn kümmern würden und bat alle zu gehen.
Die Party war vorbei.
Vor dem Club warteten Taxis. Paul spendierte die Heimfahrt, acht Kilometer bis Burgweiler, über die Landstraße durch die Nacht. Stubbi setze sich neben den Fahrer, Gackes und Paul kletterten auf die Rückbank. Marie Luise gab ihm einen Schubs, zwängte sich daneben. Gackes schlief bereits, noch bevor das Taxi losfuhr. Marie Luise rutschte in eine bequemere Stellung, nahm Pauls Hand und legte sie auf ihre Brust. Durch die dünne Wolle knetete er ihre Nippel mit den Fingerspitzen, küsste ihren Hals, bis ihr Atem schneller ging und er ihren Puls an seinen Lippen spürte. Sie rieb und massierte seinen Schwanz durch die Hose. Seine Hand glitt unter den Rock, tastete sich zu dem warmen, feuchten Dreieck unter ihrem Slip vor. Er ließ einen Finger in ihre Muschi gleiten und massierte ihre Klitoris. Ihr Duft machte ihn schwindlig, sein Herz schlug im Hals. Panik stieg in ihm hoch. Er sog Luft durch die Zähne, zuckte und atmete heftig. Marie Luise biss sich auf die Unterlippe und schloss die Augen. Dann bebte ihr Körper.
Paul hob den Kopf.
Gackes schnarchte leise.
Stubbi diskutierte laut mit dem Fahrer.
Niemand hatte etwas mitbekommen.
Das Taxi stoppte am Marktplatz. Gackes wachte auf, orientierte sich und fragte, ob man die letzte Runde im Ochsen noch mitnehmen wolle. Stubbi stimmte zu. Paul stellte sich schlafend.
Marie Luise flüsterte: „Ich setz ihn ab und fahr dann auch nach Hause.“
„Okay, gute Nacht“, murmelte Stubbi, stieg mit Gackes aus und schaute den Rücklichtern nach.
Vor seinem Haus zahlte Paul das Taxi, öffnete leise die Tür, huschte mit Marie Luise die Treppe hoch zu seinem Zimmer. Er bekam Staub in die Nase und musste niesen. Mit dem Fuß tastete er nach dem Tretschalter der Stehlampe, drängte sie auf die Couch, kniete vor ihr, schob ihr den Rock hoch, leckte sie durch den Slip und konnte nicht genug von ihrem Duft und Geschmack bekommen. Sie schob ihn von sich, schlüpfte aus dem BH, ließ das Höschen fallen und strampelte sich frei. Paul kickte seine Hose weg und starrte auf die blauen Adern und Sommersprossen auf ihren Brüsten. Marie Luise legt ihm die Beine auf die Schultern. Mühelos drang er in sie. Sie küssten sich und saugten sich fest.
Als er wach wurde, war sie verschwunden. Keine Nachricht. Nicht im Zimmer. Nicht im Bad. Schließlich schlich er runter in die Wohnung seiner Eltern.
Stille.
Alle schliefen noch.
Er hörte den ganzen Tag nichts von ihr.
Am Abend kam Stubbi vorbei. „Sie hat ein paar Sachen eingepackt und meinen Eltern gesagt, sie müsse kurz nach Frankfurt und würde morgen zurück sein.“
„Was macht sie in Frankfurt?“, fragte Paul mit flauem Gefühl im Bauch.
„Vielleicht musste sie ins Headquarter“, sagte Stubbi hoffnungsvoll. „Das war schon mal der Fall. Nur, da war sie abends wieder zurück.“
Drei Tage später wurde George nach zwanzig Dienstjahren ehrenvoll aus der US-Army entlassen, heiratete Marie Luise auf dem Generalkonsulat in Frankfurt und flog mit ihr in einer Militärmaschine nach Amerika. Marie Luise schickte ein Telegramm an Stubbi und die Eltern. Paul erwähnte sie mit keinem Wort.
Paul bestand die Aufnahmeprüfung an der Akademie, packte seinen Koffer und reiste ab. Marie Luise sollte er zehn Jahre später noch einmal treffen. Stubbi und Gackes sah er nie wieder.
9
THEA & REX
Anna: „Warum ist dir Sex so wichtig?“ Larry: „Weil ich ein scheiß Höhlenmensch bin!“
Julia Roberts als Anna und Clive Owen als Larry in „Hautnah.“
How does it feel
How does it feel
To be without a home
Like a complete unknown
Like a rolling stone
Bob Dylan
Der Tag, an dem er in Düsseldorf eintrifft, ist der Tag, der alles verändert. Paul ist achtzehn und ein anderer Mensch. Zum ersten Mal in einer Großstadt, legt er so ziemlich alles ab, was an Burgweiler und seine Herkunft erinnert, sogar den Dialekt.
Seine Vorstellung vom Beruf eines Grafikers ist eher vage. Allerdings weiß er genau, was er nicht will: sein Leben später als freischaffender Künstler zu fristen, womöglich als Illustrator von Kinderbüchern, oder als Gebrauchsgrafiker in einem Verlag zu enden, betrachtet er als Verschwendung seines Talents. Dafür lohnt es sich nicht zu studieren. Für ein Magazin wie Twen – dessen Erscheinen er kaum abwarten kann – mit seinem avantgardistischen Stil und der einprägsamen Optik oder für eine Werbeagentur zu arbeiten, Anzeigen und Plakate zu entwerfen, sich Radio-, Fernseh- und Kinospots auszudenken, Foto- und Filmshootings mit berühmten Fotografen, Regisseuren und Models zu machen, das ist es, was er will. Das ist genau sein Ding.
Die erste Woche in der neuen Stadt verbringt Paul im Breidenbacher Hof, genießt auf Kosten seines Vaters den Luxus eines Grand Hotels, lässt sich eine James-Dean-Frisur verpassen und stellt sich in den Boutiquen auf der Kö eine neue Garderobe zusammen.
Zwar kleidet er sich immer noch wie George oder seine Idole in amerikanischen Filmen – Blazer, Button-Down- und Polohemden, Khakihosen, und Mokassins, die George Loafer genannt hatte – allerdings wurde es immer schwieriger, diesem Stil treu zu bleiben. Seit George Deutschland verlassen hatte, gab es niemand mehr, der ihm seine Klamotten in einem PX-Laden hätte besorgen können. Jeans waren zu unbequem, zwickten und quetschten ihm die Eier. Außerdem kann er sich, mit Ausnahme von James Dean, keines seiner männlichen Filmidole darin vorstellen. Cary Grant oder Frank Sinatra in Jeans – der Gedanke ist einfach lächerlich.
Im Erdgeschoss einer Jugendstilvilla in der Achenbachstraße hat er ein möbliertes Einzimmerapartment gefunden, das von den früheren Besitzern des Hauses wahrscheinlich als Personalunterkunft für Haushälterin oder Chauffeur gedacht war. Die Etagen darüber waren an eine Anwaltssozietät vermietet. In der vierten Etage hat Hajo Knecht, Eigentümer des Hauses und bekannter Düsseldorfer Künstler, einen Teil seiner Werke gelagert. Knecht, der an irgendeinem See in Bayern lebt, war ein Freund Delhommes, durch dessen Vermittlung Paul zu dem Apartment kam.
Die Kunstakademie Delhomme, eine private Schule, unabhängig, selbstverwaltet und wirtschaftlich autark, befindet sich im Hinterhofgebäude eines dreistöckigen, quadratischen Gebäudekomplexes mit Innenhof. Drei der Gebäude stehen immer noch leer, die Eingänge zugemauert, die Fenster mit Latten verbarrikadiert.
Maler und Bildhauer Karl Delhomme, Leiter der Akademie, scharte renommierte Künstler, darunter ein paar seltsame Käuze, als Dozenten um sich. Gemeinsame Ausstellungen mit Joan Miró und Pablo Picasso hatten Delhomme über die Grenzen Europas bekannt gemacht. Er ist mit Hemingway befreundet und kennt Ava Gardner von Dreharbeiten in Pamplona. Fotos von Gardner und ihrer Clique zeigen ihn beim Encierro, dem Stierlauf von Pamplona, traditionell gekleidet mit weißem Hemd und weißer Hose, rotem Halstuch und roter Schärpe.
Zum Semesterbeginn veranstaltet Delhomme ein als Kennenlerntreffen getarntes Rotweingelage im Innenhof der Akademie. Im Schatten von Birken und Pappeln werden Brauereitische und -bänke aufgestellt, Dozenten entkorken Flaschen, füllen billigen Rotwein in Pappbecher, machen sich bekannt und suchen das Gespräch mit den neuen Studenten.
Paul irrt durch die Meute, trinkt aus Langeweile die Plörre, von deren Geruch er schon Sodbrennen bekommt, und wartet auf die Chance, einen Platz an Delhommes dicht belagertem Tisch zu finden. Er hofft, mit ihm über Ava Gardner und den Filmdreh in Pamplona reden zu können. Gerade als er beschließt aufzugeben und sich unauffällig zu verdrücken, wird ein Platz zwischen zwei Gestalten frei.
So lernt er Thea und Rex kennen, Neulinge wie er.
Ob es am Rotwein, der gelockerten Atmosphäre oder einfach daran liegt, dass man sich sofort sympathisch findet, Paul vergisst Delhomme und die Stories von dessen bewegtem Künstlerleben, mit denen er seinen Studenten einen Hauch von Bohème zu vermitteln versucht, und lernt stattdessen seine Tischnachbarn kennen.
Thea Forester, vor zwanzig Jahren in der Nähe von Louisville in Kentucky geboren, eine grünäugige Schönheit von der Sorte, die Kerlen den Mut nimmt sie anzusprechen. Dabei verhält sie sich weder kühl noch abweisend. Ihre Eleganz, Coolness und die nonchalante amerikanische Art würden auf deutsche Männer verstörend wirken, meint sie, wobei sie ihre selbstbewusste Behauptung mit einem Lächeln entschärft. Theas Eltern, die ihren Namen amerikanisiert hatten und früher Förster hießen, waren Pferdezüchter in der Gegend von Verden gewesen, bevor sie vor dem Krieg in die USA ausgewandert waren. Rex, ein Jean-Paul-Belmondo-Typ, der perfekt Französisch spricht, heißt eigentlich Michael Rexroth, ist zweiundzwanzig und hat eine Lehre als Goldschmied abgeschlossen. Er war schon mehrmals in Paris gewesen, wo er, wie er behauptet, mit fünfzehn seine Unschuld bei einer Nutte in der Rue Saint-Denis verlor.
Kurz vor Mitternacht leert sich der Innenhof.
Außer Paul, seinen neuen Freunden, ein paar standfesten Trinkern und Delhomme haben die meisten die Party bereits verlassen. Schließlich gelingt es doch noch, Plätze an seinem Tisch zu ergattern und das Gespräch auf Ava Gardner zu lenken.
Delhomme berichtet von der Sauftour, die er zum Abschluss der Dreharbeiten Zwischen Madrid und Paris gemeinsam mit Ava Gardner, Ernest Hemingway und Regisseur Henry King unternommen hatte.
„Mit vierzehn oder fünfzehn war sie meine Traumfrau“, sagt Paul. „Kürzlich habe ich sie zum zigsten Mal in Mogambo gesehen.“
„Ava flucht und säuft wie ein Mann“, sagt Delhomme und öffnet eine neue Flasche. „Und sie hat diese unglaublich erotische Anziehungskraft.“
„Sie hat jeden Filmpartner flachgelegt. Oder sich aus der Crew bedient – hab ich jedenfalls irgendwo gelesen.“
„Auch in Pamplona hatte sie Affären“, erwidert Delhomme. „Man sagt, mit Tyrone Power und einigen anderen.“
„Auch mit Hemingway, dem alten Romantiker?“
„Romantiker? Hemingway? Er war ein mieser Alkoholiker und Frauenfeind, der sein Leben damit verschwendet hat, bei Picasso rumzuhängen und das zu vögeln, was der übrig gelassen hat.“
Paul muss lachen. „Und Errol Flynn?“
„Eine Schwuchtel, die sich als Macho verkleidet. Er und Hemingway waren elende Säufer. Sie waren impotent vom Saufen und sie soffen, weil sie impotent waren.“
„Erbarmen! Ist sie noch mit Frank Sinatra verheiratet?“
„Könnte sein“, überlegt Delhomme und bietet eine Runde Zigaretten an. „Obwohl sie in Madrid lebt und Frank in Rancho Mirage.“
„Sie steht auf Stierkämpfer, oder?“ fragt Rex und fummelt eine Zigarette aus der Packung. „Vielleicht weil Toreros die Hoden der getöteten Stiere essen und dadurch besonders potent sind oder so ähnlich.“
„Schwachsinn“, faucht Thea.
Paul, der sich mehr als seine Gesprächspartner mit Ava Gardner beschäftigt hatte, sagt: „Sie soll mal zu Toots Shore, einem Freund Sinatras, gesagt haben, dass Frank den Längsten hat. Sie sagte, wenn Frank nackt ist, hat er drei Beine.“
Thea giggelt.
„Sie hat Männer verrückt gemacht“, sagt Delhomme. „Hast du Die barfüßige Gräfin gesehen? Das ist der Film zu ihrem Leben.“
„Kann es sein, dass ein Frauenbild dich dein ganzes Leben lang verfolgt?“ Paul schaut versunken in den Nachthimmel. „Dass du jede Frau mit deinem Traumbild vergleichst und immer auf der Suche nach dem Ideal bist?“
„Oh, oh.“ Delhomme füllt Pauls Glas nach. „Dann wärst du echt ein Fall für die Couch.“
„Kennen Sie zufällig einen guten Psychiater?“
Später, in seiner Bude, versucht Paul ziemlich besoffen die Länge seines Schwanzes nachzumessen.
10
Paul belegt Zeichnung, Grafik, Malerei und Farbgestaltung bei Addi Straub, in der Akademie einer der Dozenten der ersten Stunde und Besitzer eines grafischen Ateliers mit angeschlossenem Fotostudio. Addi gefällt sich in der Rolle des Kunstprofessors, trägt Tweed-Sakkos und Cordhosen, die immer gleiche, dunkelgrüne Strickkrawatte zu einem monströsen Knoten geschlungen.
„Vielleicht besitzt er nur die eine“, sagt Paul zu seinen Freunden, „oder aber er hat eine ganze Sammlung davon und niemand merkt, dass er jeden Tag eine andere trägt.“
Sein umfassendes Wissen vermittelt Addi seinen Studenten auf kumpelhafte Art. Nach einem vergeblichen Versuch, Paul in einer Altstadtkneipe in die Mysterien des Altbiergenusses einzuweihen, musste er sich eingestehen, dass Bier nicht jedermanns Sache ist und Paul ihn mit jedem anderen alkoholischen Getränk unter den Tisch trinken konnte. Rex studiert Plastik und Objektgestaltung bei Emanuel Hopf, einem bekannten Bildhauer und schrägem Vogel. Theas Dozentin, Marion von Krockow, eine Kunsthistorikerin mit eigener Galerie auf der Königsallee, lehrt Gattungen der bildenden Kunst, Künstler und Werke. Zusätzlich absolvieren alle drei ein kunstwissenschaftliches Begleitstudium, belegen kunst- und kulturhistorische Seminare und Vorlesungen.
Die meisten Abende verbringt Paul mit seinen Freunden im Blue Note, einer Jazz-Bar in der Grafenberger Allee, einen Steinwurf von seiner Wohnung entfernt. Die Bar hat den Charme einer Bahnhofskneipe: lang gezogener Raum, rechts der Tresen, davor Bistrotische und Hocker, im hinteren Bereich ein Podium für den Auftritt von Bands, an den Wänden Fotos bekannter Jazz-Musiker, mit persönlichen Widmungen für Mike, den Besitzer der Bar.
Mike war früher, bevor er die ehemalige Nachbarschaftskneipe übernahm und daraus eine Bar machte, Schlagzeuger bei Chris Barber und Acker Bilk. Das Blue Note hätte er nur deswegen eröffnet, sagt er, weil er größere Wände für seine Fotos brauchte. Ein Rudel ständig wechselnder Studenten ist für den Service vor dem Tresen zuständig. Mike versteht sich als Gastgeber, der seine Besucher mit Stories aus seinem wilden Tourneeleben sowie Insiderwissen über Jazz und Rock unterhält. Für alles andere ist Walli zuständig, Managerin, Barfrau und Männermagnet, die den Laden mit einem Mix aus kühlem Charme und lässigem Umgang mit Gästen schmeißt. Walli, eine falsche Blondine Mitte dreißig, sexy und geschieden, wird x-mal pro Abend angemacht. Wer Glück hat, landet in ihrem Bett. Die Freiheit, sich zu nehmen, was man will, wird von vielen Barbesuchern, auch Frauen, neidisch als feministisch bezeichnet. Eines Nachts, lange nach der Sperrstunde, mit der es Mike nicht so genau nimmt, wendet sich Paul an Walli mit der Bitte, den Frank Sinatra-Titel In the Wee Small Hours of the Morning aufzulegen. Sie schaut ihn an, als hätte er sie nicht mehr alle, spielt aber die Platte. Der Schmerz über die Trennung von Ava Gardner hatte Sinatras Stimme tiefer und reifer werden lassen. Paul betrachtet ihn als verwandte Seele, die wie er versucht, über das Ende einer Liebesaffäre hinwegzukommen. Allerdings besitzt Paul nicht Sinatras Talent, Kummer in Musik und Worte zu verwandeln:
When your lonely heart has learned its lesson
You’d be hers if only she would call
In the wee small hours of the morning
That’s the time you miss her most of all
Paul starrt dösend vor sich hin, denkt an Marie Luise, versucht sich an ihr Gesicht, ihren Körper, Duft und Geschmack zu erinnern. Oft hatte er sich gefragt, warum er in dem Abschiedstelegramm damals nicht erwähnt wurde, warum sie in der Nacht vor der Abreise Sex mit ihm hatte und sich dann doch für George entschied. Eine Zeit lang suchte er die Schuld für ihr Verschwinden bei sich, fragte sich, ob er damals zu unerfahren war, zweifelte an seiner Männlichkeit und quälte sich mit Selbstvorwürfen.
Um nicht verrückt zu werden, dachte er sich eine Version der Geschichte aus, die der Wahrheit ziemlich nahekam und die ihm half, seine Psyche wieder zu stabilisieren. Wie viele junge Frauen in seiner Region war auch für Marie Luise die Ehe mit einem Amerikaner mit der Hoffnung auf ein anderes Leben in den USA verbunden. George war der Schlüssel zu einer besseren Welt. Paul blickt kurz hoch, sucht mit den Augen Walli, winkt ihr zu und zeigt auf sein leeres Glas. Sofort versinkt er wieder in Erinnerungen. Walli, die sich missachtet fühlt, füllt das Glas und knallt es auf die Theke. Nach einem giftigen Blick zuckt sie die Achseln und wendet sich wieder Thea und Rex zu, die Pauls gelegentliche emotionale Ausraster inzwischen kennen.
„Was ist er?“, fragt Walli. „Ein Säufer oder bloß arrogant? Oder ist er ein arroganter Säufer?“
Thea flüstert mit dramatisch verstellter Stimme: „Man hat ihm das Herz gebrochen.“
„Glaub ich nicht.“ Rex schüttelt den Kopf. „Nicht dem.“
Mit der Sensibilität einer erfahrenen Frau sagt Walli: „Ich glaube, er wünscht sich, man hätte ihm das Herz gebrochen, damit er einen Vorwand zum Saufen hat.“
„Du bist so verdammt realistisch“, giggelt Thea.
„Ich arbeite in einer Bar“, sagt Walli kalt.
Paul steckt sich eine Zigarette an und nimmt den Drink in die Hand. Auf halbem Weg zu den Lippen verharrt er. Jäh, ohne im Geringsten darauf vorbereitet zu sein, durchzuckt ihn ein Erinnerungsblitz. Erst erinnert er sich an Worte, dann an einen Satz, den George damals in betrunkenem Zustand mehrmals gebrüllt hatte: We’re going to get married! Die Erkenntnis lässt Paul das Glas in einem Zug leeren. Wir waren alle besoffen, denkt er betroffen, wir haben ihn nicht verstanden. Er hat uns wahrscheinlich die ganze Story mitgeteilt oder versucht mitzuteilen. Vor Glück und weil es seine letzte Nacht in Burgweiler war, hat er gesoffen wie ein Stier. Deshalb tanzte Marie Luise mit mir. Nicht weil sie sich auf die Erektion in meiner Hose freute, sondern weil sie mich von George weghaben wollte. Weil sie Angst hatte, ich könnte ihn verstehen. Plötzlich sieht er alles so deutlich vor sich, als wäre es gestern gewesen. Er erinnert sich wie George im Duett mit Elvis It‘s Now or Never sang. Er erinnert sich auch, wie Marie Luise seinen Blick suchte, ihm dann in die Augen schaute. Sie hat es mir mitgeteilt, denkt er, melodramatisch, wie sie veranlagt ist, hat sie dafür den Text eines Songs gewählt. Was für eine groteske Schmonzette. Sie hat mich zur Figur einer Seifenoper gemacht.
Walli holt ihn in die Realität zurück.
„Du bist nicht suizidgefährdet, oder?“, fragt sie mit einem vehementen Kopfnicken in Richtung des Plattenspielers.
Paul sammelt Kraft zum Antworten, zieht so heftig an der Zigarette, dass er hustet.
„Was ist los mit dir?“, keucht er. „Kneift dein Höschen?“
„Du hast so einen Hauch von Schicksal, der an dir haftet“, spöttelt Walli.
„Einsamkeit und Frank Sinatra sind eine gefährliche Mischung“, sagt Thea. „Man sagt, wenn in Amerika Selbstmörder vom Seil geschnitten werden, dreht sich meistens eine Sinatra–LP auf dem Plattenteller.“
„Thea!“, schreit Walli. „Das ist makaber!“
„Die alte Redensart, dass man immer dem weh tut, den man liebt – na ja, die gilt auch umgekehrt“, philosophiert Rex trübsinnig.