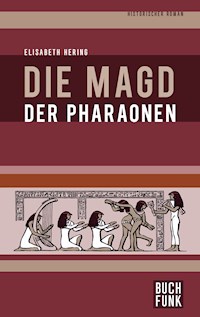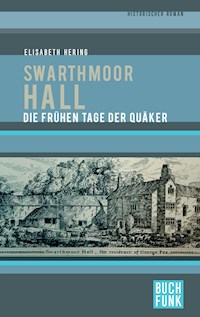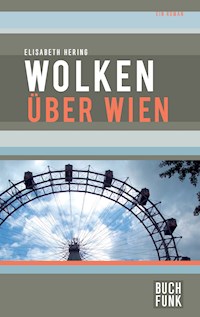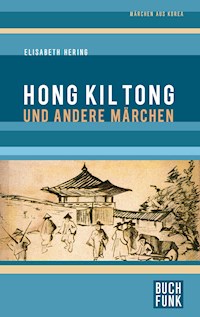Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BUCHFUNK Hörbuchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mit diesem groß angelegten historischen Roman gestalten die Autoren das Lebensschicksal eines evangelischen Geistlichen aus der Zeit nach Luthers Tode. In einer von politischen Wirren wie von konfessionellen Streitigkeiten zerrissenen Zeit erfährt der aus Geithen gebürtige Handwerkersohn Johannes Crusius am eigenen Leibe die Auswirkungen der Kämpfe und halben Friedensschlüsse (Konkordienformel), die sich aus dem Grundsatz ?cuius regio eius religio" ergeben. Aus dem Amt gejagt, in Süddeutschland und Österreich umhergetrieben, findet er doch den Frieden, der ?höher als alle Vernunft" ist, ehe er einsam auf verschneiter Landstraße sein Leben beschließt. Über die Darstellung eines der zahllosen unglücklichen Schicksale jener Tage hinaus weitet sich der auch in künstlerischer Hinsicht bedeutende Roman zu, einem erregenden, die Verhältnisse der Zeit in Dorf und Stadt, an den Universitäten und Fürstensitzen, am Kaiserhof und in Rom spiegelnden großartigen Zeitbild.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 804
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Elisabeth und Walter Hering
DER DIAKON VON MONSTAB
JOHANNES CRUSIUS Anno 1586 als Diakonus in Augsburg
„Er ist tot!“
Die Stimme, die diese Worte spricht, scheint aus dem Abgrund zu kommen. Aber so leise sie ist, greift sie doch jedem im Raum ans Herz, und jeder begegnet ihr auf seine Weise.
~
Die beiden Knaben stehen vor des Vaters Bett mit tränenüberströmtem Gesicht, und Martin, der nur um ein geringes ältere, greift nach des dreizehnjährigen Bruders Hand und presst sie so stark, dass Paul mit Mühe einen Aufschrei unterdrückt. Die Gräfin Mansfeld bestreicht das Handgelenk, aus dem der Pulsschlag entflohen ist, mit scharfem Rosenessig. Rutfeld bringt frisch gewärmte Tücher vom Ofen und reicht sie dem Magister Coelius, der den erkaltenden Leib unablässig damit reibt. Doktor Jonas endlich leuchtet dem Liegenden mit einer Kerze ins bleiche Antlitz, und ob auch gleich das heiße Wachs in großen Tropfen auf die bleichen Wangen fällt, ist doch nicht das leiseste Zucken um den eingefallenen Mund zu bemerken. Und wiederum sagt jemand leise: „Lasst ab von ihm! Ihr weckt ihn nicht! Er ist tot!“ Da beugt sich Aurifaber über die gebrochenen Augen und drückt ihnen die Lider zu.
Und plötzlich ist Stille im Raum, tiefe Stille. Selbst das leiseste Geräusch ist verstummt, und um so stärker fühlen sie alle: Verstummt ist auch der Mund, dessen Worte man vernommen hat von Wittenberg bis Rom, bis Upsala, bis Madrid!
Wer möchte reden, da er schweigt? ... schweigend das Ewige preist — so wie er ehedem nicht müde ward, in immer neuen Worten und Bildern von ihm zu sprechen?
Es ist noch tiefe Nacht, der Morgen noch fern. Und dennoch verbreitet sich in der kleinen Stadt Eisleben die Kunde von diesem Sterben wie ein Lauffeuer. Und in Scharen kommen sie herbei, um Abschied zu nehmen — Abschied von dem, dessen Leichnam man in einen weißen Kittel gehüllt hat und dessen Kopf auf weiche Kissen gebettet liegt. Und immer mehr füllt sich der Raum mit Menschen.
~
Als Graf Gebhard von Mansfeld ins Zimmer tritt, ist der erste, dem er sich gegenübersieht, sein Bruder Albrecht — jahrelang sein ärgster Feind, der ihm die Verwaltung seiner Güter entrissen und ihm in endlosen Prozessen jedes gebrannte Herzeleid angetan hat. Hier aber, vor dem Toten, geht Gebhard auf den Bruder zu und reicht ihm die Hand.
Und der Tote sagt nicht: „Beide habt ihr Unrecht getan — du, der du verschwenderisch umgingst mit deinem Hab und Gut, genauso wie du, der du unter dem Vorwand, als Treuhänder darüber wachen zu müssen, es habgierig an dich rissest!“ Sagt nicht: „Gott hat das Erz in den Berg gelegt, dass es allen Menschen diene, nicht aber, dass sich die Herren darum schlagen!“ Sagt nicht: „Schmälert nicht noch weiter die Rechte eurer Untertanen, denn eure Versöhnung wäre zu teuer bezahlt mit ihrer Unterdrückung!“ — Nein, er bleibt stumm, und die Grafen gehen still an ihm vorüber.
~
Die nächsten, die vor dem Toten stehen, sind Fürst Wolf von Anhalt und Graf Hans-Heinrich von Schwarzburg. Und er ruft ihnen nicht zu: „Oh, mir ist bange, ob ich auch wirklich mein Werk in die rechten Hände legte, da ich den Fürsten so viel Einfluss und Herrschaft zugestand über die Gemeinde des Herrn! Denn was ist der Kaiser? Was Könige? Was Fürsten? Was der Mensch? Nur ein Wasserstäubchen im Vergleich mit Christus der Gott ist, gepriesen in Ewigkeit!“
~
Und endlich die Freunde: Aurifaber, nun schon seit Jahren sein täglicher Tischgenosse, Coelius, einer seiner frühesten und liebsten Schüler, Justus Jonas, sein Begleiter schon auf dem schwersten Weg, nach Worms, zum Reichstag — sie, die mit ihm gebangt und gebetet, gehofft und frohlockt haben — klingt ihnen seine Stimme nicht auch jetzt noch im Ohr? Diese Stimme, die so leidenschaftlich, so zornig, so mahnend sein konnte und dabei selbst noch im Angesicht des Todes zu scherzen nicht aufgehört hatte! („Dann werde ich den Maden einen feisten Doktor geben!“ Oh, sie schämen sich fast, in dem Augenblick, da er tot vor ihnen liegt, gerade dieses Wortes sich zu erinnern! Und doch zaubert es ihnen nicht eben sein Menschlichstes und Liebenswertestes vor die Seele?)
Aber nun bleibt diese Stimme stumm. Sagt nicht zu ihnen: „Freunde, mehr noch als vor dem Papst und dem Kaiser, mehr als vor Fürsten und Gewalthabern, mehr als vor Schwarmgeistern und Irrlehrern bangt mir vor Euch! Denn ich sehe voraus, dass viele von den Brüdern abfallen werden nach meinem Tode — und dass sie damit dem Evangelium einen stärkeren Stoß versetzen werden als alle Papisten!“
~
Lange stehn sie, seine nächsten Mitstreiter und Freunde, vor dem Toten, keines Wortes mächtig. Endlich aber gehen sie schweren Schrittes durchs Zimmer. Und da fällt Aurifabers Blick auf den kleinen Tisch, der in der Ecke steht, und er entdeckt darauf ein beschriebenes Stück Papier. „Seine letzte Aufzeichnung“, sagt er bewegt.
Er nimmt den Zettel auf, und alle drei lesen sie ihn gleichzeitig. Lateinische Worte sind es, nur flüchtig hingeschrieben, so dass es eine Weile dauert, bis sie sie entziffert haben. Und dann, zugleich es verdeutschend, liest Justus Jonas vor, was auf dem kleinen Blatt steht:
„Den Vergil, in seinen Hirten- und Landbau-Gedichten, kann niemand verstehen, er sei denn fünf Jahre Hirt oder Bauer gewesen. — Den Cicero in seinen Briefen wird niemand verstehen, so wenigstens denke ich, er habe sich denn zwanzig Jahre hindurch in einem hervorragenden Staatswesen betätigt. — Die Heilige Schrift aber meine niemand genugsam verstanden zu haben, es sei denn, er habe hundert Jahre lang mit Propheten wie Elias und Elisa, mit Johannes dem Täufer, mit Christus und den Aposteln die Gemeinden regiert. — Wir sind Bettler! Das ist wahr!“
~
Justus Jonas lässt den Zettel sinken und schweigt. Und es dauert lange, ehe Coelius ein Wort findet.
„Und das sagst du?“ fragt er erregt, „du, Martin Luther? Hast du uns nicht die Bibel übersetzt und ausgelegt? Hast du uns nicht die reine Lehre geschenkt? Wie sollen wir nun diese deine Worte verstehen?“
Doch der stille Schläfer wendet sich nicht um nach dem Frager und gibt keine Antwort.
„Lebt er?“
Mit letzter Kraft stützte sich die Wöchnerin auf ihr Kissen und hielt den Kopf hoch. Und ihre Augen starrten die Wehmutter an. Wie lange Zeit war vergangen, seitdem ihr Körper die Frucht ausgestoßen hatte? Und warum packte die Muhme das Kind an den Beinen, hielt es mit dem Kopf nach unten und klopfte und schüttelte es? Warum legte sie das kleine Körperchen auf den Tisch, bespritzte es mit kaltem Wasser und bewegte die Ärmchen hinauf und hinunter, hinauf und hinunter, immer im Takt? Und was murmelte sie vor sich hin?
Sieben Kinder schon hatte die Krausin geboren, und jedes hatte mit einem Schrei vom Leben Besitz ergriffen, hatte unmittelbar darauf mit krebsrotem Gesichtchen neben ihr gelegen, ein Ende bereitend der stundenlangen Qual, die aber (noch bei jeder Geburt!) mit diesem Augenblick, mit diesem ersten Schrei sofort wieder vergessen war — untergegangen in dem überströmenden Glücksgefühl, das die Frau überschüttet, sobald ihr das Kind in den Armen liegt.
Hatte diesmal die Geburt zu lange gedauert? Hatte die Schwäche, die sie mitten in den Wehen überfiel und gegen die sie vergeblich angekämpft, ihrem Kind das Leben gekostet? War alles umsonst gewesen — Schmerzen, Angst, übermenschliche Anstrengung — umsonst?
Ihre Hände verkrampften sich, als suchten sie nach einem Halt. Sie wollte aufspringen und der Alten das Kind entreißen, wollte es an sich drücken — drücken, bis es aufschrie. Aber die Glieder versagten ihr den Dienst. Alle Muskeln zitterten an ihrem Körper, doch weder Arm noch Bein vermochte sie zu regen. Sprechen wollte sie, aber eine nie gekannte Beklemmung schnürte ihr die Kehle zu.
~
Da — was war das?
Ein Schrei, nicht Lust ausdrückend, nicht Schmerz: Luft ist eingeströmt in die kleinen Lungen, und nun pressen sie sich zusammen und stoßen den Atemstrom wieder aus — zum ersten Male tun sie, laut und gewaltsam, das, was sie hinfort geduldig und ohne Aufhebens in stiller Selbstverständlichkeit fortsetzen werden, tagtäglich unzählbare Male — Wochen und Monate und Jahre und Jahrzehnte lang.
Die Hebamme wischt sich den Schweiß von der Stirn. „Er lebt, Krausin, er lebt!“ ruft sie, und sie hält der Wöchnerin den Knaben hin. Doch die ergreift ihn nicht. Sie hat den Schrei noch gehört, den Schrei, der ihren Ohren süßer ist als Himmelsmusik, und mit einem tiefen Atemzug lässt sie den Kopf auf das Kissen sinken — hat das Bewusstsein verloren.
~
In diesem Augenblick geht die Türe auf und der Meister tritt ein.
„Seid Ihr endlich da?“ fragt die alte Frau vorwurfsvoll. „Ich habe Euch suchen lassen durch ganz Geithen! Ein Mann lässt seine Frau nicht allein — so kurz vor der Entbindung!“
Martin Krause hätte den Vorwurf zurückweisen können. Hätte sagen können, dass Sabine das Kind so bald nicht erwartete. Hätte sagen können, dass es höchste Zeit war, sich nach einem Wagen umzusehn für die Leipziger Messe, und dass er in drei Dörfern nachgefragt habe, bis er endlich einen Bauern fand, der ihm seine Bottiche und Fässer und Wannen in die Pleißestadt zum großen Ostermarkt fahren will. Mit Schiebeböcken — den langen Gurt über der Schulter und die Holme in den immer müder werdenden Händen — sich auf den weiten Weg machen mochte er wirklich nicht mehr. Denn selbst wenn sie zu viert loszogen — er und der Gesell und auch noch die beiden älteren Lehrbuben — ihre Ware war zu groß und zu sperrig, als dass es sich gelohnt hätte. Dazu noch die jedesmalige Übernachtung hinwärts und rückwärts in Belgershain! Und — er hatte es auch nicht mehr nötig! Konnte es sich leisten, einen Wagen zu mieten!
Aber all diese Worte blieben ihm auf der Zunge kleben, als er Sabines Gesicht sah. Er stürzte zum Bett, ergriff ihre schlaff herabhängende Hand, rief: „Frau! Was machst du, Frau?“ und ließ sich stöhnend auf den Stuhl vor ihrem Bett fallen.
„Es ist ein Sohn, Meister!“ sagte die Alte, die unterdessen das Kind gewickelt hatte und es dem Vater in die Arme schob. Der betrachtete versonnen, noch halb geistesabwesend, das kleine verkniffene faltige Gesicht, nicht größer als seine Männerfaust, in dem sich die Lippen schon suchend bewegten. Dann gab er es der Muhme zurück.
„Die Geburt hat zu lange gedauert“, fuhr die Alte fort, „und das Kind wäre fast erstickt! War schon ganz blau, als es zur Welt kam, wollte und wollte nicht schreien!“ — „Aber die Frau?“ fragte der Mann erregt, „was ist mit der Frau?“ „Die lasst schlafen, Meister!“
Krause erhob sich und ging in der Stube auf und ab. „Eine Luft ist hier — zum Schneiden!“ Und er trat zum Fenster und öffnete es.
„Um Gott, was tut Ihr da?“ schrie die Alte, „das Kind ist noch nicht getauft!“
Sie bekreuzte sich und wollte das Fenster rasch wieder schließen, doch der Meister herrschte sie an: „Könnt Ihr den Unfug nicht lassen, Zauntzschin? Seit sieben Jahren schon ist die ganze Stadt lutherisch, und Ihr hängt immer noch an dem faulen Zauber?“ — „Ob lutherisch oder papistisch“, murmelte die Alte, „katholisch oder evangelisch — es gibt nur einen Gott und nur einen Teufel!“ Sie wagte aber doch nicht, den Mann vom Fenster wegzudrängen, vor dem er breitbeinig stand.
Die Wöchnerin stöhnte leise. „Geht jetzt, Meister!“ sagte die Hebamme. „Die Nachgeburt muss noch kommen. Und ... Ihr seid ja doch nur im Wege!“
Da fügte sich Martin. Er wusste, dies waren Ort und Stunde, wo der Mann ohnmächtig ist — wo er nichts tun kann als hinter der Türe stehn und lauschen und warten. Doch diesmal war das Schlimmste ja schon vorüber.
Er ging in die Wohnstube. „Ihr habt einen Bruder bekommen!“ rief er den Kindern zu, die ihn auch gleich umringten wie eine Schar aufgescheuchter Vögel, und durcheinanderfragten: „Kann ich ihn sehn? Kann ich mit ihm spielen? Wie heißt er?“ Doch der Vater antwortete nicht. Ihm war nicht danach zumute. Martha aber, die in der Küche hantierte, trat durch die offene Tür: „Wollt Ihr nicht essen, Vater? Ich habe Euch kommen sehn, und da hab ich rasch einen Grützbrei gekocht!“
In dem Mann jagten sich die Gedanken. Erst zwölf Jahre war das Mädchen alt, und schon nahm sie die Wirtschaft in die Hand, wenn die Mutter ausfiel!
Acht Kinder in zwölf Jahren! Nie hätte er gedacht, dass es seiner Frau zu viel sein könnte. Sie gebar doch so leicht — kräftig und breithüftig wie sie war, jung und voll Leben! Als er sie heimführte, war sie eben siebzehn gewesen — jetzt kaum dreißig.
Und die Kinder, die sie ihm schenkte, waren so gesund! Nicht ein einziges hatten sie verloren — es war wie ein Wunder. Selbst als der Würgengel überall Ernte hielt — hier ein kleines Leben auslöschte und dort eines — selbst da waren sie verschont geblieben.
Wie also hätte er nicht unbesorgt über Land gehen sollen für zwei Tage, wenn er doch gewohnt war, dass Sabine ihre Kinder zur Welt brachte in nur wenigen Stunden? — Und dass sie schon nach drei Tagen wieder aufstand?
Und sein Haus blühte, seine Werkstatt vergrößerte sich von Jahr zu Jahr! Hatte er doch erst kürzlich einen dritten Lehrbuben einstellen müssen! Ja, bald sogar würde er Pferd und Wagen anschaffen, und er würde dann auch das vom Schwiegervater auf ihn gekommene Land, das er bisher verpachtet hatte, selber bewirtschaften, so wie es Sabines Wunsch schon seit langem war. — Oh, seine Sabine! Wenn sie nur erst wieder gesund wäre!
~
Dieser letzte Gedanke riss ihn zurück in die Gegenwart, und da wurde ihm bewusst, dass seine Älteste noch immer vor ihm stand, auf Antwort wartend, die Augen geduldig zu ihm emporgerichtet. Und er strich ihr übers Haar, lächelte, sagte: „Ja, bring den Brei nur herein, mein Kind!“ und setzte sich an den Tisch. Spürte, dass er rechtschaffen hungrig war. Und die andern wohl nicht minder.
In einer großen irdenen Schüssel brachte Martha den dampfenden Grützbrei herein. Er war freilich zu steif geraten, doch Martin lobte ihn, und das Kind wurde feuerrot, denn der Vater pflegte das Essen sonst weder zu loben noch zu tadeln. Was auf den Tisch kam, war gut! Weh dem, der ein Wort darüber verlor!
Die Geschwister hatten schon nach ihren Holzlöffeln gegriffen (nur die zweijährige Anna musste noch gefüttert werden) und fuhren eifrig in die große Schüssel — da wurde plötzlich die Tür aufgestoßen. „Holt den Doktor, Meister!“ rief die Alte. „Die Nachgeburt ist vorbei, aber das Blut will nicht stehen!“
Ein Glück, dass der Nachbar vom Felde zurück war. Er gab sein Pferd ohne ein Wort, als er des Meisters verstörtes Gesicht sah. Und während man zu Fuß für den Weg nach Rochlitz fast zwei Stunden brauchte, ritt ihn Krause in einer halben.
~
Als der Arzt in die Stube trat, war es schon Nacht. Er fühlte den Puls, der nur noch ganz schwach ging. Er ließ Decken wärmen und über den ausgebluteten Körper breiten, ließ Ziegelsteine erhitzen und, in Tücher gewickelt, links und rechts ins Bett legen. Dann flößte er der Kranken geduldig und mit vieler Mühe ein Getränk aus heißer Milch und Honig ein.
„Sorgt für völlige Ruhe!“ sagte er im Weggehen zu Martin, der in seinem Gesicht zu lesen suchte. „Und schont Eure Frau! Haltet ihr alles fern!“ — „Wird sie wieder aufkommen?“
,Wenn ein Wunder geschiehtʻ, wollte der Arzt sagen; doch schluckte er die Worte hinunter, als er in des Mannes verstörtes Gesicht sah, und nickte nur stumm.
~
Wie schwer es doch war, die Kinder vom Krankenzimmer fernzuhalten! Mit all ihren Sorgen und Freuden kamen sie sonst immer zur Mutter gelaufen, und nun stand der Meister ganz hilflos vor ihren Forderungen; hilflos, und auch verärgert. Martha, die Älteste, klagte: „Lene will nicht Schuhe putzen! Und Heinrich macht mir kein Holz klein!“ Lene aber verteidigte sich: „Martha schubst mich immer!“ Und Heinrich maulte: „Holz machen kann der Geselle, der Baltzer oder einer von den Lehrlingen! Ich muss zur Schule.
Die Mutter pflegte den Kindern in solchen Fällen zunächst gut zuzureden, und nur wenn das nicht half, gab es hie und da einmal Püffe — doch vor dem Vater verstummten sie bald mit ihren Klagen, denn er sah sie aus zornigen Augen streng an, dass sie sich fürchteten. (Vor der Mutter fürchteten sie sich nie, selbst dann nicht, wenn sie schalt und schlug.)
Einmal nur musste Martin sich den Leibriemen abschnallen und dem Heinrich, der nur ein Jahr jünger war als Martha, die Hosen stramm ziehn — dann hatte er Ruhe vor ihnen allen: Heinrich sorgte pünktlich für gespaltenes Holz, Lene putzte die Schuhe der jüngeren Geschwister, die auch sonst unter ihre Aufsicht gestellt waren, Martha aber, die man, als ein Mädchen, sowieso nicht zur Schule schickte, kochte das Essen und fegte die Stuben. Eine Frau kam zum Backen und Waschen, Baltzer, der Geselle, fütterte Ziegen und Schweine, und des Meisters Augen waren überall.
~
Nach vierzehn Stunden kam Sabine endlich zu sich. Sie schlug die Augen auf. Langsam, noch halb abwesend, sah sie sich um. Wo war sie denn? In einer Gruft? In einem tiefen Abgrund? Erschrocken tat sie einen leisen Schrei. Da fasste eine Hand nach der ihren.
Nein, sie war nicht gestorben. Sie lag in ihrer Stube, in ihrem Bett, und ihr Mann — saß neben ihr. Aber es musste doch tiefe Nacht sein, denn der abnehmende Mond stand am Himmel. Warum hatte sich Martin nicht niedergelegt?
Er ging in die Küche, holte ein Licht. Dann machte er Milch warm, flößte sie ihr ein. Hatte er im Dunkeln, in Kleidern neben ihr gesessen und ihren Schlaf bewacht? Wie lange schon?
„Was macht der Kleine?“ war ihre erste Frage. — „Die Zanderin hat ihn schon zweimal gestillt“, antwortete er. „Und sie will das auch weiter tun. Ihr Christian ist sechs Wochen alt, und sie hat Milch für zwei!“
Sabine war zu schwach, um dagegen Einspruch zu erheben. Später, wenn sie Milch hatte, würde sie ... Aber was sie würde, das wusste sie bereits nicht mehr, denn schon im nächsten Augenblick war sie wieder eingeschlafen.
~
Als sie erwachte, war heller Tag. Sie blickte sofort auf das Lager nebenan; sah, dass die Überdecke darüber gebreitet war. Hatte ihr Mann überhaupt in seinem Bett geschlafen? Oder war es unberührt geblieben die ganze Nacht?
Neben ihr, auf einem Küchenhocker, stand frische Ziegenmilch und Butter und Weißbrot. Aber sie war zu schwach, um sich das Brot herüberzulangen. Und doch fühlte sie Hunger. Nur tat er nicht weh — im Gegenteil, er beruhigte sie auf eine seltsame Art.
Wie still es war! Sie war das gar nicht gewöhnt. Von sieben Kindern weinte immer eines. Doch wo waren sie jetzt? Hatte eine Nachbarin sie zu sich genommen?
Sie fühlte sich plötzlich einsam. Wenn doch nur ihr Mann käme und ihre Hand fasste! Er hatte so gute, breite, starke Hände! Vielleicht würde er ihr erzählen, was um sie herum vor sich ging. Hatte sie nicht noch gestern ein tätiges Leben geführt? Sollte das mit einem Male von ihr abgefallen sein, wie ein Stein, der plötzlich einen Abhang hinabrollt?
Ob die braune Henne wohl schon brütig war? Und hatte man ihr nicht etwa zu viele Eier untergelegt? War, wie sie angeordnet hatte, Martins Reisepelz ausgeklopft worden, dass nicht die Motten hineinkamen? Sie hatte in den letzten Tagen schon eine fliegen sehn.
Und was ging in der Stadt vor? War nicht schon wieder Streit mit den Bauern der umliegenden Dörfer, die ihr Bier lieber selbst brauen wollten, statt das Geithener zu trinken? Aber die Stadt hatte doch nun einmal die alte Gerechtsame und daraus ihre Einnahmen! — eine Meile im Umkreis durfte niemand brauen, und umsonst schrien sie, das Geithener Bier sei schlecht! Auch von Freiberg und Rochlitz durfte keines gebracht werden, das war der Stadt verbrieft noch vom alten Herzog.
Aber nein, über all das würde ihr Mann nicht mit ihr sprechen. Denn er war wortkarg und war oft verdrießlich, ohne dass sie einen Grund dafür wusste. Wenn andere Männer aus der Innung kamen, erzählten sie doch, was beschlossen worden war und wen man eines Verstoßes wegen in Strafe genommen hatte, sie aber musste alles hintenherum erfahren — ja selbst dass man ihn ins Schaugericht seiner Innung gewählt hatte, verschwieg er ihr; und hätte nicht des Finohrs Frau sie dazu beglückwünscht, so wüsste sie es vielleicht heute noch nicht.
Die Finohrin war nicht ohne Neid gewesen, das hatte sie aus ihren Worten deutlich herausgehört, und doch war es Sabine nicht recht, dass ihr Mann dieses Amt angenommen hatte. In was für Verdrießlichkeiten konnte es ihn bringen, wenn er Strafen verhängen musste über Meister, die sich in ihrer Werkstatt Nachlässigkeiten hatten zuschulden kommen lassen. Denn Schluderarbeit duldete die Innung nicht! Wie viel Feindschaft konnte ihm daraus erwachsen!
Sie hatte ihm das zu bedenken gegeben, aber er hatte nur geantwortet: „Fragt man danach, wenn man tut, was nötig ist?“ Da war sie doch ein wenig stolz gewesen, denn das eine war sicher: Einen rechtlicher denkenden Mann, einen, der unparteiischer dieses Amtes waltete, würden sie nicht finden!
Und doch bedrückte sie die Unzugänglichkeit, mit der er sich umgab, und dass er ihr so selten eine Brücke baute, auf der sie zu ihm fand. Selbst wenn sie des Nachts in seinen Armen lag — litt sie da nicht manchmal unter einer Fremdheit, die sich trotz aller körperlichen Nähe, trotz Leidenschaft und Rausch wie eine unsichtbare Wand trennend einschob zwischen sie und ihn?
Ein Glück, dass die Kinder kamen, eines nach dem andern. Ihnen konnte sie Märchen erzählen und Lieder singen, konnte mit ihnen, als die Älteren schon verständiger wurden, besprechen, was sie bewegte — oh, es war so vieles! Ging sie doch mit offenen Augen und mit warmem Herzen durch die Welt!
Die Stadt war klein, und wenn sie auf die Straße trat, grüßte aus jedem Fenster ein bekanntes Gesicht. Fast in jeder Straße hatte sie Verwandte — bald machte hier ein Vetter Hochzeit, bald taufte dort eine Base ein Kind. Man kam zusammen, stritt sich und vertrug sich — aber auch zu ihren Verwandten musste Sabine meistens allein gehen.
Sie merkte es bald, dass sich ihr Mann in deren Kreis nicht wohlfühlte. Er war eben kein Einheimischer, sondern ein Zugewanderter. Weit war er herumgekommen, nicht nur in Zürich und in Innsbruck hatte er gearbeitet, sondern sogar in Venedig. Vielleicht störte es ihn, dass ihre Welt so klein war. Aber war sie auch klein, so war sie doch erfüllt!
Wie — bekam man in Venedig etwa andere Hühneraugen, wenn einem der Schuster die Schuhe zu eng angemessen hatte? Oder wurden in Zürich die Kinder nicht krank, wenn sie zu viel unreifes Obst aßen? Und wenn auch die Berge von Innsbruck viel höher waren als der Rochlitzer Berg — sicherlich waren sie das, sie wollte es ihrem Mann schon glauben! — so war doch der Stein, den man daraus brach, keineswegs schöner als der rote Porphyr, aus dem Meister Nikolaus, damals der beste Steinmetz der kleinen Stadt, Tor und Tür ihres Vaterhauses gemeißelt hatte.
Und alles in allem — hier war sie zu Hause! Hier war ihr Großvater Ratsschöppe gewesen — und war nicht der Geithener Schöppenstuhl nach dem Leipziger der berühmteste im Lande? — und die Felder, die nun verpachtet waren, stammten von ihm. Er hatte einen Meierhof vor der Stadt besessen, den aber musste die Großmutter verkaufen, als er so früh starb. Sein Bild hing im Rathaus, und sie meinte immer, sie könne sich noch an ihn erinnern, wie er mit seinem steifen Hut und dem Stock mit dem Silbergriff zur Tür hereingekommen war. Man erzählte sich, dass er die Absicht seiner Tochter, einen Zinngießer, einen Handwerker zu heiraten, sehr missbilligt habe und dass sie sich seine Erlaubnis ertrotzen musste — ob vielleicht das die Ursache gewesen sein mochte, dass ihre Eltern nicht glücklich wurden, die Mutter früh starb und der Vater verarmte? Aber trotzdem hatte sie keine freudlose Kindheit gehabt, denn in allen Schicksalsschlägen bewahrte sich ihr Vater seine sichere, herzhafte Art, mit dem Leben fertig zu werden. Er hatte ihr keine Reichtümer hinterlassen, denn Haus und Äcker waren mit Schulden belastet gewesen — was sie aber von ihm mitbekommen hatte, war mehr als das: eine leichte Hand, unter der Tiere und Blumen gediehen, eine starke Einbildungskraft, mit der sie sich heitere Bilder vor die Seele zwingen konnte, und eine große Genügsamkeit.
Martin hatte sie aus Liebe geheiratet. Er war nicht mehr ganz jung gewesen, als sein Stern — oder Unstern? — ihn in Geithen hatte Arbeit annehmen lassen, und sparsam genug, dass er eine eigene Werkstatt auf tun konnte, als es ihm an der Zeit schien, sesshaft zu werden. Dass er die Tochter eines Geithener Meisters heiratete, hatte ihm die Erlangung des Bürgerrechts allerdings erleichtert.
~
Die Tür bewegte sich in den Angeln, doch so leise, dass Sabine es kaum hörte. Sie lag mit offenen Augen im Bett, und als sie den Kopf wandte, sah sie Martins stattliche, hohe Gestalt den Türrahmen füllen. Erschrocken blickte sie auf: Sein Gesicht war ganz grau.
„Hast du nicht geschlafen?“ fragte sie leise.
Mit drei Schritten war Martin neben ihr. Es fiel ihm schwer, zu sprechen. „Iss!“ sagte er nur, und er schnitt ihr eine Scheibe Brot ab, die er mit Butter bestrich. Und während sie ein Stück abbiss, wandte er sich auch schon und ging wieder hinaus.
Dann schob er ihr Martha hinein. Die trat an der Mutter Bett und küsste sie. „Wo sind die Kinder?“ wollte Sabine wissen.
„Sie stehen draußen, dürfen sie kommen?“
„Ja!“ rief der Vater aus dem Nebenzimmer, „auf einen Augenblick, nur bis vor die Tür!“
Nun drängt sich Kopf an Kopf. Die Haare der Mädchen sind gezopft, die der Buben gebürstet, ihre Hände sind gewaschen. Nur Bastls Nase rinnt.
Sabine winkt ihnen, lächelt matt, und die Kinder ziehen leise wieder ab. Nur Martha bleibt zurück und fragt: „Brauchst du etwas, Mutter?“ — „Der Kleine! Bring mir den Kleinen!“ — „Der Vater hat es verboten!“
In dem Augenblick fühlt Sabine, wie ihr die Milch in die Brüste schießt. Ganz heiß wird ihr, und sie spricht wie im Traum: „Sag deinem Vater, ich brauche die Zanderin nicht! Sag ihm, er soll mir das Kind anlegen!“
Als der Kleine das erste Ungeschick überwunden hat und nun die Milch in vollen Zügen einsaugt, fangen plötzlich alle Glocken der Stadt zu läuten an. Die Mutter sieht fragend zum Vater auf: „Warum läutet man?“ — „Es heißt, dass Luther gestorben ist“, antwortet der Meister.
In diesem Augenblick kommt es Sabine erst ganz zu Bewusstsein, was es bedeutet, dass der Tod an ihr und dem Kind vorübergegangen ist. Sie fühlt sich zwar noch sehr schwach, aber doch klingt ihrem Ohr jeder Glockenton als eine große Verheißung. Und ihr ist, als ob ihr nicht nur das Leben, nicht nur der Sohn, sondern auch der Mann neu geschenkt worden sei.
~
Das also war die Welt, in die Johannes Krause Eingang gefunden hatte an einem kalten Februartag des Jahres 1546. Erst schien es, als wolle er sich, noch ehe er sich darin umgesehen, still und ohne ein Aufhebens zu machen wieder aus ihr entfernen — dann aber hatte er sich die Lungen voll Luft gepumpt und geschrien. Und als im Lande alle Glocken zu läuten begannen, während ein Toter von Eisleben nach Wittenberg überführt wurde, tat er den ersten Schluck an seiner Mutter Brust und hatte damit endgültig die Spielregeln dieses Lebens anerkannt, die für alle gelten: für den Kaiser wie für den Bettler, für den Propheten wie für den Böttcherssohn.
Satt lächelte er und ließ die Brust aus. Und der Vater legte ihn in die Wiege zurück.
Die Glocken sind verstummt. Die Grabplatte hat sich über den Toten gesenkt. Zu Füßen der Kanzel, von der er seine Worte hat ausgehen lassen — seine Worte, die so heiße Zustimmung gefunden, so leidenschaftliche Ablehnung erfahren, so viel Zusammengehen und so viel Zwietracht unter die Menschen gebracht haben — zu Füßen dieser Kanzel ruht er nun aus von seinem Kämpfen und Streiten.
Langsam leert sich die Schlosskirche von Wittenberg, die übervoll gewesen ist von all den vielen, die ihm das letzte Geleit gegeben haben: von Fürsten und Grafen, Professoren und Studenten, Bürgern und Weibern. Denn von nah und fern sind sie gekommen: die Abgesandten Johann Friedrichs, des Kurfürsten von Sachsen, seines gnädigen Herrn, unter dessen Schutz er sein Werk gestellt hat; die Grafen von Mansfeld, die den Leichenzug von Eisleben an begleiteten; der Superintendent von Halle, Justus Jonas, der Freund, der bei ihm gewesen ist in der letzten Stunde, und der trotz Kälte und schlechter Wege folgte; die vielen Geistlichen aus dem ganzen Lande; und sein Weib und die Kinder und seine Verwandten und Freunde, die den letzten Gang mit ihm getan haben unter heißen Tränen. Doch weiter geht keines Menschen Weg mit dem andern als bis zu der schmalen Gruft, über der sich die Grabplatte schließt.
~
Schwankend und von ihren Kindern gestützt schreitet die Doktorin dem Ausgang zu, und dicht dahinter folgt Justus Jonas, der um ein Trostwort ringt, es der Witwe des Freundes zu schenken, und dem doch der eigene Schmerz die Kehle zuschnürt.
Wie eine Flut einen Damm durchbrochen hat, strömt es aus allen Portalen der Kirche und ergießt sich in Wittenbergs Straßen und Gassen. Seit Menschengedenken hat die Stadt eine solche Menge Volkes nicht in ihren Mauern gesehn. Keine Herberge, die heute abend noch einen Schlafplatz frei hätte.
~
In der Nähe des Grabes, an einen Pfeiler gelehnt, steht einer jener jungen Magister der Universität, die der Ehre teilhaftig geworden sind, den Sarg des Toten vom Wagen zu heben und ihn auf ihren Schultern in die Kirche zu tragen. Während die Grabgesänge ertönten und die Kanzelworte zu Ehren des Verstorbenen erklangen, hat er sich nicht niedergesetzt, und nun, da alle Menschen die Kirche verlassen, schließt er sich auch dem Strom der Hinausstrebenden nicht an.
Reglos, wie erstarrt, steht er inmitten der Kirche. In dem schmalen bleichen Gesicht mit der scharf geschnittenen Nase und dem zusammen gepressten Mund scheinen nur die Augen zu leben — tief in den Höhlen liegende, nachtdunkle, heiße Augen.
Die Kirche ist beinahe leer — da fragt eine leise, fast kindlich weiche Stimme: „Wollt Ihr hierbleiben, Magister Matthias, bis man das Tor zusperrt?“
Als habe ein Schlag ihn getroffen, zuckt der Angesprochene zusammen und wendet den Kopf. Hinter ihm steht Peter Lucanus, der Jüngsten einer unter denen, die er in Hebräisch unterrichtet.
„Ist er nicht ein zweiter Cicero ...?"(obwohl Peter, der Heiligkeit des Ortes wegen, nur halblaut spricht, sind seine Worte doch in großem Eifer vorgebracht) „... ein zweiter Cicero, wie er die langen lateinischen Perioden vortrug?
Mit welcher Prägnanz des Ausdrucks, mit welcher Eloquenz ...!“
„Ihr meint den Magister Philippus ...?“ Die Stimme des Matthias Flacius scheint von weit herzukommen und sich nur mit Anstrengung in dieses Gespräch hineinzufinden. „Ja, Ihr mögt recht haben — vollendet in der Form war seine Rede, klar aufgebaut in der Disposition, wohlausgewogen in jedem Wort — nur — ohne Glut und Feuer, ohne Saft und Kraft, kühl bis in die Fingerspitzen!“
„Wie, Ihr meint, dass Melanchthon — dem Verstorbenen nicht das ihm gebührende Lob gezollt habe? Hat er ihn denn nicht zu den Größten gerechnet, die Gott zum Dienst in seiner Kirche berief? Kann man mehr sagen zu eines Mannes Ruhm, als dass man ihn mit Jakob und Josef, mit Moses und Jeremias in eine Reihe stellt — ja, mit Paulus und Jesus?“
~
„Als ich noch in meiner Heimat lebte, in Illyrien“, sagt Flacius — mehr wie zu sich selbst und ohne auf die Frage seines Gegenübers einzugehen — „da meinte ich, die ewige Wahrheit erringen zu können, wenn ich ein Mönch würde. Ich sprach darüber mit Baldo, meinem Vetter, der Minorit war. ,Du bist hungrig nach Gottʻ, sagte er, ,aber im Kloster wirst du ihn niemals finden. Jahrelang hab auch ich mich gequält mit Fasten und Kasteien — vergebliche Mühe! Hier, lies, was dieser Deutsche, dieser Augustiner, über die Möncherei sagt! Wenn ich noch so jung wäre wie du, ginge ich über die Alpen und setzte mich zu seinen Füßen nieder! Er hat Worte der ewigen Wahrheit — und Gott ist die Wahrheit!ʻ Und er gab mir die Schriften unseres Doktors, und ich las sie — nein, ich verschlang sie! Und als seine Mitbrüder die verbotenen Bücher bei ihm fanden und ihm den Prozess machten und ihn wie eine räudige Katze ersäuften, war ich schon längst mit zerrissenen Schuhen und leerem Beutel über die verschneiten Pässe gewandert. Kam zuerst nach Basel, wo sich gute Menschen meiner annahmen. Doch hielt es mich nicht dort, wo sie seine Lehre nur halb verstehen, es trieb mich weiter.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!