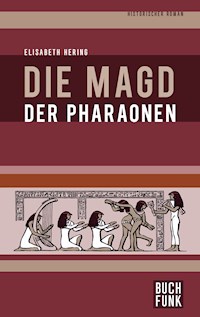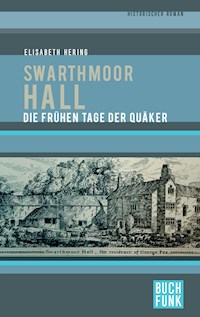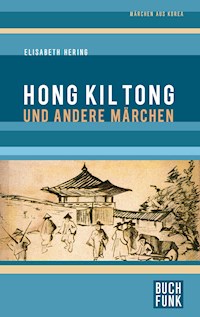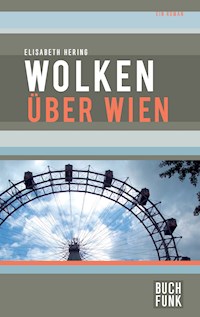
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BUCHFUNK Hörbuchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wien ist nicht immer die Stadt der Walzer und der Lebensfreude gewesen. In den Jahren 1927 bis 1934, in denen Elisabeth Herings Roman spielt, war die Hauptstadt Österreichs vom Fieber innerer Unruhen geschüttelt. 1927 kam es infolge eines Justizskandals zum Aufstand der Wiener Arbeiter und zum Brand des Justizpalastes, 1934 zu nationalistischen Unruhen und zur Ermordung des Kanzlers Dollfuß; der Faschismus begann auf Österreich überzugreifen. Diese Zeitumstände prägen die Entwicklung der Romanheldin, eines jungen Mädchens, dessen Mutter mit ihren beiden Töchtern von Siebenbürgen nach Wien übergesiedelt ist. Agnes Thieß macht sich von der konservativen Starrheit ihrer Familie frei; sie strebt nach persönlicher und beruflicher Selbstständigkeit. Sie verliert schließlich Familie und Heimat, gewinnt aber die Erkenntnis ihrer Lebensaufgabe und einen gleichgesinnten Freund, einen Architekten des Dessauer Bauhauses, mit dem sie als Ethnologin nach Mexiko geht. Der Roman entfaltet in spannenden Schilderungen ein breites Panorama der damaligen Situation in Österreich und Siebenbürgen. Er ist ein Entwicklungsroman, den man mit großer innerer Anteilnahme liest; gleichzeitig aber gibt er ein bewegtes Bild des Lebens in Wien, über dem die Bedrohung wie eine Wolkendecke hing. Schriftsteller, Wissenschaftler und Künstler, morbide Adlige und kämpfende Arbeiter, Satte und Hungrige, Geschäftemacher und Karrieristen, Menschen im Ringen um ihre wirtschaftliche und geistige Existenz und um eine bessere Zukunft ? sie alle kreuzen oder begleiten den Weg, auf dem das Mädchen Agnes unbeirrt Wahrhaftigkeit und Menschlichkeit sucht und zur verantwortungsbewussten Persönlichkeit wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 522
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ELISABETH HERING
WOLKEN ÜBER WIEN
« 1 »
Agnes stand am Fenster des D-Zuges und starrte in die Nacht hinaus. Der Himmel war verhangen, die Welt in tiefes Dunkel gehüllt; zu sehen war kaum etwas anderes als die Funken, die in glutroten Garben aus der Lokomotive emporgeschleudert wurden. Zwischen dem Mädchen und diesem Spiel des Feuer speienden Drachens mit der Finsternis zog sich ein Vorhang aus Eisblumen in bizarrem Spitzenmuster über das ganze Fenster hin. Sie hauchte ein Guckloch hinein und starrte hindurch, um eines der Bilder zu erhaschen, die da schattenhaft, in kaum enträtselbaren Umrissen, an ihr vorbeiflogen.
Es war ihre erste Nachtfahrt. Sie war siebzehn Jahre alt. Sie ließ ihr Haar noch in zwei braunen Zöpfen auf den Rücken fallen. Die Enden der Zöpfe ringelten sich wie Korkenzieher.
Marga und die Mutter schliefen im Abteil. Die konnten schlafen! Die Mutter hatte eine ganze Bank für sich. Sie lag auf der Seite, in ihr Reiseplaid gehüllt. Die Schwester hatte sich in eine Ecke gedrückt, hatte sich den Mantel übers Gesicht gezogen. Vorhang zu, Licht aus. Die Leute, die zustiegen, gingen an dem verdunkelten Abteil vorbei.
Aber fährt man so, dumpf und stumpf, in ein neues Land, in ein neues Leben?
Vorsichtig war Agnes über Margas lang ausgestreckte Beine gestiegen, hatte leise die Tür geöffnet (nur die Mutter nicht wecken, die hätte sie sofort zurückgerufen!) und sich auf den Gang gestellt. Er war fast leer. Nur an einem entfernten Fenster stand ein Mann (alt? jung? hässlich? hübsch? Agnes konnte es nicht erkennen, es war ihr aber auch gleichgültig) und rauchte eine Zigarette. Das war in den Abteilen verboten.
In ein neues Land!
Freilich nicht nach Deutschland. Aber war Österreich nicht ebenso deutsch? Hörte man in Wien mehr fremde Laute als in Berlin?
Alles verstehen, was gesprochen wird! Sich nicht wie zu Haus in Siebenbürgen die Zunge zerbrechen müssen, wenn man auf der Post auch nur einen rekommandierten Brief aufgeben will! Schon das ist viel — schon das! Aber dann erst all das andere!
In die Fremde kommen wie in ein schöneres, größeres Zuhause. Wer das nicht erlebt hat, kann es sicher nicht nachfühlen !
Nur ein Tag und eine Nacht trennten Agnes' Vaterhaus vom Wiener Stephansdom. Ein Tag und eine Nacht. Und diese Nacht war gekommen!
Manchmal blitzten Lichter auf, Lichter kleiner, verschlafener Bahnhöfe, denen der Orientexpress nicht einmal die Ehre erwies zu bremsen, wenn er über die auf Durchfahrt gestellten Weichen fuhr.
Jetzt eine Brücke, man hörte es am Ton. Schon wieder war das Guckloch zugefroren, aber die dünne Eisschicht wurde schnell abgewischt. Lichter tanzten auf der Schwärze des Flusses.
«Wie heißt dieser Fluss?»
Unwillkürlich hatte Agnes diese Worte laut ausgesprochen. Aber es war ein Selbstgespräch. Eine Antwort erwartete sie nicht.
Doch der rauchende Mann setzte sich in Bewegung, als habe er nur auf ein Signal von ihr gewartet. Jung war er. Der Schnurrbart ein Flaum.
Die Zigarette mit den Lippen festhaltend, zupfte er sich seine grüne Seidenkrawatte zurecht, schnipste mit gelben Raucherfingern etwas Asche von seinem tadellos sitzenden Anzug, verneigte sich höflich und fragte : «Mit tetszik parancsolni?»
Natürlich verstand Agnes die simple Frage, aber ihr war nach den Diensten dieses Fremden nicht zumute. Holpernde Konversation in einer Sprache, in der sie sich höchstens über Küchenprobleme unterhalten konnte? Danke schön. Köszönöm szépen! Sie streifte ihn mit schrägem Blick. Der Eifer, der in seinen Augen zu lesen war, belustigte sie ein wenig. Sie murmelte etwas, das wie «Spreche nicht ungarisch» klang, und wandte sich wieder dem Fenster zu. Der Jüngling verschwand.
Aber ihre Hochstimmung verflog. Würde sie zurückkehren nach Georgsburg? Konnte sie es? Die Mutter hatte das Haus verkauft. Warum? Das Haus mit dem hohen Giebel, mit den schön eingerichteten Zimmern, in die sie selber erst vor wenigen Jahren hatte Parkett legen lassen. Mit der verglasten Veranda, die im frühen Frühjahr wie im späten Herbst warm war, weil sie die Sonne von allen Seiten einfing, und im Sommer kühl, weil das Weinlaub ihr Schatten gab. Und den Garten mit dem schmiedeeisernen Tor. Mit dem Fliedergebüsch. Mit den Maulbeerbäumen, hinter denen der Bach floss. Er war schmal im Sommer, kaum mehr als ein Rinnsal, sie konnten trockenen Fußes über die dicken Steine springen, die sie selbst hineingeworfen hatten, um das Wasser ein bisschen zu stauen. Wenn man sich in diese Kuhle legte, konnte man mit Mühe und Not das Wasser zwingen, den ganzen Körper nass zu machen — aber man konnte den Lehm und den Sand nicht daran hindern, sich an dem Spiel zu beteiligen. Es war nicht leicht, rein aus diesem Bad zu steigen. Zu zweit schaffte man es, wenn man sich gegenseitig so lange abspritzte, bis man wieder sauber war. Wie unermüdlich Ruth darin gewesen war!
Ruth Tillmann, ihre Cousine und beste Freundin — einen Kopf größer war sie als Agnes, hatte ganz blondes, seidendünnes Haar, und unter den etwas zu stark hervortretenden Backenknochen verloren sich die Wangen in weicher Rundung. Etwas wie Widerstreit lag in ihrem Gesicht: Widerstreit zwischen Strenge und Zärtlichkeit, zwischen Anspruch und Schonung, Rechtlichkeit und Nachsicht. Doch als sie Agnes am Tor abpasste, war ihr kein Anflug von Zärtlichkeit, Schonung oder Nachsicht abzuspüren, hart fasste sie nach dem Arm der Freundin und sagte rau: «Deine Mutter hat doch gar nicht das Recht, euer Haus zu verkaufen! Nach dem Tode des Vaters erben die Kinder. Ihr steht nur die Nutznießung des vierten Teiles vom Vermögen zu.»
Agnes hatte ein Gefühl, als würde sie von Wegelagerern angefallen. Nichts ahnend kam sie aus der Klavierstunde nach Hause, nun rutschten die Noten, die sie unter dem Arm eingeklemmt hielt, zu Boden und lagen verstreut vor ihr auf dem Pflaster, und sie war so starr, dass sie keinen Finger regen konnte, um sie aufzulesen.
Was faselte Ruth? Etwas von einem Hausverkauf? Aber das konnte doch nicht ...
«Komm!» sagte sie tonlos. «Nicht hier!» Sie eilte voran, und es war Ruth, die sich nach den Noten bückte.
Ruths Mutter Wally und Agnes' Vater Franz waren Halbgeschwister. Deren Vater Andreas Thieß hatte die erste Frau früh verloren und hatte dann bald wieder geheiratet. Das Haus hatte Franzens Mutter gehört, so hatte Wally keinen Anteil daran. Aber selbstverständlich war sie mit ihren Eltern darin wohnen geblieben, auch nachdem sich Franz mit Viktorine Pieldner verheiratet hatte. Es waren ja zwei geräumige Wohnungen dort, eine im Ober-, eine im Untergeschoss, sie hatten alle reichlich Platz. Auch Rudolf Tillmann, den Wally heiratete, auch die Kinder, die in beiden Wohnungen dazukamen.
Franz Thieß hatte auch niemals ein Wort über Miete verloren. Aber Rudolf war ein viel zu korrekter Mensch, als dass er nicht darauf gedrungen hätte, einen angemessenen Preis für seine Wohnung zu zahlen. Seufzend hatte Franz Thieß nachgegeben: Der Schwager war Lehrer und verdiente wenig. Vielleicht war sein Selbstbewusstsein gerade darum so ausgeprägt und so leicht verletzbar. Nur als der alte Vater Thieß gestorben war, den Wally nach dem Tod ihrer Mutter betreut hatte, und Rudolf dessen Zimmer für sich in Anspruch nehmen und folglich mehr Miete bezahlen wollte, hatte sich Franz Thieß das energisch verbeten. Fast wäre es zwischen den Schwägern deswegen zu einem Streit gekommen, aber Viktorine hatte sich ins Mittel gelegt. «Du kannst ja», sagte sie zu Rudolf, «unsern Töchtern Unterricht in Englisch geben.»
Eine Folge hatte sie freilich nicht vorausgesehn. Je mehr Agnes in der Tillmannschen Wohnung aus und ein ging, desto heimischer fühlte sie sich dort. So kam es, dass sie nach dem Unterricht gewöhnlich so lange blieb, bis die Mutter das Dienstmädchen nach ihr schickte. Nicht immer konnte sich Viktorine dazu entschließen. Sie fühlte, dass sie damit ihre Eifersucht eingestand.
Der Geist, der im Tillmannischen Hause herrschte, könnte am besten mit den Worten Wallys gekennzeichnet werden: «Wir haben nur materielle Sorgen.» Über die wurde freilich wenig gesprochen. Dafür um so mehr über Gott und die Welt. Marga entzog sich diesen Gesprächen immer sehr bald. Agnes aber stürzte sich mit Leidenschaft in alle Debatten, und da Ruth ihr mit Vorliebe Widerpart hielt, übte sie sich in der Kunst, die Gedanken auf die Spitze zu treiben. Darin wetteiferten sie miteinander wie als Kinder beim Ballspiel: Wer wirft höher, wer wirft weiter, wer trifft besser?
Aber diesmal war es bei Ruth kein Spiel mit Worten und Begriffen, als sie der Freundin berichtete, was sie gehört hatte.
Die Stimme der Mutter: «Du bist der Vormund der Kinder meines Bruders. Du darfst es nicht zulassen, dass Viktorine das Haus verkauft. Sie hat kein Recht dazu!»
Die des Vaters: «Sie hat gesagt, dass Franz schlecht gewirtschaftet hat. Dass nach Auflösung seines Geschäftes ein Defizit blieb ... »
«Schulden? Mein sparsamer, gewissenhafter, anspruchsloser Bruder Schulden?»
«Er war ein kränklicher Mann. Und während des letzten halben Jahres hat sein Geschäftsführer ... »
«Geschäftsführer! Geschäftsführer! Und sie konnte nicht nach dem Rechten sehen? So klug, so tatkräftig — aber statt einzugreifen, sieht man zu. Weil man sich zu gut ist. Weil man ... »
«Spar deine Vorwürfe, Wally! Mach nicht böses Blut! Am Ende heißt es noch, du wollest nicht, dass dieses Haus verkauft werde, damit wir unsere billige Wohnung nicht verlieren.»
Wörtlich gab Ruth das Gespräch ihrer Eltern wieder. Tränen standen ihr im Gesicht. Sie schluckte sie aber hinunter und sagte: «Du musst deiner Mutter die Stirne bieten!» So gewählte Ausdrücke benützte sie gern. Sie bezog sie aus den vielen Büchern, die sie las.
Aber Agnes lachte bitter auf und erwiderte: «Versuch du es doch einmal, meiner Mutter die Stirne zu bieten!»
Agnes dachte, Marga eine Neuigkeit zu bringen, als sie vom Hausverkauf zu sprechen anfing. Die Schwester aber antwortete: «Ich weiß. Die Mutter hat es mir gesagt. Sie will uns von dem Geld die Aussteuer kaufen: Möbel, Wäsche, Kleider — alles, was wir brauchen.»
Zorn stieg in Agnes hoch. Also mit Marga war das alles abgekartet. Und mit ihr hatte die Mutter nicht not, darüber zu sprechen. Sie war noch zu jung, zu unverständig, nach ihrer. Meinung wurde nicht gefragt. Ihre Stimme wurde ganz brüchig, als sie fragte: «Und wohnen? Wo sollen wir wohnen, wenn wir das Vaterhaus verlieren?»
«Wohnen?» Viktorine stand plötzlich neben den Töchtern, sie hatte wohl dem Gespräch zugehört.
«Wir fahren zur Fannytante nach Wien. Ihr sollt euch in der Welt ein wenig umsehn, ehe ihr euch irgendwo festsetzt.»
Und Agnes, so überrascht, so berührt, so aufgewühlt von dieser Eröffnung, vergaß alles, was zu sagen sie sich ein Herz hatte fassen wollen, und fiel der Mutter um den Hals. Der Gedanke an Wien faszinierte sie, und ihre Tante Stefanie von Lärch kennenzulernen war schon längst ihr sehnlichster Wunsch gewesen.
«Ihr habt euch bestechen lassen!» grollte Ruth. «Marga mit schönen Kleidern, du mit der Aussicht auf große Erlebnisse.»
«Pah», machte Marga, der Agnes diese Äußerung der Cousine weitertrug. «Neidisch ist sie! Auf unsre schönen Kleider, weil sie keine hat, und weil sie ihr auch gar nicht stünden. Sieh sie dir doch an, die Hopfenstange!
Und dann: Reisen. Nicht einmal ihre Mutter hat jemals den Rand unserer Karpaten gesehn, geschweige denn darüber hinaus. Sie ist ja zu bedauern, die arme Ruth: so mittellos und dabei nicht einmal hübsch. Ein Glück für sie, dass sie Lehrerin wird. Sie würde sowieso keinen Mann bekommen.»
Aus Marga sprach die Mutter. Agnes hörte sie deutlich heraus, diese in hundert Variationen geäußerte mütterliche Ansicht: «In zwei Fällen hat ein Mädchen Aussicht, glücklich zu werden: wenn es reich ist, oder wenn es schön ist. Ist es reich, dann ist es eine gute Partie. Ist es schön, dann kann es eine gute Partie machen.»
Marga und Agnes, die Töchter von Franz und Viktorine Thieß, waren nicht reich, aber sie waren schön.
« 2 »
Stefanie von Lärch stand am Bahnhof und erwartete die Schwester mit ihren beiden Töchtern. Einen größeren Unterschied als zwischen ihr und Viktorine kann man sich kaum vorstellen. Stefanie klein und zierlich, mit etwas lässiger Haltung, aber mit raschen, fast hastigen Bewegungen, Viktorine hochgewachsen und so aufrecht und gemessen schreitend, als trüge sie ein Korsett. Stefanie: Dunkle Locken, die aus jeder Frisur ausbrechen und ihr rundliches Gesicht etwas wirr, aber reizvoll umrahmen. Viktorine: langes, schlichtes, aschblondes Haar, zu einem griechischen Knoten geschlungen, der ihr klassisches Profil noch besser zur Wirkung kommen lässt. Stefanie: Weiche, leise Stimme, einschmeichelnd, um Zustimmung werbend. Viktorine: jedes Wort betont und selbstsicher, wie «So ist es und kann nicht anders sein!» Stefanie: ein Lächeln in den Augenwinkeln, ein Ausdruck von Kindlichkeit in seltsamem Gegensatz zu all den Linien, die das Leben in ihr Gesicht gezeichnet hat. Viktorine: ein Anflug von matronenhafter Strenge, trotz glatter, faltenloser Haut.
Nun haben sie sich im Menschengewühl erkannt. Nun eilen sie aufeinander zu.
Viktorine musste sich etwas neigen, um die Schwester zu umarmen. Dann richtete sie sich wieder steil auf. «Marga!» rief sie, «Agnes! Kommt und begrüßt eure Tante!»
Die kleine Frau wurde von den weit größeren Mädchen so stürmisch bedrängt, dass sie fast das Gleichgewicht verlor. Lachend befreite sie sich und sagte: «Nun lasst euch ansehn! Welche von euch ist Agnes? Du? Aber du bist ja deiner Schwester schon über den Kopf gewachsen!» Lächelnd wandte sie sich Viktorine zu. «Genau wie du mich überholt hattest, Vicky, und genau im gleichen Alter!»
«Nur in der Länge!» antwortete Viktorine, merkte aber sogleich, dass sich dieses Wort, das sie auf die jüngere Tochter gemünzt hatte, ebenso auf sie selbst bezog, und in ihrer Eitelkeit ärgerte sie sich darüber. «Hast du einen Fiaker bestellt, Fanny?» fragte sie ablenkend.
«Warum Fiaker? Die könnt ihr bald im Museum suchen. Aber Taxis stehen genügend vor dem Bahnhof. Wir müssen uns nur nach einem Träger umsehn.»
Ein strahlend heller Vormittag. Am Himmel keine Wolke. Die Straßen frei von Schnee, der nur an ihren Rändern noch, braun verkrustet, ein jämmerliches Dasein fristete.
Aber ein eisiger Wind fegte über den Bahnhofsvorplatz, so dass Viktorine aufatmete, als das Gepäck verstaut war und sie alle im Auto saßen.
Marga rekelte sich im Fond. Agnes drückte sich am Fenster die Nase platt. Wie breit die Straßen! Wie prächtig die Häuser! Was, Häuser — Paläste mit säulengeschmückten Portalen, mit reich verzierten Erkern, mit schmiedeeisernem Gitterwerk an den Balkonen!
Wer kann alles sehen, alles aufnehmen, was da entgegenstürzt und Verschwindet? Nur gut, dass es ab und zu rotes Stopplicht gibt und der Wagen halten muss, dann gewinnt man Zeit, um zu fragen: «Was ist das?»
«Die Kuppel dort hinten, am Ende der Platanenallee? Das ist Schloss Belvedere, das Schloss des Prinzen Eugen. Da führe ich euch bald einmal hin. Gemälde gibt's dort! Und Skulpturen! Und einen zauberhaft schönen Blick auf die Innenstadt, besonders jetzt im Winter, wenn das Laub die Sicht nicht verdeckt!»
«Ja, morgen schon, Fannytante! Und zu Fuß! Solange noch der Raureif an den Parkbäumen hängt!»
«Da werdet ihr schön frieren bei dieser Kälte», sagte Viktorine und schlug sich den Pelzkragen hoch.
« 3 »
Der Wagen hielt, aber Viktorine erkannte das Haus nicht wieder. «Hier hast du», fragte sie gedehnt, «vor fünfzehn Jahren Hochzeit gehalten?»
«Ja», gab Stefanie zurück, während sie Geld aus dem Täschchen kramte, das sie dem Fahrer in die Hand drückte, «über diesem Portal hier hing im Jahre 1912 — genau gesagt, am 27. Juni 1912 — eine Girlande aus weißen Rosen, wie sie meine Schwiegermutter bestellt hatte.»
«Aber stand denn nicht» — Viktorine konnte sich in ihren Erinnerungen immer noch nicht zurechtfinden — «stand nicht rechts und links der Stufen eine Skulptur?»
«Ganz richtig. Die ,Schweigenden Engel', wie ich sie nannte, von Glaser, einem Schüler Rodins.»
«Und ... ?»
«Weggeflogen!»
Stefanie sagte das in einem Ton, der der Schwester alle weiteren Fragen in der Kehle erstickte, nahm dann einen Koffer, und auf einen Wink ihrer Augen taten die Nichten das gleiche. Schweigend griff auch Viktorine zu. Vielleicht war die Köchin krank, und das Dienstmädchen hatte gerade Ausgang.
Ausgang? Wenn Gäste erwartet wurden?
Stefanie stieß die Tür zum Vestibül auf. Viktorine erinnerte sich deutlich des Eindrucks, den dieser Raum auf sie gemacht hatte, als sie ihn zum ersten Mal betrat.
Schon seine Größe! Wenn man die Stiege mit einrechnete, die aus diesem Vestibül ins Obergeschoss führte, maß es seine vierzig bis fünfzig Quadratmeter, und seine Höhe ging bis zu dem von Säulen gehaltenen Dachstuhl. Denn zu den Zimmern des ersten Stockes gelangte man über eine Balustrade, die in entsprechender Höhe um den ganzen Raum herumführte.
Und dann die Ausstattung! Diese Gobelins, diese Armleuchter, diese intarsiengeschmückten Schränke, diese Spiegelnischen! Nun trat sie ein und prallte fast zurück vor der gähnenden Leere des Raumes, die seine Ausmaße freilich noch eindrucksvoller zur Erscheinung brachte, aber doch auf Viktorine wirkte wie ein Schlag gegen die Brust. Wo war der breite Tabernakelschrank, der seine beiden Flügeltüren so breit geöffnet hielt wie ein Hausherr die zur Geste des Willkomms ausgestreckten Arme? Wo die schwere geschnitzte Eichentruhe mit dem kostbaren ziselierten Messingbeschlag? Wo die Vitrine mit den kostbaren altitalienischen Fayencen? War statt aller Wandbehänge lediglich die rohe Schilfmatte unter den Kleiderhaken übrig geblieben? Musste man seine Garderobe nun an diese plumpen Haken hängen und der Eiseskälte eines Raumes aussetzen, in dem die Zentralheizung offensichtlich nicht funktionierte?
Viktorine zögerte, sich auszuziehen, doch es half ihr nichts. Die Mädchen waren schon aus den Mänteln geschlüpft und halfen ihr aus dem ihren. Stefanie ging auf eine der Türen zu und klopfte an.
Ein dünnes «Herein» war zu hören. «Beeilt euch», sagte Stefanie, «dass nicht zu viel Kälte eindringt. Meine Schwiegermutter ist sehr empfindlich.»
Afra von Lärch saß in einem Rollstuhl. Wie eine Porzellanfigur, dachte Agnes, als sie das aus den steifen Rüschen einer Seidenbluse sich vorstreckende gepuderte Gesicht sah, in dem nur die wasserhellen Augen zu leben schienen.
«Man küsst ihr die Hand!» flüsterte Stefanie.
Die Hand — eine welke Hand — lag über der Armlehne des Sessels. Sie streckte sich den Gästen nur zitternd entgegen. Marga war die erste, die sich darüber neigte. In Agnes bäumte sich etwas auf gegen diese ungewohnte Zeremonie, aber als sie sogar die Mutter ohne Zögern das gleiche tun sah, dachte sie: Da muss man eben mitspielen! Eckig genug fiel ihre Verbeugung aus.
«Also das sind deine lieben Verwandten, Stefanie?» fragte die alte Dame, nachdem sie die Begrüßung mit dem ihr anerzogenen Lächeln über sich hatte ergehen lassen. «Hast du der Theres gesagt, dass sie ihnen die Zimmer herrichten soll?»
«Ja, Mama!» Stefanie betonte dieses Wort auf der letzten Silbe, wie es die Franzosen tun, und es klang den Mädchen so ungewohnt, dass Agnes Marga in die Seite stieß und beide sich das Lachen kaum verbeißen konnten.
«Schöne Töchter hast du, Viktorine — wirklich schöne Töchter!» sagte die Greisin. «Da ist es nur gut, dass sich die Zeiten so gewandelt haben! Nun wird man sie bei Hofe vorstellen können!»
Diese Worte erschreckten Viktorine so, dass ihr der Schweiß ausbrach. Ratlos wandte sie den Kopf der Schwester zu, und die machte ihr ein Zeichen, das sie am Sprechen hinderte.
«Mama», sagte Stefanie, «hast du etwas dagegen, mit den beiden Mädeln eine Partie Mariage zu spielen?»
Die Augen der alten Dame leuchteten auf. «Mariage», sagte sie ganz glücklich. «Wie spielt ihr das? Einfaches Melden gilt zwanzig, in Atout vierzig, und man muss Farbe bekennen oder mit Atout stechen?»
«Nur beim letzten Stich!» wandte Marga ein.
«Nur beim letzten Stich? Ihr seid wohl Bolschewiken? Nein, von Anfang an: Farbe oder Atout!»
Ihre Augen funkelten plötzlich ganz böse, Agnes sah erschrocken zu Boden, und Marga mischte wortlos die Karten. Stefanie aber gab der Schwester einen Wink, und sie gingen beide aus dem Zimmer.
«Um Gottes willen!» sagte Viktorine, als sie draußen waren, «was ist denn mit deiner armen Schwiegermutter? Die ist doch ganz durcheinander!»
«Ja, leider wird es immer schlimmer mit ihr. Nach dem Tode ihres Mannes, das ist jetzt sechs Jahre her, erlitt sie einen Schlaganfall. Und obwohl die Lähmung fast ganz zurückgegangen ist, sie wieder greifen und sogar ein paar Schritte im Zimmer tun kann, werden ihre Reden immer wirrer. Sie lebt nur noch in der Vergangenheit und versteht die heutige Zeit überhaupt nicht.»
Sie hatten den Vorraum durchschritten und standen nun in der Küche, die kalt war wie eine Gruft, denn in dem großen weiß gekachelten Herd brannte kein Feuer.
«Wenn du willst, kannst du mir bei der Vorbereitung des Mittagessens helfen», sagte Stefanie. «Die Kartoffeln sind zwar schon geschält, aber die Schnitzel müssen geklopft und der Sprossenkohl geputzt werden.»
«Und eure Köchin? Ihr habt doch immer noch die alte Theres, das Faktotum, das dir schon vor fünfzehn Jahren den Hochzeitsschmaus ... ?»
«Ach, Vicky, du denkst, 'weil die Mama mir einen Auftrag an sie gab ... Theres ist schon seit sieben Jahren tot, aber täglich lässt die Mama ihr Aufträge zugehn, ähnlich diesem, dass sie die Zimmer für euch herrichte. Wir haben nämlich gar keine ,Zimmer'.»
Keine Köchin, keine Zimmer, und in diesem Eispalast von Küche sitzen und Gemüse putzen? Viktorine sprach es nicht aus, sah die Schwester nur verstört an.
Die stieß eine schmale Tür auf.
Eine enge Kammer. Ein Schrank, ein Tisch, zwei Stühle, ein Bett. Und ein Kanonenofen, der Hitze spie. Fast zu viel Hitze.
«Hier wohne ich», sagte Stefanie. «Hier können wir das Essen vorbereiten, ohne zu frieren. Und uns aussprechen, ohne dass uns jemand zuhört.»
«Hier wohnst du? In der Mägdekammer? Ist denn im ganzen großen Haus kein anderer Raum für dich als dieser?»
«Ist das so schlimm? Ich bin froh, dass ich ordentliche Mieter habe. Die obere Wohnung ist im Ganzen vergeben. Bankleute, kinderlos, mit zwei Dackeln. Die Hunde machen wenig Lärm, nur gerade auf den Stiegen, beim Hinauf- und Hinuntergehen, hörst du sie, wenn ,Frauchen' sie ,äußerlt'.
Die obere Kammer, gleich neben dem Bad, hab ich ihnen als Küche eingerichtet. So hab ich keine Scherereien. Und die unteren Zimmer hab ich einzeln vermietet. Kost und Logis für Ledige, weißt du, das bringt mehr ein. Ein Student, ein Sänger, eine Lehrerin. Wenn ich für die alle koche, essen wir zwei Frauen auch noch mit. Was wir schon brauchen. Die arme Mama isst nur noch wie ein Vogerl.»
«Und das fünfte Zimmer? Es waren doch fünf in jedem Stockwerk!»
«Wie du dir das alles gemerkt hast, Vicky! Ja, fünf. Das letzte bewohnt mein Schwager Axel, wenn er sich in Wien aufhält.»
Sie sagte das so beihin, wie man Belanglosigkeiten erwähnt, und wollte noch etwas hinzufügen, was sich auf ganz andere Dinge bezog, aber Viktorine ließ es nicht dazu kommen. «Dann hast du ja», rief sie, «gar kein Quartier für uns! Aber warum hast du mir das nicht geschrieben? Ich wäre doch nie nach Wien gekommen, wenn ich gewusst hätte, wie es hier steht!»
«Eben drum!» sagte Stefanie sehr herzlich. «Ich wollte, dass ihr kämet. Du brauchst doch eine Abwechslung, jetzt, nach all dem Schweren, das du erlebt hast!»
Viktorine schwieg. Stefanie fühlte, dass die Schwester bedrückt war. «Es ist doch nicht schlimm!» sagte sie im Tone guten Zuredens. «Ich habe euch in der Pension Adami ein Zimmer bestellt. Gleich hier um die Ecke. Keine fünf Minuten entfernt.»
Sie sah dabei die Schwester ängstlich an. Kannte sie doch das ungeschriebene Gesetz ihrer Heimat: Gäste beherbergt man in der eigenen Wohnung! In einem Hotel untergebracht zu werden, empfänden sie als eine Beleidigung.
Doch Viktorine setzte nicht die ihrer Schwester so wohl bekannte Miene eisiger Ablehnung auf, als Stefanie ihr diese unliebsame Mitteilung machte, sondern fragte nur tonlos: «Wie ist das möglich? Wie ist das bloß möglich?»
«Was?» Stefanie verstand nicht gleich.
«Dass es dir so schlecht geht! Hattest du denn nicht das Große Los gezogen? Hineinzuheiraten in eine Familie, die nicht nur reich war, sondern dazu noch adlig! Und einen Mann zu bekommen, der deinetwegen seine Karriere aufgab!» «Meinetwegen?»
«Nun ja, war es nicht so? Zog er nicht des Kaisers Rock aus, weil du die Kaution nicht hattest und sein Vater, der mit seiner Wahl nicht einverstanden war, ihm das Geld dazu nicht geben wollte? Nahm er nicht darum die Stellung als Vertreter einer großen österreichischen Firma in Konstantinopel an, um dir, unabhängig vom Geld seines Vaters, ein glänzendes Leben zu verschaffen? Und söhnte sich der Vater nicht mit ihm aus, als er dich kennenlernte und du ihn mit deinem Charme ebenfalls bezaubertest?»
«Wer hat dir das alles erzählt?»
«Dein Schwager Axel selber!»
Stefanies Mundwinkel zuckten verächtlich. Axel! Das hätte sie sich denken können!
«Ist es denn nicht wahr?»
Nein, es war nicht wahr! Es war alles anders gewesen, völlig anders. So: Ein Konzert, in dem das erste Werk eines jungen Komponisten aufgeführt wurde. Und Stefanie bekam von Bekannten eine Karte geschenkt, die ein Abonnement hatten, aber keine Lust, sich das Konzert anzuhören.
Auch ihr hatte es nicht gefallen. War das noch Musik? Diese Töne, die dem Ohr in keiner Weise schmeichelten, nein, es beleidigten, es verletzten, ihm wehtaten! Zorn stieg in ihr auf, am liebsten hätte sie ihm ebenfalls durch Pfeifen Luft gemacht, wie einige junge Leute in den letzten Reihen es taten, nur war sie dazu zu gesittet.
Aber nach dem Konzert warf sie sich den Mantel über und stürmte hinaus, sie fuhr auch nicht mit der Straßenbahn, sondern nahm den Weg unter die Füße, weil es ihr guttat, dass der Wind ihr um den Kopf pfiff und ihre Erregung etwas abkühlte.
Da hörte sie Schritte hinter sich, und neben ihr tauchte ein junger Leutnant auf, der es offenbar darauf angelegt hatte, sie einzuholen.
«Gut haben sie getan, ihn auszupfeifen, jetzt weiß er wenigstens, was er wert ist, dieser Schönberg!»
Wahrscheinlich hätte sie ein andermal auf eine solche Anbiederung überhaupt nicht reagiert. Wäre ihres Weges gegangen, hätte den Zudringlichen abgeschüttelt.
Damals aber, im Banne ihrer Auflehnung gegen etwas, das sie als Lästerung empfand (denn sie liebte die Musik, die ihre Vorstellung mit schönen Bildern, ihr Herz mit guten Gefühlen, ihren Kopf mit großen Gedanken erfüllte, und diese hatte das Gegenteil bewirkt, sie entleert, sie fast krank gemacht!), damals überwand die Freude, einen Gleichgesinnten gefunden zu haben, ihre anerzogene Zurückhaltung, sie sah ihm voll ins Gesicht und rief: «Ja, nicht wahr ... »
Er ließ sie nicht aussprechen. «Es sind die gleichen», fuhr er fort, «die auch den Beethoven ausgepfiffen haben zu seiner Zeit!»
Und dann blieb er stehen und richtete eine Feuergarbe von Anwürfen gegen diese Hohlköpfe, wie er sie nannte, diese Finsterlinge, diese Jammerfinken, die keinen auch nur um eine Sprosse höher steigen lassen wollen, als sie selbst auf der Lebensleiter zu erklimmen vermögen. Wie er sich steigerte, im Ausdruck, im Stimmaufwand, bis er zum Schluss ausrief: «Endlich einer, der das ewige Beschönigen satt hat! Der der Welt zeigt, wie sie ist! Denn die Rechnung geht nun einmal nicht auf! Man kann es versuchen, womit man will: mit Kunst, mit Moral, mit Religion — immer bleibt ein Rest, eine imaginäre Zahl, die es eigentlich gar nicht geben kann und doch gibt! Regeln und Rezepte? Die braucht man nur, um sie über den Haufen werfen zu können. Aber wenn einer dazu den Mut aufbringt, so schlägt man ihm eben den Schädel ein.»
Stefanies Zorn hatte sich bei all seinen Worten nur gesteigert, und nun, da er sich wie erschöpft an den Pfahl einer Gaslaterne lehnte, wollte sie ihm ihren Widerspruch ins Gesicht schreien. Doch als sie seine von dem fahlen Licht angestrahlten Züge sah, vermochte sie es nicht. Alle Musik dieses Abends spiegelte sich in ihnen: Schmerz, Auflehnung, Vermessenheit — Zertrümmerung einer Welt!
Als Stefanie das alles aufbrennen und dann plötzlich in sich zusammensinken sah wie eine Flamme, die nicht mehr genährt wird, ließ sie alle Vorwürfe in ihre eigene Seele zurückfallen und fragte nur leise: «Warum sind Sie Offizier geworden — und nicht Musiker?»
Da packte der Mann sie am Handgelenk. «Warum? — Warum? —Warum?» — (jedes Warum in einem andern Ton.)
Dann ließ er ihre Hand frei. «Darum!»
Den Schmerz, den sein heftiger Druck ihr verursacht hatte, spürte sie in jener Nacht noch im Traum.
Von da an passte er sie jeden Abend ab, wenn sie aus dem Modesalon, in dem sie arbeitete, nach Hause ging. Erst ließ sie sich von ihm nur bis zur Haustür bringen, aber schließlich nahm sie seine Einladungen an, fuhr mit ihm in den Prater, auf den Kahlenberg, in den Wienerwald.
Wie er sprechen konnte, philosophieren, erzählen! Und singen! Nicht wie irgendein dummer Tenor, der das mit der Kehle reproduziert, was ihm ein anderer mit dem Kopf vorgegeben hat, o nein! Seine Lieder dichtete er sich selbst, und er vertonte sie selbst; oft entstanden sie in plötzlicher Eingebung, Verse und Melodien, und er sang sie aus sich heraus, ganz unvermittelt, ohne greifbaren Anlass.
Einmal nahm Stefanie einen Bleistift, um sie festzuhalten, da wehrte er ab. «Lassen Sie das! Die Lieder sind zu schad fürs Papier!»
Nach ein paar Wochen, in denen er jede freie Minute mit ihr zugebracht hatte, blieb er plötzlich ohne jeden Grund, ohne jede Erklärung aus. Er hat genug von mir! dachte sie bitter. War sie ihm nur dazu gut gewesen, seine Selbstgespräche, seine Selbstdarstellungen anzuregen? War er nur darüber froh gewesen, dass sie den Flug seiner Gedanken nicht durch alberne Zwischenbemerkungen unterbrach? Und scheute er sich, einen Schritt weiter zu gehn — den Schritt von sich zu ihr?
Sei's drum! Sie wollte ihm keine Träne nachweinen. Täglich, wenn sie von ihrer Arbeitsstelle nach Hause ging und in jedem Uniformierten, den sie von Weitem erblickte, Guido zu erkennen wähnte, sie mochte wollen oder nicht, sagte sie sich: Etwas Gutes kann ja aus dieser Geschichte nicht herauskommen — etwas Gutes nicht! Und schließlich redete sie sich ein, er sei ihr gleichgültig geworden.
Bis er nach Monaten wieder vor ihr stand: etwas salopp in der Haltung, mit lachenden Augen und einer kleinen Verlegenheit in den Mundwinkeln, die sie entwaffnete.
«Sind Sie mir böse? Ich bin strafversetzt worden. Dürfte gar nicht hier sein!»
«Und schreiben konnten Sie nicht?»
«Schreiben? Wie macht man das?»
Nach weiteren brieflosen Monaten suchte er sie zum ersten Mal in ihrer Wohnung auf. Diesmal in Zivil.
Er sprach kaum ein Wort, rauchte nur eine Zigarette nach der andern. So fremd war er ihr, dass sie meinte, nun sei das Ende ihrer Freundschaft unweigerlich gekommen.
Schließlich aber kam ihr sein Gebaren doch so seltsam vor, dass sie sich sagte, es müsse etwas Besonderes dahinterstecken. So fragte sie ihn geradezu danach.
«Sie haben recht», sagte er, «mein Vater will, dass ich heiraten soll.»
Sie zwang sich zu einem Lächeln. «Die alte Geschichte?» fragte sie. «Eine standesgemäße Braut, die dem Sohn nicht behagt?»
«Wenn es nur das wäre! Nein, es ist viel schlimmer. Ich habe meinen Abschied nehmen müssen, und jede standesgemäße Braut würde mir den Verlobungsring vor die Füße werfen.»
«Ja, aber warum das?»
«Ich bin in einen Skandal verwickelt worden, in einen Skandal, der vertuscht werden soll, weil sonst einige Namen — hohe und höchste Namen — befleckt sein würden. So haben alle Betroffenen schleunigst den Dienst quittiert, damit kein Ehrengericht zusammentreten und ihnen ihre Unwürdigkeit, des Kaisers Rock zu tragen, bescheinigen muss.»
«Und in dieser Lage wollen Sie heiraten? Wo es doch besser für Sie wäre, über die ganze Geschichte erst einmal Gras wachsen zu lassen.»
«Ich will ja auch gar nicht! Aber mein Vater drängt mich, weil er meint, dass dadurch gewissen Gerüchten die Spitze abgebrochen werden könne. Und er will seinen Einfluss dazu verwenden, mir eine einträgliche Stellung im Ausland zu verschaffen, aber nur unter der Bedingung, dass ich ihm binnen vierzehn Tagen eine Schwiegertochter präsentiere!»
Mit einem Mal durchfuhr es Stefanie wie ein Schock: Das sollte eine Werbung sein! Eine Werbung, die er direkt nicht anzubringen wagte. Und heute wusste sie: Es war die wirksamste, die er sich hätte ausdenken können. Nie in ihrem Leben hatte sie eine so ungeheure Steigerung ihres Selbstgefühls erfahren wie in jenem Augenblick, da dieser Mann die Vorstellung in ihr erweckte, sie sei dazu bestimmt, zwischen ihn und sein Verhängnis zu treten.
Sie fragte nicht einmal, was es mit dem Skandal auf sich hatte, in den er verwickelt war. Sie hätte sich denken können, welcher Art die Gerüchte waren, denen mit einer raschen Heirat die Spitze abgebrochen werden sollte, zumal sie den Namen dessen erfuhr, der gedeckt worden war: Erzherzog Ludwig Viktor! Aber sie wollte so weit nicht denken.
Da saß ein Mann, der trotz seiner Vorzüge, trotz seiner großen Begabung im Begriff war, ins Bodenlose zu stürzen, wenn sie ihn nicht auffing. Und im Vollgefühl all ihrer weiblichen Kraft breitete sie dazu die Arme aus.
Dass ihr Schwager Axel daraus eine so rührende Legende gemacht hatte, wusste sie gar nicht. Es sah ihm aber ähnlich. Ein romantischer Bruder, der einem armen Mädel zuliebe seine Karriere aufgibt, stand ihm immer noch besser zu Gesicht als einer, der in dunkle Affären verwickelt ist, und ein Vater, der zwar erst poltert, dann aber großmütig verzeiht, besser als einer, der ängstlich bemüht ist, nur ja kein Licht auf eine so trübe Angelegenheit fallen zu lassen.
Darum also auch die große Hochzeit! Darum die Einladung an ihre Verwandtschaft, der freilich Viktorine allein Folge leisten konnte, denn die Mutter war damals schon kränklich, und der Schwager konnte geschäftlich nicht abkommen.
Hatte die Schwester sie beneidet? Viktorine, die schon mehrere Jahre vor ihr geheiratet hatte?
Stefanie hatte sich damals gewundert, dass ihre schöne und etwas hochfahrende Schwester sich so Hals über Kopf entschloss, einen Mann zu nehmen, der kein Akademiker war. Der Nachbarssohn hatte ihr freilich lange den Hof gemacht, doch ebenso lange hatte Vicky die Unnahbare gespielt. Aber schließlich war Franz ja wirklich ein kreuzbraver Mensch, und unvermögend war er auch nicht, besaß ein Haus, besaß die Buchhandlung, die ihm viel mehr abwarf, als das Gehalt eines Mittelschulprofessors ausmachte, gehörte zu jenen, die sich nie verspekulieren, weil sie niemals etwas aufs Spiel setzen, bei denen also eine Frau gut aufgehoben ist. Und hatte er es der Schwester jemals an etwas fehlen lassen?
Ja, gut hatte Viktorine getan, den Franz Thieß zu heiraten, und sie hatte ja auch, allem nach, was man hörte, die beste Ehe mit ihm geführt, während sie selbst, Stefanie ... Doch wozu an alte Wunden rühren, die nun endlich vernarbt sind? Wozu die Schwester, die schwer genug zu tragen hatte am eigenen Verlust, belasten mit unglücklichen Geschichten?
«Es geht mir gar nicht schlecht, Vicky! Ich habe satt zu essen, ein Dach über dem Kopf, ein warmes Zimmer, Arbeit von früh bis spät, einen Menschen, der mich braucht. Und nun seid auch ihr da! Was meinst du, wie ich mich gesehnt habe, die lange Zeit, nach dir und deinen Kindern!»
Stefanie spürte, dass ihre Worte die Schwester nicht erreichten. Irgendetwas in Viktorines Wesen riegelte sich ab gegen sie — schon als Kind hatte sie das oft empfunden. Doch ehe sie einen weiteren Vorstoß machen konnte, drang ein Lachen an ihre Ohren. Das waren die Mädel! «Hörst du», sagte sie ablenkend, «Axel erzählt deinen Töchtern seine Geschichten!»
«Er ist zu Hause? Wie hat er uns dann nicht begrüßt?»
«Oh, er schläft immer sehr lange. Aber um diese Zeit macht er seiner Mutter seine Aufwartung, ehe er ins Kaffeehaus geht. Also geh hinüber und sag ihm Guten Morgen.»
« 4 »
Als Viktorine in Afras Zimmer trat, saßen ihre Töchter beide auf dem Sofa und der Major zwischen ihnen. Über Margas Wangen kugelten Tränen, die das Lachen aus ihr herausgeschüttelt hatte, sie fuhr sich mit dem Handrücken übers Gesicht und rief: «Gut, dass du kommst, Mama, da kann Onkel Axel dir auch gleich erzählen, wie ... »
«Aber Kind!» Axel von Lärch sprang auf und ging mit betont soldatischen Schritten auf Viktorine zu, «ich habe deine liebe Mama ja noch gar nicht begrüßt!» Und er zog ihre Hand so an seine Lippen, dass sie die Andeutung eines Kusses auf dem Handrücken verspürte. «Du hast dich nicht ein wenig verändert, liebe Viktorine. Wenn nicht deine reizenden Töchter hier an diesem Tisch säßen, müsste ich denken, die Zeit sei stillgestanden.»
«Wirklich?»
Viktorine war für derartige Komplimente nicht unempfänglich, konnte sich aber doch ein kleines Spottlächeln nicht verkneifen, als sie die Gestalt des Majors ins Auge fasste. Aus dem schlanken Rittmeister von damals, der in seiner Paradeuniform, den roten Hosen und dem blauen Attila, keine schlechte Figur gemacht hatte, war ein untersetzter ältlicher Herr geworden, dessen spärliches Haar trotz des tiefsitzenden Scheitels und der sorgfältigen Frisur die Glatze nicht mehr verbergen konnte, über die es gebürstet war.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!