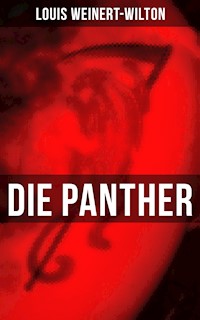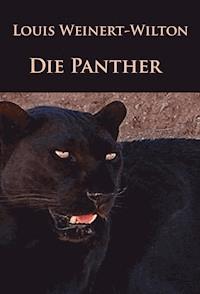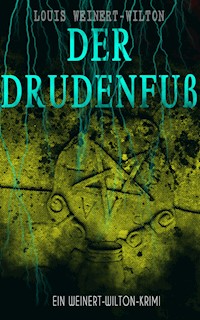
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Mehr erfahren.
Dieses eBook: "Der Drudenfuß (Ein Weinert-Wilton-Krimi)" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Aus dem Buch: "Was er fand, enttäuschte ihn zunächst, ließ ihn aber nach einigen Sekunden der Überlegung um so fassungsloser zurück. Das Papier enthielt nichts anderes als ein flüchtig hingeworfenes Pentagramm – einen Drudenfuß –, aber die Finger Bayfords zitterten leicht, als er es mechanisch wieder zusammenfaltete, und Mrs. Lee fand nach einer Weile, daß ihr bisher so unterhaltender und aufmerksamer Begleiter plötzlich sehr einsilbig und zerstreut geworden war." Louis Weinert-Wilton (1875-1945) war ein sudetendeutscher Schriftsteller. In den 1960er Jahren entstand im Zuge der erfolgreichen Edgar-Wallace-Filme eine eigenständige Louis-Weinert-Wilton-Kriminalfilmreihe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Der Drudenfuß (Ein Weinert-Wilton-Krimi)
INHALTSVERZEICHNIS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
1
Inhaltsverzeichnis
Wenige Minuten, bevor der Dampfer Folkestone–Boulogne an einem unfreundlichen Oktobermorgen in den Kanal stach, tauchte noch eine hohe Gestalt aus dem dichten Nebel an der Pier und steuerte gemessenen Schrittes dem Laufsteg zu.
Der Mann hatte den Kragen seines Trenchcoats hochgeschlagen und die Mütze tief in die Stirn gedrückt, so daß von seinem Gesicht nichts zu sehen war, aber einer der beiden überwachenden Kriminalbeamten hob doch hinter ihm rasch den Kopf und ließ mit verkniffenen Augen einen leisen, gedehnten Pfiff hören.
»Etwas Besonderes?« flüsterte sein neuer Kollege mit lebhafter Neugier, der andere zuckte jedoch nur mit den Achseln, und erst als das Wasser unter den Schrauben des Dampfers zu rauschen begann, verstand er sich zu so etwas wie einer Erklärung.
»Es scheint so«, murmelte er wichtig. »Wir kennen ihn schon über ein Jahr, und er nimmt immer die Route Folkestone – Boulogne, obwohl sie gerade nicht die kürzeste und angenehmste ist. Wahrscheinlich hat er seine Gründe dafür. – Der Inspektor, der eine Nase für solche Dinge hat, nennt ihn den ›Sturmvogel‹, denn sooft er hier auftauchte, gab es in Kürze eine große Sache.«
Es dauerte diesmal genau dreiundzwanzig Tage, bis der geheimnisvolle Reisende in Folkestone den Fuß wieder an Land setzte, aber der Kriminalbeamte konnte mit seinem Kollegen nur einen raschen Blick wechseln, denn es hieß die Augen offenhalten. Es war einer der großen Zeeland-Dampfer aus Vlissingen, der angelegt hatte, und über den Steg schlängelte sich eine lange Kolonne von Passagieren, was um diese Jahreszeit eine Seltenheit war.
Mrs. Joanna Lee deutete mit ihrer kleinen, fleischigen Hand, an der einige sehr kostbare Steine blitzten, flüchtig auf eine Reihe von Koffern und wandte sich dann sofort wieder an ihren Begleiter. Sie wünschte nicht, daß die Bekanntschaft mit dem eleganten Mann, der sich ihrer bereits in Genf und nun auch während der gemeinsamen Heimfahrt in so zuvorkommender Weise angenommen hatte, schon in Folkestone oder auf einem der Londoner Bahnhöfe ihr Ende fände, und war entschlossen, dies Mr. Bayford möglichst deutlich zu verstehen zu geben. Sie war seit acht Jahren Witwe, in jeder Beziehung unabhängig, und der Herr mit dem Monokel hatte auf sie einen ganz außerordentlichen Eindruck gemacht.
Sie blinzelte unter den etwas schweren Lidern schmachtend zu ihm auf und dämpfte ihre tiefe Stimme zu einem lockenden Gurren.
»Ich danke Ihnen herzlichst für alle Ihre liebenswürdigen Bemühungen und Aufmerksamkeiten, die mir die letzten Wochen so angenehm gestaltet haben – und auch für Ihr Interesse an unserer Sache. Was wir anstreben, ist wirklich der Unterstützung wert, und ich möchte Ihnen darüber gerne noch mehr mitteilen. Wir haben in Genf eine Reihe von Beschlüssen gefaßt, die dem verbrecherischen Treiben bald ein Ende bereiten werden. Wenn es Sie nicht langweilt, könnten wir darüber –«
»Das würde mich sehr freuen, Mrs. Lee. Es ist dies keine bloße Redensart«, versicherte er, »und mein Interesse entspringt auch nicht müßiger Neugierde, sondern wirklicher Anteilnahme an Ihren Bestrebungen. – Man sollte es nicht für möglich halten, daß es so etwas heute noch gibt, und es ist einfach die Pflicht eines jeden, mit dazu beizutragen, daß dem Mädchenhandel endlich das Handwerk gelegt wird.«
»Ich empfange Montag und Freitag«, hauchte sie, indem sie ihm ihre Karte reichte, »aber für meine Freunde bin ich auch sonst zu sprechen, wenn sie sich telefonisch ansagen.«
Der Herr mit dem Monokel neigte verbindlich den Kopf und war bereits im Begriff, der so zuvorkommenden Frau zu versichern, daß er das Vorrecht ihrer Freunde in Anspruch nehmen werde, als ihn plötzlich ein beklemmendes Gefühl unruhige Umschau halten ließ ...
Dicht neben ihm stand an der Barriere ein hochgewachsener Mann in einem Trenchcoat und blickte, die Arme verschränkt, teilnahmslos auf das Getriebe in der Halle. Er hatte die Mütze so tief ins Gesicht gezogen, daß zwischen dem Mantelkragen und dem Mützenschirm nur das starke, glatte Kinn und der von zwei scharfen Linien umrissene, bartlose Mund zu sehen waren, und Mr. Bayford begriff nicht, weshalb ihm die Nähe dieses Fremden mit einemmal solches Unbehagen verursachte. Er war ihm in den letzten drei Wochen in Genf und nun während der Rückfahrt wiederholt begegnet, ohne das geringste Interesse an ihm zu nehmen, und auch der andere hatte ihm nie irgendwelche Aufmerksamkeiten geschenkt. Der Mann von einigen dreißig Jahren schien nach seinem Äußeren und seinem Auftreten irgendein vornehmer Globetrotter zu sein, der für seine Umgebung nichts übrig hatte.
Auch jetzt hielt er sich abseits und wartete gelassen, bis er mit seinem Gepäck an die Reihe kam, aber Mr. Bayford gab etwas auf sein äußerst empfindliches Ahnungsvermögen, das ihn noch selten getäuscht hatte.
Eben als er an der Seite der strahlenden Mrs. Lee zu dem bereitstehenden Zug schritt, tauchte der Fremde plötzlich unmittelbar vor ihnen wieder auf und zog langsam die Hand aus der Tasche.
Die Bewegung geschah ganz unauffällig, aber für den mißtrauischen Mr. Bayford hatte sie etwas Absichtliches und Herausforderndes.
Im nächsten Augenblick bemerkte er auch schon das kleine gefaltete Papier, das zu Boden fiel, und, geschickt, wie er in solchen Dingen war, hatte er bereits beim nächsten Schritt den Fuß darauf gesetzt.
An dem Wagen gab es zunächst eine ziemlich lebhafte allgemeine Verabschiedung, deren Mittelpunkt die stattliche Mrs. Lee war, und ihr Begleiter hatte die Ehre, hierbei einigen der namhaftesten Führerinnen der englischen Frauenfürsorge vorgestellt zu werden. Aus den hastig und abgerissen hin- und herfliegenden Worten erfuhr er auch, daß der auf der Tagung in Genf beschlossene einheitliche Kampf gegen den Mädchenhandel nach Erledigung der notwendigen Vorarbeiten sofort aufgenommen werden sollte und daß Mrs. Joanna Lee zur Präsidentin des Komitees ausersehen war.
Alle diese Dinge nahmen den höflichen und geschmeidigen Mr. Bayford derart in Anspruch, daß er nicht dazu kam, sich das Papier, das er auf dem Bahnsteig mit einem raschen Griff aufgelesen hatte, näher anzusehen. Es steckte noch immer in seinem Handschuh, und der Zug war bereits längst in voller Fahrt, als der hagere Herr mit dem Monokel endlich Gelegenheit fand, es unauffällig zu entfalten.
Es war ein vom Rand einer Zeitung abgerissener Streifen, und während ihn Mr. Bayford spielend mit den Fingern glättete, flogen seine unruhigen Augen hastig und verstohlen über die weiße Fläche.
Was er fand, enttäuschte ihn zunächst, ließ ihn aber nach einigen Sekunden der Überlegung um so fassungsloser zurück.
Das Papier enthielt nichts anderes als ein flüchtig hingeworfenes Pentagramm – einen Drudenfuß –, aber die Finger Bayfords zitterten leicht, als er es mechanisch wieder zusammenfaltete, und Mrs. Lee fand nach einer Weile, daß ihr bisher so unterhaltender und aufmerksamer Begleiter plötzlich sehr einsilbig und zerstreut geworden war.
Der Mann, der ihm den Drudenfuß in den Weg geworfen hatte, war für ihn plötzlich zu einer wichtigen Persönlichkeit geworden, denn je länger er darüber nachdachte, desto unwahrscheinlicher schien es ihm, daß es sich hier um einen harmlosen Zufall handelte. Ganz abgesehen davon, daß ihn sein oft bewährter Instinkt so nachdrücklich vor dem Manne in dem Trenchcoat gewarnt hatte, war das Zeichen, das dieser ihm hatte zukommen lassen, nicht alltäglicher Art. Man kritzelt nicht zufällig gerade ein Pentagramm auf einen Streifen Papier und läßt es nicht gerade einem der beiden unter Hunderttausenden vor die Füße fallen, für die ein Drudenfuß einiges zu bedeuten hatte.
Mr. Bayford war sehr gedankenvoll und sehr ernst gestimmt, als er vor der Station ein Taxi nahm und seine Wohnung angab. Den zudringlichen Zeitungsjungen, der ihm mit seiner monotonen Litanei bis auf den Tritt des Wagens verfolgte, bemerkte er nicht einmal.
2
Inhaltsverzeichnis
»Verdammter Idiot«, stieß einige Stunden später Allan Ferguson erregt hervor, als Mr. Bayford seinen wichtigen Bericht eben mit der interessanten Episode von dem Drudenfuß eingeleitet hatte.
»Wie konntest du den Burschen aus den Augen lassen! – Weißt du, was das heißt?«
Der Ton und die Ausdrucksweise paßten weder zu der würdevollen Erscheinung des Sprechers noch zu dem luxuriös ausgestatteten Privatkontor, aber Bayford nahm sie mit unerschütterlicher Ruhe hin. Er putzte mit dem feinen Seidentuch umständlich an seinem Monokel und stäubte dann noch einige Aschenflöckchen von seinem tadellosen Anzug, bevor er erwiderte: »Das kann heißen, daß wir eines Tages um rund zweihunderttausend Pfund und um das Doppelte an Dollars reicher oder ärmer sein werden ...«
»Hol dich der Teufel!« fauchte der andere unfreundlich, indem er mit schweren Schritten auf dem dicken Teppich auf und ab stapfte und verstört an seiner erloschenen Zigarre biß. »Zunächst denke ich nicht an das Geld, sondern daran, daß uns die Geschichte den Hals kosten kann ...«
»Von solchen Dingen spricht man nicht«, verwies ihn sein Teilhaber tadelnd und schlug gemächlich ein Bein über das andere. »Es ist auch wirklich noch lange kein Grund vorhanden, gleich das Schlimmste zu befürchten.« Er begann mit der Fußspitze zu wippen, und die kleinen Augen unter den schütteren farblosen Brauen hefteten sich starr auf das rote Gesicht Fergusons. »Was ist denn eigentlich los?« fuhr er überlegen und geschäftsmäßig fort. »Schön, es ist plötzlich jemand aufgetaucht, der von dem Drudenfuß und was damit zusammenhängt einiges zu wissen scheint, und das kann uns nicht gerade angenehm sein. Wir sind nun so lange hinter der Sache her und haben dabei so viel aufs Spiel gesetzt, daß uns eine Einmischung nicht passen kann. Wir müssen sie uns aber auch nicht gefallen lassen, und allein kann der Mann unmöglich etwas beginnen. Die Zeichnung haben wir, und die Karte ...«
»Ja, die Karte ...«, murmelte Ferguson und hob ratlos die breiten Schultern. »Gut, daß du mich daran erinnerst. – Es war auch diesmal wieder nichts. Der Nachlaß ist in alle Winde verstreut worden, und wer weiß, wohin das Kartenblatt, das ja an sich wertlos ist, mit dem übrigen Kram verschleppt wurde. Und ob es überhaupt noch existiert. – Von dem Drudenfuß kann eigentlich nur der gewisse Dritte wissen«, flocht er plötzlich ein, und seine Stimme klang trocken und heiser. »Er hat die Zeichnung einen Augenblick in der Hand gehabt, bevor ...«
»Der gewisse Dritte? – Möglich. Ich habe auch schon daran gedacht.« Bayford strich sich gelassen über die lange, schmale Nase und zog die hellen Brauen hoch. »Anstatt einfach zuzuschlagen, hättest du damals eben schießen sollen. Er hat sich's ja auch nicht überlegt.« Bayfords Gesicht verzog sich zu einer leichten Grimasse, während er nach der tiefgefurchten Narbe blickte, die auf der wohlgenährten Wange des anderen bis zum Ohr lief. »Man soll in solchen Dingen nie etwas halb tun, das ist immer gefährlich. – Wenn ich damals den Revolver nicht dummerweise beiseite gelegt hätte ...«
»Der Teufel mag immer gleich an alles denken«, knurrte Ferguson aufgeregt und ärgerlich. »Es hat auch gar keinen Zweck, jetzt lange darüber zu reden, was wir damals hätten tun sollen. Die Bescherung ist nun einmal da, und wir müssen uns unserer Haut wehren. Wenn der Bursche die alte Geschichte aufrührt, kann es uns übel ergehen.«
»Vierzehn Jahre sind eine sehr lange Zeit«, erklärte Bayford bedächtig. »Und wenn es schon damals verdammt schwer gewesen wäre, uns etwas nachzuweisen, so ist es heute geradezu unmöglich. Dazu gehören Zeugen, und die gibt es bis auf den einen nicht. Und dieser eine hat nur gesehen, daß wir von einem Toten ein Papier an uns nahmen, was an sich kein Verbrechen ist. Von dem, was früher geschehen war, kann er kaum wissen, denn es ging ja so Hals über Kopf und so lärmend zu, daß man verrückt werden konnte. Eine scheußliche Nacht.« Er schüttelte sich leicht und machte eine kleine Pause, um sich eine frische Zigarre anzuzünden, während Ferguson mit gesenktem Kopf unruhig auf und ab lief. »Wenn mich etwas bedenklich machen könnte, so wäre es der fabelhafte Blick, den der Mann haben muß. Nach so vielen Jahren jemand wiederzuerkennen, dem man einziges Mal für wenige Minuten gegenübergestanden hat und noch dazu unter derartigen Verhältnissen, dazu gehört allerhand. Vergiß übrigens nicht, daß wir nach unseren völlig einwandfreien Papieren zu der fraglichen Zeit in Argentinien gewesen sind. – So«, schloß er entschieden, indem er das Monokel aus dem Auge beförderte und mit einem flinken Taschenspielergriff auffing, »und nun wollen wir abwarten, was der Drudenfuß eigentlich bedeuten sollte. Dann werden wir ja sehen.« Er räkelte sich in dem tiefen Klubsessel noch bequemer zurecht und sah Ferguson erwartungsvoll an. »Was machen die Geschäfte?«
»Das möchte ich dich fragen«, meinte dieser lebhaft. »Wie war es?«
»Wie ich es mir gedacht habe«, erklärte Bayford leichthin. »Zunächst einmal sündhaft teuer, und sonst viel Geschrei und nichts dahinter. Eine Menge von schönen Reden und Entschließungen, aber nichts Bedenkliches. Wenn es in diesem Tempo weitergeht, können wir in aller Ruhe und Beschaulichkeit alte Herren werden.«
»Um so besser. Es wäre ein furchtbarer Schlag gewesen, wenn uns gerade jetzt das Geschäft gestört worden wäre.« Er beugte sich dicht zu dem interessierten Mr. Bayford, und obwohl sie völlig ungestört waren, dämpfte er seine Stimme zu einem kaum vernehmbaren Flüstern. »Ich habe ungefähr dreihundert Ballen versandbereit und wollte nur deine Nachricht abwarten, bevor ich die Depeschen loslasse.«
»Laß sie ruhig los«, warf sein Teilhaber ein, und Ferguson machte sich an seinem Schreibtisch zu schaffen. Er rückte etwas von dem Tisch ab, faßte nach der Platte, und im selben Augenblick sprang mit einem federnden Geräusch in der ganzen Länge eine etwa fünf Zentimeter tiefe Lade hervor. »Da sieh her«, sagte er selbstbewußt und deutete auf die farbige Weltkarte, die den Boden bedeckte, »so arbeite ich. Wo die Fähnchen sind, werden die Transporte gesammelt«, fuhr er eifrig erklärend fort, »und wenn die Ware eingeschifft ist, kommt der Wimpel auf die betreffende Schiffahrtslinie. Dabei ist aus jedem Fähnchen zu ersehen, wieviel Ware da ist und von welcher Sorte, denn ich halte alles täglich auf dem laufenden.«
»Sehr nett«, meinte Bayford zurückhaltend, »aber wenn zufällig einmal ein anderer seine Nase in die hübsche Spielerei stecken sollte ...«
»Ausgeschlossen«, erklärte Ferguson mit einem breiten Grinsen, indem er die Lade wieder zurückspringen ließ und auf den Tisch klopfte. »Die Sache ist gesichert, und wenn ungeschickt daran herummanipuliert wird, tritt Kurzschluß ein. Dann gibt es in dem Fach nur ein Häufchen Asche. Alles ist genau ausprobiert und ganz zuverlässig.«
Mr. Bayford, der kaum mehr zugehört hatte, sagte jetzt lebhaft: »Übrigens, das Reisegeld, mit dem du mich ausgestattet hast, war etwas knapp, und du mußt zweihundert Pfund zulegen. Allein die Blumen für Mrs. Lee haben mich einige tausend Francs gekostet. Es waren aber auch geradezu märchenhafte Orchideen darunter. Ich konnte ihr doch nicht gut Gänseblümchen schicken, obwohl –«
»Mach für mein gutes Geld nicht auch noch schlechte Witze«, fiel ihm der geizige Ferguson ins Wort. »Was geht mich deine Mrs. Lee an?«
»Sehr viel, mein Lieber«, gab Bayford kühl zurück, indem er in seiner Aktentasche zu kramen begann. »So viel, daß du morgen zwei Schecks auf je hundert Pfund an sie überweisen wirst – einen von dir, den andern von mir. Hier hast du die Adresse. Dafür werden Mr. Allan Ferguson und Mr. Joe Bayford die Ehre und das Vergnügen haben, dem Komitee zur Bekämpfung des Mädchenhandels anzugehören. Es ist bereits alles geregelt.«
Er klemmte mit ernstem Gesicht das Monokel ins Auge, und sein Teilhaber starrte ihn sekundenlang an, als ob er ein Wundertier wäre. Dann bekam der große, starke Mann plötzlich einen Lachanfall, der ihm fast den Atem benahm, und Bayford mußte ihm hilfreich den breiten Rücken klopfen.
»Siehst du, so arbeite ich«, sagte nach einer weiteren Viertelstunde Bayford, indem er ein Bündel Banknoten lässig in die Westentasche schob. »Die Verbindung ist einfach unbezahlbar, und ich glaube, wir können nun sogar das hiesige Geschäft ruhig aufnehmen. Ich habe dir schon oft gesagt, daß hier das Geld auf der Straße liegt. Und wenn jemals Gefahr drohen sollte, so erfahren wir davon jedenfalls rechtzeitig.«
Der tüchtige Ferguson war neuen Geschäften nie abgeneigt, aber diesmal hob er mit einer raschen, abwehrenden Gebärde die Hand.
»Hier mache ich keine Geschäfte«, erklärte er entschieden, aber Bayford, der bereits an der Tür stand, zuckte nur mit den Achseln.
»Du wirst sie machen, und ich glaube, daß ›Tausendundeine Nacht‹ ein recht ergiebiges Arbeitsfeld sein wird. Mrs. Smith ist eine verständige Person, und ich werde sie noch heute vorsichtig vorbereiten. Du kannst mich gegen elf Uhr dort erwarten.«
Er nickte seinem Teilhaber flüchtig zu, und dieser erhob sich, um den Riegel, den er der Sicherheit halber vorgelegt hatte, zurückzuschieben.
Der Korridor des großen Geschäftshauses lag um diese Stunde bereits ruhig und menschenleer, aber kaum hatte Ferguson einen Blick in das Halbdunkel getan, als er blitzschnell den Kopf duckte und mit verstörten Mienen auf den Boden starrte.
Zwei Schritte vor der Schwelle prangte, mit dicken Kreidestrichen aufgetragen, ein Drudenfuß, und der Anblick war für den großen, starken Mann so erschreckend, daß er mit zitternder Hand an dem Türgriff Halt suchen mußte.
Nur Bayford behielt seine Fassung und stieß lediglich einen leisen Pfiff durch die Zähne, als er mit der Sohle seines Schuhs an dem unheimlichen Zeichen zu wischen begann. »Gut«, murmelte er mit einem etwas krampfhaften Lächeln, »nun wissen wir wenigstens, woran wir sind.« Er tastete unauffällig nach seiner Gesäßtasche und warf seinem völlig fassungslosen Teilhaber einen vielsagenden Blick zu. »Der Mann scheint es plötzlich sehr eilig zu haben, und wir werden bei der ersten Gelegenheit die Ungeschicklichkeit gutmachen müssen, die du vor vierzehn Jahren begangen hast.«
3
Inhaltsverzeichnis
Der schmächtige, blasse Maurice Rosary hatte an diesem Nachmittag eine jener geheimnisvollen Aufforderungen erhalten, die ihn immer etwas aus dem Gleichgewicht brachten, da sie stets ein gutes Geschäft bedeuteten und außerdem eine gewisse Romantik in das ewige Einerlei seiner arbeitsreichen Tage woben.
Moritz Rosenkranz aus Polen war vor zwei Jahrzehnten auf seiner Wanderung in die Welt irgendwie in London hängengeblieben und hatte hier Wurzel gefaßt. Er besaß in Stratford einen kleinen, peinlich sauberen Trödlerladen mit einem festen Kundenstamm, seinen weit einträglicheren Erwerb aber bildeten gelegentliche Vermittlergeschäfte, denn er besorgte einfach alles. Sammler, die nach irgendeinem Unikum jagten, kleine Unternehmungen, die ihre billige Ramschware loswerden wollten, Theater, die irgendein altes oder besonderes Requisit benötigten, wandten sich an Mr. Rosary, und der tüchtige Mann trieb gegen eine äußerst bescheidene Provision auf, was man brauchte. Dieses Tagewerk war nicht sehr ereignisreich und aufregend, und wenn es dabei einmal eine wesentlichere Episode gab, so blieb diese in dem Gedächtnis von Mr. Rosary unauslöschlich haften.
Wie beispielsweise jener Abend vor ungefähr achtzehn Monaten, an dem man ihn in einem Auto abgeholt hatte und er zu jener seltsamen neuen Geschäftsverbindung gekommen war. Rosary war damals höflichst ersucht worden zu sagen, ob er über das oder jenes oder über diesen oder jenen etwas wisse, und Mr. Rosary gab ebenso höflich Auskunft. Er wußte viel, kannte das London der Reichen wie die Elendsviertel und hatte seine Beziehungen zu den Fremdenkolonien. Wenn er etwas nicht wußte, so konnte er es innerhalb vierundzwanzig Stunden erfahren – erschöpfend und in allen Einzelheiten unbedingt zuverlässig. Sein Auftraggeber konnte mit ihm zufrieden sein, und Mr. Rosary war auch zufrieden. Jedesmal hatte er für seinen Zeitverlust eine Summe erhalten, wie er sie sonst in Monaten nicht verdiente.
Heute war es zum sechstenmal, daß er sich zu einem dieser lohnenden Gänge anschickte.
Als der blasse Mann mit dem schütteren schwarzen Bart an der letzten Tür vorüberkam, tat sich diese plötzlich auf, und aus dem Lichtschein tauchte ein Mädchenkopf hervor.
»Oh, Mr. Rosary, Sie gehen ...«, sagte eine frische Stimme entschuldigend und etwas enttäuscht. »Ich dachte, Sie ...«
Rosary blieb stehen und zog höflich den Hut. Er war gegen alle Leute zuvorkommend, aber bei der Miss vom ersten Zimmer links – er wußte ihren Namen nicht, wie hier überhaupt kaum einer den andern kannte – kam ihm das von Herzen. Sie hatte, wenn sie an ihm vorüberhuschte, auf seinen Gruß stets ein freundliches ›Guten Abend, Mr. Rosary‹ – zu einer andern Tageszeit hatte er sie noch nie gesehen –, und sie schien ihm auch so ganz anders als die übrigen Leute, die im Hause wohnten, obwohl ... Aber Mr. Rosary kümmerte sich nicht um Dinge, die ihn nichts angingen.
»Wenn Sie etwas brauchen sollten, Miss«, beeilte er sich zu versichern, »so habe ich Zeit, sehr viel Zeit sogar.«
Das etwas grell bemalte Gesicht in der Türspalte bekam einen spitzbübisch verlegenen Ausdruck, und die Stimme klang schüchtern und zaghaft.
»Wenn ich Sie um etwas Brennspiritus bitten dürfte ...«
»Schon gemacht«, erklärte der gefällige Mann beflissen, war bereits wieder bei seiner Wohnungstür und kehrte nach wenigen Minuten mit einer säuberlich in Papier gehüllten Flasche wieder zurück.
Eine schlanke weiße Mädchenhand nahm sie in Empfang.
»Danke schön, Mr. Rosary. Sie sind riesig nett.« In die großen strahlenden Augen kam plötzlich ein übermütiges Leuchten, und das Lächeln um den grellroten Mund wurde noch liebenswürdiger. »Würden Sie eine Tasse Tee mit mir trinken?«
Der schmächtige Mann wich jäh einen Schritt zurück und hob mit einem entsetzten, scheuen Blick abwehrend die Hand. Sein Erschrecken war so eindeutig und komisch, daß das Mädchen in ein leises, belustigtes Lachen ausbrach.
»Sie können ruhig hereinkommen, Mr. Rosary; ich werde Ihnen nicht zu nahetreten. – Nur eine Tasse Tee, wenn Sie mögen.« In der nächsten halben Stunde war dem bescheidenen Mann so verwunderlich und so wohl zumute, wie noch nie in seinem Leben. Er saß an einem sauber gedeckten Tischchen und trank Tee, wie er noch keinen gekostet hatte – eine Tasse und dann noch eine, die ihm von schlanken, gepflegten Fingern mit glänzenden Nägeln vorgesetzt wurden. Dazu knabberte er bereits an dem dritten Stückchen knusprigen Zwiebacks, der auf der Zunge zerging und nach köstlichen Gewürzen schmeckte. Nach jedem Schluck tupfte sich Mr. Rosary mit seinem Taschentuch fein säuberlich den krausen Bart ab, und er hielt die feine Tasse, die unter Brüdern gut ihre fünfzehn Schillinge wert war, genauso zierlich mit den Fingerspitzen, wie die schöne junge Dame ihm gegenüber.
Kurz und gut, es war ein sehr gemütlicher Plausch, bei dem der schüchterne Mann immer mehr auftaute, und je länger er das prächtig gebaute Mädchen mit den blitzenden Augen ansah, desto wärmer wurde ihm ums Herz.
»Sie haben sich so schön gemacht, daß Sie wohl ins Theater gehen oder ins Kino«, sagte er plötzlich, aber sie verneinte sofort entschieden, und Mr. Rosary bekam mit zarten Fingern einen leichten Nasenstüber.
»Fehlgeraten – ich gehe tanzen.«
»Tanzen? Auch ein schönes Vergnügen«, meinte er, indem er bedächtig nickte, aber seine Begeisterung schien doch nicht allzugroß zu sein. »Sie sind wohl eingeladen zu einem Ball?«
»Was Ihnen nicht einfällt! Bälle sind langweilig. Ich gehe ins ›Tausendundeine Nacht‹«, vertraute ihm das Mädchen an. »Dort ist es weit lustiger, und man sieht etwas.«
Das Mädchen setzte sich wieder, und Mr. Rosary atmete auf und wischte sich mit seinem geblümten Taschentuch die heiße Stirn. Sein Gesicht war plötzlich sehr ernst und sein Blick unsicher.
»Ins ›Tausendundeine Nacht‹, so ...«, murmelte er. »Ein schönes Lokal und viel Leute.« Er ließ seinen dünnen Bart langsam durch die Finger gleiten und räusperte sich. »Ich habe einige Male hineingesehen«, fuhr er dann zögernd fort, »so, wie unsereiner eben zu so etwas kommt, und man staunt, was es da an Pracht und Herrlichkeit gibt. – Und diese Menschen! Weiße, braune, gelbe und sogar schwarze.« Er zog die Schultern ein, und sein scheuer Blick streifte das Mädchen, das ihm lächelnd und nickend zuhörte. »Angst und bange könnte einem werden, denn wie leicht kann da etwas geschehen ... Es gibt viele schlechte Männer, Miss, und eine schöne junge Dame kann nicht vorsichtig genug sein.«
Seine gutturale, weiche Stimme war immer eindringlicher geworden, aber er hatte mit seiner Warnung keinen Erfolg. Das Mädchen kicherte leise, und plötzlich schnellte es hoch und hielt ihm ihren wunderbaren bloßen Arm dicht vors Gesicht. Dann bog sie ihn mit einem Ruck im Ellbogen ab und tippte stolz auf die Muskeln, die am Oberarm hervorgetreten waren.
»Oh, ich bin vorsichtig«, versicherte sie verschmitzt. »Und das hier genügt auch für einen Schwarzen. – Greifen Sie einmal!« Der schmächtige Mann kam der Aufforderung höchst zaghaft nach und legte vorsichtig einen Finger auf den Oberarm, aber damit war das Mädchen nicht zufrieden.
»Drücken Sie – recht fest«, gebot sie, und Mr. Rosary gehorchte, soweit er es vermochte.
»Großer Gott!« stieß er überrascht hervor, als er wie auf Marmor griff, aber gleich darauf ließ er einen leisen Laut des Schreckens hören und fuhr mit den Händen in die Luft, weil der weiße Arm mit einer blitzschnellen Bewegung gegen seinen Magen fuhr.
»Wenn wir nicht so gute Freunde wären, wären Sie jetzt für eine halbe Stunde erledigt«, sagte das Mädchen unter belustigtem Kichern, und auch Mr. Rosary kicherte, aber etwas krampfhaft, weil es kein Spaß gewesen wäre, wenn der weiße Arm mit den gespannten Muskeln ihn getroffen hätte ...
Von Zeit zu Zeit tauchte auf der Themse ein kleiner Dampfer mit silbergrauem Rumpf und weißem Schornstein auf, der in irgendeinem versteckten Winkel festmachte und dort oft wochenlang lag. Einmal kam er von Erith herauf, das nächste Mal von Mortlake herunter, und selbst die kundigsten Hafenleute und Schiffer wußten nicht, was sie aus dem Ding machen sollten. Er führte weder Passagiere noch Ladung, und der baumlange, ausgedörrte Steuermann mit dem feuerroten Bart und der junge Heizer mit dem Bulldoggengesicht waren die unzugänglichsten Burschen, die das dreckige Wasser je getragen hatte.
An diesem Tag war der graue Dampfer kurz vor Einbruch der Dämmerung drüben in Bermondsey erschienen und hatte in aller Stille unterhalb der Tower-Brücke angelegt. Die Luft war so dick, daß man sie wie einen gelben Sack vor den Augen hatte, und sooft sich Steve Flack über den nach vorne starrenden roten Bart strich, tropfte dieser wie ein nasser Strumpf. Das war für den Steuermann eine hochwillkommene Gelegenheit, nach und nach alle seine kräftigen und phantasievollen Flüche auf den verdammten Nebel anzubringen und sich dadurch halbwegs bei Laune zu erhalten.
Als er sich überzeugt hatte, daß die Trossen festsaßen, kroch er in die kleine Kajüte, und bald darauf erklang das regelmäßige harte Klopfen der Knöchel auf die Tischplatte.
Kurz nach acht Uhr – draußen war bereits die Nacht heraufgezogen – warf der Steuermann die Karten auf den Tisch, daß sie nach allen Richtungen spritzten, und hielt dem andern gebieterisch die lediglich aus Knochen, Haut und Sehnen bestehende Hand hin.
»Gib mir meine sieben Pence zurück, Patrick«, sagte er. »Du bist zwar der Sohn meiner Schwester, die eine ehrliche Frau war, aber sonst bist du der niederträchtigste und filzigste Schotte, der mir je untergekommen ist. – Glaubst du, ich habe nicht bemerkt, daß du alle Asse mit Pech beschmiert hast, damit sie an deinem verdammten Daumen klebenbleiben?«
Der Bursche mit dem Bulldoggengesicht zählte, wie immer, seinen Gewinn gehorsam wieder auf den Tisch, und der Rotbart strich das Geld versöhnt und befriedigt ein. Dann schlüpfte er in sein Ölzeug und drückte sich draußen an den Kamin, um mit gespannten Sinnen in die Finsternis zu lauschen.
Nach einer knappen Weile schwankte das Boot wie unter einem leichten Stoß, und dicht vor Steve tauchte ein grauer Schatten aus der Dunkelheit.
Der Steuermann fuhr mit der Rechten an den Südwester und turnte dann hinter dem Ankömmling den Gang hinunter. Die ohnehin nicht sehr geräumige Kabine sah aus wie ein Verschlag, da sie durch eine übermannshohe Wand in zwei Abteilungen geschieden war, von denen die vordere außer einem einfachen Stuhl überhaupt keinen Einrichtungsgegenstand enthielt. In der Holzwand befand sich eine schmale Tür, durch die man in den dahinterliegenden Raum gelangte, aber auch hier gab es nur einen kleinen Tisch, eine einfache Bettstelle und eine Art Truhe. In der Mitte der Trennungswand war ein viereckiges Gitter ausgeschnitten, wie man es in alten Beichtstühlen findet, und jede der beiden Abteilungen war durch eine spärliche Öllampe erleuchtet.
Der Mann warf mit einer raschen Bewegung den schweren Mantel und die Kappe ab und trocknete sich umständlich die Hände. Er war groß und breitschultrig, aber dabei von einer federnden Gelenkigkeit, die allen seinen Bewegungen etwas Stoßartiges gab. Das Gesicht mit dem Bronzeton erhielt durch das männliche Kinn und die zwei scharfen Linien, die von den Nasenflügeln zu den Mundwinkeln liefen, einen etwas harten Ausdruck, und die durchdringenden Augen unter den dunklen Brauen verschärften ihn noch. Der Mann mochte Ende der Dreißig sein, und seine tadellose Erscheinung bildete einen auffallenden Gegensatz zu der Dürftigkeit des Raumes.
Steve stand mit vorgestrecktem Bart und mit dem Ölhut in der Rechten und wartete, bis der Herr das Wort an ihn richten würde.
»Alles in Ordnung?« fragte dieser endlich, und der Steuermann konnte seine längst vorbereitete Meldung anbringen.
»Sehr wohl, Sir. – Schiff frisch kalfatert, Maschine in Stand. Von Greenwich herauf bei Nordnordwest und schlechter Sicht.«
»Ohne Aufsehen?« forschte der andere, indem er eine Zigarette anbrannte und dann das Gitter in der Holzwand eingehend in Augenschein nahm.
»Immer fein zwischendurch wie ein Fisch«, versicherte Flack mit seiner hohlen Stimme, und der Herr nickte befriedigt.
»Wie lange haben wir uns eigentlich nicht gesehen?« fragte er.
»Drei Monate und fünf Tage«, kam es prompt und etwas vorwurfsvoll zurück. »Eine verdammt lange Zeit, Sir, wenn man zwischendurch nichts anderes tun darf, als Karten spielen und Fische fangen.«
Über das strenge Gesicht flog ein flüchtiges Lächeln.
»Dafür wird es vielleicht jetzt wieder wochenlang Arbeit geben.« Er griff in die Westentasche, zog ein gefaltetes Papier hervor und reichte es dem Steuermann, der mit gierigen Fingern danach fuhr. »Vor allem kümmern Sie sich ein bißchen um die beiden Leute, deren Adressen ich Ihnen hier aufgeschrieben habe. Nicht zu auffällig, denn es sind sehr gerissene Gentlemen, und es genügt vorläufig, wenn Sie sie kennenlernen. Das Weitere wird sich dann schon ergeben. Und wenn der Mann hier gewesen ist, den ich erwarte, werde ich vielleicht noch einige Aufträge für Sie haben. – Sorgen Sie dafür, daß er heil an Bord und unbehelligt wieder aus diesem unsicheren Winkel herauskommt.«
»Sehr wohl, Sir«, versicherte der Rotbart dienstbeflissen, und der große Herr nickte zufrieden. Als sich Steve aber durch die niedrige Tür schob, hatte jener für ihn noch eine sehr eindringliche Weisung.
»Mit der Polizei halten wir es wie immer. Wenn sie aber auf Ihren schönen roten Bart doch irgendwie aufmerksam werden sollte, müssen Sie dichthalten.«
Mr. Rosary hatte von der letzten Busstation noch gute zehn Minuten zu gehen, und der Weg durch dieses Viertel war um diese Stunde und bei dem dichten Nebel nicht gerade angenehm. Aber der schmächtige Mann biß die Zähne zusammen und huschte wie ein wesenloser Schatten durch die Nacht. Er lief bald links, bald rechts, bald in der Mitte der winkligen Gassen, denn jeder Tritt und jedes Geräusch ließen ihn vorsichtig ausbiegen.
Schon mußte er nach seinem sicheren Ortssinn fast am Ziel sein, als sein eiliger Lauf durch einen festen Griff jäh gehemmt wurde. Bevor er noch dazu kam, den entsetzten Schrei auszustoßen, der sich auf seine Lippen drängte, vernahm er eine wohlbekannte hohle Stimme und sah die kantigen Umrisse eines in die Luft starrenden Bartes vor sich, der ihm in diesem Augenblicke der herrlichste Bart der Welt dünkte.
»Menschenskind«, sagte Steve, »kommen Sie 'ran. Wenn ich Sie nicht lotse, steuern Sie in Ihrer Einfalt direkt auf den Themsegrund, und der Herr kann bis zum Jüngsten Tag auf Sie warten.«
Eine Weile später stand Mr. Rosary in dem vorderen Abteil der kleinen Kabine, hielt den steifen Hut an die Brust gepreßt und machte zunächst eine ehrerbietige Verbeugung gegen das Gitter in der Wand.
Er kannte sich hier bereits aus, und als ihn eine höfliche Stimme hierzu aufforderte, nahm er gehorsam auf der Kante des Stuhles Platz. Es saß nun dicht vor dem Gitter, aber hinter den Holzstäben war bei der spärlichen Beleuchtung nicht einmal ein Schatten des Sprechers wahrzunehmen.
»Sie sind ein Mann, der London gründlich kennt und viel von dem weiß, was unter der Oberfläche vorgeht«, sagte die Stimme hinter der Wand. »Besonders die verschiedenen Geschäfte, die betrieben werden, dürften Ihnen wenigstens vom Hörensagen bekannt sein«, fuhr die Stimme unbeirrt fort, »und darüber möchte ich Sie heute um eine Auskunft ersuchen: Wie ist das mit dem Mädchenhandel? Gibt es hier so etwas? Oder kennen Sie vielleicht den einen oder andern, von dem man sagt, daß er mit diesen Dingen irgendwie in Verbindung steht?« Der Frager verstummte, und in dem niedrigen Raum herrschte sekundenlang tiefes Schweigen. Rosary rückte unruhig auf seinem Stuhl hin und her, und seine Finger zupften nervös an dem dünnen Bart. Das Unternehmen, über das der Herr etwas erfahren wollte, war Rosary immer so schrecklich erschienen, daß er davon nicht einmal etwas hätte hören wollen. Nur was seine scharfen Augen zufällig beobachtet hatten, wußte er, und was er wider Willen hier und dort in flüchtigen Andeutungen aufgefangen hatte. Es war nicht viel, aber sogar davon zu sprechen scheute er sich, und erst ein drängendes »Nun?« konnte ihm die Zunge lösen.
Rosary rückte unruhig auf seinem Stuhl hin und her, und seine Finger zupften nervös an dem dünnen Bart.
»Ich habe gehört«, sagte er zögernd und vorsichtig, indem er sich die feuchte Stirn wischte, »daß es so etwas geben soll. Einmal haben neben mir zwei Spaniolen davon gesprochen, weil sie nicht ahnten, daß ich sie verstehe, und ein anderes Mal habe ich von einem Lokal gehört, wo solche Leute zusammenkommen sollen.«
»Welches Lokal soll das sein?« kam es gespannt hinter der Wand hervor, aber der Mann auf dem Stuhl wiegte bedenklich mit dem Kopf.
»Sir«, meinte er unentschlossen, »soll ich Ihnen mit einer Auskunft dienen, von der ich nicht weiß, ob sie reell ist? Es wird so viel geredet, daß man nicht wissen kann, was wahr ist und was nicht, obwohl ...«
Er brach ab und wiegte wiederum den Kopf, blickte aber dann plötzlich nach dem Gitter, weil er dort ein leises Geräusch vernahm. Durch die Stäbe kam ein starkes Kuvert zum Vorschein, und die Stimme sagte höflich: »Für Ihre Bemühungen und den unangenehmen Weg, den Sie gehabt haben.«
Mr. Rosary griff mit seiner schmalen blassen Hand rasch zu, und während er den Umschlag in der Innentasche seines langen Überrockes barg, wurde er mit einemmal sehr gesprächig.
»Was heißt ›Bemühungen‹ und ›unangenehmer Weg‹! Mein ganzes Leben möchte ich solche Bemühungen und solche Wege haben«, versicherte er und sah sich dann vorsichtig in dem winzigen Raum um, bevor er seinen Mund dicht an das Gitter brachte und seine Stimme zu einem geheimnisvollen Flüstern dämpfte. »Sir, ich will nichts gesagt haben, aber sehen Sie doch selbst einmal, was sich in der Bar tut, die ›Tausendundeine Nacht‹ heißt und in Summers Town ist, und vielleicht werden Sie erfahren, was Sie zu wissen wünschen.«
»Also ›Tausendundeine Nacht‹«, wiederholte die Stimme des andern mechanisch und setzte hinzu: »Summers Town. – Ich danke Ihnen.«
Das war die gewöhnliche Verabschiedung, und der schmächtige Mann schnellte von seinem Stuhl auf, um seine ehrerbietigen drei Verbeugungen gegen die Wand zu machen, aber schon nach der ersten wurde er unterbrochen.
»Noch einen Augenblick. – Ich würde ein Mädchen brauchen, das in diesem oder einem ähnlichen Lokal verkehrt und das Sie als zuverlässig empfehlen könnten. – Sie verstehen?«
Mr. Rosarys Augen blitzten nach dem Gitter, und seine Rechte fingerte lebhaft an den Barthaaren.
»Und ob ich verstehe, Sir! – Ein schönes Mädchen, ein braves Mädchen, ein anständiges Mädchen ...« Er geriet immer mehr in Eifer, und alle seine Gliedmaßen waren in Bewegung. »Habe ich. Sie werden zufrieden sein, Sir. – Geradezu eine feine Dame ...«
»Das muß sie gerade nicht sein«, kam es kühl zurück. »Aber verständig, verschwiegen und auch mutig.«
Der gute Mr. Rosary war so entzückt, daß er ganz vergaß, was sich gehörte und ein leises Kichern hören ließ.
»Mutig?« Er schnellte seinen rechten Arm vor und deutete am Oberarm eine Kugel von der Größe eines Fußballs an. »Wenn ich nicht ihr Freund wäre, so wäre ich jetzt ein toter Mann«, fügte er vertraulich hinzu. »Sie schlägt einmal mit der Hand zu, und man ist erledigt, wie sie sagt. – Das mit der feinen Dame aber ist so: Wenn Sie sie anschauen, Sir, so sieht sie aus wie ein gewöhnliches Mädchen, aber wenn Sie mit ihr Tee trinken und sprechen, so ist sie eine feine Dame; und wenn sie vielleicht auch keine feine Dame, sondern nur ein gewöhnliches Mädchen ist, so –«
»Ist sie jedenfalls ein Wunder, das man sich ansehen muß«, schnitt die Stimme hinter der Wand seine begeisterte Erklärung ab, und Mr. Rosary nickte befriedigt.
»Tun Sie das, Sir, und ich glaube, Sie werden zufrieden sein.«
»Wo ist sie zu finden?«
»Zu finden ist sie in meinem Hause, im Flur die erste Tür links«, beeilte sich der schmächtige Mann zu erklären, »aber nur so gegen Abend. Was sie sonst den ganzen Tag über macht, weiß ich nicht, aber dann geht sie tanzen. Und wenn Sie sie vielleicht noch heute zu sprechen wünschen, so ist sie gerade im ›Tausendundeine Nacht‹. Sie hat einen roten Turban auf dem Kopf und ein rotes Kleid und einen feinen roten Mund. Und Augen hat sie so –«
»Gut«, sagte der Herr, »wir werden sehen. – Und nun nur noch eine Kleinigkeit, dann werde ich Sie nicht länger aufhalten. – Kennen Sie vielleicht zwei Männer namens Bayford und Ferguson?«
Das war eine einfache, geschäftsmäßige Frage, und Mr. Rosary konnte sie ebenso einfach und geschäftsmäßig beantworten.
»Und ob ich sie kenne! – Mr. Bayford ist ein feiner Gentleman mit einem Monokel, und man sagt, daß er der Teilhaber von Mr. Ferguson ist, Mr. Ferguson aber handelt an der Börse, und zwar in Papieren, die nicht immer gut sein sollen. Außerdem soll er noch ein großes Überseegeschäft haben, aber man weiß nicht, womit. Man weiß überhaupt nicht so recht, wie man mit ihm dran ist. Ich habe vor einigen Tagen mit ihm auch sozusagen in Geschäftsverbindung gestanden und mich gewundert, was der Mann für Passionen und Sorgen hat.«
Er fand die Sache zu nichtig, um weiter darauf einzugehen, aber dem andern schien daran gelegen zu sein.
»Worum handelt es sich, wenn man fragen darf?«
»Gewiß dürfen Sie fragen«, meinte Rosary lebhaft und zuvorkommend. »Worum hat es sich auch schon gehandelt? – Ausgerechnet um alte Landkarten, die ich mit anderem Trödelkram aus dem Nachlaß einer verstorbenen Dame im Clapham gekauft habe. Sie sollen ihrem Neffen gehört haben, der im Kriege gefallen ist. – Und für diese Karten hat mir Mr. Ferguson zwanzig Pfund geboten. Was soll man dazu sagen?«
»Haben Sie sie ihm verkauft?« klang es hastig hinter der Wand hervor, aber Mr. Rosary schüttelte etwas wehmütig mit dem Kopfe.
»Wenn ich sie noch gehabt hätte, hätte ich sie ihm verkauft«, erklärte er mit einem leichten Seufzer. »Aber ich hatte sie bereits einem hohen General gebracht, der in der Zeitung ankündigte, daß er für jede Landkarte aus dem Krieg fünf Schilling bezahle, und er hat mir auch wirklich vierzig Schillinge bar auf den Tisch gelegt. Wie ich dann gekommen bin, ihn zu bitten, mir die Karten wieder zu verkaufen gegen einen anständigen Profit, ist er sehr unfreundlich geworden und hat gesagt, ich solle schauen, daß ich weiterkomme, denn er brauche die Karten. Und ich bin wieder gegangen, denn ich habe eingesehen, daß ein hoher General so etwas wirklich brauchen kann, während es für einen Geschäftsmann, wie Mr. Ferguson, doch zu gar nichts nütze ist –«
»Welcher General war das?« forschte die Stimme hinter dem Gitter lebhaft.
»Sir Humphrey Norbury«, gab der schmächtige Mann betrübt zurück. »Mein ganzes Leben lang werde ich mir den Namen merken, weil es ein so schlechtes Geschäft war.«
»Das kann man heute noch nicht sagen«, tröstete ihn der fremde Herr, aber erst einige Wochen später sollte Rosary daraufkommen, welch eine gescheite und wahre Bemerkung das gewesen war.
4
Inhaltsverzeichnis
»Halte endlich die Klappe oder mach, daß du fortkommst«, schrie Mrs. Polly Smith verzweifelt und erbost, indem sie vor dem Spiegel heftig mit dem Fuß stampfte.
Sie war eben im Begriff, zu dem übrigen kostbaren Schmuck ein Paar ebenso kostbarer Ohrgehänge anzulegen, als ihr die Geduld riß, weil der semmelblonde, dickliche Mr. Smith seit einer halben Stunde mit schiefem Kopf und gespitzten Lippen in einem Fauteuil lümmelte und bald einen einzelnen Ton, bald eine ganze Tonleiter vor sich hinpfiff.
»Was ist dir schon wieder nicht recht?« fuhr er auf, und seine pathetische, ölige Stimme bebte vor Empörung. »Willst du den Künstler in mir wirklich ganz töten? Soll das köstliche Geschenk der göttlichen Musik, das mir in die Wiege gelegt wurde, verkümmern und verderben, weil du leider keinen Sinn dafür hast?«
»Nimm den Mund nicht so voll«, gab sie gereizt zurück, »denn deine albernen Redensarten verfangen bei mir nicht. Verkümmern und verderben würdest du, wenn du von deiner göttlichen Musik leben müßtest. Wenn einer ein zweibeiniges Geschöpf um sich haben will, das den ganzen Tag piepst und trällert, so kauft er sich einen Kanarienvogel oder einen Zeisig. Nur ihr Musikanten macht so ein Wesen aus der Geschichte, weil ihr sonst zu nichts zu gebrauchen seid ...«
»Das sagst du mir«, empörte sich Mr. Smith, »der ich bereits mit sechs Jahren Konzerte gegeben habe?« Aber Mrs. Smith hob ungerührt die stark gepuderten, bloßen Schultern.
»Wenn du mit sechs Jahren, anstatt Konzerte zu geben, wie andere gesunde und vernünftige Kinder in der Nase gebohrt hättest, so wäre vielleicht etwas aus dir geworden. So aber lungerst du den ganzen Tag müßig herum und malträtierst einem die Ohren.«
»Malträtierst einem die Ohren ...!« Seine Stimme überschlug sich, und sein Blick war so verschwommen, als ob er durch eine dicke Schicht von Aspik käme. »Weil man ständig übt, um das Gedächtnis aufzufrischen und auf der Höhe zu bleiben. Wenn ich daran denke, wie man mich in Amerika gefeiert hat ...«
Er gab dem bequemen Fauteuil einen Tritt, legte den Kopf schief, maß Mrs. Smith mit einem vernichtenden, glasigen Blick und ging wiegenden Schrittes ab.
Mrs. Smith legte befriedigt das zweite Ohrgehänge an und fühlte sich einigermaßen erleichtert. Die schlechte Laune, unter der sie seit einigen Tagen litt, kam daher, daß ihr Freund ihr untreu geworden war, und so wenig eine derartige Episode in dem bewegten Leben von Mrs. Polly früher bedeutet hatte, jetzt war das immerhin eine unangenehme Sache. Nicht, daß Mrs. Smith gerade sentimental veranlagt gewesen wäre und sich auf den einen kapriziert hätte, aber einen Freund mußte man haben, wenn man mit Mr. Smith verheiratet war. Dessen Lebens- und Gefühlsäußerungen beschränkten sich lediglich auf Essen, Trinken, Schlafen und Musizieren. Ein Grammophon mit Pfeif- und Flüsterplatten hätten den gleichen Zweck erfüllt, ohne so anspruchsvoll zu sein. Für Mrs. Polly bedeutete dieser Gatte allerdings keine sonderliche Enttäuschung. Sie hatte den musikbesessenen Mann geheiratet, als sie entschlossen war, sich ins bürgerliche Leben zurückzuziehen und hier ihren regen und tüchtigen Erwerbssinn zu betätigen.
Schließlich und endlich war eine Tanzbar mit entsprechender Aufmachung auch eine Art Kunstetablissement und noch dazu eines, mit dem man Geld verdienen konnte.
Nur in der allerersten Zeit war es zu einem kleinen Zwischenfall gekommen, den Mr. Smith verursacht hatte. Um dem Unternehmen seiner Frau eine besondere Note zu geben, hatte er sich entschlossen, in das Programm einige wertvolle musikalische Nummern aufzunehmen, die er selbst am Klavier zum Vortrag bringen wollte.
Nach der ersten Viertelstunde aber erscholl hier und dort ein energisches Räuspern, und von irgendwoher erklang sogar ein schriller Pfiff, nach weiteren fünf Minuten setzte ein allgemeines Trampeln ein, und als der weltentrückte Mr. Smith auch diese bedenklichen Sturmzeichen überhörte, kamen nach weiteren fünf Minuten zuerst Bananen und dann plötzlich Gläser und Flaschen geflogen ...
Seit jenem Tage mied Mr. Smith das Lokal und überließ es seiner Frau, hier den Ton anzugeben. Mrs. Polly tat dies in großer Abendtoilette und mit sehr viel Takt und Umsicht. Sie war eine große, schlanke Brünette von einigen vierzig Jahren, die sich bei diskreter Beleuchtung noch immer sehen lassen konnte, und wenn sie hie und da einmal in das Tanzparkett hinabstieg, stellte sie selbst weit jüngere Frauen in den Schatten. Von einer der kleinen, völlig abgeschlossenen Logen aus überwachte sie Nacht für Nacht den Betrieb, und ihr Freund hatte ihr über dieses ewige Einerlei bisher hinweggeholfen.
Nun allerdings waren für die vereinsamte Frau diese Nächte eine Qual, und der unternehmende Mr. Bayford hätte für die Zwecke, die er im Auge hatte, keinen günstigeren Zeitpunkt finden können.