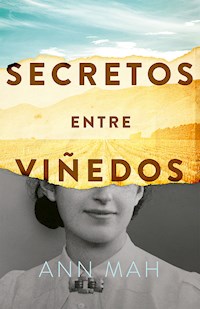9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Idyllische Landschaften, Picknicks in der Spätsommersonne –
willkommen im malerischen Burgund, wo ein altes Weingut ein dramatisches Geheimnis birgt ...
Um sich auf die berüchtigte Meister-Sommelier-Prüfung vorzubereiten, kehrt Kate, eine Amerikanerin mit französischen Wurzeln, zurück auf das Weingut ihrer Familie im Burgund. Dort verbrachte sie als Studentin die schönste Zeit ihres Lebens – doch ließ sie dort auch ihre große Liebe Jean-Luc zurück. Als sie ihm gleich nach ihrer Ankunft wiederbegegnet, wird klar, dass ihre Gefühle von einst nicht erloschen sind. Um sich abzulenken, bietet Kate ihre Hilfe beim Aufräumen der alten Kellergewölbe an – und findet Hinweise auf eine ihr bislang unbekannte Tante, Hélène, und deren dramatisches Schicksal während der deutschen Besatzungszeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 529
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Buch
Um sich auf die berüchtigte Meister-Sommelier-Prüfung vorzubereiten, kehrt Kate, eine Amerikanerin mit französischen Wurzeln, zurück auf das Weingut ihrer Familie im Burgund. Dort verbrachte sie als Studentin die schönste Zeit ihres Lebens – doch ließ sie dort auch ihre große Liebe Jean-Luc zurück. Als sie ihm gleich nach ihrer Ankunft wiederbegegnet, wird klar, dass ihre Gefühle von einst nicht erloschen sind. Um sich abzulenken, bietet Kate ihre Hilfe beim Aufräumen der alten Kellergewölbe an – und findet Hinweise auf eine ihr bislang unbekannte Tante, Hélène, und deren dramatisches Schicksal während der deutschen Besatzungszeit.
Autorin
Ann Mah ist Food- und Reisejournalistin und schreibt regelmäßig Artikel für das Reiseressort der New York Times. Sie erhielt ein Stipendium der New Yorker James Beard Foundation zur Förderung der Kochkunst und studierte in Bologna. Außerdem besitzt sie eine Auszeichnung des Wine and Spirits Education Trust, der größten Weinschulungsinstitution der Welt. Ann Mah lebt und arbeitet in Washington, D. C., und Paris.
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
ANN MAH
DER DUFT VON WEISSEM BURGUNDER
Roman
Deutsch von Babette Schröder
Die Originalausgabe erschien 2018 unter dem Titel »The Lost Vintage« bei William Morrow, New York. Das Zitat von Paul Éluard auf S. 7 stammt aus dem Gedicht »Liberté«, in: Paul Éluard, Gedichte, übersetzt von Stephan Hermlin, Verlag Volk und Welt, Berlin 1949. Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright der Originalausgabe © 2018 by Ann Mah Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2020 by Blanvalet in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München Redaktion: Margit von Cossart Covergestaltung: © Favoritbuero, München Covermotiv: © Drunaa/Trevillion Images; Miiisha/Shutterstock.com AF · Herstellung: sam Satz und E-Book: GGP Media GmbH, Pößneck ISBN: 978-3-641-25492-6V001 www.blanvalet.de
Für Lutetia
Et par le pouvoir d’un mot
Je recommence ma vie
Je suis né pour te connaître
Pour te nommer
Liberté
Und durch die Macht eines Wortes
Beginne ich mein Leben noch einmal
Ich lebe, um dich zu kennen
Um dich zu nennen
Freiheit
»Liberté« von Paul Éluard, 1942
1. Kapitel
Meursault, Burgund
September
Ich hätte es niemals zugegeben, aber eigentlich hatte ich mir geschworen, nie mehr an diesen Ort zurückzukehren. Ich hatte sehr wohl unzählige Male von ihm geträumt, von den geschwungenen Hängen mit den knorrigen Reben, von der Sonne, die in der Hitze nur als weißer Streifen am Himmel zu erkennen war, von dem flirrenden Licht und den Schattenflecken. Doch die Träume gingen stets schlecht aus. Schwere Wolken verdunkelten den Himmel, raue Winde wirbelten Blätter auf, die sich leise Geheimnisse zuflüsterten. Jedes Mal schreckte ich aus dem Schlaf hoch. Mein Herz pochte beunruhigend, und in meinem Hals saß ein Kloß, der sich auch nicht vertreiben ließ, wenn ich kaltes Wasser trank.
Und dennoch war ich nun hier. Dies war mein erster Morgen im Burgund. Von meinem Zimmerfenster aus sahen die Weinreben genauso aus, wie ich sie in Erinnerung hatte. Wie es sich für den Spätsommer gehörte, hingen sie voll von üppigen, fast reifen Trauben. In zwei oder drei Wochen begann die vendange, die jährliche Weinernte, und ich würde zu den Erntehelfern gehören, die die Trauben in alter burgundischer Tradition von Hand schnitten. Bis dahin sahen wir zu, wie die Früchte reiften und immer süßer wurden, die Chardonnay-Trauben eine hellgrüne Farbe annahmen und die des Pinot Noir ein tiefes Schwarz.
Ich zuckte zusammen, als es an der Tür klopfte. »Kate?«, rief Heather. »Bist du wach?«
»Guten Morgen!«, gab ich zur Antwort, und sie trat ins Zimmer.
Ihr Lächeln war noch genau so, wie ich es aus der Collegezeit in Erinnerung hatte – fröhlich strahlende Augen umgeben von Lachfalten und kleine ebenmäßige Zähne.
»Ich habe dir einen Kaffee mitgebracht.« Sie reichte mir eine Tasse und strich sich die dunklen Locken aus dem Gesicht. »Hast du gut geschlafen?«
»Wie eine Tote.« Nachdem ich fast vierundzwanzig Stunden von San Francisco nach Frankreich unterwegs gewesen war, war ich eingeschlafen, kaum dass mein Kopf das Kissen berührt hatte.
»Fühlst du dich hier oben auch wohl? Ich fürchte, das Zimmer ist ein bisschen spartanisch eingerichtet.«
Heather blickte sich um – ein schmales, mit frischen Laken bezogenes Bett, ein Garderobenständer aus Bugholz, der als Kleiderschrankersatz diente, sowie ein verschrammter Schreibtisch vor dem Fenster würden für die kommenden Wochen meine Zuhause sein.
»Alles in Ordnung«, versicherte ich ihr, obwohl sie recht hatte. Trotz des Straußes feuerroter Dahlien auf dem Kaminsims und der glänzenden honigfarbenen Dielen wirkte das Dachzimmer mit dem nackten Fenster und den ausgeblichenen Tapeten, die sich von den Wänden lösten, irgendwie trostlos. »Ich glaube, dieses Zimmer hat schon in meiner Kindheit so ausgesehen.«
»Ach ja, du hast ja früher mit deiner Mutter hier gewohnt. Das hatte ich ganz vergessen. Das Zimmer steht leer, seit dein Großvater gestorben ist. Wie lange ist das jetzt her? Zwanzig Jahre? Aber sei unbesorgt, es gibt keine Geister, das sage ich den Kindern auch immer.« Sie zwinkerte mir zu, und ich lachte. »Wie dem auch sei, im Keller finden wir bestimmt noch ein paar Möbel. Einen Nachttisch habe ich da unten neulich schon entdeckt.«
»Ihr seid so nett«, brach es spontan aus mir heraus. »Ich kann euch gar nicht genug dafür danken, dass ich bei euch wohnen darf.«
Heather und ich hatten uns seit Jahren nicht gesehen, doch als ich sie vor drei Wochen per E-Mail fragte, ob ich bei der Weinlese mithelfen dürfe, schrieb sie umgehend zurück: Komm, sobald du magst. Die vendange beginnt irgendwann Mitte September – bis dahin könntest du mir bei einem anderen Projekt helfen.
Jetzt winkte sie ab. »Sei nicht albern, du gehörst zur Familie! Du weißt doch, dass du hier immer willkommen bist. Und wie gesagt, wir wollten schon ewig den Keller entrümpeln. Der …« Sie zögerte, und ihr Blick fuhr zum Fenster. »Der Zeitpunkt ist perfekt.«
»Dies ist mein erster Urlaub seit Jahren«, gab ich zu.
Zu Hause in San Francisco erforderte meine Arbeit als Sommelière viele Überstunden. Jede freie Minute verbrachte ich mit dem Studium von Wein, jede Reise war Recherchen vorbehalten. Ich buchte stets Nachtflüge, damit ich vom Flughafen aus direkt zur Mittagsschicht ins Restaurant hetzen konnte.
»Ich habe davon geträumt, einmal im Courgette zu essen«, sagte Heather sehnsuchtsvoll. »Ich kann immer noch nicht glauben, dass es geschlossen ist.«
»Es war für alle ein Riesenschock. Vor allem, nachdem wir den dritten Michelin-Stern bekommen hatten …«
Bevor ich weiterreden konnte, ertönte draußen das Dröhnen eines Motors, und als ich aus dem Fenster blickte, sah ich einen gelben Traktor auf den Hof rumpeln. Am Steuer saß mein Cousin Nico. Neben ihm saß eine große, schlanke Gestalt, deren Gesicht im Schatten lag.
Heather trat neben mich. »Da sind Nico und Jean-Luc. Sie waren in der Werkstatt.«
Ich stellte die Kaffeetasse auf dem Fenstersims ab. »Seht ihr Jean-Luc oft?«
»Oh ja. Er und Nico sind immer noch superdicke Freunde – und natürlich superstarke Konkurrenten.« Sie lachte. »Obwohl Jean-Luc sehr zu Nicos Leidwesen im Vorteil ist. Keine Frau, keine Kinder … Er ist total frei und kann ständig arbeiten.«
Ich verschränkte die Arme und zwang mich zu lächeln. Ich konnte zwar nicht hören, was die Männer sprachen, doch der Klang von Jean-Lucs Stimme drang zu mir herauf. Ich erkannte sie, auch wenn ich sie über zehn Jahre nicht mehr gehört hatte.
Als spürte er, dass ich ihn beobachtete, drehte Jean-Luc sich um und blickte zu mir hoch. Ich erstarrte und hoffte, dass die Fensterläden mich verbargen. Dann ging Nico auf das Haus zu, und Jean-Luc wandte sich ab, er neigte den Kopf über ein Klemmbrett. Langsam atmete ich aus.
»Bruyère!« Nicos Stimme schallte die Treppe herauf. »Hast du meine Gummistiefel gesehen?«
»Ich komme sofort!«, rief Heather.
»Er nennt dich immer noch Bruyère?«
»Ja, nach all diesen Jahren besteht dein geliebter Cousin weiter darauf, dass der Name ›Heather‹ für Franzosen unaussprechbar ist.« Sie verdrehte die Augen, doch in ihrem Blick lag Milde.
Eine weitere Erinnerung aus Collegezeiten. »Eh-zaire? Ehzaire?«, hatte Nico immer gesagt und war zunehmend an ihrem Namen verzweifelt, bis er sie eines Tages einfach bruyère genannt hatte. Das französische Wort für Heather, die Heide.
»Es ist irgendwie süß, dass er einen eigenen Kosenamen für dich hat.«
»Ach, Kate.« Eine Hand auf den Türrahmen gelegt, blieb Heather stehen. »Der ganze Ort nennt mich Bruyère.« Ein wehmütiger Ausdruck huschte über ihr Gesicht, dann schlüpfte sie aus dem Zimmer und rief mir über die Schulter zu: »Ich bin unten, wenn du was brauchst.«
Ich hörte, wie sie die Stufen hinunterflog, und dann Nicos Stimme, die einen Schwall Französisch von sich gab, das Lärmen von Kinderstimmen und das Klappern von einer Million Plastikspielsachen, die auf den Holzfußboden krachten.
»Ach, Thibault!«, schalt Heather ihren Sohn, musste jedoch zugleich lachen.
Ich warf einen weiteren verstohlenen Blick aus dem Fenster. Jean-Luc lehnte am Traktor und hielt einen Arm über die Augen, um sie vor der Sonne zu schützen. Von hinten wirkte er erstaunlicherweise kaum verändert. Er war immer noch schlank, sein braunes Haar glänzte wie früher golden.
Hoffentlich hatte er mich nicht gesehen …
Nachdem ich ausgepackt und mich überwunden hatte zu duschen, obwohl das Wasser in dem lachsfarbenen Badezimmer nur lauwarm war, herrschte Ruhe im Haus. Um einen weiteren Kaffee zu trinken, begab ich mich mit meiner Tasse nach unten in die Küche. Auf dem Tresen fand ich eine Nachricht von Heather: Bringe die Kinder in die Ferienbetreuung. Nimm dir Kaffee und Toast. Pfeile deuteten auf eine Stempelkanne und einen Laib Brot.
Ich steckte eine Scheibe in den Toaster und wartete an die Arbeitsplatte gelehnt, dass sie heraussprang. Alle Räume in diesem Haus waren sonnendurchflutet, das Licht fiel durch saubere Leinenvorhänge auf Bücherregale und breite Holzdielen. Doch die Morgensonne brachte Spuren von Altersschwäche zum Vorschein, die mir am Abend zuvor nicht aufgefallen waren: verblasste Tapeten, Risse in den Decken, an einer Wand blätterte die Farbe ab. Auf den Sims über dem Kamin hatte Heather einige silbergerahmte Familienfotos gestellt. Wie jung sie und Nico auf ihrem Hochzeitsfoto aussahen! Ihre Wangen waren glatt und rund wie bei einem Baby. Die steife Korsage von Heathers trägerlosem Kleid verbarg ihr Geheimnis: Sie war bereits mit ihrer Tochter Anna schwanger. Ich hatte das Kleid in einem Brautgeschäft in San Francisco mit ihr zusammen ausgesucht, sah es jedoch heute zum ersten Mal wieder. War das tatsächlich schon zehn Jahre her? Ich hatte immer noch ein schlechtes Gewissen, dass ich die Hochzeit damals verpasst hatte.
Heather und ich hatten uns an der University of California in Berkeley kennengelernt – wir waren Freundinnen und Kommilitoninnen. Wir studierten beide Französisch im Hauptfach und nahmen am selben Auslandsprogramm teil. Als wir in Paris eintrafen, konnte Heather gerade in einer boulangerie ein Croissant kaufen und litt derart unter Heimweh, dass sie eigentlich früher abreisen wollte. Doch dann stellte ich ihr meinen französischen Cousin Nico vor, und sieben Monate und eine ungeplante Schwangerschaft später war aus einer stürmischen Romanze eine ernsthafte Beziehung geworden. Ich wäre skeptisch gewesen, hätte ich nicht bemerkt, wie sie sich anhimmelten, wenn sie sich unbeobachtet fühlten. Jetzt hatten sie zwei Kinder und lebten auf dem Weingut der Familie, das Nico zusammen mit seinem Vater, meinem Onkel Philippe, betrieb.
Mit einem Knall sprang mein Toast heraus. Ich nahm mir ein Messer, setzte mich an den Tisch und bestrich die Scheibe mit Butter und Marmelade, die wie buntes Glas glitzerte. Confiture de cerises war die Lieblingssorte meiner Mutter. Die Kirschen stammten aus dem Garten des Weinguts. Der herbsüße Geschmack der Marmelade erinnerte mich an die Besuche während meiner Kindheit. Meine Mutter hatte einen Löffel davon in meinen Joghurt gerührt und streng darauf geachtet, dass ich auch ja nichts übrig ließ. Sie fürchtete, ich könnte den Zorn ihres Vaters erregen, wenn ich Essen vergeudete.
Ich glaube, wir waren beide ein bisschen erleichtert, als Grandpère Benoît starb und diese Besuche ein Ende hatten. Kurz darauf ließen sich meine Eltern scheiden, und meine Mutter wurde aus beruflichen Gründen nach Singapur versetzt. »Ich habe keine Geduld mehr mit Europa, hier ist es so provinziell. Asien ist die Zukunft«, pflegte sie stets zu sagen. Ich konnte mich nicht daran erinnern, wann meine Mutter das letzte Mal einen Fuß auf französischen Boden gesetzt hatte. Abgesehen von dem einen Jahr, das ich in Frankreich studiert hatte, war ich seitdem ebenfalls nicht mehr hier gewesen.
Geräuschvoll kaute ich meinen Toast, dann trug ich den vollgekrümelten Teller zum Spülbecken. Durchs Fenster sah ich Nico und Jean-Luc in die Weinberge hinaufgehen und hinter einer Hügelkuppe verschwinden. Erleichtert atmete ich aus. Ich räumte die Küche auf, wischte die Arbeitsplatten ab und spülte das Geschirr. Während ich an einem besonders klebrigen Marmeladenklecks herumschrubbte, wanderten meine Gedanken zu dem wahren Grund, aus dem ich hergekommen war – dem Test.
Es war achtzehn Monate her, dass ich den Test das letzte Mal gemacht hatte, doch ich konnte mich noch lebhaft an jedes Detail der viertägigen Prüfung erinnern. An die Form der schlichten Glaskaraffen, in denen sich der Wein für die Blindverkostung befunden hatte. An das Geräusch meines Stifts, mit dem ich mir knappe Notizen zu jedem Wein gemacht hatte – zu seiner Herkunft und Herstellung. An den Geschmack von gerösteten Mandeln, Holunderblüten und Feuerstein, der den Weißburgunder charakterisierte, bei dem ich versagt hatte. An das grauenhafte, demütigende Gefühl, das mich überkommen hatte, als ich begriff, dass ich einen der beliebtesten Weine der Welt nicht erkannt hatte – den Wein, den der französische Zweig meiner Familie seit Generationen herstellte. Den Wein, von dem diese Familie glaubte, er flösse in unseren Adern.
Natürlich wusste ich, dass das Bestehen des Tests keine Erfolgsgarantie war. Ich kannte die Bewertung einiger anerkannter Weinkenner, die auf den Titel Master of Wine pfiffen und ihn als albernes, teures Chichi abtaten. Doch es gab einen Teil in mir, der voller Neid den Wine Spectator verschlang und bis zum Morgengrauen das Wissen auf Karteikarten notierte, und jener Teil kam sich ohne diesen Titel wie ein Versager vor. Die Qualifikation »MW« war wie ein Dr. phil. oder Dr. med. – sogar wertvoller, denn es gab nur dreihundert Masters of Wine auf der ganzen Welt. Fünf Jahre lang hatte ich mich auf den Test vorbereitet, Hunderte von Stunden und Tausende von Dollar in das Kreisen, Nippen und Ausspucken von Wein investiert.
Der erste Test war eine Katastrophe gewesen, ein peinliches Bombardement von Fragen, die mir nur bewusst machten, wie viel ich noch zu lernen hatte. Ein Jahr später bestand ich den Theorieteil – eine Reihe einfacher Fragen zu Weinanbau und – herstellung, zu Verkauf und Lagerung sowie der besten Art, ihn zu trinken. Doch ich musste noch den praktischen Teil bestehen, eine albtraumhafte Prüfung in Form einer Blindverkostung. Ein Wald aus Stielgläsern mit Dutzenden von unterschiedlichen Weinen, die ich anhand weniger Schlucke identifizieren musste. Das Programm »Master of Wine« bezeichnete sich selbst als den härtesten Wissens- und Kenntnistest in der Welt des Weines und ließ jedes Jahr voller Stolz die Mehrheit der Kandidaten durchfallen. Ich hatte nur noch eine Chance, den Test zu bestehen, anschließend verbot mir das steife britische Institute of Masters of Wine, jemals wieder daran teilzunehmen.
»Frankreich ist deine Achillesferse. Und noch nicht einmal der ganze französische Wein. Nur der Weißwein«, hatte Jennifer vor einigen Monaten festgestellt, als wir eine meiner praktischen Prüfungen durchgingen. »Das ist witzig, weil der Test so viel mehr umfasst als zu der Zeit, als ich ihn gemacht habe. Nicht nur Südafrika, auch den Libanon, Australien, Oregon, Kalifornien …«
»Wein aus der ›Neuen Welt‹ gab es auch schon in der guten alten Zeit«, neckte ich sie. »Und das nicht nur in Südafrika.« Jennifer war in Cape Town geboren und eine unermüdliche Verfechterin des Pinotage.
»Aber in der ›Neuen Welt‹ kennst du dich hervorragend aus. Kanntest dich schon aus, als du gerade erst angefangen hattest. Nein, die Weißweine der ›Alten Welt‹ musst du studieren. Du bist das genaue Gegenteil von mir.« Jennifer blickte mich über den Rand ihrer Brille hinweg an. »Hast du mal überlegt, nach Frankreich zu gehen?«
»Nach Frankreich?«
»Sieh mich nicht so entsetzt an. Ja, nach Frankreich. Du weißt schon, dieses Land, in dem ein bisschen Wein produziert wird? Pass auf, Kate, als deine berufliche Mentorin ist es meine Aufgabe, dir unaufgefordert Ratschläge zu erteilen. Also, wenn du diese verdammte Prüfung bestehen willst, musst du dich mit französischem Wein auskennen. Und das tust du nicht. Das ist merkwürdig. Es ist fast, als hättest du etwas gegen ihn.«
Sie durchbohrte mich mit ihrem Blick, eine Mischung aus mütterlicher Sorge und professioneller Autorität. Jennifer und ich hatten uns in einem spanischen Restaurant in Berkeley kennengelernt, in dem sie Chef-Sommelière war und ich als Collegestudentin kellnerte, um mir etwas dazuzuverdienen. Sie hatte mich unter ihre Fittiche genommen und mich ermuntert, mich weiter mit Wein zu beschäftigen. Ohne ihre Unterstützung hätte ich es nie so weit gebracht.
Unter ihrem Blick lief ich rot an. »Ich glaube, ich habe schon ziemliche Fortschritte mit den Bordeaux-Sorten gemacht.«
»Oh, du weißt genug, um zurechtzukommen.« Sie wedelte mit der Hand. »Aber ich meine richtig kennen. Nicht nur die Unterschiede zwischen den einzelnen Regionen, sondern den Unterschied zwischen den verschiedenen Anbaugebieten. Du musst das Terroir verstehen, den Unterschied schmecken, den drei Meilen ausmachen. Besuch Weingüter. Rede mit den Winzern. Trink Wein. Die meisten Menschen würden sich um deine Probleme reißen.« Sie beugte sich auf ihrem Stuhl vor. »Du sprichst doch noch Französisch, oder?«
Ich starrte auf die Reihe halb leerer Gläser. »Ich könnte wieder reinkommen, wenn ich es versuchen würde.«
»Denk darüber nach. Ein ausgedehnter Urlaub. Drei oder vier Monate mindestens. Du musst reisen. Und du solltest zur Weinlese hinfahren. Den Prozess aus erster Hand miterleben.«
»Drei oder vier Monate?« Ich hatte nur zehn Urlaubstage im Jahr. »So lange kann ich mir nicht freinehmen.«
»Warum nicht? Du hast doch auch diesen Job in Australien gemacht.«
»Das war direkt nach dem College«, protestierte ich. »Jetzt habe ich Verpflichtungen. Autoraten. Miete.« Sie spricht von Frankreich, schrie eine Stimme in meinem Kopf. Dorthin kann ich nicht zurück. Stattdessen sagte ich: »Das ist zu kompliziert.«
»Denk noch mal drüber nach.«
»Mach ich«, sagte ich, entschlossen, den Gedanken schnell wieder zu vergessen.
Doch dann geschahen ein paar Dinge.
Als Erstes erhielt ich einen Anruf von einer Headhunterin. Ich liebte meine Arbeit als Sommelière im Courgette und schnitt Headhuntern normalerweise das Wort ab, bevor sie mit ihrem Geschwafel überhaupt beginnen konnten. Doch diese Frau sagte, noch ehe ich sie unterbrechen konnte, ein Wort, das mein Herz höherschlagen ließ: »Sotheby’s.«
Sie stelle eine Liste von Kandidaten zusammen, um im Napa Valley eine Weinabteilung zu eröffnen. Die Qualifikation Master of Wine war äußerst begehrt. Ein langer Prozess, aber die Gespräche mit den Kandidaten, die in die engere Auswahl kamen, würden erst nach dem Test stattfinden. Jennifer Russel habe mich wärmstens empfohlen. Ob ich interessiert sei?
Zunächst wich ich aus. Das Courgette wurde von der Kritik als Sternerestaurant gefeiert und war äußerst beliebt. Andererseits war mir klar, dass ich nicht ewig bleiben konnte. Ich wollte schlafen gehen, wenn die Sonne unterging, nicht umgekehrt. Ich wollte eine Beziehung mit jemandem haben, der samstagabends zum Essen ausging, statt zu arbeiten. Und ich konnte nicht bis ins hohe Alter Kartons schleppen und täglich vierzehn Stunden auf den Beinen sein. Früher machte ich gern Witze darüber, dass mich nur ein Leistenbruch von der Arbeitslosigkeit trenne – bis ich befördert wurde, weil der leitende Sommelier wegen eines Leistenbruchs gehen musste. Die Aussicht auf einen beruflichen Wechsel klang verlockend, insbesondere zu einem so angesehenen Auktionshaus wie Sotheby’s. Ich würde mit Sammlern von Lagenweinen zu tun haben, Verkäufe organisieren, einen regelmäßigen, gut bezahlten, begehrten Job mit allen Sozialleistungen haben. Ja, erklärte ich ihr, ich bin interessiert. Nein, versicherte ich ihr, der Test sei kein Problem, und ich hoffte inständig, dass dem auch so war …
Das Zweite, was passierte, war für uns alle ein Schock. An einem grauen, eiskalten Julinachmittag, wie er zuweilen im Hochsommer in San Francisco vorkommt, wurde Bernard »Stokie« Greystokes – bon vivant, Weinkenner und Inhaber des Courgette – wegen Unterschlagung verhaftet. Die Bundespolizei führte ihn zwischen dem Mittags- und dem Abendgeschäft in Handschellen ab. Als wir einige Tage später zur Arbeit kamen, erfuhren wir die traurige Wahrheit. Stokie war pleite, das Restaurant insolvent, und wir waren unsere Jobs los. Nach fünfzehn Jahren schloss das Courgette für immer seine blau-weiß gestreiften Türen.
Wir versammelten uns in einer Spelunke, die drei Blocks entfernt lag. Auf Margaritas folgten Tequilas und schließlich Tequila direkt aus der Flasche. In unserer Fassungslosigkeit wegen Stokie, unserer Trauer um das Courgette und unserer Angst um unsere Bankkonten klammerten wir uns aneinander. Doch als ich im Morgengrauen von hämmernden Kopfschmerzen erwachte, zwang ich mich, pragmatisch zu denken. Meine Ersparnisse genügten, um einige Monate über die Runden zu kommen, doch der Test fand erst in knapp einem Jahr statt. Ich musste mir einen neuen Job suchen.
»Warum nutzt du die Zeit nicht, um dich ganz der Prüfungsvorbereitung zu widmen?«, fragte Jennifer, als sie mich am nächsten Morgen anrief. »In meinen Augen ist das die perfekte Gelegenheit für eine ausgiebige Weinreise.«
»Wäre da nicht das kleine Problem mit dem Geld.«
»Vermiete deine Wohnung über Airbnb. Kauf dir von deinen Ersparnissen ein Flugticket nach Frankreich. Hast du nicht Verwandte mit einem Weingut in Meursault?«
»Ja«, gab ich zögernd zu.
»Frag sie, ob du ein paar Monate bei ihnen wohnen kannst. Sag ihnen, du hilfst gegen Kost und Logis auf dem Gut mit. Glaub mir, ich habe noch nie erlebt, dass ein Winzer einen freiwilligen Helfer abweist. Und«, fügte sie hinzu und erwärmte sich zunehmend für ihre Idee, »wenn du dich bald darum kümmerst, könntest du sogar zur vendange dort sein!«
Jennifer konnte stur und penetrant sein, doch in all den Jahren, die ich sie kannte, hatte sie mir niemals einen schlechten Rat erteilt. Ich schluckte meinen Stolz hinunter, schrieb Heather und Nico, und einige Wochen später fand ich mich dort wieder, wo ich mich am allerwenigsten vermutet hätte. Auf einem Direktflug nach Paris.
2. Kapitel
»Also los.« Heather drehte den Türknauf und öffnete knarrend die Tür. Dahinter führte eine Treppe hinunter in die Dunkelheit. »Mach dich auf was gefasst.«
Ich folgte ihr in den Keller und atmete die kühle, feuchte Luft ein, die ein wenig modrig roch. Im schwachen Schein einer Glühbirne, die von der Decke hing, kamen Berge von Gerümpel zum Vorschein. Kartons, aus denen alte Kleider hervorquollen, umgekippte Zeitungs- und Zeitschriftenstapel, bergeweise alte Möbel, die umzukippen und uns unter sich zu begraben drohten. Ich sah Fernseher aus Zeiten, in denen es noch keine Fernbedienung gab, ein Radio aus der Ära, als das Fernsehen noch nicht erfunden war, einen gesprungenen Globus aus Zeiten vor der Sowjetunion, eine Kiste voller Fächer, die vermutlich in Gebrauch gewesen waren, bevor der elektrische Strom erfunden wurde. Und das war nur das, was direkt vor uns stand.
Heather legte den Kopf in den Nacken. »Das gibt’s doch nicht«, flüsterte sie. »Vermehrt sich das Zeug, während wir schlafen?«
»Das ist wie in einer Folge von Leben im Chaos.«
»Mmh?« Sie riss den Blick von dem Gerümpel los und sah mich an.
»Das ist eine Realityshow, in der Leute in Schutzanzügen Wohnungen entrümpeln.«
»Darüber gibt es eine ganze Fernsehsendung? Gott, manchmal sind mir die Staaten ziemlich fremd.«
»Es gibt Menschen, die wegen ihres Sammelzwangs sterben. Das ganze Zeug bricht über ihnen zusammen, und sie ersticken.«
»Sind wir die Typen in den Schutzanzügen oder die, die lebendig begraben werden?«
»Wir könnten beides sein.«
»Ich würde ja gern lachen«, sagte sie finster. »Aber genau so könnte es sein.« Sie rollte eine Packung Müllbeutel auseinander. »Komm. Du fängst auf der einen Seite an, ich auf der anderen, dann treffen wir uns in der Mitte. Wahrscheinlich irgendwann im Februar. Was meinst du?«
»Klar.« Ich nickte, und sie riss einige schwarze Plastiksäcke von der Rolle und reichte sie mir.
Eigentlich hatte Heather nach dem Mittagsessen mit mir nach Beaune fahren wollen, um durch die verwinkelten Gassen der Altstadt zu schlendern und auf dem Place Carnot Limonade zu trinken. »Es ist dein erster Tag«, hatte sie gesagt. »Wir haben noch genug Zeit, la cave auszuräumen, ehe die vendange beginnt.« Dennoch hatte sie irgendwie erleichtert gewirkt, als ich ihr vorschlug, direkt mit der Arbeit zu beginnen. »Ich will dir helfen, so gut ich kann«, hatte ich gesagt, was zum Teil der Wahrheit entsprach.
Ich verschwieg ihr, dass ich noch nicht so weit war, einen Nachmittag mit einer Freundin, die ich zehn Jahre nicht gesehen hatte, in Erinnerungen zu schwelgen oder Geheimnisse auszutauschen.
Jetzt arbeiteten wir in kameradschaftlichem Schweigen. Das Zerreißen von Pappe und das Rascheln der Müllsäcke waren die einzigen Geräusche. Hin und wieder rief ich ihr zu, was ich in einem der Kartons gefunden hatte.
»Hier sind alte, fleckige Strampelanzüge drin. Kaputte Schnuller. Schmuddelige Stofftiere.«
»Weg damit!«
»Ungefähr eine Million Stoffwindeln.«
»Weg damit!«
»Ein mittelalterliches Folterinstrument?« Ich hielt ein Plastikobjekt mit sich windenden Gummischläuchen hoch.
»Ach, Gott, meine Milchpumpe. Weg damit!«
Es schien mir merkwürdig, diese Erinnerungsstücke zu begutachten, ohne ihren ideellen Wert zu kennen. Wie beispielsweise einen Berg statisch aufgeladener Shirts aus knallbuntem Polyester. Ich hielt eins hoch und betrachtete die breiten gelb-blauen Streifen. Auf dem Rücken stand der Name CHARPIN, darunter eine große 13.
»Ein Fußballtrikot … vielleicht Nicos?«, rief ich Heather zu.
»Weg damit!« Dann fügte sie leiser hinzu: »Aber erzähl es ihm nicht.«
Ich legte eins von Nicos Fußballtrikots auf den Stapel mit den Sachen, die wir behalten wollten, und stopfte den Rest in einen Müllsack. Als ich den nächsten Karton öffnete, berührten meine Finger weiches Leder, und ich zog ein Paar winzige Babyschuhe mit verblassten rosa Schleifen hervor. Als ich sie umdrehte, sah ich, dass ein Name in die Sohlen gestickt war – Céline. Die Schuhe hatten meiner Mutter gehört, die in diesem Haus aufgewachsen war. Sosehr ich mich bemühte, es fiel mir schwer, sie mir als Baby vorzustellen, das etwas so Niedliches getragen hatte. In meinem Kopf sah ich sie immer als tadellos gekleidete Geschäftsfrau mit makellosem blondem Bob.
Ich zögerte. Sollte ich die Schuhe für sie aufheben? Sie hatte nie viel auf ihr Erbe gegeben. Als ich auf die Welt gekommen war, hatte sie schon nicht mehr in ihrer Muttersprache geredet – hatte sogar ihren Akzent verloren und »aus steuerlichen Gründen« ihre französische Staatsbürgerschaft aufgegeben. So hatte sie beides auch nicht an mich weitergegeben. Dennoch, diese winzigen Schuhe waren eins der wenigen Dinge, die von ihrer Kindheit übrig waren. Ich stellte sie fürs Erste auf den Stapel mit den Sachen, die aufbewahrt werden sollten.
Unten in dem Karton fand ich einen kleinen vergilbten Matrosenanzug mit eckigem Kragen und Messingknöpfen. »Oh, sieh mal!«, rief ich. »Der muss Onkel Philippe gehört haben.« Ich griff nach einem leeren Karton. »Ich packe einen Karton für ihn und Tante Jeanne.«
Heather kam herüber und nahm mir den Anzug ab. Sie zögerte. »Nicos Eltern sind im Urlaub auf Sizilien.«
»Ja, aber sie können doch alles durchsehen, wenn sie zurück sind.«
Wieder zögerte sie, und selbst in dem trüben Licht hier unten sah ich, dass ihr die Röte in die Wangen stieg. »Ich glaube, du hast recht«, sagte sie schließlich und ging zurück auf ihre Seite, ehe ich ihr noch weitere Fragen stellen konnte.
Am späten Nachmittag wateten wir durch ein Meer aus randvollen Müllsäcken. Trotzdem wirkte der Keller noch seltsam unberührt. Überall Berge von Gerümpel. »Ich schwöre dir, das Zeug vermehrt sich jedes Mal, wenn wir uns umdrehen«, sagte Heather stöhnend, als wir Kartons und Plastiksäcke nach oben brachten und auf die Ladefläche von Nicos Pick-up hievten. Doch nach einer Tasse Tee und ein paar Shortbreads fassten wir neuen Mut. Zurück im Keller, schafften wir es, ein paar Quadratmeter Kellerboden freizuräumen. Heather zog einen zerschrammten Lederkoffer hervor, ein kastenartiges Relikt aus einer anderen Zeit mit stabilen Seiten, einem Messingverschluss und einem dicken Ledergriff.
»Kannst du dir vorstellen, dieses Ding mit dir herumzuschleppen? Ohne Räder?« Sie kniete sich auf den Boden, um den Verschluss zu öffnen. »Hm.«
»Was ist?« Ich blickte von einem Karton voller Bücher auf.
»Der Verschluss klemmt.«
»Warte.« Ich quetschte mich an einem Metallregal vorbei. »Zeig mal.« Als ich neben dem Koffer kniete, entdeckte ich ein Schild an dem schweren Griff, ein abgenutztes Lederschild mit den Initialen H. M. C. Ich drückte auf den Verschluss. »Der Koffer ist abgeschlossen. Ist da irgendwo ein Schlüssel?«
Heather schaltete die Taschenlampe ihres Smartphones ein und richtete den Lichtstrahl auf den Boden. »Hier ist keiner.« Dann versuchte sie erneut, den Verschluss zu öffnen. »Vielleicht können wir das Schloss knacken? Ist hier unten irgendwo ein Werkzeugkasten?«
»Wir könnten es«, ich grub in der Tasche meiner Jeans, »hiermit versuchen.« Ich hielt ihr meinen Korkenzieher hin.
Sie lachte. »Hast du das Ding immer bei dir?«
»Für den Notfall.« Ich reichte ihn ihr.
Sie führte die Spitze des Korkenziehers in das Schloss ein und schlug mit dem Rücken eines französisch-englischen Wörterbuchs auf das Ende. »Ich weiß nicht, ob das funktioniert.«
»Lass mich mal.« Ich nahm das Wörterbuch, zielte sorgfältig und schlug zweimal zu. Dann hörte ich ein Knacken, und der Verschluss sprang auf.
»Ich werde mich nie wieder über deinen Korkenzieher lustig machen«, versprach Heather und hob den Kofferdeckel an. »Puh! Noch mehr alte Kleidung. Kannst du dir das vorstellen?«
Ich zog ein geblümtes Kleid aus einem verblichenen Baumwollstoff hervor, vermutlich aus den 1940er-Jahren. Es hatte einen schlichten rechteckigen Ausschnitt und kurze Puffärmel. Und es sah abgetragen aus. Unter den Armen und auf dem Rock waren dunkle Flecken, winzige Löcher scharten sich um ein großes Loch. Darunter lag ein rot-weiß gepunktetes Baumwollkleid im selben Stil, das noch mehr Löcher hatte. Ein praktischer Hosenrock aus dickem braunem Tweed. Ein Paar Stegsandaletten, deren graues Wildleder abgenutzt war und glänzte. Ein zerdrückter beiger Hut mit einer mottenzerfressenen Krempe. Einige gehäkelte Damenhandschuhe und ein Einzelstück aus schwarzem Seidenpikee.
»Wem haben diese Sachen gehört?« Ich hielt das gepunktete Kleid hoch. Es reichte mir bis knapp unters Knie und war für eine Frau meiner Größe bestimmt. »Das Zeug kann nicht von meiner Großmutter sein. Die war winzig.«
»Sieh mal.« Heather grub weiter in dem Koffer. »Hier sind noch andere Sachen. Eine Karte.« Sie faltete sie auseinander. »Paris et ses banlieues. Paris und seine Vororte?« Erneut griff sie in den Koffer. »Und … ein Umschlag!« Sie hob die Lasche an und zog einen Stapel Schwarz-Weiß-Fotografien hervor, die in dem schwachen Licht kaum zu erkennen waren. »Wollen wir hochgehen? Ich muss sowieso das Abendessen vorbereiten.«
Wir schleppten den Koffer hoch. In der hell erleuchteten Küche wuschen wir uns die schmutzigen Hände, dann studierten wir die Fotos.
»Ich bin mir fast sicher, dass das eine von unseren Parzellen ist.« Heather hielt eine Aufnahme der Weinberge hoch, in denen eine kleine Steinhütte mit einem gewölbten Ziegeldach stand. »Ich erkenne die cabotte. Sie ist oval, was ziemlich selten ist – normalerweise sind die Hütten rund.«
Als Nächstes folgte ein Foto von zwei Jungen mit einem hellen Labrador. Das letzte Bild zeigte ein Gruppenporträt vor dem Haus. In der Mitte stand ein stämmiger Mann mit einem dunklen Schnurrbart. Ein Lächeln spielte um seine Lippen, die Augen waren im Schatten einer Schirmmütze verborgen. Eine schlanke Frau mit feinen Gesichtszügen stand neben ihm und lächelte steif. Sie trug ein kariertes Baumwollkleid. Davor hockten die zwei Jungen, die sie schon von dem Foto mit dem Hund kannten. Der kleinere schaute finster in die Kamera, der etwas ältere, der zerzaustes Haar und ein blasses schmales Gesicht hatte, blickte aus dunklen Augen in die Linse. Neben den Kindern stand ein hochgewachsenes junges Mädchen mit lockigem schulterlangem Haar. Sie trug ein geblümtes Kleid und hatte eine runde Schildpattbrille auf der Nase.
»Das Kleid, das das Mädchen anhat«, sagte ich. »Das ist das aus dem Koffer.«
»Wer ist sie? Erkennst du jemanden?«, fragte Heather.
Ich schüttelte den Kopf. »Meine Mutter hatte es nicht so mit Familiengeschichte. Aber dieser Junge«, ich deutete auf den finster dreinblickenden Jungen, »sieht genau aus wie Thibault. Findest du nicht?«
Heather lachte. »Du hast vollkommen recht.« Sie betrachtete die Gesichter, dann drehte sie das Foto um. »Les vendanges. 1938. Dann ist es nicht Nicos Vater, denn der ist in den Fünfzigern geboren.«
»Einer der Jungen muss Grandpère Benoît sein. Aber wem gehört der Koffer? Soweit ich weiß, hatte er keine Schwester.« Ich berührte das abgenutzte Namensschild und strich mit den Fingern über die Initialen. »Wer ist H.M.C.?«
Heather schüttelte den Kopf. »Ich habe keine Ahnung. Eine lang vergessene Tante? Eine Tochter, die in Ungnade gefallen ist?«
Bevor ich etwas erwidern konnte, flog die Hintertür auf, und Thibault sauste herein. »Maman!« Er stürzte auf Heather zu. »Wir haben eine Überraschung für Kate!«
»Für mich?«, fragte ich.
Anna erschien in der Tür, dann Nico, die Arme voller Flaschen. »Ich habe einige Weine für eine dégustation ausgewählt, um dir bei der Vorbereitung auf die Prüfung zu helfen«, erklärte er.
»Ja!« Heather klatschte in die Hände. »Das heißt, es gibt CFC zum Abendessen.«
»Was ist CFC?«, fragte ich, während Nico mir eine Flasche zum Öffnen reichte.
»Charcuterie. Fromage. Crudités. Aufschnitt. Käse. Salat.« Heather wuschelte ihrer Tochter durchs Haar, dann nahm sie ein paar Holzbrettchen aus einem der Regale.
»Alles, was man für eine ausgewogene Mahlzeit braucht«, sagte Nico.
»Und ganz ohne zu kochen«, ergänzte Heather.
Zwanzig Minuten später saßen wir um den Küchentisch, schnitten Stücke von zerlaufendem Käse, stapelten Scheiben von saucisson sec auf ein Stück Baguette und luden Salat auf unsere Teller. Vor uns stand ein Wald aus Stielgläsern.
»Jetzt probier diesen hier.« Nico schenkte mir einen anderen Weißwein ein und beobachtete, wie ich ihn im Glas kreisen ließ und tief einatmete.
»Die Farbe ist klar und hell … gelb mit einem Hauch Gold …«, begann ich. »Eine Nase von Steinobst – weißem Pfirsich – und etwas Geröstetem. Mandeln?« Ich träufelte einige Tropfen auf meine Zunge. »Ja … Pfirsich. Aprikose. Und ein schöner langer Abgang mit Gewürznoten.« Ich nahm noch einen Schluck und seufzte leise. Als ich die Augen öffnete, stellte ich fest, dass mich alle beobachteten – Heather, Nico und die Kinder, die ihre Baguettestücke auf halbem Weg zum Mund in der Luft hielten.
»Alors?« Nico hob fragend die dichten Augenbrauen.
»Ausgezeichnet«, sagte ich, um Zeit zu gewinnen.
»Und? Welches Anbaugebiet?« Er hatte das Etikett weggedreht, sodass ich es nicht lesen konnte.
Ich überlegte. »Montrachet?«
Entsetzt sah er mich an. »Mais non, Kate. Der letzte Wein war ein Montrachet. Dieser ist ein Meursault. Unser Wein. Probier ihn noch mal.«
Beim zweiten Schluck schmeckte ich hinter der Frucht eine blumige Note heraus, und etwas Sinnliches, fast Verführerisches, das ich nicht benennen konnte. Ich wollte unbedingt herausfinden, was es war. Wo hatte ich schon einmal etwas Ähnliches getrunken?
»Er kommt mir irgendwie … bekannt vor.«
»Pas mal, Katreen!« Nico schürzte die Lippen und nickte. »Es ist der Wein von Jean-Lucs Weingut. Sein Vater hat ihn produziert.«
»Ah. Jean-Lucs Vater.« Ich schluckte etwas heftiger als beabsichtigt.
»Er ist aus einer der letzten Lesen von Gouttes d’Or, die er je gemacht hat«, erklärte Nico. »Ich habe ihn aus dem cave geholt, damit du ihn mit den anderen vergleichen kannst.«
»Gouttes d’Or … Goldtropfen«, wiederholte ich.
Ich trank noch einen Schluck, und gegen meinen Willen stieg eine Erinnerung in mir auf: Jean-Lucs Hände hielten eine Flasche, die von einer dicken weißgrauen Schicht Kellerschimmel überzogen war. »Gouttes d’Or«, hatte er gesagt, und seine Augen hatten vor Stolz geglänzt. »Der Wein meiner Familie. Dieser ist ein 1978er, einer der besten millésimes. Und der erste Wein, den mein Vater hergestellt hat.« Mich überkam eine derart heftige Sehnsucht, dass der Wein auf meiner Zunge bitter schmeckte.
»Maman!« Thibault durchbrach die Stille und ließ klappernd die Gabel fallen. »Ich will Barbapapa sehen! Ich bin fertig!«
Ich schob mein Glas fort und hoffte, dass es niemandem aufgefallen war.
»Ich bin auch fertig.« Anna rutschte von ihrem Stuhl.
»Moment, Moment, was sagt ihr?« Heather blickte sie erwartungsvoll an.
»Danke für das Essen, Maman! Darf ich bitte aufstehen?«, fragten sie im Chor.
»Ja, ihr dürft«, sagte sie. »Schön, dass ihr gefragt habt.«
Sie verschwanden im Wohnzimmer, und gleich darauf hörte man, wie der Fernseher eingeschaltet wurde.
»Apropos les caves«, Heather nahm ihr Weinglas und trank einen Schluck, »Kate und ich haben dort unten heute etwas Interessantes entdeckt.«
»Ah bon? Quoi?« Nico langte über den Tisch und spießte eine Restscheibe Schinken von Thibaults Teller auf. »Einen zerkratzten Louis-XV.-Sekretär?«, fragte er hoffnungsvoll. »Oder vielleicht ein scheußliches Gemälde, das ein Werk des jungen Picasso ist?«
»O nein. Einen alten Koffer voller Kleider. Und ein paar Fotografien.« Sie nahm die Fotos vom Tresen, reichte sie Nico und schaute ihm über die Schulter, während er sie durchsah.
»Das ist eine unserer Parzellen«, sagte er und hielt bei dem Bild von den Weinbergen mit der Steinhütte inne. »Mein Vater hat früher in der cabotte mit mir campiert. Erinnerst du dich, Kate? Ich glaube, einen Sommer warst du dabei. Papa sagte immer, es sei wie früher. Comme autrefois.«
In meinem Kopf tauchte die Erinnerung an eine dunkle Nacht auf. Ein Himmel voller Sterne. Flackerndes Lagerfeuer. Würstchen, die auf Stöcken gegrillt wurden und, anstelle von S’mores, Riegel dunkler Schokolade, die man zwischen zwei Baguettescheiben schmolz.
»Wir haben immer ein Feuer in der Mitte der Hütte gemacht.« Nico wandte sich dem nächsten Foto zu, es war das Gruppenporträt. »Wow, das Haus sieht ganz genauso aus.«
»Es wurde 1938 aufgenommen.« Heather schnappte sich ein cornichon von seinem Teller und biss genüsslich in die kleine Gewürzgurke. »Erkennst du jemanden?«
Nico betrachtete die Menschen auf dem Bild. »Den.« Er zeigte auf den stämmigen Mann, dessen grobe gallische Gesichtszüge und dunkle Augen seinen eigenen glichen. »Das ist unser Urgroßvater. Edouard Charpin. Er ist im Krieg noch ziemlich jung in einem Arbeitslager gestorben … Das muss wenige Jahre nach dem Entstehen dieses Fotos passiert sein. Und das«, er ließ den Finger zu der schlanken Frau gleiten, »ist unsere Urgroßmutter Virginie. Hier ist unser Großvater Benoît.« Er zeigte auf das Kind mit dem schmalen Gesicht. »Und der kleine Junge ist sein Bruder Albert. Er ist Trappistenmönch geworden.«
»Im Ernst?«, fragte Heather.
»Das war damals nichts Ungewöhnliches, chérie.«
»Wer ist das?« Heather beugte sich über Nicos Stuhl, sodass ihr Kopf seinen berührte. Sie zeigte auf das junge Mädchen im geblümten Kleid. »Ist sie mit euch verwandt?«
Nico betrachtete das Foto genauer. »Sie sieht ganz aus wie …«
»Thibault?«, unterbrach ihn Heather. »Das hab ich auch gedacht.«
Nico sah sie verwirrt an. »Ich wollte sagen, dass sie wie Kate aussieht. Sieh dir ihren Mund an.«
Heather atmete geräuschvoll ein. »O mein Gott, du hast recht.«
Ich blickte auf das Mädchen auf dem Foto. Ob es ebenfalls grüne Augen hatte? Und Sommersprossen auf der Nase? Als ich aufsah, starrten Heather und Nico mich derart durchdringend an, dass ich errötete.
»Wer ist H. M. C.?«, fragte ich in dem Bemühen, das Thema zu wechseln. »Diese Initialen stehen auf dem Koffer.«
»Das weiß ich nicht«, räumte Nico ein. »Mein Vater kennt sich besser mit unserer Familiengeschichte aus. Er verwahrt das livret de famille – unser Stammbuch.« Er schob die Fotos zurück in den Umschlag. »Wie du weißt, reagiert er allerdings manchmal ein bisschen gereizt auf diese Dinge. Er spricht nicht gern über die Vergangenheit.«
Ich nickte und erinnerte mich an Onkel Philippes scharfe Gesichtszüge und seine schmalen Augen. Als Kind hatte er mir Angst gemacht, er konnte unseren Kabbeleien mit einem einzigen vernichtenden Blick ein Ende bereiten. Selbst als Studentin hatte mich seine kühle Distanziertheit eingeschüchtert – ganz zu schweigen von seiner Angewohnheit, ständig mein Französisch zu korrigieren, sodass ich in seiner Gegenwart keinen Ton mehr herausbrachte. Ja, Nico hatte recht. Mein Onkel würde sich nicht gerade über Fragen nach der Vergangenheit freuen.
»Aber es ist irgendwie so traurig.« Ich griff nach dem Umschlag mit den Fotos. »Man hat sie mit der Zeit einfach vergessen.«
Auf der anderen Seite des Tisches sackten Heathers Schultern kaum merklich ein Stück nach unten, dann begann sie, das Geschirr abzuräumen.
»Mal ehrlich«, sagte sie, »könnte das nicht jedem von uns passieren?«
Schon bald stellte sich eine gewisse Routine ein. Morgens brachten Heather und ich die Kinder in die Betreuung, dann entrümpelten wir weiter. Ein paarmal fuhren wir zum Recyclinghof, der sich außerhalb von Beaune befand. Mit jeder Fuhre, die wir dort abluden, brachte Heather dem Leiter, der uns beim Entladen half, eine Dose selbst gebackener Brownies mit. Im örtlichen Secondhandladen, der gespendete Sachen für einen guten Zweck verkaufte und morgens geschlossen hatte, stellten wir alles, was noch gut nutzbar war, vor der Hintertür ab und stahlen uns wie Diebe davon. Gegen Mittag legten wir eine kurze Pause ein – meist wärmten wir Essensreste in der Mikrowelle auf. Wir aßen im Stehen am Küchentresen und blickten dabei auf unsere Smartphones – »Erzähl das bloß nicht Anne und Thibault«, murmelte Heather –, dann kehrten wir in den Keller zurück, bis es Zeit wurde, die Kinder abzuholen.
Anfangs hatte mich die Aussicht ein wenig beunruhigt, so viel Zeit mit Heather allein zu verbringen. Ich fürchtete, sie würde mir unangenehme Fragen zu meinem Leben in San Francisco stellen. Im Grunde war es mir nur peinlich zuzugeben, dass ich neben der Arbeit kaum ein Leben hatte. Der Großteil von Freizeit und Geld ging für den Test drauf. Und mir war noch kein Mann begegnet, den es nicht störte, neben meinem Studium die zweite Geige zu spielen.
Doch zu meiner Überraschung verhielt sich Heather äußerst zurückhaltend – sie war so ungewöhnlich still, dass ich mich fragte, ob ichsie ein bisschen ausfragen sollte. War sie nur diskret? Oder war sie mit den Gedanken woanders? Sie hatte einiges um die Ohren – das Haus, die Kinder und die Vorbereitungen der bevorstehenden vendange. Manchmal erwischte ich sie jedoch dabei, wie sie gedankenverloren ins Nichts starrte und noch nicht einmal ihre zankenden Kinder wahrnahm. Irgendwie wurde ich das Gefühl nicht los, dass sie ein Geheimnis hütete.
Nach einer Woche hatten wir Dutzende von Bücherkartons geöffnet, waren veraltete Reiseführer durchgegangen sowie zahlreiche ledergebundene Bände französischer Klassiker und ausreichend Wörterbücher Französisch-Englisch/Englisch-Französisch, um eine ganze Armee von Übersetzern damit zu versorgen. Entsetzt hatten wir auf ein riesiges Ölgemälde gestarrt, das eine blasse junge Frau darstellte, die auf einem Tablett den Kopf eines bärtigen bleichgesichtigen Mannes mit leerem Blick trug, aus dessen abgeschnittenem Hals Blut auf den Boden troff.
»Widerlich, nicht?«, hatte Heather geflüstert. »Dieses Exemplar, Johannes der Täufer, enthauptet, hing bei unserem Einzug im Esszimmer. Anscheinend war deine Urgroßmutter très croyante – eine sehr gläubige Katholikin. Künstlerisch gesehen, ist es Müll, aber … Nun ja, so etwas schmeißt man nicht so einfach weg.«
Bei dem meisten Zeug, das wir fanden, fackelten wir jedoch nicht lange. Aus den Stapeln (den unzähligen Stapeln) von Zeitungen, Zeitschriften und veralteten Formularen in dreifacher Ausführung machten wir ein Lagerfeuer. Wir schleppten einen sperrigen Futon fort, der ständig zu einer Seite wegklappte. Darauf hatten Heather und Nico nach Annas Geburt abwechselnd geschlafen. Allein der Anblick machte Heather verrückt. Ein Küchentisch, den sie in einem widerlichen Graugrün gestrichen hatte, bezeichnete sie als missglücktes Heimwerkerprojekt. Äußerst missglückt. Eine helle Kommode aus Pressspan von IKEA, mit kaputten Schubladen, die wie schiefe Zähne auseinanderklafften, war nur noch etwas für den Sperrmüll.
Wir hatten jedoch auch einige nützliche Möbelstücke ausgegraben – Dinge, die zwar nicht wertvoll waren, aber praktisch und bewahrenswert: einen kleinen Schreibtisch, der einen neuen Anstrich brauchte, einen Sessel, den Heather aufpolstern lassen wollte. Doch trotz sorgfältiger Suche hatten wir nichts weiter gefunden, das die rätselhaften Initialen H. M. C., den Koffer oder seinen Inhalt erklärte.
»Hey!« Heathers Stimme riss mich aus meinen Gedanken. »Erinnerst du dich noch daran?« Sie kam mit einem Stapel französischer Notizhefte herüber – klein und dünn mit Millimeterpapier und buntem Einband. Ich öffnete eins und stieß auf vollgeschriebene Seiten in meiner eigenen Handschrift: Côte de Beaune-Villages, 2004. Rote Beeren, Erde, Pilze. Weich, rund. Wenig Säure, wenig Tannine. Ich schlug das Notizheft zu. »Du erinnerst dich doch noch an unseren Weinklub? Oder sollte ich sagen …«, sie warf mir einen durchtriebenen Blick zu, »… den Nerd-Klub?«
Ich lächelte. »Dich scheint er zumindest nachhaltig beeindruckt zu haben.«
»Soll das ein Witz sein? Ihr habt doch stundenlang darüber diskutiert, welche roten Früchte ihr herausschmeckt. Erdbeeren! Nein, rote Johannisbeeren! Nein, Erdbeeren! Nein, wilde Erdbeeren. Am liebsten hätte ich den ganzen Wein in einem großen Becher zusammengeschüttet und runtergekippt.«
»Ich glaube, das hast du auch gemacht.«
»Ach ja?«
Sie lächelte süß, wanderte zurück in ihren Bereich des Kellers und ließ mich mit den Notizheften in der Hand zurück.
Auf die Idee mit dem Weinklub war Jean-Luc gekommen, nachdem er herausgefunden hatte, dass ich in Berkeley einen Weinkurs belegte. »Wenn du in Frankreich bist«, hatte er gerufen, »musst du französischen Wein kennenlernen!« Heather war weniger begeistert gewesen, aber zu jener Zeit hätte sie alles getan, um mehr Zeit mit Nico zu verbringen. Nein, nein, sie mochte ihn nicht – schließlich hatte sie zu Hause einen Freund. Sie wollte nur ihr Französisch verbessern. Als mein Cousin Heather einige Wochen später auf einen Stehplatz in die Opéra Garnier entführte und in der Pause eine Piccoloflasche Champagner aus der Jackentasche zauberte, tat mir ihr unbeholfener Freund zu Hause in Berkeley unwillkürlich ein bisschen leid. Dagegen hatte er keine Chance.
Die Treffen unseres Weinklubs fanden in meiner winzigen Dachkammer statt, weil ich die Einzige von uns war, die allein wohnte – meine Gastmutter residierte drei Etagen unter mir in einer weitläufigen bourgeoisen Wohnung. Sie vermietete ihr ehemaliges chambre de bonne, das Dienstmädchenzimmer, um ihre magere Witwenrente aufzubessern. Zu viert quetschten wir uns in meine Mansarde. Heather und ich hockten auf dem Bett, Jean-Luc und Nico auf den Terrakottafliesen auf dem Fußboden. Wir tranken aus billigen Weingläsern und kühlten die Weißweinflaschen auf dem Fenstersims, weil sie nicht in den Kühlschrank passten. Auf einem kleinen Tisch stellte ich Baguette und ein Stück Comté bereit, dazu vier Plastikbecher.
»Zum Spucken?« Heather sah mich beinahe beleidigt an. »Das ist ein Witz, oder?«
»So war das in meinem Kurs, die Profis machen das so.«
»Aber das ist … eklig!« Sie verzog das Gesicht.
»Na ja, du musst es ja nicht machen«, sagte ich, während Jean-Luc eine Flasche Sauvignon Blanc entkorkte.
Niemand spuckte den Wein aus. Natürlich nicht. Wir begannen mit kleinen bedachten Schlucken und beschrieben den Geschmack mit Wörtern wie »feuersteinhaltig«, »mineralisch« und »säurebetont«. Im Laufe des Abends floss der Wein in alarmierendem Tempo, und unsere Beschreibungen, die wir mit unsicheren Händen in den Notizheften festhielten, klangen wie die Beiträge eines schlechten Lyrikwettbewerbs.
»Ein Apfelbaum neigt sich über umspülte Flusssteine, die Frucht ist von mediterraner Zitronenschale geküsst, mit einem Hauch von bitterer Galle«, deklamierte Heather.
»Tiefgründig«, bemerkte Nico lächelnd und meinte es keineswegs ironisch.
»Was ist?« Heather lachte. »Was?«
Unwillkürlich stieß ich einen übertriebenen Seufzer aus, und als ich Jean-Luc ansah, wirkte er ähnlich amüsiert.
Als Nico seinen Freund Jean-Luc zum ersten Mal erwähnte, dachte ich zunächst, er wollte uns verkuppeln. Doch je mehr Zeit wir zu viert verbrachten, desto klarer wurde mir, dass Nico einfach gern mit Jeel, wie er ihn nannte, zusammen war. Jean-Luc war auf einem benachbarten Weingut aufgewachsen, und ich war ihm begegnet, als ich als Kind zu Besuch im Burgund gewesen war. Ich erinnerte mich an ihn, weil er das einzige französische Kind gewesen war, das sich getraut hatte, Englisch mit mir zu sprechen. Zu meiner Überraschung war aus dem dürren, ungelenken Jungen ein selbstbewusster junger Mann geworden. Der Braunton seines Haars, das fast golden wirkte, wiederholte sich in der Farbe seiner Augen, die ungewöhnlich klar und tiefgründig wirkten. Sie funkelten unglaublich charmant, blitzten im einen Moment auf, wenn er über einen Witz lachte, und füllten sich im nächsten mit Mitgefühl und großer Wärme. Meine Tante Jeanne sagte immer, alle verehrten Jean-Luc – kleine Babys, kratzbürstige Katzen, die launische Verkäuferin in der boulangerie.
Wir hatten im Grunde keine Ahnung, was wir taten, dennoch lernte ich sehr viel bei unseren Weinklubtreffen. Wie man Feuerstein und Kalk herausschmeckt, die den Reiz von Champagner ausmachen. Dass der Mistral einem Côte du Rhône den Geschmack von grüner Paprika verleihen kann. Dass jeder Wein eine Geschichte erzählt – von einem Ort, einem Menschen, einem Moment. Von einem glücklichen oder unglücklichen Sommer, einem selbstbewussten Winzer, einem besorgten, oder vielleicht von einem, der verliebt war.
»Der Wein ruht in der Flasche, verändert sich aber dennoch. Er entwickelt sich«, hatte Jean-Luc eines Abends erklärt. »Und wenn der Korken entfernt wird, atmet er und erwacht erneut zum Leben. Wie ein Märchen. Un conte de fées.« Sein Blick hielt meinen fest. Hatte es so angefangen? Mit einem Blick? Damit, dass er mein Haar zurückstrich, dass ich seinen Rücken berührte? Später, als wir allein waren, verriet sein tiefes Erröten, dass er doch nicht so selbstbewusst war, wie ich immer angenommen hatte. »Bei dir komme ich mir wie ein Idiot vor, Kat«, sagte er. »Du … schüchterst mich ein. Mit deinem perfekten Gaumen. Du kannst dich so gut ausdrücken, bist lustig und scharfsinnig … Ich hätte nie gedacht, dass du mich überhaupt bemerkst.«
Ihn so überraschend nervös zu sehen, berührte etwas in mir. Seine Lippen legten sich auf meine, ich spürte seine Wangen rau an meinem Gesicht, die Wärme seines Körpers an meinem. Unsere Kleider sammelten sich als Haufen auf dem Boden.
Hatten wir uns da ineinander verliebt? Bei den langen Spaziergängen durch die schmalen Gassen? Bei den leisen Unterhaltungen spät in der Nacht, wenn wir über unsere Lieblingsbücher und Musik sprachen und darüber, ob nicht angereicherte Dessertweine köstlich oder widerlich schmeckten? All diese aufrichtigen Gespräche – über die Scheidung meiner Eltern und ihre neuen Ehen, das Weingut seiner Familie und das Land, das er eines Tages hinzukaufen wollte – brachten uns einander näher. So nah, dass es sich manchmal anfühlte, als wären wir schon seit Ewigkeiten zusammen.
Es war nur eine Romanze während eines Studienaufenthalts im Ausland. Nur eine verträumte Affäre. Für eine dauerhafte Beziehung waren wir beide zu jung. Doch als ich eines Morgens neben seinem glatten muskulösen Körper erwachte, wurde mir klar, dass ich noch nie in meinem Leben so glücklich gewesen war. Ich hatte vor ihm schon andere Freunde gehabt, aber zum ersten Mal fühlte ich mich gesehen – nicht nur die hübsche Kellnerin oder die mittelmäßige Französischstudentin oder die einsame Jugendliche, die von ihren Eltern zu oft sich selbst überlassen worden war, sondern wirklich mich. Zum ersten Mal hatte ich mich Hals über Kopf und bis über beide Ohren verliebt.
Und dann ging es irgendwie kaputt.
Die Notizhefte, die ich mit den Händen umklammert hielt, waren feucht geworden. Mein linker Fuß war eingeschlafen. Auf der anderen Seite des Kellers rollte Heather einen Müllsack auseinander und schüttelte ihn, sodass das dünne Plastik sich wie ein Segel blähte. Ich kämpfte mit meinem Fuß, fand einen leeren Karton und legte die Notizhefte hinein. Es war lange her. Zehn Jahre. Doch noch immer hörte ich Jean-Lucs Stimme, die in der dunklen Nacht in mein Ohr flüsterte. Noch immer spürte ich seine Arme, die mich an sich zogen …
Ich nahm einen Stapel mottenzerfressener Pullover, warf sie auf die Notizhefte und klappte den Karton zu – er würde ebenfalls zum Recyclinghof gebracht werden. Dann zog ich einen weiteren Karton zu mir heran.
Als ich ihn öffnete, fand mein Herzschlag zu seinem normalen Rhythmus zurück. Kaputter Weihnachtsschmuck. Zerbröselnde Papierketten. Lichterketten, deren Stecker leicht einen Kurzschluss auslösen konnten. Weg damit. Ich griff nach dem nächsten Karton: noch mehr Bücher. Ich betrachtete das erste, ein französisches Lehrbuch, blätterte es durch … Das Periodensystem. Ah, ein Chemiebuch. Weg damit. Auch bei dem Rest handelte es sich um französische Schulbücher: Geschichte, Mathematik, Biologie sowie ein zerlesenes Exemplar des Grafen von Monte Christo. Weg damit. Weiter unten im Karton fand ich einen großen Stapel Hefte, die in braunes Packpapier gebunden waren, cahiers d’exercices, vollgeschrieben mit Grammatikübungen in gestochener Handschrift. Ich blätterte das erste durch, dann legte ich es mit den anderen zur Seite. Weg damit.
Auf dem Boden des Kartons fand ich ein großes flaches Buch. Nein, es war eine Aktenhülle aus braunem Leder mit einer bourbonischen Lilie darauf. Darin befand sich ein vergilbtes Dokument. Auf die eine Seite war ein Pinienzweig gedruckt, der mit verschiedenen Siegeln bedeckt war, oben auf der Seite stand: LYCÉE DE JEUNES FILLES À BEAUNE. Ich las den Text darunter und übersetzte im Stillen die Worte:
Französische Republik
Zeugnis über den Abschluss der Sekundarstufe II
3. Juli 1940
Mademoiselle Hélène Marie Charpin
Ich schnappte nach Luft. »Hélène!«
Heathers Kopf tauchte über einem Stapel Kartons auf. »Alles in Ordnung?«, rief sie.
»Sieh nur! Lycée de jeunes filles«, stieß ich hervor. »H.M.C.« Ich wedelte mit der Mappe in der Luft. »Hélène Marie Charpin.«
»Moment! Was sagst du? Warte. Ich komme zu dir.« Heather bahnte sich einen Weg durch das Chaos und nahm mir das Dokument ab. »Hélène Marie Charpin. Geboren am 12. September 1921 in Meursault.« Sie strich mit dem Zeigefinger über die Wörter.
»Das muss das Mädchen auf dem Foto sein! Der Koffer hat ihr gehört. Aber …« Ich stutzte. »Wer war sie? Wenn sie mit Nachnamen Charpin hieß, wie ist sie dann mit uns verwandt?«
Heather holte geräuschvoll Luft. »Schau! Das Zeugnis wurde im Juli 1940 ausgestellt. Das war kurz nach Beginn der Besatzung.«
»Könnte sie im Zweiten Weltkrieg gestorben sein? Haben wir deshalb nie etwas von ihr gehört?«
»Kann sein … vielleicht. Aber warum sollte sie verschwunden sein?«
»Hat Nico neulich nicht gesagt, dass Urgroßvater Edouard im Krieg gestorben ist? Vielleicht hängt das alles miteinander zusammen.«
Sie zuckte die Schultern. »Vielleicht …« Sie nestelte an dem Diplom herum und versuchte, es zurück in die Aktenhülle zu schieben.
»Nico hat gesagt, dass sein Vater es weiß, richtig? Ich wünschte, wir könnten ihn einfach fragen.« Doch als ich Onkel Philippe erwähnte, erinnerte ich mich gleich an einen lange zurückliegenden regnerischen Sommernachmittag. Wir waren noch klein, vielleicht sechs oder sieben, und Nico hatte sich in das Büro seines Vaters geschlichen, um sich eine Schere zu leihen. Als Kinder war uns der Zutritt verboten, und als sein Vater ihn erwischte, hatte er ihm kurzerhand den Hintern versohlt. Nico hatte die Strafe abgetan und behauptet, es habe nicht wirklich wehgetan. Doch den Anblick von Onkel Philippes Gesicht mit den vor Wut zusammengepressten Lippen, aus denen jegliche Farbe gewichen war, hatte ich nicht vergessen. »Aber ich glaube, er ist nicht sehr … zugänglich«, fügte ich hinzu.
Bevor Heather etwas erwidern konnte, flog die Kellertür auf, und Nico sprang die Stufen herunter.
»Nico, hallo! Du errätst nicht, was wir gefunden haben«, hob ich an, doch als ich sein Gesicht sah, verstummte ich. Seine Augen waren dunkel und geweitet, seine Haut gerötet, und er atmete stoßweise, als wäre er gerannt.
»Sie sind zurück«, sagte er zu seiner Frau, und sie zuckte wie von der Tarantel gestochen zusammen.
»Ich dachte, wir hätten noch eine Woche Zeit!«, rief sie.
Nico zuckte die Schultern. »Juan hat ihm die Laborergebnisse geschickt. Papa will keinen Tag länger warten.« Er holte tief Luft und verschränkte fest die Arme vor der Brust.
»Was ist los?«, fragte ich beunruhigt. »Stimmt was nicht?«
Nico und Heather tauschten einen Blick und wandten sich gleichzeitig zu mir um. »Nein, nein, keine Sorge. Es ist nichts«, sagte Nico. »Es ist nur … die vendange.« Er zwang sich zu lächeln. »Die Trauben sind reif zum Pflücken, deshalb fangen wir morgen mit der Lese an.«
»Aber ist alles in Ordnung?«, hakte ich nach. »Ihr wirkt so …«
»Ich muss in den Supermarkt«, unterbrach Heather mich. »Wie viele sind wir morgen zum Mittagessen? Achtzehn?«
»Rechne besser mit zwanzig«, sagte Nico.
Sie nickte und machte sich auf den Weg nach oben.
»Ich muss die Geräte rausstellen. Eimer, Gartenscheren …«, murmelte Nico und folgte ihr.
Sekunden später waren sie fort, ich blieb allein in dem dämmrigen Keller zurück. Meine Fragen hingen wie aufgewirbelter Staub in der Luft, setzten sich und blieben unbeantwortet.
12. September 1939
Cher journal,
ich frage mich, ob das auf Englisch auch so albern klingt, wie es mir auf Französisch vorkommt. Liebes Tagebuch … Schreiben Mädchen so etwas wirklich?
Ich bin mir nicht sicher, wie ich dieses Tagebuch beginnen soll. Am besten fange ich mit den Fakten an wie eine richtige Wissenschaftlerin. Ich heiße Hélène Charpin und bin heute achtzehn Jahre alt geworden. Ich wohne in Meursault, einem Dorf im Burgund, in der Region Côte d’Or. Papa sagt, dass unsere Familie hier schon Wein herstellt, seit der Duc de Bourgogne die ersten Chardonnay-Trauben an den Hängen gepflanzt hat, was mindestens fünfhundert Jahre her ist. Allerdings ist Papa dafür bekannt, bei solchen Geschichten gern etwas zu übertreiben, wenn er damit ein oder zwei Fässer mehr verkaufen kann. Erst vor wenigen Wochen hat er einem amerikanischen Importeur erzählt, Thomas Jefferson habe den Wein unserer Familie in die Vereinigten Staaten exportiert. »C’est vrai!«, sagte er. »Gouttes d’Or war Jeffersons Lieblingsweißburgunder.«
Ich weiß nicht, ob der Händler ihm geglaubt hat, aber er bestellte drei Fässer zusätzlich, und Papa zwinkerte mir zu. Nachdem der Mann in sein Auto gestiegen und zum nächsten Weingut davongebraust war, legte Papa mir einen Arm um die Schultern. »Léna, du bist mein Glücksbringer!«, rief er aus.
Das ist im letzten Monat gewesen, im August. Nachdem wir jetzt mit der Lese begonnen haben, lächelt Papa nicht mehr so oft. Es war ein jämmerlicher Sommer, aber ich glaube, bis zum Beginn der Erntearbeiten vor ein paar Tagen war keinem von uns bewusst, wie kalt und nass er tatsächlich gewesen ist. Die eine Hälfte der Trauben ist unreif, hart und grün, die andere von grauer Fäule vernichtet. Papa und die Männer, die uns bei der Lese helfen, haben die Trauben bis spät in die Nacht verzweifelt sortiert. Gestern Abend ist Albert in der cuverie eingeschlafen, und als ich ihn zurück ins Haus trug, war ich entsetzt, dass der Hof von einer Schneeschicht bedeckt war. Seit wann schneit es mitten im September?
Ich habe es Papa nicht gesagt – es kommt mir so makaber vor –, aber ich fürchte, die schlechte Ernte ist ein Omen. Seit Wochen sprechen alle nur noch von Frankreichs Kriegserklärung. Die Menschen sind nervös und warten darauf, dass etwas geschieht. Man hat uns aufgefordert, Gasmasken mit in die Schule zu nehmen, und ich scheue mich, das Radio einzuschalten. Papa scherzt, dass die angespannte Lage zumindest dem Weinverkauf zuträglich sei, aber wann immer er die Zeitung aufschlägt, wird sein Gesicht aschfahl. Wie sollte er sich auch keine Sorgen machen, nachdem er La Grande Guerre erlebt hat, der ihm seine beiden Brüder genommen und ihn zum Einzelkind gemacht hat? Zum Glück sind Benoît und Albert noch viel zu jung, um zu kämpfen.
Wegen der angespannten Stimmung dachte ich, dass niemand heute an meinen Geburtstag denken würde, aber das stimmte nicht. Als ich den Kaninchen vor dem Abendessen Gemüseabfälle in die Käfige schob, kam Papa zu mir.
»Joyeux anniversaire, ma choupinette.« Er legte mir ein Satinsäckchen in die Hand. Darin lag eine Perlenkette. Die Perlen sind so klein und weiß wie Babyzähne. »Die hat deiner Maman gehört«, sagte er, was erklärt, weshalb Madame sie sich noch nicht unter den Nagel gerissen hatte, wie den ganzen anderen Familienschmuck.
Ich berührte die Perlen, und sie fühlten sich kühl und glatt an. »Merci, Papa.«
Als ich ihn auf die rauen Wangen küsste, bildeten sich Fältchen um seine Augen, und kurz hatte ich das Gefühl, dass er Maman ebenso sehr vermisste wie ich.
»Wenn du lächelst, siehst du aus wie sie«, sagte er, was mehr einem Wunsch als den Tatsachen entspricht. Die wenigen Fotos, die ich von Maman kenne, zeigen eine schlanke junge Frau mit hellen Locken – nicht mit krausem dunkelbraunem Haar so wie dem meinen – und mit einem glücklichen Strahlen in den Augen. (Madame sagt, dass meine Brille mein Gesicht mürrisch wirken lässt.) Maman ist seit über dreizehn Jahren tot – schon so lange, dass ich nicht sicher bin, ob die Erinnerungen, die ich an sie habe, meine eigenen sind oder Dinge, die mir andere Leute über sie erzählt haben. »Sie wäre sehr stolz auf dich.« Papa seufzte. »Genau wie deine belle-mère und ich es sind«, fügte er eilig hinzu.
Das ist dermaßen übertrieben, dass ich nur nickte, ein eingefrorenes Lächeln auf den Lippen. Seit Madame meinen Vater geheiratet hat, damals war ich elf, zählt sie die Tage bis zu meinem Auszug. Es würde mich nicht überraschen, wenn sie sie wie der Graf von Monte Christo im Kalender abstreicht. Ich jedenfalls tue es.
Vielleicht weil er meine Zurückhaltung spürte, fuhr Papa fort: »Ich weiß, sie kann etwas eigen sein, aber bitte sei nicht zu streng mit Virginie. Bennys Krankheit hat uns allen große Sorgen gemacht.« Er blickte hinunter auf seine Füße. Die schwache Gesundheit meines Halbbruders beeinflusst unsere Familie wie das Wetter die Weinberge. Nur Albert kann Madame besänftigen. Mit seinen drei Jahren ist er wie ein kleiner Braunbär – un petit ours brun.