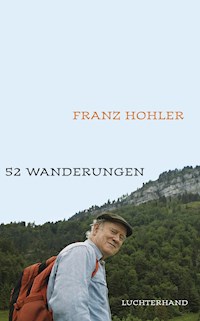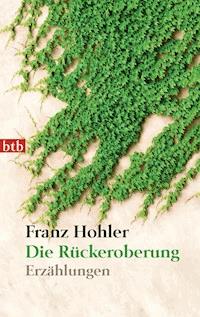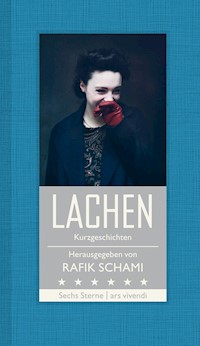3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand Literaturverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nirgends kommt das Fantastische so beiläufig daher wie bei Franz Hohler. Seine Erzählungen handeln von merkwürdigen Begebenheiten und dem plötzlichen Einbruch des Wunderbaren: Von einem geheimnisvollen Steinregen, der das Personal eines einsamen Alpenhotels in die Flucht schlägt. Von einem Tisch in einem beliebten Ausflugslokal, der großes Unglück bringt. Von einem jähen Moment der Wahrheit im Telefonat zwischen Mutter und Tochter. Vom nächtlichen Gesang einer Nachtigall, der die Menschen einer Kleinstadt elektrisiert. Und von einem Enkeltrick, durch den die betagte Amalie Ott noch einmal auf eine weite Reise geht…
Es sind die unscheinbaren Risse im alltäglichen Gefüge, von denen Franz Hohler so meisterhaft pointiert und abgründig erzählt – jede Geschichte ein kleines Wunder, das den Blick auf das Leben reicher macht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 158
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über das Buch
Nirgends kommt das Fantastische so beiläufig daher wie bei Franz Hohler. Seine Erzählungen handeln von merkwürdigen Begebenheiten und dem plötzlichen Einbruch des Wunderbaren: von einem geheimnisvollen Steinregen, der das Personal eines einsamen Alpenhotels in die Flucht schlägt. Von einem Tisch in einem beliebten Ausflugslokal, der großes Unglück bringt. Von einem jähen Moment der Wahrheit im Telefonat zwischen Mutter und Tochter. Vom nächtlichen Gesang einer Nachtigall, der die Menschen einer Kleinstadt elektrisiert. Und von einem Enkeltrick, durch den die betagte Amalie Ott noch einmal auf eine weite Reise geht …
Es sind die unscheinbaren Risse im alltäglichen Gefüge, von denen Franz Hohler so meisterhaft pointiert und abgründig erzählt – jede Geschichte ein kleines Wunder, das den Blick auf das Leben reicher macht.
Über den Autor
FRANZ HOHLER wurde 1943 in Biel, Schweiz, geboren. Er lebt heute in Zürich und gilt als einer der bedeutendsten Erzähler seines Landes. Hohler ist mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet worden, zuletzt mit dem Alice-Salomon-Preis und dem Johann-Peter-Hebel-Preis. Sein Werk erscheint seit über fünfzig Jahren im Luchterhand Verlag.
FRANZ HOHLER
Der Enkeltrick
Erzählungen
Luchterhand
Der Enkeltrick
Die Frau, die vor der Wohnungstür stand, war eindeutig nicht die Postbotin, obwohl sie zweimal geklingelt hatte. Die Postbotin hatte blondes Haar, das zu einem Pferdeschwanz gebunden war, und die hier hatte krauses schwarzes Haar und dunkle Augen. Auch trug sie keine blaue Uniform, sondern eine rote Bluse und eine schwarze Lederjacke. »Frau Ott?« fragte sie und lächelte.
Amalie Ott nickte. Sie musste zwar ab und zu mit Momenten kämpfen, in denen sie nicht mehr sicher war, wo sie gerade stand oder wohin sie gehen wollte und ob heute wirklich Sonntag war, wenn sie eine geschlossene Kirchentür vorfand, aber mit 88 Jahren sei so etwas nicht ungewöhnlich, hatte ihr der Hausarzt gesagt, und wichtig sei einfach, dass sie immer ihre Adresse bei sich trage, wenn sie das Haus verlasse.
Doch jetzt stand sie bloß an der Wohnungstür und nickte, denn soviel stand fest, sie war Amalie Ott.
»Was wünschen Sie?« fragte sie die fremde Frau.
»Darf ich einen Moment hereinkommen?« fragte diese, »es ist vertraulich.«
Amalie schloss kurz die Augen und sah ihre zwei Töchter mit ihren Männern und ihren Groß- und Urgroßkindern, und sie riefen ihr im Chor zu: »Keine Fremden hereinlassen!«
Als sie die Augen wieder öffnete, stand die Frau in der roten Bluse immer noch da und schaute sie lächelnd an.
»Bitte«, sagte Amalie, »kommen Sie herein.«
»Das ist lieb von Ihnen«, sagte die Fremde, die bereits einen Fuß auf der Schwelle hatte.
»Wir gehen in die Küche«, sagte Amalie und ging vor der Frau her durch einen schwach beleuchteten Korridor in die Küche. Auf dem Tisch war ein Teller mit einem halb gegessenen Stück Butterbrot mit Marmelade und einer Tasse, dahinter ein Glas mit Nescafé-Pulver.
»Setzen Sie sich«, sagte Amalie und wies auf den zweiten Stuhl, »ich bin spät dran mit dem Frühstück, möchten Sie auch einen Kaffee?«
»Danke«, sagte die kraushaarige Frau, »ich habe nicht viel Zeit. Ich bringe Ihnen eine Nachricht von Ihrer Enkelin.«
Wieder schloss Amalie kurz die Augen, und wieder sah sie den kleinen Familienchor. Fünf Enkel waren dabei, drei hochgeschossene junge Männer von der ersten Tochter, zwei mit ihren Frauen und zwei Urenkel, ein etwas kleinerer Mann von der zweiten Tochter, und da stand rechts außen noch eine junge Frau, etwa dreißigjährig, mit einer Stupsnase und einem Bubikopf, die ihr zuwinkte.
»Von Cornelia?« fragte Amalie, als sie die Augen wieder öffnete.
»Ja, von Cornelia«, sagte die Frau.
»Was ist mit ihr«?
»Sie ist in Not.«
Und die Fremde erzählte nun, dass Cornelia auf einer Reise in Rom verhaftet worden sei, weil sie für einen Freund ein Päcklein mitgenommen habe, in dem Drogen versteckt waren, natürlich habe sie das nicht gewusst, Cornelia hätte so etwas nie gemacht, aber jetzt sei sie im Gefängnis und käme nur gegen eine Kaution von 20 000 Euro frei, das seien also etwa 22 000 Franken, und Cornelia habe ihr ihre, Amalies Adresse, gegeben mit der Bitte, ob sie ihr vielleicht aus dieser Lage heraushelfen könne.
»Aber ihre Mutter?«
Die dürfe auf keinen Fall etwas erfahren, Cornelia schäme sich furchtbar, dass sie in so etwas hineingeraten sei, und sie bitte sie, niemandem von der Familie etwas davon zu sagen, sie werde ihr bestimmt auch alles zurückzahlen.
Amalie nahm einen Schluck Kaffee und wischte sich die Lippen mit dem Handrücken ab.
Ja, die Cornelia, sagte sie, das passe zu ihr.
Sie hatte das Mädchen immer gemocht, schon weil sie ihre einzige Enkelin war, aber auch das Wilde an ihr hatte ihr gefallen. Cornelia war bereits als Schülerin gerne gereist, war einmal per Anhalter mit einer Freundin nach Spanien gefahren, während ihre Eltern in allen Ängsten waren. Amalie hatte sie damals beruhigt, sie werde schon wieder zurückkommen. Später dann hatte sie eine Kunstschule im Ausland besucht, wollte Filme machen und schlug sich mit Gelegenheitsarbeiten durch, der Kontakt mit ihr war in letzter Zeit etwas verloren gegangen, ab und zu war ein Kartengruß von ihr gekommen, von irgendeiner fernen Insel, und jetzt also das.
Amalie nahm einige Postkarten vom Kühlschrank ab, wo sie mit Magneten befestigt waren, und schaute sie einzeln an. »Das ist von ihr, glaub ich«, sagte sie und hielt der Fremden eine Karte hin, auf der das Meer gegen Küstenfelsen brandete, »da war sie am Meer.«
Die Fremde schaute die Karte an. »In Irland«, sagte sie dann, »sie war oft in Irland, davon hat sie mir erzählt. Und wie machen wir jetzt das mit dem Geld?«
Amalie schloss nochmals die Augen, und ihre ganze Familie rief ihr zu: »Nichts geben!« Sogar die beiden kleinen Urenkel schüttelten ihre Köpfe. Einzig Cornelia ganz außen machte ihren Mund nicht auf und winkte ihr bloß zu.
Amalie seufzte. »Warten Sie«, sagte sie und ging in das Zimmer ihres verstorbenen Mannes. Sie machte die unterste Schublade des Schreibtisches auf und zog die Schachtel hervor, auf der groß »Fotos« stand. Zuoberst lag das Familienfoto, das sie schon gesehen hatte, als sie die Augen schloss. Auf einmal schien ihr, Cornelia blicke traurig drein. Unter dem Foto war ein Umschlag, der mit »Hochzeitsreise« angeschrieben war, und dort drin bewahrte sie ihr Geld auf. Ihr Mann hatte das so eingerichtet, »gegen die Einbrecher«, hatte er gesagt. Sie öffnete das Couvert und zählte 10 Hunderternoten. Sie steckte den Umschlag in die Handtasche, die auf dem Schreibtisch stand, und machte Schachtel und Schublade wieder zu.
Als sie sich umdrehte, stand die fremde Frau im Türrahmen.
»Es reicht nicht«, sagte Amalie, »ich muss es auf der Bank holen.«
»Ich kann Sie begleiten«, sagte die Fremde.
Eine Stunde später gingen die zwei Frauen über die Aarebrücke. Amalie hatte sich sonntäglich angezogen, wie immer, wenn sie zur Bank ging, ein blaues Deux-Pièces, darüber ihren feinen Regenmantel und den Hut mit der Brosche und der silbernen Feder, dazu ihre große Handtasche. Die Botin von Cornelia hatte sie zwar zur Eile ermahnt, aber Amalie hatte sich nicht beirren lassen. Sie bekomme ihr Geld nur, wenn sie anständig aussehe, sagte sie.
Die Bank lag gleich am Aarequai, und die kraushaarige Frau sagte zu Amalie, sie warte hier auf der Sitzbank auf sie, bis sie mit dem Geld zurückkomme, und Cornelia werde ihr bestimmt unglaublich dankbar sein.
Als Amalie über den Fussgängerstreifen gegangen war und sich nochmals umdrehte, sah sie, dass sich eine zweite Frau zur Fremden gesetzt hatte und sich mit ihr zu unterhalten begann.
Es war nicht leicht, dem Mann am Schalter begreiflich zu machen, dass sie 20 000 Euro brauchte, und zwar in bar. Ob er sie fragen dürfe, wofür sie das Geld brauche? Sie überlegte einen Moment, erinnerte sich daran, dass sie niemandem etwas sagen solle, und fand dann ein Wort, das ihr angemessen schien.
»Privat«, sagte sie.
Er müsse zuerst schauen, ob sie überhaupt soviel Euro da hätten, sagte der Mann, ging nach hinten und kam erst nach einer Weile wieder. Doch, sagte er dann, es gehe, aber falls sie damit ins Ausland fahren wolle, könne er ihr auch einen Teil davon in Reisechecks mitgeben, das wäre sicherer als Bargeld.
Als sie nichts davon wissen wollte, legte er ihr eine Quittung über 21 625 Franken zur Unterschrift vor. Soviel kosteten die 20 000 Euro, die hier in diesem Umschlag bereitlägen. Dann zählte er ihr die Scheine ab, vor allem grüne und braune, Scheine jedenfalls, die sie noch nie gesehen hatte, steckte sie dann in den Umschlag und schob ihn ihr zu.
Lächelnd steckte sie den Umschlag in ihre große Handtasche und sagte, sie habe gar nicht gewusst, dass sie soviel Geld habe.
Sie solle vorsichtig sein, sagte der Schaltermann, und ob vielleicht jemand von ihnen sie nach Hause begleiten könne.
Oh nein, das sei nicht nötig, sagte sie, sie habe schon jemanden.
Aber als sie zur Sitzbank kam, war diese leer.
Amalie schaute sich um, ohne dass sie irgendwo eine rote Bluse sah.
Sie setzte sich und wartete. Es gefiel ihr nicht, dass die Frau, mit der sie doch abgemacht hatte, einfach verschwunden war. Cornelia brauchte ja das Geld.
Was sie nicht wusste, war, dass der Mann am Schalter die Polizei angerufen hatte. Die hatte sofort eine Streife geschickt, welche die beiden Frauen, die als Betrügerinnen ausgeschrieben waren, festnahm.
Sie wartete und wartete und nickte etwas ein.
Als sie erwachte, standen ein Mann und eine Frau vor ihr. Sie seien, sagten sie, von der Polizei, zeigten ihr ein Foto von der kraushaarigen Frau und fragten sie, ob sie diese Person kenne.
Amalie nickte. »Ja«, sagte sie, »seit heute.«
Ob sie sie um Geld angegangen habe, fragten die beiden weiter, und Amalie nickte wieder: »Für meine Enkelin.«
Nun blickten sich die beiden an und nickten. Da habe sie Glück gehabt, sagte der Mann, die Person sei eine Betrügerin. Ob sie mit ihnen auf die Wache komme zu einer Aussage und einer Konfrontation, fragte er weiter.
Amalie war verwirrt. Sie? Zur Polizei? Sie schüttelte den Kopf.
Oder lieber morgen Vormittag? fragte die Polizistin, das genüge auch noch. Sie sei doch Frau Amalie Ott von der Rosengasse?
Ja, sagte Amalie, etwas erstaunt darüber, dass man sie kannte, ja, das wäre ihr lieber, sie habe heute noch zu tun.
Der Polizist sagte, er erwarte sie in dem Fall morgen um 9 h auf dem Posten der Kantonspolizei, gab ihr sein Kärtchen und fragte dann, ob sie sie in die Bank begleiten sollten, um das abgehobene Geld zurückzubringen.
Amalie schloss kurz die Augen und sah sogleich den ganzen Familienchor, der ihr ein einziges »Jaaa!« zuschrie. Aber wieso stimmte Cornelia nicht mit ein, sondern stand einfach stumm am Rand?
»Nein, danke«, sagte Amalie und erhob sich von der Bank, »ich komme schon zurecht.«
»Passen Sie gut auf«, sagte die Polizistin, und: »Das Geld ist am sichersten auf der Bank«, fügte der Polizist hinzu.
Amalie nickte, sagte auf Wiedersehen und ging langsam neben dem bronzenen nackten Mann, der ein bronzenes Pferd besteigen wollte, über die Aarebrücke zum Bahnhof.
In der Mitte der Brücke blieb sie stehen, hielt sich mit einer Hand am Geländer fest und blickte ins Wasser hinunter. Es war ihr, als trieben alle ihre Gedanken flussabwärts. Wer war sie und wieso stand sie da? Wieso war sie so gut angezogen? War etwa Sonntag?
Sie schloss einen Moment die Augen, aber der Familienchor war verschwunden, und einzig ihre Enkelin Cornelia stand noch da und blickte sie an, ohne etwas zu sagen.
Als sie die Augen öffnete, wusste sie wieder Bescheid. Cornelia war in Rom im Gefängnis und brauchte Hilfe, und niemand von der Familie durfte etwas davon wissen. Niemand, außer ihr. Ihre Stunde war gekommen, die Stunde der Großmutter.
Am nächsten Morgen um 9 Uhr saß sie im Schnellzug nach Mailand und fuhr gerade in Airolo zum Gotthardtunnel heraus. Am Vierwaldstättersee hatte es noch geregnet, jetzt schien die Sonne.
»Oh«, sagte sie zum Herrn gegenüber, »hier scheint ja die Sonne!«
Der senkte die Basler Zeitung, hob kurz den Kopf und sagte dann: »Wir sind ja auch im Tessin.«
Die Frau im Reisebüro der SBB war gestern sehr nett gewesen, hatte ihr genau erklärt, wie sie in Mailand umsteigen müsse und dass sie dann eine Platzkarte im Wagen 24 für den Zug nach Rom habe, wo sie um 13.55 Uhr ankommen werde. Zuvor hatte sie ihre Kundin kurz gemustert und einladend gefragt, ob sie 1. Klasse fahren wolle, und Amalie hatte, ohne die Augen zu schließen, genickt. Auch dem 3-Tage-Arrangement in einem 4-Stern-Hotel, einem Sonderangebot der Bahn, hatte sie sofort zugestimmt, hatte die 685 Franken aus ihrem Couvert »Hochzeitsreise« bezahlt und die restlichen 315 Franken umgewechselt, in Lire, hatte sie verlangt und sich dann belehren lassen, dass man in Italien schon lange mit Euro bezahle.
Als sie der Herr gegenüber bei der Fahrt am Luganersee entlang fragte, was sie denn nach Rom führe, musste sie zuerst einen Moment nachdenken, bevor sie sagte: »Meine Hochzeitsreise.«
Ob da nicht der Mann fehle, fragte der Herr, worauf Amalie entgegnete: »Sie sind ja da.«
Der Herr lachte und sagte: »Aber nur bis Mailand.«
Dort half er ihr jedoch beim Umsteigen, trug ihr sogar das Köfferchen und brachte sie in den Wagen 24, wo sie den Sitz Nr. 35 hatte, einen Fensterplatz, wie sie erfreut feststellte.
Neben ihr saß niemand, und kurz vor der Abfahrt setzte sich eine korpulente Frau mit mehreren Halsketten auf den Platz vis-à-vis und stellte ein Hundekörbchen auf den Sitz daneben, aus dem ein kleiner Spitz seine Schnauze streckte.
Amalie lächelte zuerst den Hund an, dann die Dame, und die Dame lächelte zurück.
»Ein herziges Hündli«, sagte Amalie, und die Dame nickte.
Als der Zug Mailand hinter sich gelassen hatte, fuhr er in einem Tempo, das ihr kaum Zeit ließ, etwas von der Landschaft zu sehen. Gutshöfe und Pappelalleen flogen vorbei, Kirchtürme und Dörfer tauchten auf und verschwanden wieder, ein großer Fluss wurde überquert, in einer Ebene, die kein Ende nahm, so dass es Amalie nach einer Weile aufgab, aus dem Fenster zu schauen.
Sie öffnete ihre große Handtasche und zog einen Thermoskrug hervor, schenkte sich einen Tee ein, der immer noch dampfte, und wickelte ein Schinkensandwich aus, das sie sich am frühen Morgen gemacht hatte.
Der Spitz blickte begierig zu ihr herüber.
»Darf ich?« fragte Amalie und zupfte ein Stücklein Schinken ab.
Die Dame nickte, ihre Halsketten blitzten, und der Spitz schleckte Amalie den Schinken von der Hand.
Wieder kam ein Moment, in dem sie sich erschreckt fragte, wo sie eigentlich war und warum sie in diesem rasenden Zug saß und ein Hündchen fütterte. Dann sah sie in ihrer Handtasche das durchsichtige Mäppchen des Reisebüros, auf dem groß das Wort »Roma« zu lesen war und wusste wieder Bescheid. Was sie allerdings nicht wusste, war, ob sie Italienisch konnte.
Sie machte einen Versuch. Sie zeigte auf den Spitz und fragte die Besitzerin: »Comment il s’appelle?«
Die Antwort kam sofort: »Zorro.«
Bis Bologna wusste Amalie, dass Zorro der Tochter ihrer Sitznachbarin gehörte, dass er drei Wochen bei ihr in den Ferien war und dass er jetzt nach Rom zurückgebracht werde.
Bis Florenz wusste die andere Frau, dass Amalie auf ihrer Hochzeitsreise nach Rom war, da sie bei der Heirat nach dem Krieg kein Geld dazu hatten und sie bis zum Tod ihres Mannes nicht mehr dazu gekommen waren, und in Rom schließlich wurde Amalie von der Tochter der Frau mit dem Spitz ins Hotel Ambasciatore gefahren.
Schon die Eingangshalle war überwältigend, mit roten Teppichen ausgeschlagen, und mit einem Kronleuchter, der aus einem gewaltigen offenen Treppenhaus herunterhing. Die Dame hinter dem großen Empfangspult war außerordentlich freundlich, als Amalie ihr das Mäppchen vom Reisebüro hinüberschob, und auch mit ihrem Italienisch, das sie sich in ihrem Welschlandjahr als junge Frau angeeignet hatte, kam sie ganz gut durch. »Pour trois jours«, sagte sie, und »Parfait« bekam sie zur Antwort.
Leicht belustigt sah sie zu, wie ein junger Bursche in einer Uniform mit Goldtressen, silbernen Knöpfen und einem kecken Mützchen ihren Koffer ergriff. Sie folgte ihm, und er fuhr mit ihr im Lift in den 5. Stock.
Als sie auf dem ausladenden Doppelbett im Zimmer saß, entglitt ihr die Welt wieder für einen Augenblick, und sie schloss die Augen. Sie sah ihren verstorbenen Mann, jung war er, im Sonntagsanzug trat er zur Kirche heraus, blickte sich suchend um und winkte ihr dann zu.
Sie nickte, öffnete ihre große Handtasche und holte den Umschlag hervor, auf dem »Hochzeitsreise« stand. Es war die exakte und schwungvolle Schrift ihres Mannes, und darin waren die Lire, die jetzt Euro hießen. Und auf dem Prospekt, den sie auf das Nachttischchen legte, stand »Rom – die ewige Stadt«. Da war sie also. Erleichtert legte sie sich auf das Bett und schlief sofort ein.
Beim Aufwachen brauchte sie eine Weile, bis sie sich zurechtgefunden hatte. Die Aussicht aus dem Fenster über die unendlich vielen Dächer und Türme war ihr vollkommen unvertraut, und sie konnte sich so lange nicht erklären, wo sie war, bis sie den Prospekt wieder sah.
»Rom«, sagte sie zu sich, »ich bin in Rom«, und plötzlich wurde sie von einem Gefühl erfüllt, das sie kaum mehr kannte. Es war eine Neugier, eine Unternehmungslust, etwas von ganz früher, wenn es in ein Klassenlager ging oder auf eine Schulreise, als sie noch nicht Amalie Ott war, Mutter zweier Kinder, sondern selbst noch ein Kind, ein Kind, das sich auf das Leben freute. Aber da mischte sich noch etwas ein, auch von früher, es war die Angst vor dem Unbekannten, wie damals, als sie für ein Jahr ins Welschland ging und nicht wusste, was sie dort erwartete.
Doch die Freude überwog. Das Zimmer, in dem sie sich befand, gehörte zu einem Hotel, der Name des Hotels stand auf einem Notizblock neben dem Telefon. Sie riss sich das oberste Blatt davon ab und schob es in die Handtasche. Der Schlüssel steckte innen an der Zimmertür, die Nummer war auf dem Anhänger, der die Form einer Birne hatte. Sie zog den Zettel des Notizblocks wieder heraus und schrieb die Nummer unter die Hotel-Adresse, 501. Dann verließ sie ihr Zimmer, schloss die Tür ab, ging zu dem großen offenen Treppenhaus, in welchem der Kronleuchter herunterhing, und stieg in die Eingangshalle hinunter.
Von der freundlichen Frau an der Rezeption erfuhr sie, dass Nachtessen und Frühstück im Sonderangebot inbegriffen waren, dass der Speisesaal gleich neben dem Eingang bereits geöffnet sei und dass man ihr, wenn sie das wolle, für morgen gerne eine Stadtrundfahrt reserviere.