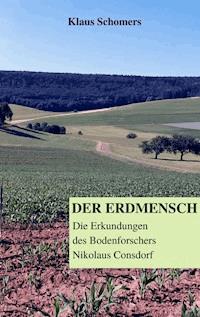
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Was hat es mit dem Boden auf sich? Bei seinen fachlichen und sinnlichen Spurensuchen begegnet Nikolaus Consdorf der Ökologie des Erdplaneten. Schritt für Schritt findet er hierbei zu seiner eigenen Natur.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 292
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Gunar
und seine Freunde
INHALT
Prolog
Am Anfang
Gescheiterter Gipfelsturm
Auf der ländlichen Seite
Kindliche Raumerkundungen
Graben, graben, graben
Am Fluss – Der Himmelgeister Rheinbogen
Zur Orientierung
Im Russenloch
Studierjahre
„Le Waldsterben“
Der Boden zeigt Profil
Ein weiteres Mal zum Rheinbogen
Schwierige Probenahme – Der Reaktorunfall von Tschernobyl
Mit kollegialer Kraft
In die Höhe – Erkundungen im Hochgebirge
Wildbacheinzugsgebiete
Die Bilanz des Geschiebes – Teil der Kraft werden
Der Gipfelblick
EXKURS: Zu Sauberkeit und Anstand – Er ist (k)ein Dreckskerl!
In die Weite – Erkundungen im näheren Umland
Heimat – Der 50-km-Radius
„Deutschland“
In die Tiefe – Erkundungen im Tiefland
In die Tiefe/In der Tiefe
Zwischen Theorie und Praxis – Glück im Unglück
Auf die Spitze getrieben
EXKURS: Nicht nur in eigener Sache – Das anthropozentrische Weltbild
Abbitten
Abbitte an eine Strecke
Abbitte an die Zeit
Das weitere Umland
Deutsches Mittelgebirge
Das Exkursionsgebiet – Der 100-km-Radius
Ein Kurzurlaub in Schalkenmehren
In der Prümer Kalkmulde
Moselimpressionen
Besinnungsflucht am Rhein
EXKURS: Reise ins Périgord – Streit mit Stephan?
„Re-Earthing“
Krötenwanderung
In memoria tenere
Stephans Traum
Consdorfs Traum
Zur Meditation
Ich atme, ich esse, ich trinke
Anhang 1 – Technologischer Fortschritt
Anhang 2 – Consdorfs Eifelfahrt
Prolog
Ob Gipfel spitz, ob runde Kuppe,
ob feuchtes Tal, ob Moores Suppe,
dem Erdmenschen ist es einerlei,
hat er sein Bohrgerät dabei.
Er schlägt mit dem Hammer wieder und wieder,
der Stahlstock geht hierbei zügig nieder.
Und wie er derart weiterschwenkt,
das Teil ist schließlich ganz versenkt.
Nun heißt es mit Ziehen, Drehen und Drücken,
die Sonde dem Erdreich zu entrücken.
Ans Tageslicht kommt nunmehr „Schicht für Schicht“
des Bodens Bau – ein wahrhaft Gedicht!
1. Am Anfang
Warmes, rundes Nest.
Schon reicht meine Nase
über deinen Rand hinaus –
entfliehen werde ich.
Gescheiterter Gipfelsturm
Als Nikolaus Consdorf drei Jahre alt war, geleitete ihn seine Mutter zu einem überdimensionalen, lärmenden Erdhaufen. Behütet, an der festen mütterlichen Hand, fand sich der kleine Mann im Anschluss wie angewurzelt im Halbschatten zwischen einer pyramidenförmig aufgeworfenen, graubraunen Oberbodenmiete und der Rückseite des unlängst fertiggestellten Wohnblocks, in den die Familie wenige Wochen zuvor eingezogen war.
Mit erhobenem, ehrfurchtsvollem Blick versuchte Consdorf das lebhafte Geschehen auf dem Erdhaufen zu erfassen: Größere Jungen hatten den Berg lautstark in Besitz genommen und in seinen Gipfellagen kleinere Höhlen gegraben. Einige Jungen patrouillierten mit Schaufeln und sonstigen selbst gefertigten, aus Strauchwerk zugeschnittenen Waffenimitaten würdevoll auf ihrem erhobenen Posten, andere wiederum hockten eng eingekeilt in verschiedenen kleinen Erdlöchern. „Wieso stecken die Jungs in diesen Löchern? Wie sind sie in diese Höhlungen hineingekommen? Sind sie in diese hineingestiegen oder etwa von anderen Jungen dort hineingedrückt worden? Oder hocken sie dort, weil der Berg genau jetzt im Begriff ist, sie aus seinem tiefsten Inneren freizugeben – ja auf die Erdoberfläche auszuspucken?“ Fragen wie diese blieben unbeantwortet im Raum stehen, marterten den kleinen Kinderkopf und hinterließen für längere Zeit eine merkwürdige, nicht auflösbare Stimmung.
Wie sich Nikolaus Consdorf Jahre später erinnert, liefert die beschriebene Szene die ersten Bilder seines Lebens. Zuvor hatte er keine optischen Eindrücke abgespeichert. Gleichfalls liegen ihm weder akustische noch sonstige Signale aus dem Dunkel einer wie auch immer gearteten Vorzeit vor. Das stimmungsvolle Ereignis spielt im Frühjahr 1961. Seine Eltern, seine beiden Geschwister und er hatten der Düsseldorfer Innenstadt den Rücken gekehrt und anschließend am Stadtrand Quartier bezogen. Die mehrgeschossigen, parallel angeordneten Wohngebäude der Postlersiedlung waren wenige Wochen zuvor bezugsfertig geworden, die Rasen- und Beetflächen zwischen den langgezogenen, Südwest-Nordost-gerichteten Wohnblocks noch nicht angelegt. Der natürliche Oberboden, der früher als Haut der Landschaft die Freiflächen schützend abgedeckt und dort jahrhundertelang als Ackerkrume Dienst getan hatte, ruhte nun an verschiedenen Positionen aufgetürmt zwischen den Gebäuden.
Der größte dieser Erdberge besaß die magische Macht, den kleinen Mann in seinen Bann zu schlagen. Sein Kraftfeld war offenbar derart stark, dass Consdorf neben seiner Mutter stehend nahezu erstarrte und sein Blick voller Demut an dem rätselhaften, hoch aufgeworfenen Erdreich emporkroch. Er konnte es sich nicht erklären, verspürte aber von einem zum anderen Moment den unnachgiebigen inneren Drang, das angehäufte Bodenmaterial zu ertasten, es mit den Händen aufzunehmen, es behutsam zu verformen und anschließend durch seine kleinen Finger rinnen zu lassen sowie im Weiteren den gesamten Haufen bis hinauf in seine Hochlagen zu besteigen. Vermutlich trieb es ihn ebenso an, gleichberechtigt an dem bedeutungsvollen Spielgeschehen der größeren Jungen teilzunehmen. Die Consdorf-Mutter hielt Nikolaus allerdings bestimmend zurück. Das Spiel der Größeren war der vorsichtigen Frau eindeutig zu wild. Zudem war sie der festen Überzeugung, es sei für ihren Sohn noch lange nicht an der Zeit, die kleinkindliche, bodennahe Perspektive gegen eine „reifere Position“ in Gipfellage einzutauschen. In diesem Sinne sah sich Nikolaus Consdorf außerstande, sich von der fürsorglichen Hand zu trennen, und musste seinen ersten, frühkindlichen Gipfelsturm im Frühjahr des Jahres 1961 als gescheitert ansehen.
Auf der ländlichen Seite
Das vorrangige Ablaufen von befestigten Wegen oder Straßen führt zu Zielen, die andere mehr als zwingend vorgegeben haben, die offensichtlich kein Neuland verheißen und die zwangsläufig mit nur wenigen Überraschungen aufzuwarten wissen. Abseits der ausgetretenen Pfade und asphaltierten Verbindungen besteht hingegen die Möglichkeit, selbstbestimmt auf Erkundungssuche zu gehen. Hier folgt der Suchende seinem eigenen Stern, geht seinen eigenen Weg und erreicht mitunter Ziele, die aus anderer Perspektive zuvor nicht einsehbar waren.
Die Erschließungsstraße am Rand der Großstadt trennte zwei Welten voneinander. Diesseits lag die wohlgeordnete, einfach strukturierte, aber insgesamt auch wenige Abenteuer verheißende Wohnsiedlung, die in dieser Hinsicht mit dem nüchternen Terminus „Postlersiedlung“ mehr als treffend beschrieben scheint. Hier herrschten klar vorgegebene, einfach überschaubare Raumstrukturen vor: In der Vertikalen dominierten parallel gestellte, deutlich lang gezogene, dreistöckige Wohnblocks. Dazwischen fanden sich verschiedene gepflasterte Fußwege, die jeweils beiderseits von eintönigen, fortwährend kurz gehaltenen Zierrasenflächen gesäumt waren. Insgesamt gesehen war dieses vorstädtische Siedlungsbild klar von der Geometrie und Ästhetik des rechten Winkels bestimmt.
Im Zentrum der größeren Rasenflächen hatte die zuständige Wohnbaugesellschaft kleine, an Stahlrohren montierte braune Schilder aufgestellt, die mit weißen Lettern im Zeitgeist der frühen 60er-Jahre verkündeten: „Betreten der Grünanlage verboten! Eltern haften für ihre Kinder!“ Neben den überdimensionierten Rasenflächen gab es mehrere kleinere und größere Beete, die entweder mit einzeln gesetzten Ziergehölzen oder aber mit mehr oder weniger dichtem Gebüsch aus verschiedenartigen Sträuchern und Bäumen bestückt waren.
Derartig strukturiertes Terrain war aus elterlicher Perspektive von beiden Seiten der Wohngebäude aus problemlos über zahlreiche Balkone und Fenster zu kontrollieren und diente in den ersten drei Jahren – trotz oder aber gerade wegen der genannten kleinen Warnschilder – als weitläufiges Spielgelände. Zumeist hielten sich die Kleinkinder allerdings in einem der drei Sandkästen auf, die jeweils in einem Abstand von nur wenigen Metern vor den Wohngebäuden errichtet worden waren und deren Funktion offenbar darin bestand, die Siedlungskinder mit Bedacht von dem sorgsam gepflegten Grün fernzuhalten.
Jenseits der Straße waren die Verhältnisse weniger offensichtlich. Sie zeigten sich hier kaum geometrisch vorgezeichnet und entzogen sich vor allem im Hinblick auf jedes kindliche Spielgeschehen einer klar definierten wie auch kontrollierbaren Reglementierung. Hier ging der Stadtrand unvermittelt in die offene, agrarisch genutzte Kulturlandschaft über. An dieser Nahtstelle begann die Abenteuerwelt der Stadtrandkinder. Zunächst gab es dort zwei alte niederrheinische Bauernhöfe: In 50 Metern Entfernung von der Consdorfschen Wohnung – schräg gegenüber auf der anderen Straßenseite – stand das zweigeschossige, rot gebrannte Ziegelsteinhaus „ihres Bauern“. In rund 250 Metern Entfernung – in östlicher Richtung gelegen – befand sich das große, weiß getünchte, burgartig aufgestellte und einen größeren Innenhof umschließende Ziegelsteingebäude des „weißen Bauern“.
Im Bereich dieser landwirtschaftlichen Hofstellen standen neben den Wohngebäuden unterschiedliche Wirtschaftsgebäude, wie Ställe, offene Scheunen mit hoch aufgetürmten Strohballen und verschiedene Schuppen, die diverses Kleingerät irgendwie zu verstecken suchten. Dazwischen waren größere und kleinere Stellplätze eingeschaltet, auf denen vor allem Landmaschinen und Anhänger standen. Auffallend war hier eine scheinbar unvermeidbare, betriebsbedingte Unordnung, die spielende Kinder förmlich dazu einlud, sich in das Durcheinander einzuschleichen und hinter hoch gestapelten Kisten, Fässern und sonstigen Geräten in Deckung zu gehen.
Im Umfeld der Hofstellen herrschten in der Kulturlandschaft Acker-, Wiesen- und Weideflächen sowie verschiedene Areale mit kleingärtnerischer Nutzung vor. Auch auf diesem Terrain gab es für das kindliche Auge Interessantes zu beobachten, was nach eingehender Sichtung der Dinge nicht selten zu spielerischen Erkundungen einlud.
Auf den siedlungsnahen Äckern wurden Rüben, Getreide oder Kartoffeln angebaut. Hier verrichtete „ihr Bauer“ auf verschiedenen Schlägen mit dem Traktor, gelegentlich aber auch mit seinem alten braunen Kaltblutpferd „Max“, unter schweißtreibendem Körpereinsatz schwerste Feldarbeit. Als Spuren, die die angespannten Pflüge oder Eggen in dem sandigen Oberboden hinterließen, tauchten im Anschluss – je nach vorangegangenem Arbeitsschritt – entweder große, glatt abgeschnittene und seitlich umgeworfene Schollen oder aber zerkleinerte, weitgehend eingeebnete, aber letztlich doch wirr herumliegende Krümel und Bröckel aller möglichen Fraktionen auf.
Auf den benachbarten Kleingartenparzellen harkten Kleingärtner entweder emsig oder aber beschaulich zwischen Gartenhäuschen, Obstbäumen und Sträuchern in ihren Beeten oder ernteten mehr oder weniger zielstrebig verschiedenartiges, reif gewordenes Obst und Gemüse.
War die Winterzeit vorbei, standen auf den Weideflächen schwarzweiß gescheckte Kühe, die friedlich hinter weitmaschigen Stacheldrahtzäunen grasten oder dort bewegungsarm und monoton wiederkäuten. Im Hintergrund der landbaulichen Aktivitäten und des weidewirtschaftlichen Trotts veränderte die Landschaft, den jahreszeitlichen Verlauf nachzeichnend, zusehends ihren Charakter. Dieser saisonale Wandel zeigte an, dass jegliche Form von Leben, wie auch die das Land bewirtschaftende Aktivität des Menschen, der Veränderung unterliegt.
Gleichzeitig erfuhren die Stadtrandkinder mit Blick auf die Ackerflächen und deren graubraunen Mutterboden, auf welchem Wege die pflanzliche Nahrung, die am elterlichen Mittagstisch auf Tellern dargeboten wurde, Gestalt annimmt bzw. als Feldfrucht zur Reife kommt. Aßen die Consdorf-Kinder Kartoffeln oder Möhren, so hatten sie mitunter auch die Gestalt und Ausprägung des zugehörigen Blattwerks vor Augen. Tranken die Kinder ihre Frühstücksmilch, so stand für sie außer Zweifel, dass genau diese den friedlich grasenden, schwarz-weiß gescheckten Kühen des „weißen Bauern“ entstammte.
Vernetzt waren die Landwirtschaftsflächen und Kleingärten über unbefestigte gelbbraune Feldwege. Auf diesen stand nach lang anhaltenden Landregen gelegentlich tagelang das Wasser. Bei Trockenheit hingegen verursachten die wenigen hier entlang fahrenden Autos und Motorräder beachtliche Staubwolken, die einerseits Kinder stark beeindruckten, andererseits jedoch am Rand stehende Erwachsene verärgerten und zu wildem Gestikulieren veranlassten. Im Sommer wurden diese Feldwege beiderseits von überaus bunten, teppichartig entwickelten Ackerwildkrautfluren gesäumt, in denen Klatschmohn, Kornblumen, Kamillen und Margeriten als fröhliche Farbtupfer frisch aufleuchteten.
Daneben traten, den Jahreszeiten nicht unterstellt, an einigen Positionen wenig spektakuläre, unterschiedlich dimensionierte Flächen hervor, die mehr oder weniger stark verbuscht waren. Auf diesen herrschten dichtes, stacheliges Brombeergestrüpp mit eingestreutem Gehölzjungwuchs aus Weiden- und Holundersträuchern sowie Hochstauden wie Disteln, Beifuß und Kletten vor. Die größten dieser Brombeergebüsche waren – wenn überhaupt – nur über schmale, wenig ausgetretene Trampelpfade begehbar. Stellenweise gab es hier zudem kleinere tunnelartige Eingänge und Durchlässe, die bei näheren, nicht ganz ungefährlichen Erkundungen mindestens eine gebeugte Körperhaltung erforderten. Derart strukturiertes Dickicht, wie auch verschiedenartige Hecken und durchlässige Holz- oder Drahtzäune, regten von Beginn an die kindliche Neugierde und Fantasie stark an und gaben so manchen Anlass für eine kindliche Expedition ins Reich des Unbekannten. Für den frühen Forscherdrang besaßen diese halbdurchlässigen Begrenzungen geradezu katalytische Funktion.
Kindliche Raumerkundungen
Je häufiger die Stadtrandkinder die Dinge selbst in die Hand nahmen und sich konsequent der elterlichen Obhut entzogen, desto selbstbewusster und stolzer wurden sie. Ergo wechselten sie, so oft sich die Gelegenheit bot, wild entschlossen auf die andere Straßenseite über und weiteten dort ihren Aktionsradius aus. Derart entfernte sich auch Nikolaus Consdorf zusammen mit seinem großen Bruder und einigen Freunden mehr und mehr von den hinlänglich vertrauten Wohnblocks, von der aufgeräumten Geometrie der „Postlersiedlung“ und nahm nach und nach die vielgestaltigen Räume der freien Kulturlandschaft für sich in Besitz. Hierzu kletterte er über Zäune und Mauern, ließ jene halb durchlässigen Gebüsche und Hecken hinter sich und überquerte mit Genugtuung Straßen und Wege, die noch wenige Wochen zuvor seinen Erfahrungshorizont eingeengt und begrenzt hatten. In diesem Sinne unternahm er – ob zu Fuß oder aber von einem Zweirad getragen – alle paar Tage eine Erkundungstour, die oftmals zu einem neuen interessanten Zielpunkt führte und nicht selten mit Blessuren wie Schürfwunden, Kratzern, Beulen und blauen Flecken bezahlt werden musste.
Je älter, kräftiger und mobiler die Kinder wurden, desto schneller bewegten sie sich und desto weiter entfernte Areale suchten sie auf. In der heimatlichen, scheinbar endlosen und ungeordneten Weite der Stadtrandlandschaft eröffneten sich ihnen ungeahnte Möglichkeiten. Es galt, die Welt auf eigene Faust zu erobern, Erfahrungen zu sammeln und vorgegebene Grenzen und Hindernisse zu überwinden. Natürlich wollten sie dabei auch genau jene verbotenen Dinge anstellen, die sie sich unter elterlicher Aufsicht mit Sicherheit hätten verkneifen müssen.
Mit mehreren Freunden drangen die Consdorf-Jungen unbeobachtet in verlassene Obstgärten ein, kletterten dort auf Obstbäume und pflückten von Ästen in ansehnlicher Höhe große Mengen reifer Äpfel und Birnen. Ihr Beutegut überließen sie am späten Nachmittag mit Stolz und Genugtuung der Mutter zum Einkochen. – Am Rheinufer sammelten sie trockenes Treibholz und Reisig und entzündeten damit kleinere oder auch größere Feuer. In diesen garten sie Kartoffeln, die sie zuvor auf abgeernteten Feldern aufgelesen hatten. Diese gerösteten Feuerkartoffeln mit schwarz verkohlter Kruste schmeckten natürlich hervorragend – besser als jene, die man am häuslichen Tische gekocht als Mittagessen bekam. Ausgerüstet mit Schaufeln und Fahrtenmessern – somit also jederzeit gut bewaffnet – durchstreiften sie stundenlang verbuschte Ruderalflächen, kleinere Wäldchen oder Feldgehölze, errichteten dort aus Ästen und belaubten Zweigen gut getarnte Unterschlüpfe und rauchten in diesen aus weißen Schaumkreidepfeifen getrocknete Kastanienblätter oder auch echten Tabak. Erstere hatte ihnen Sankt Martin als Beigabe zum Weckmann beschert, letzteren hatten sie einige Male am Abend des Vortages „unauffällig“ aus dem Tabakbeutel ihres Vaters abgezweigt. – Daneben fuhren die Jungen im regelmäßigen Turnus mit ihren Fahrrädern Rallye-Strecken ab, die über Feldwege mit tiefen Schlaglöchern, über holprige Deichkronen, über aufgeweichte Waldwege und kurvenreiche, kaum befahrbare Trampelpfade in unmittelbarer Rheinufernähe führten.
Als die Abenteurer schließlich jugendliches Alter erreicht hatten, führten sie auch gerne ein Luftgewehr mit sich. Mit diesem schossen sie am Rheinufer in Cowboy-Manier auf angeschwemmte Blechdosen oder aber auf Markierungsbojen im Bereich des Stromstrichs. Gelegentlich nahmen sie dann allerdings auch den ein oder anderen vorbeituckernden Rheinfrachter unter Feuer.
Nachdem die Consdorf-Jungen mit ihren Kameraden jahrelang ihr Umland erkundet hatten – dort gewissermaßen flächendeckend ihre Fuß- und Fahrspuren hinterlassen hatten –, kannten sie ihre Heimatgegend in- und auswendig. Durch ihre Erkundungen hatten sie sich einerseits einen konkreten Bezug zu ihrem Lebensraum erarbeitet, andererseits aber auch die reale Größe und Ausstattung dieses Gebietes am eigenen Körper erfahren.
So wie sie mit ihren Expeditionen Schritt für Schritt die räumlichen Grenzen ihres heimatlichen Gebietes hinaus in größere Ferne verschoben hatten, so war es ihnen gleichfalls gelungen, die Grenzen ihrer eigenen Wahrnehmung und Erfahrung zu erweitern. In dieser Hinsicht darf mit Fug und Recht behauptet werden, sie hätten eigenverantwortlich – fernab elterlicher Obhut – ein gutes Stück Erziehungsarbeit selbst in die Hand genommen.
Graben, graben, graben
Ob als Kinder oder Jugendliche, die Consdorf-Jungen haben im Bereich der Wohnblocks und an zahlreichen anderen Stellen im näheren wie auch weiteren Umfeld der Siedlung beinahe unablässig gegraben. Angefangen hatten auch sie mit den üblichen frühkindlichen Grabarbeiten in den gebäudenahen Sandkästen. Dort zeigten sie sich unter mütterlicher Aufsicht zunächst vorwiegend gestalterisch tätig. Mit Eimern, Förmchen, Sieben und kleinen Schaufeln zwangen sie dem sandigen, mehr oder weniger trockenen Substrat ihren Willen auf und reproduzierten zielgenau jene Formen, die bereits etliche Generationen von Vorkindern zustande gebracht hatten. Zudem gruben sie bald jedoch kleinere Löcher in den Sandkasten hinein, um Dinge dort hineinzustecken, sie im Anschluss zu verschütten und später erneut auszugraben.
Mit der Zeit, nach nur wenigen Jahren, gewannen die Sandkastenlöcher deutlich an Größe. Nachdem die Jungen bereits mehrfach tief bis in das unterlagernde, natürliche Substrat hinein vorgedrungen waren, drängte es sie hinaus aus der sandigen Kastenwelt, weg von den Wohnblocks, hinüber auf die andere Straßenseite. Denn das dortige Gelände verhieß ungeahnte Möglichkeiten, in großem Stile – ungehindert und unbeobachtet – entsprechende Grabungen durchführen zu können. Dort entstanden dann schließlich jene ansehnlichen Löcher, in die mehrere Kinder gleichzeitig hineinklettern konnten wie auch solche, die als Fallgruben – für unliebsame Artgenossen sorgsam abgedeckt und getarnt – angelegt wurden.
Auf dem weiten Wege dorthin gab es allerdings auch den ein oder anderen unvermeidbaren Rückschlag. So blieb Nikolaus Consdorf in einem Falle mit seinen Gummistiefeln derart fest im Schlamm stecken, dass graubraunes Wasser unaufhaltsam von oben her in den Schaft seines Schuhwerks hineinströmte und er es letztlich nur der ansehnlichen Kraft seines Bruders verdankte, aus dieser misslichen Lage unbeschadet befreit zu werden.
Auch versuchte man den jungen Erdarbeiter von Beginn an von künstlichen Substraten jeglicher Art fernzuhalten. Glaubte er auf einem Baustellengelände in geöffnet herumliegenden Zementsäcken eine optimal zu handhabende bzw. gut schaufelbare Lockersubstanz aufgespürt zu haben, so waren aufgeschreckte Nachbarn bemüht, im Zusammenspiel mit seiner Mutter, ihn ein für alle Mal von kreativen Grabvorhaben dieser Art abzubringen. Erstere zeigten sich dafür verantwortlich, dass er umgehend in Richtung elterlicher Wohnung abgeführt wurde, letztere nahm ihn anschließend im häuslichen Badezimmer mit erhobenem Zeigefinger und mahnendem Blick in Verwahrung und drohte: „Zu dem Dreckszeuchs jehst de mir nich noch mal hin, mein Freundchen! Du siehst ja aus wie ein ergrauter Bäcker!“
Je älter und kräftiger die Jungen wurden, desto umfangreicher und zeitaufwendiger wurden ihre Grabungen, desto tiefgründiger im Ergebnis allerdings auch die von ihnen ausgehobenen Löcher wie auch die auf dem Wege dorthin gesammelten Erkenntnisse.
Bei der Errichtung eines Erdlochs und der allgegenwärtigen Frage, was denn wohl im Untergrund zum Vorschein kommen mag, stand stets die Suche nach den eigenen Möglichkeiten im Raum: War man klein und besaß nur bescheidene Kräfte, so vermochte man allenfalls unbedeutende Löcher anzulegen. Verfügte man hingegen über große Kraftreserven, so konnten diese in Form eines ansehnlichen Lochs unter Beweis gestellt werden. In diesem Sinne war jedes kindliche Graben nicht eindeutig zweckgebunden. Wichtig war vielmehr, dass man grub und dass hierbei nach Maßgabe der körperlichen Konstitution vor allem in die Tiefe und in die Breite gegangen wurde. Dem Graben wohnte demnach – faktisch wie auch wörtlich – ein durch und durch tief gehender Sinn inne. Die Löcher, die die Consdorf-Jungen bei diesen schürfenden Sinnsuchen zustande brachten, wurden deshalb von Mal zu Mal größer und gewannen vor allem auch zunehmend an Gründigkeit.
Als die Jungen mehr als deutlich jugendliches Alter erreicht hatten, schien es zwischenzeitlich beinahe so, als hätten sie das Interesse an Grabungen jeglicher Art verloren. Ihre Spaten und Schaufeln standen irgendwo in einem dunklen Kellerraum abgestellt, und ihre Perspektive – der Blick auf alles Künftige – schien eher nach vorne und oben, denn nach hinten und unten ausgerichtet zu sein.
In diesem Schwebezustand hatten sie dann die Errichtung eines Baumhauses ins Auge gefasst. Dieses versprach ihnen ein moderates Abheben vom Boden der Realität und sollte zudem eine gewisse Verschnaufpause im Hinblick auf das bevorstehende Erwachsenwerden garantieren. Da ihnen für dieses Vorhaben allerdings der logistische Sachverstand – vor allem aber auch ein geeigneter größerer Baum – fehlte, nahmen sie in einem Sommer Mitte der 70er-Jahre alternativ dazu dann doch ein größeres „Erdhausprojekt“ in Angriff. Ergo wurden die eingekellerten Grabwerkzeuge erneut ausgemottet.
Das geplante Erdhaus sollte aus soliden Brettern zusammengenagelt und mit einem kleinen, selbst gemauerten Ofen ausgestattet werden sowie über ein stabiles Holzdach verfügen. Letzteres wollte man abschließend, nach allen Regeln der Kunst, mit Erde, Gras und Laubwerk tarnen. Die Jungen hatten vor dem Hintergrund der luftigen „Baumhausvision“ die Vorstellung entwickelt, auch in einem gut getarnten Versteck wie einem Erdhaus ließe sich – wenn auch nur für eine geraume Zeit – ein Teil der jugendlich erkämpften Autonomie erfolgreich verteidigen.
Das geplante Bauvorhaben machte zunächst umfangreiche Erdarbeiten erforderlich. Mit zwei treuen Freunden hatten die Consdorf-Jungen in einer kleineren, nur wenige Jahre alten Birkenaufforstung zunächst zahlreiche Bäumchen und deren Wurzelwerk entfernt und anschließend mehrere Tage lang erbarmungslos ins Erdreich gegraben. Die jugendlichen Arbeiter gruben sich hierbei mit großer Schlagzahl Schicht für Schicht tiefer in den rotbraunen Boden hinein. Mit anwachsender Tiefe und zunehmender Bodenfeuchte wurde das Schachten mehr und mehr beschwerlich. Der sandige Lehm, der mit jedem Spatenstich angehoben wurde, blieb immer häufiger quaderförmig an dem Spatenblatt kleben und trennte sich beim anschließenden ruckartigen Abwerfen kaum noch vom Metall des Grabwerkzeugs. Es schien fast so, als wolle sich das sandig-lehmige Substrat nur äußerst widerwillig von seinem geologischen Verbund trennen. Schließlich brachten die Jungen nach mehreren Tagen eine ansehnliche Baugrube zustande, die in etwa die Ausmaße zwei mal drei Meter bei rund 180 Zentimetern Tiefe aufwies.
Als sie endlich die anstrengenden Grabarbeiten beendet hatten und am Tage später auch die Errichtung des gemauerten Ziegelsteinofens, einschließlich eines akzeptablen Kamins, nahezu abgeschlossen war, wollte sich anschließend, bei der Fertigstellung des eigentlichen Gebäudes, kein nennenswertes Vorankommen mehr einstellen. Dieses lag vor allem daran, dass die Jungen nirgendwo geeignete Baumaterialien wie größere Bretter und Balken auftreiben konnten.
Wie sie sich in ihrem Erdloch auch drehen und wenden mochten – und derart ihrem Denken Richtung und Beweglichkeit zu geben hofften –, das Vorhaben war ihnen logistisch wie auch zeitlich über den Kopf gewachsen. Sie mussten sich eingestehen, an der übermächtigen Herausforderung Lust und Laune verloren zu haben. Deshalb berieten sie sich und kamen kurzerhand überein, das Projekt unvollendet zu begraben. Unmittelbar danach schaufelten die vier Freunde das Loch in einer schweißtreibenden Gewaltaktion von mehreren Stunden wieder zu.
Mit dem Zuschütten ihres größten Erdlochs begruben die Jungen jedoch nicht nur ein rudimentär angelegtes Erdhaus und einen gemauerten Ziegelsteinofen mit einem bis fast zuletzt hoch herausragenden Kamin, sondern sie verabschiedeten sich auch von der Autonomie-Vision, die ihrem Projekt innewohnte. Vermutlich waren sie sich zu diesem Zeitpunkt bereits ohnehin darüber im Klaren, dass die Zeit des jugendlichen Herumstromerns unweigerlich zu Ende ging und dass ihnen keine Möglichkeit mehr blieb, sich vor dem herannahenden Erwachsenwerden – jenem unvermeidbaren Sprung ins kalte Wasser – zu verbergen. Mit dieser letzten großen Aktion begruben die Freunde unwiderruflich ihre Erdkarrieren. Auch der Consdorf-Bruder waren in diesem Sinne ein für alle Mal aus dem Schneider. Nikolaus Consdorf hingegen konnte zum damaligen Zeitpunkt noch nicht ahnen, dass alles bisherige Graben für ihn erst die Probe aufs Exempel sein sollte.
Am Fluss – Der Himmelgeister Rheinbogen
Nikolaus Consdorf mag damals dreizehn Jahre alt gewesen sein. Sein Vater und er unternahmen wieder einmal eine kleinere Fahrradtour zum Rhein. Und immer wenn die beiden ein „Tourchen zum Rhein“ antraten, war es der Himmelgeister Rheinbogen in rund drei Kilometern Entfernung, der als Zielobjekt angesteuert wurde. Das bedeutete, Vater und Sohn bewegten sich auf genau jenes Terrain zu, welches Consdorf ansonsten eher im Freundestrupp unsicher machte.
Der Himmelgeister Rheinbogen krümmt sich rechtsrheinisch zwischen den Flusskilometern 723 und 731. In seinem westlichen Teil umfasst er zahlreiche stromparallel angelegte Flutrinnen, die bis etwa zwei Meter tief in die Flussaue eingelassen sind und bei Hochwasser sukzessive untertauchen. Folgt man zu Fuß in Nordsüd-Richtung dem befestigten Hauptweg durch dieses hochwassergefährdete Auenareal, so fallen einem zunächst die ausgedehnten Weideflächen mit den locker eingestreuten Kopfweiden und die zahlreichen, verschiedene Wege und Parzellengrenzen markierenden, hohen Pappelreihen ins Auge. Auf den zweiten Blick treten dann einige größere Ackerflächen hinzu. Daneben zeigen sich einzelne größere wie auch kleinere Feldgehölze. Mit Blick aufs Detail erkennt man, dass die bis zu dreißig Meter hohen Baumreihen aus Balsam- und Hybrid-Pappeln durch verschiedenartige Strauchgruppen und kleinere Bäume heckenartig miteinander vernetzt sind. Schaut man schließlich ganz genau hin, so fällt einem darüber hinaus möglicherweise das wellenartige Kleinrelief auf, dessen ausgeprägter Rinnencharakter sich allerdings nur dem tatsächlich erschließt, der sich wirklich einmal die Mühe macht, einer der eingetieften Linien über eine Länge von mehreren hundert Metern zu folgen.
Hat der Spaziergänger mit wachen Augen eine Bestandsaufnahme dieser niederrheinischen Auenlandschaft geleistet, so ist ihm unbedingt angeraten, auf besagtem „Nordsüdweg“ einen kurzen Halt einzulegen und anschließend langsam und bewusst eine komplette Drehung um die eigene Achse zu vollziehen. Genau diese offenbart die Erkenntnis, dass es in einer Großstadt wie Düsseldorf nur noch wenige Orte gibt, an denen man – wie in hiesigem Rheinbogen – das Gefühl verspürt, sich in der freien Landschaft zu bewegen. Nur selten noch findet der städtische Fußgänger im Rheinland Freiräume vor, die ihm einen Rundumblick mit kulturlandschaftlicher, nicht urban geprägter Horizontlinie vermitteln. Und noch seltener stößt er im großstädtischen Außenbereich auf Weideflächen, auf denen friedlich Rinder grasen. Was den Himmelgeister Rheinbogen darüber hinaus gleichermaßen auszeichnet, ist die Tatsache, dass der Wind hier die hohen, sich biegenden Pappelkronen unvergleichbar zum Rascheln bringt. Es ist ein anhaltendes, auf- und abbrausendes Rauschen im Blattwerk, das allenfalls dem Brandungsspiel am Meeresstrand vergleichbar ist. Dieses ist einerseits der unmittelbaren Rheinnähe zu verdanken, die zwangsläufig erhöhte Windgeschwindigkeiten nach sich zieht, andererseits aber auch dem halb offenen Charakter dieser ansprechenden Kulturlandschaft.
Nun lagen Nikolaus Consdorf und sein Vater bei schönstem Sommerwetter am südlichen Ende des Rheinbogens unter einer etwa zwanzig Meter hohen, breitkronigen Eiche. Diese steht hier, im Hochflutbett des Flusses, zusammen mit einigen weiteren Exemplaren auf einer ufernahen Glatthaferwiese. An diesem schattigen Pausenplatz genossen die beiden die prächtigen Farben, erfreuten sich an dem sanften Rauschen der Pappeln und an dem abwechslungsreichen, jahreszeitlich gestimmten Gesang der Vögel, die entweder hoch über ihren Köpfen in der Luft waren oder aber gut versteckt im benachbarten Geäst saßen.
Schließlich kamen wie aus dem Nichts jene beiden merkwürdigen Sätze hervor: „Man müsste ein eigenes Haus haben“, sagte der Vater. „Ein wirkliches Zuhause, einen Ort, an dem man sich so richtig wohl fühlt!“, fügte er hinzu.
Nikolaus war nicht klar, was sein Vater damit meinte. Wollte er ihm zu verstehen geben, dass er nicht gerne zur Miete wohnte und dass man als Bewohner eines gemütlichen Einfamilienhauses seiner Meinung nach größere Freiheiten genießen konnte – welcher Art auch immer? Die Familie, als lebendigen Hort der Geborgenheit, konnte er in diesem Kontext ebenfalls nicht gemeint haben, denn die wohnte doch zusammen mit ihm unter einem Dach? Oder spielte der Vater hier möglicherweise auf die geographische Heimat an und wollte mit seinen Worten zum Ausdruck bringen, dass er nicht gerne im dicht besiedelten Rheinland und in einer dortigen Großstadt wohnte? Die Wahrheit war nämlich folgende: Consdorfs Vater war Wirtschaftsimmigrant aus der Eifel. Die Nachkriegswirren hatten ihn als jungen Mann ins benachbarte Rheinland verschlagen. Deshalb sehnte er sich häufig in die Eifel seiner Kinder- und Jugendtage zurück. Denn eines stand für den Vater außer Zweifel: Die Eifel war seine Heimat; dort fühlte er sich verwurzelt. Die Eifellandschaft hatte er unfreiwillig und nur mit äußerstem Widerwillen verlassen.
Auch die hoch aufragende, breitkronige Eiche, an deren festen Stamm die beiden nun angelehnt lagen, benötigt jene starke Verwurzelung – eine Verwurzelung, die tiefer als der Mutterboden geht und irgendwie in den Untergrund hinabführt. Nur so vermag der Baum zu gedeihen und der natürlichen Witterung wie auch den menschlich bedingten Schadstoffeinträgen zu trotzen. Ihr Standort ist ihr Zuhause. Hier, genau hier, im Auenbereich des Flusses, bekommt sie Sonnenlicht, Wasser, Kohlendioxid und all jene Nährstoffe, die ihr der satte Auenlehm gratis zur Verfügung stellt. Ein Baum besitzt gegenüber dem Menschen allerdings einen entscheidenden Vorteil: Er ist unwiderruflich fest an seinen Standort gebunden. Er kann nicht denken und muss deshalb auch keinerlei Gedanken darüber anstellen, wo er denn hingehört bzw. wo er hingehen müsste, um genau dieses herauszufinden.
Nachdem Vater und Sohn sich etwa zehn Minuten lang schweigend im Baumschatten entspannt hatten, stand Erster auf, schlug mit der flachen Hand leicht an den Stamm und richtete in ruhigem Ton folgende Worte an Nikolaus Consdorf: „Wenn du wissen willst, wo du hingehörst, dann musst du möglicherweise eine längere Reise antreten! Nur wenn du hierbei tatsächlich deinen eigenen Weg gehst, wirst du die Erkenntnisse ans Tageslicht fördern, die für dich von Bedeutung sind. Die Verwurzelung, die ein Baum wie diese Eiche zum Leben braucht, ist genau dieselbe, die auch du für dich und dein Leben finden musst. Wenn du sie gefunden hast, wird sie dir Halt und Stärke geben und dir unmissverständlich sagen, was du fortan zu tun oder zu lassen hast!“ Und nach einer Pause von wenigen Sekunden bemerkte er dazu noch: „Jedenfalls hat mir jemand genau das vor längerer Zeit einmal gesagt.“
Mehr oder weniger regelmäßig tuckerten beladene oder unbeladene Rheinfrachter an ihrem beschaulichen Pausenplatz vorbei. Flussaufwärts fuhren sie langsam, stemmten sich keuchend, mit laut dröhnenden Motoren gegen die Flut und schoben derart teils beachtliche Bugwellen vor sich her, zu Tale fahrend pflegten sie ein deutlich größeres Tempo und rauschten wie auf einem abschüssigen Förderband glatt und gleichförmig an ihnen vorbei.
Im Hintergrund, unmittelbar gegenüber auf der anderen Rheinseite – hinter dem bewegten Kraftspiel der Frachtschifffahrt –, fanden die Anmut und Gemütlichkeit der hiesigen Auenlandschaft ihr jähes Ende. Am dortigen Prallhang des Flusses, wie auch 500 Meter weiter flussabwärts, befinden sich verschiedene industriell und gewerblich genutzte Flächen, die mit Hafenanlagen, Kränen, Lagerhallen, verschiedenen Schornsteinen, größeren Werksgebäuden, Mauern und Zäunen sowie sonstiger rüder technologischer Unromantik aufwarten. Genau diesen industriellen Flächen entstammen verschiedenartige Schadstoffe, denen der breitkronige Baum im rechtsrheinischen Hochflutbereich seit mehreren Jahrzehnten erfolgreich getrotzt hatte.
Aber mit dieser Faktenlage, wie auch mit der tatsächlichen Belastungssituation beiderseits des Rheinbogens, sollte sich Consdorf erst Jahre später näher beschäftigen.
2. Zur Orientierung
Fragen und Fragezeichen,
ihr verflixten und
krummen Gestalten.
Ich kann nicht
ewig warten –
verbiegen werde ich euch.
Im Russenloch
Nachdem die Schulzeit erfolgreich ad acta gelegt worden war, hatte sich Nikolaus Consdorf Ende der 70er-Jahre fünfzehn Monate lang – wenn auch unfreien Willens – den niedrigen Gangarten angedient. Seine Wehrzeit spielte sich bei den Panzergrenadieren im Münsterland ab. War er über eine Dauer von rund achtzehn Jahren aufrecht und mehr oder weniger erhobenen Hauptes durch die Welt gezogen, so musste er beim Militär die bereits in frühen Kindestagen abgelegten Bewegungsformen erneut aufnehmen.
Die niedrigen, erdnahen Gangarten, das tief gebückte Gehen, das Kriechen – auf Knie und Handflächen gestützt – und das Gleiten – mit flach an den Boden geschmiegtem Körper –, aufgeführt in Wäldern, auf Wiesen- und Ackerflächen, vor allem aber auch auf unbefestigten Wegen und angrenzenden Rainen, lernte er in dieser maßgeblich vom Zwang diktierten Zeit erneut und ausgiebig kennen. Besonders unangenehm empfand er hierbei jene zumeist lautstark und unfreundlich befohlenen Anordnungen, die ihm hastige und sprunghafte Bewegungsabläufe abverlangten, wobei diese unweigerlich dort landeten, was alle Beteiligten zuvor übereinstimmend als „schmutzigen Dreck“ bezeichnet hatten.
Im Rahmen weitläufiger, horizontal bestimmter Raumerkundungen bekam Consdorf vielfach Gelegenheit, hautnahe Selbsterfahrungen mit den verschiedenen bodenrelevanten Konsistenzen zu machen. Bei tastenden Erkundungen dieser Art stieß er buchstäblich mit der Nase auf das, was er heute im Zuge seiner Arbeit als feste, halbfeste, steife, weiche, breiige oder gar zähflüssige Bodenkonsistenz anzusprechen weiß. Mit anderen Worten: Seine Kameraden und er krochen und robbten durch den „Dreck“, was das Zeug hielt. Entweder sie durchwühlten trockene, mitunter stark staubende Böden oder aber sahen sich gezwungen, erdfarbenen Schlämmen unterschiedlicher Feuchte auf den Leim zu gehen. Hierbei sammelte der Soldat Consdorf ungewollt Erfahrungen, von denen er seinerzeit nicht im Entferntesten ahnen konnte, dass sie ihm die spätere Ausübung seines Berufes durchaus erleichtern würden.
„Er ist kein Mensch, er ist kein Tier, er ist ein Panzergrenadier …!“ Da diese Spezies häufig mit dem Klappspaten im Erdreich hantierend angetroffen wird, weiß sie sich gelegentlich als „Erdferkel“ diffamiert. Ja, wenn man denn so will, kam Consdorf während seiner Wehrzeit als „Erdferkel“ voll auf seine Kosten. Er durfte derart ausgiebig graben, dass ihm nach getaner Arbeit häufig tagelang die Arme und der Rücken schmerzten.
Auf militärischem Übungsgelände mussten die Grenadiere zudem häufig umfangreiche „Schanzarbeiten“ angehen. Zumeist hoben sie dabei in dichten Wäldern oder an lichten Waldrändern Kampfstände aus – das heißt, „sie gruben sich ein“ und gingen anschließend mit ihren Handfeuerwaffen in Stellung.
Bei baulichen Vorhaben dieser Art hatten die Wehrpflichtigen mit ihrem Klappspaten, selten nur mit einem leistungsfähigeren „Schanzzeug“, in großem Umfang Bodenmaterial zu bewegen. Für die Errichtung eines Kampfstandes hoben in der Regel zwei Soldaten ein etwa zwei Meter langes, sechzig Zentimeter breites und rund 150 Zentimeter tiefes Loch aus. Der ausgehobene Boden wurde hierbei in mehreren großen Haufen unmittelbar neben dem Kampfstand abgeworfen. Nach Beendigung der Grabarbeiten wurden die aus dem Aushub entstandenen Erdhügel mit dem Klappspaten flach geklopft und sodann mit zuvor gestochenen Grassoden abgedeckt. Der frische, erdfarbene Bodenaushub wurde derart versteckt, und der Kampfstand verschwand in Folge gut getarnt in einem künstlich geformten, schwach bewegten Relief.
Waren die Soldaten in den Kampfständen mit ihren Waffen in Stellung gegangen, mussten sie mitunter stundenlang auf weitere Befehle warten, ohne dass in der Zwischenzeit irgendetwas Erwähnenswertes passiert wäre. Am Ende derartiger Übungen, die gelegentlich auch sechsunddreißig Stunden dauern konnten, wurden die Erdlöcher in der Regel wieder mit dem zuvor ausgehobenen und als Erdhügel zwischengelagerten Bodenmaterial verfüllt. Spätestens während des kräftezehrenden Zuschaufelns machte es in Consdorfs Kopf dann regelmäßig laut „klick“. Bei diesem Arbeitsschritt musste er unwillkürlich an das gescheiterte „Erdhausprojekt“ der in nicht allzu weiter Ferne zurückliegenden Jugendtage denken. „Besser man hätte sich damals wirklich ganz tief und lange eingegraben“, murmelte er dann bockig und zähneknirschend vor sich hin.
Bei einer dieser unfreiwilligen Grabungen im sandigen Substrat des Münsterlandes gruben Consdorfs Kameraden und er ein sogenanntes Russenloch. Jenes „Russenloch“ wies an der Bodenoberfläche einen runden, zirka fünfzig bis sechzig Zentimeter großen Querschnitt auf, war etwa 150 Zentimeter tief und weitete sich in seinem unteren Bereich tropfenförmig aus, so dass ein normal gebauter Soldat dort unten für längere Zeit bequem hockend abtauchen konnte. Der Terminus Russenloch rührt angeblich daher, dass sich im zweiten Weltkrieg vor allem russische Soldaten „gerne“ in derartigen Löchern versteckt hatten, um sich derart von herannahenden feindlichen Panzern überrollen zu lassen und diesen entweder im richtigen Moment eine Panzermine anzuheften oder aber von hier aus den Kampf aus dem Hinterhalt mit anderen geeigneten Mitteln aufnehmen zu können.
Nachdem Nikolaus Consdorf unter Anleitung ein derartiges Bauwerk gegraben hatte, ergab sich für ihn während einer anschließenden Übung die einmalige Gelegenheit, für längere Zeit in ein „Russenloch“ abzutauchen. Diesem Vorhaben folgend, ließ er sich vorsichtig mit beiden Beinen voran, abgestützt durch seine flachen Hände, in das Erdloch hinabgleiten. Unmittelbar danach ging er behutsam in die Hocke. Er machte seine Knie spitz, zog seine Schultern leicht nach vorne und suchte eine annähernd bequeme Anlehnung an der rückwärtigen Höhlenwand. In dieser Haltung versuchte er nun mit der ungewohnten, beengten Situation – mit sich in der erdigen Röhre – ins Reine zu kommen.
Je länger er nun in dem Loch in Tuchfühlung mit dem Boden ausharrte, desto mehr verschwanden die anfangs der Enge geschuldeten Gedanken und desto nachhaltiger stellte sich in ihm das überaus angenehme Gefühl einer mollig-warmen Geborgenheit ein. Seine Atmung und sein Puls verlangsamten sich, und seine Gedanken schickten sich an, in ein ruhigeres Fahrwasser abzugleiten.
Zwar steckte er hier angewurzelt wie eine Rübe im Boden fest – die Erde hatte ihn gewissermaßen inkorporiert –, er konnte aber nach wie vor ungehindert ein- und ausatmen. Nach geraumer Zeit keimte in ihm sogar das Gefühl auf, sein Körper und das ihn umgebende Bodenwesen stünden in einem wechselseitigen Gasaustausch – in einem gleichberechtigten Verhältnis zwischen einem Gebenden und einem Nehmenden. Er würde einatmen, was der Bodenkörper ausatme, und jener würde einatmen, was er an Atemluft von sich gebe. In dieser merkwürdigen Situation schien es Consdorf beinahe so, als wäre er mit dem Boden aufs Innigste verwachsen und würde mit diesem eine untrennbare Einheit bilden.





























