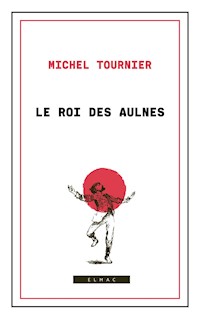Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Abel Tiffauges, im zivilen Leben Automechaniker in Paris, taumelt durch die Wirren des Zweiten Weltkriegs: Er wird unschuldig für ein Verbrechen verurteilt und zur Strafe an die Front geschickt. Er gerät in deutsche Kriegsgefangenschaft und wird nach Ostpreußen verlegt. Dort begegnet Tiffauges diversen SS-Führern, kommt auf das Gut des Reichsjägermeisters Hermann Göring, entwickelt einen Sinn für die Ästhetik des Faschismus und gewinnt das Vertrauen der Deutschen. Schließlich erhält der Franzose, dessen Liebe Deutschland gilt, den Auftrag, Nachwuchs für die Nationalpolitische Erziehungsanstalt »Kaltenborn« zu rekrutieren. Dem Erlkönig gleich verführt er junge Männer, mit ihm zu gehen, und schildert ihnen Deutschland als Utopie. Als er jedoch realisiert, dass er die Kinder ins Verderben des Krieges geführt hat, zerbricht sein Glaube an eine bessere Welt. Psychologisch meisterhaft verknüpft Michel Tournier in diesem Jahrhundertwerk historische Ereignisse mit mythischen Erzählungen und philosophischen Elementen. Ein Werk, das Furore machte und von jeder Generation neu zu entdecken ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 626
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Erlkönig
Michel Tournier
Der Erlkönig
Roman
Aus dem Französischen von Hellmut Waller
Inhalt
I. Die sinistren Aufzeichnungen des Abel Tiffauges
II. Die Tauben aus dem Elsass
III. Hyperborea
IV. Der Oger von Rominten
V. Der Oger von Kaltenborn
VI. Astrophorus
Anmerkungen
Dem geschändeten Andenken des
Starez Grigori Jefimowitsch
RASPUTIN
der den Zarewitsch Alexis heilte
und der ermordet wurde,
weil er sich der Entfesselung
des Ersten Weltkriegs
widersetzt hatte
I. Die sinistren Aufzeichnungen des Abel Tiffauges
Um etwas interessant zu finden, muß man es nur lange genug betrachten.
Gustave Flaubert
3. Januar 1938. Du bist ein Oger, sagte Rachel manchmal zu mir. Ein Oger? Also ein Monstrum, das Menschen frisst, ein elbisches Ungeheuer, der Nacht der Zeiten entstiegen? Ja – ich glaube an meine elbische Natur, das heißt an diese geheime Beziehung, durch die meine eigene Lebensgeschichte im tiefsten Grunde verquickt ist mit dem Lauf der Welt und ihn in ihre Richtung zu lenken vermag.
Auch glaube ich, dass ich der Nacht der Zeiten entstamme. Schon immer war mir die Leichtfertigkeit der Menschen ein Ärgernis, die sich leidenschaftlich darum kümmern, was nach dem Tod auf sie wartet, und sich keinen Deut darum scheren, was sich vor der Geburt mit ihnen getan hat. Dabei ist das Vorher gewiss nicht leichter zu nehmen als das Nachher, zumal es wahrscheinlich dessen Schlüssel birgt. Ich jedenfalls, ich war schon vor tausend, vor hunderttausend Jahren da. Die Erde war noch nichts als ein wirbelnder Feuerball in einem Himmel von Helium, und doch war es meine Seele, die sie in Brand setzte und kreisen ließ. Meine Herkunft aus schwindelnden Urzeiten erklärt übrigens zur Genüge meine übernatürliche Macht über den Gang der Welt: Das Sein und ich, wir beide wandern schon so lange Seite an Seite, wir sind so alte Weggenossen, dass wir – nicht aus Zuneigung, aber kraft einer Gewöhnung, so alt wie die Welt selbst – einander verstehen und einander nichts abschlagen können. Und was meine Monstrosität anbelangt …
Zunächst – was ist denn ein Monstrum? Die Etymologie hält eine etwas schockierende Überraschung bereit: Monstrum kommt von monstrare, zeigen. Ein Monstrum ist das, worauf man zeigt – mit dem Finger, bei Volksfesten und so weiter. Je monströser demnach ein Wesen ist, desto mehr muss es zur Schau gestellt werden. Eine haarsträubende Vorstellung für mich, der ich nur im Dunkeln leben kann und überzeugt bin, dass die vielen, die meinesgleichen scheinen, mich nur infolge eines Missverständnisses am Leben lassen: weil sie mich nicht kennen.
Um kein Monstrum zu sein, muss man seinesgleichen eben wirklich gleichen, der Gattung entsprechen, nach dem Bild seiner Vorfahren geschaffen sein, oder aber eine Nachkommenschaft haben, die dann das erste Glied einer neuen Gattung aus einem macht. Denn die Monstren, die Ungeheuer, pflanzen sich nicht fort. Die Kälber mit sechs Beinen sind nicht lebensfähig. Das Maultier und der Maulesel sind von vornherein unfruchtbar, als wollte die Natur ein Experiment, das sie als unvernünftig ansieht, schleunigst abbrechen. Und damit komme ich wieder zurück auf mein ewiges Dasein: Es nimmt für mich die Stelle der Vorfahren und zugleich der Nachkommenschaft ein. Alt wie die Welt, unsterblich wie sie, kann ich ja nur einen Putativvater, eine Putativmutter und allenfalls Adoptivkinder haben.
…
Ich lese diese Zeilen nochmals. Ich heiße Abel Tiffauges, betreibe eine Autowerkstätte an der Place de la Porte-des-Ternes und bin nicht verrückt. Und doch muss, was ich soeben geschrieben habe, als mein völliger Ernst betrachtet werden. Und dann? Dann wird die Zukunft hauptsächlich dazu dienen müssen, die Ernsthaftigkeit der vorstehenden Zeilen zu demonstrieren oder genauer: zu illustrieren.
6. Januar 1938: Mit Neon in den feuchten, schwarzen Himmel gezeichnet, wirft das geflügelte Pferd von Mobilgas einen Widerschein auf meine Hände und verschwindet sogleich wieder. Dieses rötliche Aufzucken und der Geruch von altem Schmierfett, der hier alles durchtränkt, bilden eine Atmosphäre, die ich hasse und in der ich mich doch uneingestandenermaßen wohlfühle. Dass ich eben nur daran gewöhnt sei, wäre zu wenig gesagt: Sie ist mir so vertraut wie die Wärme meines Bettes oder das Gesicht, das ich allmorgendlich im Spiegel wiederfinde. Aber wenn ich mich zum zweiten Mal, einen Füllfederhalter in der linken Hand, vor dieser weißen Seite hinsetze – der dritten meiner sinistren Aufzeichnungen –, dann deshalb, weil ich die Gewissheit habe, mich, wie man zu sagen pflegt, an einem Wendepunkt meines Daseins zu befinden, und weil ich zum Teil von diesem Tagebuch erwarte, dass es mir hilft, dieser Werkstatt, dem schablonenhaften Durchschnittsdenken, das mich in ihr festhält, und damit in gewissem Sinne mir selber zu entrinnen.
Alles ist Zeichen. Doch bedarf es eines Lichts oder Schreis, die hervorbrechen und unser trübes Auge, unsere Taubheit durchstoßen. Seit meinen Anfangsjahren in der St.-Christophorus-Schule habe ich stets auf die Hieroglyphen geachtet, die auf meinen Weg gezeichnet, und auf die verworrenen Worte gehorcht, die mir ins Ohr gemurmelt wurden, ohne dass ich etwas verstand, ohne dass ich etwas anderes daraus schöpfen konnte als noch mehr Zweifel über meine Lebensführung, freilich auch immer aufs Neue den Beweis dafür, dass der Himmel nicht leer ist. Jenes Licht aber, das infolge ganz simpler Umstände gestern aufleuchtete, hat seitdem unaufhörlich meinen Weg erhellt.
Ein ganz alltäglicher Vorfall setzt mich für eine Weile außerstande, meine rechte Hand zu gebrauchen. Ich wollte mit einigen Kurbeldrehungen die Kolbenringe eines Motors wieder gängig machen, den seine Batterien nicht mehr munter bekommen hätten. Dabei traf mich unversehens ein Rückschlag der Kurbel. Durch einen glücklichen Zufall hatte ich gerade den Arm entspannt und die Schulter locker. Den ganzen Schlag musste also mein Handgelenk auffangen, und ich glaubte wirklich zu hören, wie darin die Bänder rissen. Es fehlte nicht viel, und ich hätte mich vor Schmerz übergeben; unter dem dicken, elastischen Verband vor mir fühle ich noch immer stechend meinen Puls. Unfähig, mit einer Hand allein in meiner Werkstatt irgendeine Arbeit zu verrichten, habe ich mich hierher in den zweiten Stock, in dieses Kämmerchen, geflüchtet, in dem ich Geschäftsbücher und alte Zeitungen übereinandergestapelt habe. Um meinen Geist zu beschäftigen, wollte ich mit meiner gesunden Hand einige belanglose Worte auf ein Blatt meines Notizblocks kritzeln.
Und da ging mir plötzlich auf, dass ich mit der linken Hand schreiben konnte! Ja, wirklich: Ohne vorherige Übung, ohne Zögern und ohne Säumen, ganz fest, zeichnet meine Linke vollkommene Schriftzüge, die frei sind von aller kindlichen Unbeholfenheit und obendrein keinerlei Ähnlichkeit haben mit meiner gewohnten Schrift, mit der Schrift meiner rechten Hand. Ich werde auf dieses Ereignis zurückkommen, das mich zuinnerst aufgewühlt hat und dessen Quelle ich ahne. Aber ich musste doch eingangs die Umstände festhalten, die mir nun erstmals die Feder in die Hand drücken zu dem alleinigen Zweck, mein volles Herz zu leeren und die Wahrheit kundzutun.
Muss ich auch den anderen, vielleicht nicht minder entscheidenden Umstand erwähnen: meinen Bruch mit Rachel? Dann freilich werde ich eine ganze Geschichte erzählen müssen, eine Liebesgeschichte, kurz: meine Liebesgeschichte. Selbstverständlich ist mir das zuwider, aber vielleicht ist das nur Mangel an Routine. Für einen von Natur aus so verschlossenen Menschen wie mich ist es zunächst recht abstoßend, seine Innereien auf dem Papier auszubreiten, doch meine Hand reißt mich mit, und mir scheint, nachdem ich einmal zu erzählen begonnen, werde ich nicht mehr innehalten können, eh’ ich nicht am Ende meines Garns angelangt bin. Ob sich vielleicht die Geschehnisse meines Lebens fortan auch nicht mehr aneinanderreihen ohne diese Spiegelung in Worten, die man ein Tagebuch nennt?
Ich habe Rachel verloren. Sie war meine Frau. Nicht meine Gattin vor Gott und den Menschen, aber die Frau meines Lebens, das heißt – ohne jeden Schwulst – das weibliche Wesen meines persönlichen Universums. Ich hatte sie vor einigen Jahren kennengelernt, wie ich alle Leute kennenlerne: als Kundin der Werkstatt. Sie war am Steuer eines heruntergekommenen Peugeot Quadrillette bei mir erschienen, sichtlich geschmeichelt von dem Erstaunen, das eine Frau am Steuer damals noch viel stärker erweckte als heute. Mir gegenüber hatte sie gleich von Anfang an eine Vertraulichkeit an den Tag gelegt, die das, was uns verband – das Auto –, zum Vorwand nahm und sich rasch auf alles Sonstige ausdehnte, sodass ich sie binnen kurzem in meinem Bett fand.
Zuerst hielt mich ihre Nacktheit bei ihr fest, die sie gekonnt und ohne Scheu zu tragen verstand, nicht mehr und nicht weniger gut als andere Kleidung, als ein Reisekostüm oder ein Abendkleid. Mit Sicherheit leidet der Reiz einer Frau durch nichts so sehr, wie wenn sie nicht versteht, dass man auch nackt existieren kann, dass es nicht nur eine angewöhnte, sondern auch eine natürliche, angeborene Nacktheit gibt. Ich mache mich anheischig, auf den ersten Blick die Frauen zu erkennen, die von diesem Unverständnis geprägt sind. Sie sind gewissermaßen verdorrt, und die Kleider kleben ihnen sonderbar an der Haut. Unter ihrem Köpfchen mit dem Adlerprofil, über dem schwarze Löckchen einen Schopf bildeten, besaß Rachel einen mächtigen, runden Leib, der überraschend weiblich war mit seinen ausladenden Hüften, mit den Brüsten und den breiten violetten Monden darauf, mit dem sehr hohlen Kreuz und mit jener ganzen Skala von tadellos festen Rundungen, alle für die Hand zu umfänglich und insgesamt ein uneinnehmbares Ganzes bildend. In ihrer Haltung betonte sie ohne große Originalität den Typ der »Garçonne«, der seit einem bestimmten Erfolgsroman sehr en vogue war. Ihre Unabhängigkeit hatte sie sich insofern gesichert, als sie den Beruf der fliegenden Buchhalterin ausübte und bei Handwerkern, Händlern und Inhabern von kleinen Betrieben umherfuhr, um deren Buchführung aufs Laufende zu bringen. Sie war Jüdin, und ich konnte feststellen, dass alle ihre Kunden gleichfalls Juden waren, was doppelt erklärlich ist wegen des vertraulichen Charakters der Schriftstücke, die sie zu prüfen hatte.
Ihr zynischer Geist, eine gewisse zersetzende Weise, die Dinge zu betrachten, eine Art zerebraler Juckreiz, der sie immer in der Angst vor Langeweile leben ließ – all das hätte mich abstoßen können. Doch ihr Sinn für Komik, ihr Geschick, die zutiefst absurde Seite von Menschen und Situationen zu entdecken, eine tonische Fröhlichkeit, die sie aus dem Einerlei des Lebens zu schlagen wusste, hatten einen wohltuenden Einfluss auf mein gern etwas missgestimmtes Naturell.
Beim Niederschreiben dieser Zeilen erkenne ich zwangsläufig, wie viel sie mir war, und die Kehle presst sich mir zusammen, wenn ich wiederhole: Ich habe Rachel verloren. Rachel, ich kann nicht sagen, ob wir uns geliebt haben, aber sicher ist, dass wir ganz schön miteinander gelacht haben – ist das etwa nichts?
Lachend und ohne jede Bosheit hat sie übrigens die Prämissen aufgestellt, von denen aus wir beide schließlich auf verschiedenen Wegen zum gleichen Schluss gelangten: zum Abbruch unserer Beziehung.
Sie kam manchmal an wie ein Windstoß, überließ ihr kleines Auto meinem Mechaniker zu einer Reparatur oder einem Ölwechsel, und wir nutzten dies aus, um in meine Wohnung hinaufzugehen, nicht ohne dass sie üblicherweise einen obszönen Witz von sich gab, indem sie tat, als verwechsle sie, was dem Auto und was dessen Fahrerin bevorstand. Damals bemerkte sie beiläufig beim Wiederankleiden, ich benähme mich bei der Liebe »wie ein Gimpel«. Ich glaubte zuerst, sie wolle meine Erfahrung, mein Geschick infrage stellen. Sie belehrte mich eines anderen. Gemeint war allein meine Hast, die sich nach ihren Worten mit dem eiligen Stempeldruck vergleichen ließ, den die Vögelchen einander als eheliche Pflicht verabreichen. Dann beschwor sie träumerisch die Erinnerung an einen ihrer früheren Liebhaber, sicherlich den besten, den sie gehabt hatte. Er hatte ihr versprochen, er werde sie sich vom Sonnenuntergang an vornehmen und vor Tagesanbruch nicht von ihr lassen. Und er hatte Wort gehalten und sie bis zum ersten Schimmer des Morgens bearbeitet. »Allerdings«, so fügte sie fairerweise hinzu, »waren wir spät zu Bett gegangen, und die Nächte waren zu dieser Jahreszeit kurz.«
Diese Geschichte erinnerte mich an die von der kleinen Ziege des Monsieur Séguin, die, um dem Beispiel der alten Renaude zu folgen, ihre Ehre dareinsetzte, die ganze Nacht mit dem Wolf zu kämpfen und sich nicht eher als beim ersten Sonnenstrahl fressen zu lassen.
»Es wäre tatsächlich gut«, schloss Rachel, »wenn du glaubtest, ich fräß’ dich auf, sobald du innehältst!«
Und sogleich entdeckte ich eine Wolfsmiene an ihr mit ihren schwarzen Augenbrauen, ihrer Nase mit den aufgeworfenen Nüstern, ihrem großen, gierigen Mund. Und wir lachten nochmals. Zum letzten Mal. Denn ich wusste, dass ihr Wanderbuchhalterinnenhirn mein Ungenügen überschlägig geschätzt und ein anderes Lager ausgemacht hatte, auf dem sie sich niederlassen würde.
Wie ein Gimpel … Seit sechs Monaten, seit dieses Wort ausgesprochen wurde, ist es lange und tief in mir umgegangen. Ich wusste seit langem, dass eine der häufigsten Formen sexuellen Versagens die Ejaculatio praecox ist, kurz gesagt der nicht genügend verhaltene, nicht ausreichend verzögerte Geschlechtsakt. Rachels Vorwurf geht recht weit, denn er will mich an die Grenze zur Impotenz verweisen, oder besser: Er zeugt von der großen Disharmonie innerhalb des menschlichen Paares, der grenzenlosen Frustration der Frauen, die unablässig befruchtet, doch nie ganz beglückt werden.
»Um mein Vergnügen kümmerst du dich keinen Pfifferling!«
Das muss ich allerdings zugeben. Wenn ich Rachel mit meinem ganzen Körper umschloss, um sie mir zu eigen zu machen – das, was hinter ihren geschlossenen Lidern in ihrem kleinen hebräischen Hirtenkopf vor sich gehen mochte, war gewiss das Letzte, was mich beschäftigte. »Du sättigst deinen Hunger nach frischem Fleisch, dann kehrst du in deinen Blechladen zurück.«
Das stimmte. Und es stimmt ebenso, dass der Mann, der sein Brot isst, sich nicht um die Befriedigung kümmert, die das Brot bei diesem Gegessenwerden empfindet oder nicht empfindet.
»Du verschlingst mich genauso wie ein Beefsteak.«
Vielleicht – wenn man unbesehen den »Kodex der Männlichkeit« übernimmt, der das Werk der Frauen und die Waffe ihrer Schwachheit ist. Zunächst einmal hat jedoch die Gleichstellung der Liebe mit der Nahrungsaufnahme nichts Erniedrigendes, weil zahlreiche Religionen gerade darauf zurückgehen, in erster Linie die christliche mit der Eucharistie. Diese Vorstellung von Männlichkeit – ein ausschließlich weiblicher Begriff – müsste man aber einmal unter die Lupe nehmen: Die Männlichkeit bemisst sich dabei nach der sexuellen Potenz, und die sexuelle Potenz besteht einfach darin, den Geschlechtsakt möglichst lange auszudehnen. Sie hat etwas mit Enthaltsamkeit zu tun. Der Ausdruck Potenz, das Potenzielle, muss demnach in seinem aristotelischen Sinne verstanden werden als das Gegenteil des Aktes, des Aktuellen. Sexuelle Potenz ist die völlige Umkehrung und gleichsam die Negation des sexuellen Aktes. Sie ist das nie eingehaltene Versprechen des Aktes, der endlos verschleiert, zurückgehalten, aufgeschoben wird. Die Frau ist das Potenzielle, der Mann das Aktuelle. Und demnach ist der Mann von Natur aus impotent, von Natur aus nicht im Einklang mit dem langsamen, pflanzenhaften Reifen der Frau. Sofern er sich nicht ihrer Lehre, ihrem Rhythmus fügt und sich mit aller gebotenen Verbissenheit abmüht, um dem zögernden Leib, der sich ihm darbietet, einen Funken Freude zu entreißen.
»Du bist kein Liebhaber, du bist ein Oger.«
Ach, waren das Zeiten! Indem Rachel diesen simplen Satz aussprach, ließ sie schemenhaft die Gestalt eines monströsen Kindes erstehen, eines Kindes von erschreckender Frühreife und verwirrender Kindlichkeit: Nestor. Mit übermächtiger Gewalt ergreift die Erinnerung an ihn Besitz von mir. Ich hatte schon immer geahnt, dass er mit Macht in mein Leben zurückkehren werde. In Wahrheit hatte er es niemals verlassen, doch ließ er mir nach seinem Tod mehr Spiel; er begnügte sich mal da, mal dort mit einem kleinen Zeichen ohne ernste Bedeutung – das manchmal sogar amüsant war –, damit ich nicht vergäße. Meine neue sinistre Schrift und Rachels Fortgehen verkünden mir, dass die Wiederherstellung seiner Macht nahe ist.
10. Januar 1938. Neulich habe ich eines jener Klassenfotos betrachtet, die im Juni kurz vor der Preisverteilung reihenweise gemacht werden. Unter all den Gesichtern, die darauf mit Galgenmienen festgebannt sind, ist das meine das schmalste, das verhärmteste. Champdavoine und Lutigneaux sind da, der eine unter seiner artischockenhaft gestutzten Clownsperücke Grimassen schneidend, der andere mit geschlossenen Augen in seinem durchtriebenen Gesicht, wie wenn er unter dem Deckmantel einer trügerischen Mittagsruhe irgendeinen Streich ausheckte. Von Nestor keine Spur, obwohl das Foto unbestreitbar zu seinen Lebzeiten entstanden ist. Aber eigentlich sah es ihm ganz ähnlich, sich vor dieser kleinen, ein bisschen lächerlichen Zeremonie zu drücken und ja keine banale Spur von seinem Leben zu hinterlassen, ehe er verschwand.
Ich mochte elf Jahre alt sein, und ich war kein Neuling mehr in St. Christophorus, wo bereits das zweite Internatsjahr für mich begann. Aber wenn auch mein Unglück nicht mehr das grenzenlose Elend dessen war, der entwurzelt und im Unbekannten verloren umherirrt, so war es in seiner ruhigen, reflektierten und gleichsam endgültigen Form nur noch tiefer. Damals, das weiß ich noch, hatte ich Bestandsaufnahme von meiner Misere gemacht, und ich erwartete aus keiner Himmelsrichtung einen Schimmer von Hoffnung. Ich hatte die Lehrer und die Welt des Geistes, in die sie uns angeblich einführten, einfach ausgestrichen. Ich war so weit – bin ich von dieser Haltung überhaupt je abgekommen? –, dass ich jeden Autor, jede historische Gestalt, jedes Werk, jeden wie auch immer gearteten Lehrstoff als null und nichtig, als restlos disqualifiziert betrachtete, sobald die Erwachsenen ihn in Besitz genommen hatten und ihn uns als geistige Nahrung aufzwangen. Indem ich in Lexika herumschmökerte, mir einiges in Schulausgaben zusammenlas, in der Geschichts- oder Französischstunde auf jede flüchtige Andeutung dessen lauerte, was für mich von Bedeutung war, begann ich, mir stückchenweise eine Kultur am Rande, ein persönliches Pantheon aufzubauen, worin Alkibiades und Pontius Pilatus, Caligula und Hadrian, Friedrich Wilhelm I. und Barras, Talleyrand und Rasputin nachbarlich vereint waren. Es gab eine bestimmte Weise, von einem Politiker oder einem Schriftsteller zu sprechen – natürlich ablehnend, doch genügte das nicht, etwas anderes musste hinzukommen –, die mich die Ohren spitzen und mich vermuten ließ, er gehöre vielleicht zu den Meinen. Dann unternahm ich sogleich Nachforschungen, eine Art Seligsprechungsprozess mit Bordmitteln, an dessen Schluss die Pforten meines Pantheons sich entweder öffneten oder – je nachdem – geschlossen blieben.
Mit meinem dünnen schwarzen Haar und dem davon umrahmten schwärzlich-gelben Gesicht, das etwas von einem Araber und von einem Zigeuner hatte, mit meinem linkischen, knochigen Körper und den fahrigen, ungefälligen Bewegungen war ich mickrig und hässlich anzusehen. Aber vor allem musste ich irgendeinen verhängnisvollen Zug an mir haben, durch den ich selbst den Angriffen der Feigsten, den Schlägen der Schwächsten zur bevorzugten Zielscheibe wurde. Ich war für sie der unerwartete Beweis, dass auch sie einen anderen überwältigen und demütigen konnten. Kaum ertönte die Pausenglocke, so lag ich schon am Boden, und es kam selten vor, dass ich wieder aufstehen konnte, ehe wir ins Klassenzimmer zurückmussten.
Pelsenaire war ein »Neuer« in der Schule, doch hatten ihm seine körperliche Kraft und sein schlichtes Wesen auf Anhieb einen bevorzugten Platz in der Rangordnung der Klasse verschafft. Ein gut Teil seines Ansehens knüpfte sich an einen Ledergürtel von unerhörter Breite – ich erfuhr später, dass er aus einem Pferdebauchgurt zurechtgeschnitten war –, den er über seinem schwarzen Schulkittel trug und dessen stählerne Schnalle nicht weniger als drei Dorne besaß. Er hatte einen Quadratschädel, über dem ein blonder Haarschopf in die Höhe stand, ein regelmäßiges, ausdrucksloses Gesicht, helle Augen mit ganz geradem Blick, und wenn er zwischen den Gruppen der anderen umherging, die Daumen im Gürtel, brachte er seine prächtigen, genagelten Stiefel zum Klingen, mit denen er bei großen Anlässen Funkengarben aus dem Granitpflaster des Hofes zu schlagen vermochte. Er war ein Wesen, lauter und ohne Falsch, aber auch ohne Abwehrkräfte gegen das Böse, und wie manche primitiven Stämme im Pazifik schon beim ersten Kontakt mit den Krankheitskeimen zugrunde gehen, die von den Weißen ungestraft eingeschleppt werden, so ergab er sich plötzlich seit dem Tage, an dem ich ihm die ganze Vielfalt meines Herzens offenbarte, der Bosheit, der Grausamkeit und dem Hass.
Die Mode, sich zu tätowieren, hatte sich plötzlich in der Schule ausgebreitet. Einer der in der Stadt wohnenden Schüler handelte mit chinesischer Tusche und mit abgestumpften Federn, mit denen man tiefe Zeichen in die Haut einritzen konnte, ohne sie zu verletzen. Wir brachten lange Stunden damit zu, uns Buchstaben, Worte und Zeichnungen auf die Handflächen, auf die Handgelenke oder auf die Knie zu »tätowieren«. Dabei ging es stets um Albernheiten und um unklare Symbole, deren Vorbilder wir unter den Kritzeleien an den Wänden und in den Pissoirs fanden.
Pelsenaire war gewiss nicht unempfänglich für den Reiz unseres neuen Zeitvertreibs, doch fehlten ihm offensichtlich die Fantasie und die Geschicklichkeit, die eine seiner Würde angemessene Verschönerung erfordert hätte. So zeigte er sich denn auch sogleich interessiert, als ich eines Tages wie beiläufig ein Blatt Papier herumzeigte, auf dem ich, so gut ich es konnte, ein Herz gezeichnet hatte, das von einem Pfeil durchbohrt war – Blutstropfen rannen aus der Wunde – und von den Worten umrahmt war: A toi pour la vie. Er war vollends geblendet, als ich behauptete, ich hätte dieses Kunstwerk von der Brust eines meiner Freunde, eines Unteroffiziers der Fremdenlegion, kopiert. Dann bot ich mich als Tätowierer an, wenn er diese großartige Inschrift auf der Innenfläche des linken Oberschenkels haben wolle, an einer diskreten Stelle, die aber jederzeit auch frei gezeigt werden konnte.
Die Prozedur dauerte nicht weniger als einen ganzen Übungsabend. Ich saß auf dem Boden, unter Pelsenaires Pult, und dank der Mithilfe der Nebensitzer, die mit ihren Körpern, Büchern und Schultaschen einen Schutzwall gegen die indiskreten Blicke des Aufsichtsführenden bildeten, arbeitete ich mit eifersüchtiger Sorgfalt. Meine Arbeit war erschwert durch das Aufliegen des Schenkels auf der Bank, das seine Form veränderte und ihm eine nach außen gewölbte Oberfläche gab. Pelsenaire zeigte sich von dem Ergebnis höchst befriedigt, obschon ein wenig überrascht, weil aus der Umschrift um das durchbohrte, blutende Herz A T pour la vie geworden war. Mit ungerührter Stirn behauptete ich, die Legionäre benützten diese Buchstaben als Abkürzung, einmal für A toi, dann auch, um ihre Auflehnung gegen Gott zu bekunden (athée pour la vie – gottlos fürs Leben), schließlich aber in doppeltem Sinn, um gleichzeitig das eine wie das andere zu bezeichnen. Pelsenaire, der offensichtlich von meinen verworrenen Erklärungen nichts verstanden hatte, schien sich im Augenblick damit zufriedenzugeben.
Am folgenden Abend jedoch zog er mich in der Sechs-Uhr-Pause beiseite, mit einer Miene, die nichts Gutes verhieß. Irgendeiner musste inzwischen seinem Verstand nachgeholfen haben, denn er ging gleich wegen der rätselhaften Initialen auf mich los.
»A T«, sagte er, »das sind deine Initialen. Abel Tiffauges fürs Leben. Sofort machst du dieses idiotische Zeug weg!«
Ich war entlarvt, und alles auf eine Karte setzend, wagte ich die Gebärde, von der ich seit Wochen glühend träumte: Ich näherte mich ihm, legte meine Hände in Höhe der Hüften auf den berühmten Gürtel, und mit entzücktem Zögern immer näherkommend, ließ ich sie auf dem Gürtel nach hinten gleiten, bis sie sich in seinem Rücken trafen. Dann schmiegte ich meinen Kopf in der Herzgegend an seine Brust.
Pelsenaire war sich offenbar nicht klar, was da vor sich ging, denn im ersten Moment rührte er sich nicht. Aber dann hob sich langsam seine rechte Hand – im gleichen Tempo, mit dem ich mich bewegt hatte – und klatschte auf mein Gesicht; ein brutaler Stoß, ein unwiderstehlicher Hieb schleuderten mich von ihm weg und streckten mich mehrere Meter entfernt rücklings zu Boden. Dann machte er kehrt und entfernte sich, Funkengarben aus seinen Schuhnägeln schlagend.
Nun hatte er den Reiz des Sklavenhalterdaseins entdeckt und gab mir Demütigungen und Misshandlungen in Fülle zu schlucken, die ich mit dumpfer Unterwürfigkeit hinnahm. Aus freien Stücken überließ ich ihm die Hälfte meiner Essensration im Speisesaal, denn ich hatte keinen Appetit, und die Aufgabe, seine wunderbaren Stiefel jeden Morgen vom Dreck zu säubern und zu wichsen, übernahm ich sogar mit heimlichem Glücksgefühl, denn ich habe schon immer gern Schuhe angefasst.
Doch diese insgesamt noch recht vernünftigen Forderungen waren ihm zu wenig; seine verderbte Seele ließ sich nur durch härtere Dinge zufriedenstellen. So hatte er beschlossen, dass ich täglich Gras essen müsse. Gleich zu Beginn der Mittagspause warf er mich auf der mageren Wiese, die die Statue unseres Schulpatrons umgab, zu Boden, und rittlings auf mir sitzend, das Kinn in brutalem Reflex vorgereckt, stopfte er mir ganze Hände voll Quecken in den Mund, die ich gewissenhaft zerkaute, damit ich nicht daran erstickte. Ein Kreis von Neugierigen sah der Prozedur zu, und nicht ohne eine Aufwallung von Hass und Entrüstung denke ich heute daran, dass kein einziges Mal einer der Aufsichtsführenden – die es so eilig hatten, mich bei einem Streich zu erwischen und mich dafür büßen zu lassen – eingegriffen hat, um diesem Treiben ein Ende zu machen.
Meine Knechtschaft sollte erst enden, nachdem sie ihren Höhepunkt erreicht hatte. Es war zu Beginn des Herbstes, nach tage- und nächtelangem Regen, der den Pausenhof in eine Kloake verwandelt hatte. Kies und Schlacken waren unter einer Schicht aus Schlamm und welkem Laub von trügerischer Weichheit verschwunden. Unser Elend glich dem von Waisenkindern, denen es an Wärme gebricht, die schlecht ernährt und nie gewaschen werden, und die Feuchtigkeit, mit der diese Misere getränkt war, ließ unsere Kleider am Körper kleben und sie schließlich einem natürlichen Fell, einer Schale, einem Panzer ähneln; die Fühlung mit ihm zu verlieren war gräulich, ob es nun abends beim Ausziehen oder dadurch geschah, dass wir uns innerlich zusammenzogen mit schaudernder Haut, verkrampften Muskeln und eingeschrumpftem Geschlechtsteil. Damals nahmen unsere Spiele eine ungewöhnliche, beinahe verzweifelte Gewalttätigkeit an, als hätten wir, um der Düsterkeit und Härte unserer Lebensbedingungen zu entsprechen, uns selbst bestätigen wollen, wir seien Krieger oder wilde Tiere. Fäuste landeten mit sattem Klatschen auf Gesichtern, gestellte Beine führten zu parabolischen Stürzen in den Dreck, ineinander verknäuelte Ringer wälzten sich keuchend auf dem Boden. Geschrien wurde nicht viel, Schimpfworte fielen nie, doch derjenige, der allein am Boden lag, konnte es sich selten verkneifen, ganze Hände voll Schlamm zusammenzuscharren und auf seinen Gegner zu schleudern, damit auch der gründlich dreckig würde. Ich dagegen versteckte mich hinter den Pfeilern der Pausenhalle und suchte jeder Begegnung aus dem Wege zu gehen, die für mich übel ausgehen konnte, und deren gab es viele. Ich glaubte, diesmal vor Pelsenaire keine Furcht haben zu müssen, denn in dem grandiosen Kampfgewühl würde er einen so mickrigen Gegner übersehen. So geriet ich auch nicht in besondere Panik, als ich ihn plötzlich anrempelte, weil ich einem Ball auswich, der wie eine Kanonenkugel daherkam. Er musste sonderbar hingefallen sein, nur auf ein Knie, denn er war nur auf einer Seite am halben Bein schmutzig, sonst sah man ihm fast nichts an. Als ich mich sachte davonmachen wollte, packte er mich am Arm, streckte sein Knie vor und befahl mir: »Wisch mich ab!« Sogleich machte ich mich, zu seinen Füßen gekauert, mithilfe eines etwas dubiosen Taschentuchs an die Arbeit. Pelsenaire wurde ungeduldig.
»Hast du nichts anderes? Dann nimm die Zunge!«
Schenkel, Knie und oberer Teil der Wade waren unterschiedslos aus schwarzem, wie Firnis glänzendem Schlamm geformt, der tadellos ausgesehen hätte ohne die Wunde in der Mitte, die ausgefranst und purpurn über der Kniescheibe klaffte. Daraus sickerte ein zinnoberrotes Rinnsal, das zunächst ins Ockerfarbene, dann durch die Vermengung mit dem Schmutz in ein immer dunkleres Braun überging. Meine Zunge umrundete die Verletzung und umgab sie mit einer grauen Aureole. Ich spuckte mehrmals Erde und Schlackenrückstände aus. Die Wunde, aus der noch immer Blut rann, breitete dicht vor meinen Augen ihre eigenwillige Geografie aus: geschwollenes Fleisch, weißliche Pusteln von abgeschürfter Haut und eingerollte Wundlippen. Rasch tauchte ich die Zunge zum ersten Mal hinein, nicht behutsam genug freilich, um nicht ein Zucken hervorzurufen, das den Muskelkranz über der Kniescheibe wie einen krampfhaft grinsenden Mund verzerrte. Dann ein zweites Mal, etwas länger. Endlich pressten sich meine Lippen auf die Lippen der Verletzung und verweilten dort eine Zeitspanne, die ich nicht ermessen konnte.
Was dann geschah, kann ich nicht genau sagen. Ich glaube, ich wurde von einem Schauder, ja sogar von Krämpfen erfasst, und man musste mich in die Krankenstube bringen. Mir ist noch, als sei ich mehrere Tage krank gewesen. Meine Erinnerung an diese Episode in St. Christophorus ist ziemlich verworren. Dagegen bin ich wieder sicher, dass meine Lehrer es für richtig hielten, meinen Vater von dieser gesundheitlichen Störung zu unterrichten, und um irgendeinen Grund dafür vorzubringen, spielten sie – mit einer Ironie, deren Ungeheuerlichkeit ihnen entging – auf eine Verdauungsstörung infolge übermäßigen Genusses von Leckereien an.
13. Januar 1938. Ich sagte zu Rachel: »Es gibt zwei Arten von Frauen; die ›Nippes-Frau‹, die man in die Hand nehmen, irgendwie behandeln, mit dem Blick umfassen kann und die des Männerdaseins Zierde ist. Und die ›Landschafts-Frau‹: Die sucht man auf, um sie anzuschauen, man ergeht sich in ihr, man läuft Gefahr, sich in ihr zu verlieren. Die erstere ist vertikal, die zweite horizontal. Die erstere ist beweglich, kapriziös, anspruchsvoll, kokett. Die andere ist schweigsam, beharrlich, besitzbewusst, vergangenheitsträchtig und voller Träume.«
Mit gerunzelten Brauen hörte sie mir zu; sie suchte in meinen Worten etwas, was ihr gegenüber unhöflich sein konnte. Um sie zum Lachen zu bringen, tat ich, als wollte ich meinen Vortrag mit anderen Ausdrücken nochmals beginnen: »Es gibt zwei Arten von Frauen«, wiederholte ich, »solche, die ein Pariser Becken, und andere, die ein Mittelmeerbecken haben«, und dabei deutete ich mit den Händen geringe und große Breite an. Sie lächelte, wobei sie sich noch immer mit einem Rest von Unruhe fragte, ob ich sie nicht zu der breiten Sorte rechnete – zu der sie übrigens ohne den Schatten eines Zweifels auch tatsächlich gehört.
Denn diese »Garçonne«, die überall zurechtkommt, ist unbestreitbar eine »Landschafts-Frau«, ein Mittelmeerbecken (übrigens stammt ihre Familie aus Saloniki). Sie hat einen breiten, empfänglichen, mütterlichen Körper. Aus Furcht, sie zu reizen – denn für sie ist jedes Wort stets Liebkosung oder Aggression, nie Spiegel der Wahrheit –, hütete ich mich, ihr das zu sagen. Und ich verschwieg ihr erst recht die Reflexionen, die mir zum Beispiel durch den Kopf gingen, wenn ich meine Hand auf ihren Hüftknochen legte, der sehr kräftig entwickelt war und wie ein Vorgebirge die übrige Landschaft beherrschte. Zwischen den Gebirgen der Schenkel floh der Unterleib zurück, eine fröstelnde, von ängstlicher Unruhe gehöhlte Senke … Ich habe viel nachgedacht über den mysteriösen Begriff »das Geschlecht der Frau«. Sicherlich kann nicht der geköpfte Unterleib auf diesen Titel Anspruch erheben, oder doch allenfalls auf Grund der Symmetrie, die der Körper des Mannes und der Frau grob gesehen aufweisen. Das Geschlecht der Frau. Man wäre zweifellos besser beraten, wenn man es in Höhe der Brust suchen würde, die triumphierend ihre zwei Füllhörner trägt … Die Bibel wirft ein seltsames Licht auf diese Frage. Wenn man den Anfang der Genesis liest, so wird man gleich aufgeschreckt von einem flagranten Widerspruch, der den ehrwürdigen Text entstellt: Und Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf sie einen Mann und ein Weib. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan … Dieser plötzliche Übergang vom Singular zum Plural ist eigentlich umso unverständlicher, als die Erschaffung des Weibes aus einer Rippe Adams erst viel später kommt, nämlich im 2. Kapitel der Genesis. Dagegen wird alles klar, wenn man den Singular in dem zitierten Satz beibehält: Und Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde, das heißt als Mann und Weib in einem. Er sprach zu ihm: »Wachse und mehre dich«, und so weiter. Später stellt er fest, dass die Einsamkeit, die das Hermaphroditentum mit sich bringt, nicht gut ist. Er lässt Adam in Schlaf sinken und entnimmt ihm nicht eine Rippe, sondern seine »Seite«, die Weiche zwischen Rippen und Hüften, das heißt seine weiblichen Geschlechtsteile, und macht daraus ein selbständiges Wesen.
Von daher versteht man, warum die Frau keine eigentlichen Geschlechtsteile besitzt: weil sie Geschlechtsteil ist. Geschlechtsteil des Mannes, zu sperrig allerdings, als dass er ihn ständig tragen könnte, weshalb er ihn meist abgelegt hat und nur bei Bedarf wiederaufnimmt. Es ist ja auch sonst dem Menschen eigen – im Gegensatz zum Tier –, dass er jederzeit ein Gerät, ein Werkzeug, eine Waffe für den Zweck einzusetzen vermag, zu dem er sie gerade benötigt, dass er sich ihrer aber auch gleich wieder entledigen kann, während der Hummer dazu verurteilt ist, ständig seine beiden Scheren mit sich herumzuschleppen. Und ebenso wie die Hand das Verbindungsorgan ist, das es dem Manne ermöglicht, nach Bedarf einen Hammer, ein Schwert oder einen Federhalter einzusetzen, so ist sein Glied eher Verbindungsorgan zwischen Geschlechtsteilen als selbst Geschlechtsteil.
Wenn solcherart die Wahrheit ist, muss man hart ins Gericht gehen mit dem Anspruch der Ehe: so eng und so unauflöslich wie möglich zusammenzuschweißen, was getrennt war. Was Gott getrennt hat, soll der Mensch nicht vereinen! Welch vergebliche Beschwörung! Man entrinnt nicht der mehr oder weniger bewussten Faszination, wie sie von dem alten Adam ausgeht, der, mit seinem ganzen Fortpflanzungsrüstzeug behangen, im Liegen lebt, vielleicht unfähig zu gehen, jedenfalls unfähig zu arbeiten, stets im Bann eines unerhört vollkommenen Liebesrausches, in ein und demselben Taumel besitzend und besessen, es sei denn – aber wer weiß selbst das! – während solcher Zeiträume, in denen er von sich selbst schwanger ist. In welchem Aufzug mag damals unser sagenhafter Stammvater dahergekommen sein: Ein Mann, der das Weib trägt und überdies noch Träger eines Kindes geworden ist, beladen und überladen, wie diese Matrjoschka-Puppen, die immerfort ineinander geschachtelt sind.
Das Bild mag lächerlich scheinen. Mich – der ich doch so hellsichtig bin gegenüber der Verirrung, die man Ehe nennt –, mich rührt dieses Bild; es weckt in mir ich weiß nicht welches atavistische Heimweh nach einem übermenschlichen, schon durch seine Fülle über den Wechselfällen der Zeit und des Alterns stehenden Leben. Denn wenn es in der Genesis einen Sündenfall des Menschen gibt, dann nicht in der Episode um den Apfel – die im Gegenteil einen Fortschritt kennzeichnet –, sondern wohl in dieser Aufspaltung, die den Ur-Adam in drei Teile zerschlug und zuerst das Weib, dann das Kind aus dem Manne herausfallen ließ und so mit einem Schlag drei Unglückliche schuf: das stets verwaiste Kind; das vereinsamte, verängstigte Weib, immer auf der Suche nach einem Beschützer; den Mann, leicht und alert – aber wie ein König, den man all seiner Attribute beraubt hat, um ihn durch Arbeit zu versklaven.
Den Abstieg rückgängig zu machen und den Ur-Adam wiederherzustellen – diesen und keinen anderen Sinn hat die Ehe. Aber gibt es wirklich nur diese Lösung, die ihrer selbst spottet?
16. Januar 1938. Als ich St. Christophorus verließ, hatte die Seele des alten Hauses es schon zwei Jahre verlassen, und diese ganze schulmeisterliche, fromme und zugleich kerkerhafte Welt war nur mehr mit Schatten von Kindern und Geistlichen bevölkert. Nestor ist tot, im Keller der Schule erstickt – er ist für die anderen tot, für mich ist er lebendiger denn je.
Nestor war der einzige Sohn des Pedells der Anstalt. Wer je eine derartige Institution kennengelernt hat, wird sogleich die Macht ermessen können, die ihm dieser Umstand verlieh. Er wohnte ja bei seinen Eltern und doch zugleich auch in der Schule, und vereinigte so auf sich die Vorteile der Internatsschüler mit denen der in der Stadt Wohnenden. Da ihn sein Vater oft mit kleinen Diensten im Hause betraute, konnte er nach Belieben in allen Gebäuden umhergehen, und er besaß die Schlüssel zu fast allen Türen, während es ihm andererseits außerhalb der Schul- und Übungsstunden freistand, »in die Stadt« zu gehen. Doch all das wäre noch gar nichts gewesen, wenn er eben nicht Nestor gewesen wäre. Mit den Jahren gibt er mir Fragen auf, die mir nicht in den Sinn kamen, als ich sein Freund war. Dieses monströse, geniale, elbische Wesen – war es ein zwergwüchsiger Erwachsener, dessen Wachstum auf der Stufe eines Kindes stehengeblieben war, oder war es im Gegenteil ein Riesenbaby, wie seine Silhouette das nahelegte? Ich vermag es nicht zu sagen. Diejenigen seiner Aussprüche, die mein Gedächtnis noch mehr oder weniger wortgetreu zusammenbringt, würden von einer verblüffenden Frühreife zeugen, wenn es überhaupt erwiesen wäre, dass Nestor gleich alt war wie seine Mitschüler. Nichts ist aber ungewisser als dies, und es ist nicht ausgeschlossen, dass er im Gegenteil ein Spätentwickler, ein Zurückgebliebener war, einer, der auf Dauer in der Kindheit angesiedelt war, in der Schule geboren und verurteilt, in ihr zu bleiben. Inmitten solcher Ungewissheiten drängt sich mir ein Wort auf, das ich nicht länger in der Feder zurückhalten kann: zeitlos. Ich habe in Bezug auf mich selbst von ewigem Dasein gesprochen. Kein Wunder demnach, dass Nestor – von dem ich unbestreitbar herstamme – wie ich selber dem Maßstab der Zeit entzogen war.
Er war sehr dick oder, genauer gesagt, richtig feist, was all seinen Gesten, sogar seinem Schritt, eine majestätische Langsamkeit gab und ihn bei Balgereien vermöge seiner Masse zu einem gefürchteten Gegner machte. Hitze vertrug er nicht, er zog bei großer Kälte kaum etwas an und schwitzte im übrigen Jahr unablässig. Er redete langsam, wie beengt von seiner ungewöhnlichen Intelligenz und seinem hervorragenden Gedächtnis, mit einer professoralen Art, die Worte zu zerkauen, die einstudiert und ohne einen Schimmer Natürlichkeit »gemacht« war, und er hob gern den Zeigefinger, wenn er eine Formulierung von sich gab, die wir einhellig wunderbar fanden, ohne eine Spur davon zu verstehen. Ich glaubte anfangs, er drücke sich nur in Zitaten aus, die er in seiner Lektüre zusammengelesen habe; später kam ich ihm näher und begriff, dass ich mich geirrt hatte. Seine Autorität über alle Schüler war unbestritten, und selbst die Lehrer schienen sich vor ihm zu fürchten und gestanden ihm Privilegien zu, die mir damals exorbitant schienen, als ich noch nicht wusste, wer er war.
Der erste augenfällige Ausdruck dieser privilegierten Stellung, dessen ich Zeuge war, war mir freilich unwiderstehlich komisch vorgekommen, weil ich noch kein Gespür für den furchterregenden Nimbus hatte, der alles umgab, was ihn betraf. In jeder Klasse stand am Fuß des Katheders eine schwarz gestrichene Kiste, die als Papierkorb diente. Wenn ein Schüler auf den Abort gehen wollte, bat er durch Heben zweier Finger in V-Form darum, austreten zu dürfen. Auf ein zustimmendes Nicken des Aufsichtführenden oder des Lehrers lief er dann zu der Kiste, griff rasch hinein und eilte mit einer Handvoll Papier zur Türe.
Dass Nestor sich nicht an das übliche V-Zeichen hielt, entging mir anfangs, weil er einen Platz weit hinten im Klassenzimmer hatte. Doch erfasste mich gleich auf Anhieb großer Respekt vor der Gelassenheit, mit der er auf die Kiste zuging, und vor dem, was sich dann abspielte: Mit verbohrter Akribie begann er die verschiedenen Papierfetzen zu mustern, die sichtbar obenauf lagen, dann, anscheinend von dieser Auswahl wenig befriedigt, wühlte er raschelnd in der Kiste, um zerknüllte oder zerrissene Blätter früheren Datums zutage zu fördern; diese betrachtete er längere Zeit prüfend und ging, wie es schien, sogar so weit, zu lesen, was darauf stand. Die Szene zog unwiderstehlich die Aufmerksamkeit aller Schüler auf sich, und selbst der Lehrer fuhr in seinem Geografieunterricht nur noch mit langsamer, mechanischer, von immer längerem Stillschweigen unterbrochener Stimme fort. Dieses angstvolle Verstummen, das über der ganzen Klasse lastete, hätte mich eigentlich in Erstaunen setzen müssen, zumal da ein gleiches Auftreten, wenn es sich ein anderer Schüler erlaubt hätte, mit ungeheuerlichem Gejohle begrüßt worden wäre. Aber noch einmal: Ich war Neuling in St. Christophorus, und ich lachte, an mein Pult geklammert, Tränen; mein Nebensitzer versetzte mir schließlich mit dem Ellbogen Rippenstoß um Rippenstoß, und zwar mit einer Bissigkeit, die ich nicht verstand. Und ebenso wenig verstand ich den Kommentar, den er mir zwischen den Zähnen zumurmelte, als Nestors Wahl schließlich auf ein vollgekritzeltes Konzeptheft fiel: »Für ihn ist nicht das Papier selbst wichtig, sondern was draufsteht und wer es draufgeschrieben hat.« Dieser Satz – und zahlreiche andere, an die ich mich zu erinnern versuche – umkreist das Geheimnis Nestor, ohne es zu erhellen.
Er hatte einen ungewöhnlichen Appetit, dessen Zeuge ich jeden Tag war, denn er aß zwar bei seinen Eltern zu Abend, nahm aber das Mittagessen im Refektorium ein. Jeder Tisch umfasste acht Gedecke und war der Verantwortung eines »Tischältesten« unterstellt, der auf die gleichmäßige Verteilung der Portionen zu achten hatte. Infolge eines jener Paradoxa, die mich erst nach mehrmonatiger Eingewöhnung nicht mehr verwunderten, war Nestor nicht Tischältester. Doch zog er daraus erst recht seinen Vorteil, denn der Schüler, der diese Funktion innehatte – wie übrigens auch die anderen Tischgenossen –, ließ nicht nur, ohne mit der Wimper zu zucken, ein gutes Viertel von jeder Schüssel auf Nestors Teller wandern, sondern stellte um ihn Speiseopfer auf wie um einen antiken Gott.
Nestor aß rasch, ernsthaft, angestrengt; eine Pause machte er nur, um den Schweiß abzutrocknen, der ihm von der Stirn auf seine Brillengläser rann. Er hatte etwas von einem Silen an sich mit seinen Schweinskinnbacken, seinem runden Wanst und seinem breiten Hinterteil. Der Dreiklang Ernährung – Verdauung – Ausscheidung bestimmte den Rhythmus seines Lebens, und diese drei Tätigkeiten wurden mit allgemeinem Respekt umgeben. Doch war dies nur Nestors erkennbare Außenseite. Sein verborgenes Gesicht, das ich als einziger ahnte, galt den Zeichen, dem Entziffern der Zeichen. Zusammen mit dem absoluten Despotismus, dessen Gewicht er das ganze St. Christophorus fühlen ließ, war dies das große Thema seines Lebens.
Die Zeichen, das Entziffern der Zeichen … Um was für Zeichen ging es denn? Was sollte ihre Entschlüsselung ans Licht bringen? Wenn ich auf diese Frage antworten könnte – mein ganzes Leben würde sich ändern, und nicht nur mein Leben, sondern (ich getraue mich’s nur zu schreiben im sicheren Wissen, dass nie jemand diese Zeilen liest) – sondern sogar der Lauf der Geschichte. Nestor hatte zweifellos nur einige Schritte in diesem Sinne getan, aber mein einziger Ehrgeiz ist gerade, in seine Fußstapfen zu treten und vielleicht, dank der längeren Zeit, die mir beschieden ist, und dank der Inspiration, die von seinem Schatten ausgeht, ein wenig weiter zu kommen als er.
20. Januar 1938. Das Ich ist zähflüssig: Man bringt mir eine gute, eine sehr gute Nachricht; vor Freude bin ich ganz beschwingt. Bald danach wird die Nachricht widerrufen. Nichts, absolut nichts bleibt übrig. Und doch! In einer seltsamen Remanenzerscheinung hat die Freude, die mich überkam und die sich wieder verzogen hat, eine glückliche Stelle hinterlassen, so wie das Meer beim Zurückweichen klare Pfützen hinterlässt, in denen sich der Himmel spiegelt. In mir ist einer, der es noch nicht begriffen hat, dass die gute Nachricht falsch war, und der unsinnigerweise weiterjubiliert.
Als Rachel mich verließ, nahm ich es leichten Herzens hin. Übrigens beurteile ich noch immer den Bruch mit ihr als unwichtig und unter einem gewissen Gesichtspunkt sogar als gut für mich, weil ich der Überzeugung bin, dass er die Bahn öffnet für große Veränderungen, für große Dinge. Es gibt jedoch ein anderes Ich, das zähe Ich. Das hatte zuerst von dieser Trennungsgeschichte gar nichts begriffen. Es begreift übrigens nie etwas auf Anhieb. Es ist ein gewichtiges, nachtragendes, von seinen Säften abhängiges Ich, stets tränenüberströmt und samenbenetzt und schwerfällig an seine Gewohnheiten, an seine Vergangenheit gebunden. Es brauchte Wochen, um zu begreifen, dass Rachel nicht wiederkommen würde. Jetzt erst hat es das begriffen. Und weint. Ich trage es am Grunde meines Selbst wie eine Wunde, dieses naive, zärtliche Wesen; es ist ein wenig schwerhörig, ein wenig kurzsichtig, es lässt sich so leicht täuschen, ist so langsam, wenn es gilt, sich vor dem Unglück zusammenzunehmen. Und dieses Wesen ist es sicherlich, das mich auf den eiskalten Korridoren der St.-Christophorus-Schule nach der Spur eines kleinen, trostlosen Schattens suchen lässt, der erdrückt wird von der Feindseligkeit aller und mehr noch von der Freundschaft eines einzigen. Als könnte ich zwanzig Jahre später sein Leid auf meine Mannesschultern nehmen und ihn das Lachen lehren, das Lachen!
25. Januar 1938. Die St.-Christophorus-Schule in Beauvais befindet sich in den Gebäuden der ehemaligen Zisterzienserabtei gleichen Namens, die 1152 gegründet und 1785 aufgelöst wurde. Aus dem Mittelalter sind nur noch die Gewölbe der restaurierten Abteikirche vorhanden; der wesentliche Teil der Schule ist in dem riesigen Abtsbau untergebracht, der von Jean Aubert im 18. Jahrhundert errichtet wurde. Diese Einzelheiten sind von Bedeutung, denn die Atmosphäre von Strenge und Kargheit, der wir ausgesetzt waren, hatte zweifellos der Herkunft dieser Mauern und ihrer Geschichte einiges zu verdanken. Nirgends war diese Atmosphäre fühlbarer als im Kreuzgang, dessen mittelmäßige Architektur nicht weiter als bis ins 17. Jahrhundert zurückreichte und der den Internatsschülern am Morgen vor der Ankunft der Externen und am Abend nach deren Fortgehen als Aufenthalt während der Freizeit diente. Wir hatten nur zu den Wandelgängen Zutritt und durften auch nur über die Brüstung hinweg den kleinen Garten bewundern, den er umschloss, sorgfältig gepflegt von Vater Nestor, mit Sykomoren bepflanzt, die sommers ein meergrünes Licht verbreiteten, im Mittelpunkt mit einer schartigen Schale geschmückt, in der ein Farnbüschel dahinkümmerte. Die Traurigkeit, die von diesem Ort ausging, wurde durch die hohen Mauern ringsum noch lastender; man atmete sie förmlich ein.
Wenn die Externen fort waren, die unsere lebendige Verbindung zur Außenwelt darstellten, fanden wir uns also zweimal täglich in diesem grünen Gefängnis zusammen, das wir unter uns das Aquarium nannten. Lärmendes Spielen und Fangen waren dort verboten, und überdies hätte die Stimmung des Ortes ausgereicht, jede derartige Anwandlung zu ersticken. Immerhin durften wir dort nach Belieben auf und ab gehen und miteinander sprechen, und so stellte das Aquarium – noch mehr als die Kapelle, das Refektorium oder die Schlafräume – den normalen Versammlungsort der Internatsschüler, den Sammelpunkt dieser hundertfünfzig Kinder dar, die man einem zurückgezogenen, abgeschlossenen Leben unterwarf. Nestor war dort nur selten zu sehen, ebenso wie er nach meiner Beobachtung am Abend im Refektorium nicht bei uns war. Dennoch war er nicht etwa abwesend – nein, bewahre! –, seine beiden Faktota Champdavoine und Lutigneaux übernahmen es, seine Botschaften und Befehle zu überbringen. Es handelte sich gewöhnlich um eine Art indirekter Einflussnahme, zu der einerseits das in St. Christophorus geltende, recht subtile System von Strafen und Strafbefreiungen Anlass gab, andererseits auch die okkulte Macht, die Nestor in dieser Domäne der Erwachsenen ausübte. Die Strafenskala von St. Christophorus kannte ich gut, weil ich sie unaufhörlich von einem Ende zum anderen durchlief. Es gab das Peloton, eine lange Reihe von Schülern, die verurteilt waren, eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, eine Stunde oder länger schweigend in der Pausenhalle im Kreis herumzugehen, dann den Sequester, der dem Bestraften verbot, das Wort an irgendjemanden zu richten, es sei denn, dass er die Frage eines Lehrers oder einer Aufsichtsperson beantworten musste, das Erectum, das einen dazu zwang, im Refektorium allein an einem Tischchen – und zwar stehend – zu essen. Doch hätte ich tausendmal jede beliebige dieser kleinen Quälereien ertragen, hätte ich nie mehr in Verbindung mit meinem Namen die schauerliche Formel hören müssen, die mir Angst und Demütigung ankündigte: »Tiffauges ad colaphum!«, denn man musste dann das Klassenzimmer verlassen und zwei Stockwerke höher durch einen verlassenen Flur gehen, um schließlich am Vorzimmer des Disziplinarpräfekten anzuklopfen. Dort kniete man sich auf einen Betschemel, der seinen Platz kurioserweise inmitten des Raumes gegenüber der Tür des Büros hatte, und nun musste man mit einem Glöckchen schellen, das in Reichweite auf dem Boden stand. Ein Betschemel, das Knien, ein Glöckchen, das hell ertönt – ich kann heute nicht umhin, in diesem Bestrafungsritus eine satanische Parodie des Wandlungsrituals der Messe zu sehen. Denn ad colaphum ging man ganz gewiss nicht, um einen Akt der Anbetung zu vollbringen. Nach Ertönen des Glöckchens konnte die Wartezeit schwanken zwischen einigen Sekunden und einer Stunde, und darin bestand die unerträglichste Abgefeimtheit dieses Strafvollzugs. Jedenfalls ging früher oder später die Bürotür im Sturm auf, unter zornigem Rauschen der Soutane tauchte der Präfekt auf und hielt einen Entlassschein in der Linken. Er stürzte sich auf den Betschemel, bedachte den Schuldigen mit einer vollen Tracht Ohrfeigen, schob ihm die Quittung, dass er seine Strafe verbüßt habe, in die Hand und verschwand im gleichen Atemzug wieder. Ein System von Strafbefreiungen, von Exemptionen, ermöglichte es, diesen verschiedenen Züchtigungen nach einem mit kasuistischen Finessen ausgeklügelten Einmaleins zu entgehen. Die Exemptionen waren kleine, je nach Wert weiße, blaue, rosarote oder grüne Kärtchen, die als Entlohnung für sehr gute Noten oder für die besten Klassenarbeiten ausgegeben wurden. So wussten wir, dass nach der Meinung der guten Patres sechs Stunden Peloton den gleichen Wert hatten wie ein Tag Sequester, wie zwei Tage Erectum oder wie ein Colaphus, und dass sie abgegolten werden konnten durch einen ersten Platz bei einer Klassenarbeit, durch zwei zweite Plätze, durch drei dritte Plätze oder durch vier Noten über sechzehn Punkten. Doch zog es der bestrafte Schüler häufig vor, die Strafe auf sich zu nehmen und seine Exemptionen zu behalten, denn diese boten auch die Möglichkeit, einen »kleinen Ausgang« (am Sonntagnachmittag) oder einen »großen Ausgang« (den ganzen Sonntag) damit zu erkaufen.
Trotzdem blieb das System fast immer theoretisch und sozusagen lahmgelegt, denn entgegen dem Geist der Gemeinschaft der Heiligen und im Widerspruch zur Übertragbarkeit ihrer Verdienste hatten die guten Patres bestimmt, dass jede Exemption streng an die Person gebunden sein solle – die Nummer des Begünstigten stand auf dem Kärtchen – und nur dem zugutekommen dürfe, der sie sich verdient hatte. Doch gerade diejenigen, welche am meisten davon einheimsten – die guten Schüler, die großen Könner im Aufsatz, die Lieblinge der Lehrer und der Aufsichtführenden –, die bedurften ihrer am wenigsten, denn gleichzeitig schien eine sonderbar schützende Hand Peloton, Sequester, Erectum und Colaphus von ihrem Haupt abzuwenden. Nestors ganzes Genie war notwendig, um dieser Unvollkommenheit abzuhelfen.
2. Februar 1938. Den ganzen Tag habe ich unaufhörlich ein Gummibändchen um meine Finger auf- und abgewickelt. Morgen werde ich zu kämpfen haben, um ohne diese seltsame, falsche Berührung auszukommen, die – freilich lästiger und weniger symbolträchtig – der eines Eherings ähnelt. Dieses Gummibändchen – es war wie eine kleine Hand, die sich in die meine krampfte und die sich zusammenzog und sachte ziepte, wenn man sie loszureißen suchte.
8. Februar 1938. Manchmal muss man in der tiefsten Hölle angelangt sein, um am Ende doch einen Hoffnungsschimmer aus dem schwarzen Himmel hervorbrechen zu sehen. Der Colaphus war es, der mir erstmals jene erstaunlich beschirmende Hilfe offenbarte, die mir zuteilwerden sollte und die sich noch immer über mich breitet.
Ein Tumult war in der Ecke der Klasse, wo ich hockte, entstanden. Ich kann nicht mehr sagen, inwieweit ich wirklich daran beteiligt war. Jedenfalls war vom Podest herab das schreckliche Urteil über mich gefallen: »Tiffauges ad colaphum!«, und ein Schauer von Schadenfreude, wie er eine derartige Bestrafung stets begleitete, überlief die Bankreihen. Wie in bösem Traum stand ich auf und ging durch die trübe, aus dem verhaltenen Atem von vierzig Kehlen aufsteigende Stille zur Tür. Wir hatten Dezember, in einem Winter, der nie zu enden schien; ich war noch immer angeschlagen von meinen Händeln mit Pelsenaire, der mich seit meiner Entlassung aus der Krankenstation nicht mehr zu sehen schien. Feuchtes Dämmerlicht erfüllte den Schulhof; durch das schwarze Gitterwerk der Kastanien gewahrte man darauf links die verlassene Pausenhalle und im Hintergrund das Pissoir, das ungeniert dastand wie der dampfende Altar der Jungenhaftigkeit. Zerstreut kickte ich einen liegengebliebenen Ball gegen den Bordstein der Pausenhalle. Schwarze Schülerkittel, die an zahnlückigen Kleiderrechen hingen, glichen im Halbdunkel einer Familie von Fledermäusen. In mir stieg wie eine lautlose Klage der Widerwille gegen das Leben auf. Ein geheimer Aufschrei, ein ersticktes Geheul drang aus meinem Herzen und ging über in das Beben der starren Dinge. Ein übermächtiger Sturm riss uns – die Dinge und mich – dem Nichts entgegen, trieb uns mit wütenden Stößen, unter denen ich die Schultern zusammenkrümmte, kopfüber dem Tod zu. Ich setzte mich hin, die Füße im Rinnstein, und schlang die Arme um meine Knie: Wenigstens diese beiden kahlen und buckligen Zwillingspuppen mit ihren viereckigen Köpfen, die ein Stück von mir waren, zumindest die hatte mir die Einsamkeit noch gelassen. Ich fuhr mit den Lippen über eine schwarze Kruste, eine kleine Erhöhung inmitten des Rautennetzes der Haut, die stellenweise schmutzig, anderswo pulverig und trocken war. Erleichtert fand ich den Geruch geschlagenen Feuersteins wieder, der mir so vertraut war. Ich begriff, dass ich ziemlich unsanft am tiefsten Grund meiner Hölle angelangt sei, so unsanft, dass ich noch ganz betäubt war, als ich die Armsündertreppe hinaufstieg. Das Vorzimmer des Disziplinarpräfekten lag in Halbdunkel getaucht. Ich hütete mich wohl, Licht zu machen. Vom Betschemel aus sah man deutlich auf der weißen Wand ein Gemälde in kräftigen Farben, Christus, dornengekrönt in Schmach und Schande, wie ihm ein Kriegsknecht einen Backenstreich gibt. Ich war noch zu unkundig im Lesen von Zeichen – dem großen Thema meines Lebens –, dass ich nicht an den Vergleich dachte, der sich aufdrängte. Heute weiß ich: So abstoßend ein menschliches Gesicht auch sein mag – wenn es geohrfeigt wird, so wird es sogleich zum Antlitz Jesu.
Eine Glocke ertönte von weit her. Der Fußboden knarrte. Ein Lichtstreifen drang unter der Tür des Präfekten hindurch. Ich duckte mich auf dem Betschemel zusammen und hielt den Atem an. Die Minuten verrannen, ohne dass ich mich entschließen konnte, ad colaphum zu schellen. Wo war denn die Schelle? Ich tastete im Dunkel nach dem Boden. Bald streiften meine Finger den geschweiften, hölzernen Stiel, der oben auf dem kupfernen Röckchen dieses schweren, tückischen Gegenstandes saß. Ich hob ihn langsam auf und holte ihn zu mir her – mit einer Vorsicht, als handelte es sich um eine schlafende Viper. Sicherer fühlte ich mich erst, als meine Finger den Klöppel fest umschlossen hielten. Er war aus Blei, und seine Oberfläche war gehämmert, glatt wie ein Leib, und trug oben und unten einen kleinen Wulst nach innen. Das verriet, dass er schon lange Jahre seinen Dienst getan hatte, und ich träumte von unzähligen Colaphi, die diese Schelle auf Kindergesichter hatte regnen lassen, als sie mir plötzlich entglitt, von der gepolsterten Armlehne des Betschemels nochmals hochsprang und dann mit Donnergetöse auf den Fußboden rollte. Sogleich öffnete sich die Tür des Büros, und Licht flutete in den Raum. Versteinert schloss ich in Erwartung des Schlages die Augen.
Doch kein Schlag kam, eine Liebkosung vielmehr, etwas Sanftes, Seidiges, das mir mit raschelndem Geräusch über die Wange strich. Schließlich wagte ich aufzuschauen. Champdavoine stand da, wie üblich grinsend und sich verrenkend, und streckte mir ein Papierchen entgegen, mit dem er mir die Wange gestreichelt hatte. Dann trat er zurück, deutete eine clownhafte Verbeugung an und verschwand in der weit offenen Tür des Büros. Gleich darauf kam sein Kopf nochmals zu einer letzten Grimasse zum Vorschein, und die Tür schloss sich wieder.
Ich blickte auf das Papier, das er mir gegeben hatte: Es war ein Entlassschein, ordnungsgemäß vom Präfekten unterzeichnet.
Als ich wieder in meine Klasse zurückging, dröhnte mir der Kopf stärker, als wenn ich einen doppelten Colaphus hinter mir hätte. Aber ich hatte natürlich nichts von alledem begriffen, und ich war weit davon entfernt, zu ahnen, dass ich soeben Zeuge einer ersten Rissbildung in dem monolithischen Block des Schicksals geworden war, das mich niederdrückte. Von diesem denkwürdigen Tag an hätte ich aufhören dürfen, es als unentrinnbare, a priori feindselige Verstrickung zu betrachten, hätte erkennen können – wie ich es seitdem erkennen musste –, dass das Schicksal mit meiner kleinen, persönlichen Geschichte gewissermaßen unter einer Decke steckt – kurz, dass in den Lauf der Welt ein Quäntchen Tiffauges einfließen kann.
Doch die Colaphus-Geschichte war nur ein Vorzeichen. Es dauerte noch lange, bis das Ereignis eintrat, das meine Stellung in St. Christophorus verändern und eine neue Ära meines Lebens eröffnen sollte.
Am Palmsonntag waren die Internatsschüler der Tradition entsprechend unterwegs auf einer »Landpartie«; diese sollte durch ein Picknick noch vergnüglicher gestaltet werden und das Ende der Winterzeit anzeigen. Ich verabscheute jegliche Verpflichtung, die mich nötigte, die Mauern von St. Christophorus zu verlassen, wo mein Elend sich wenigstens mit so etwas wie Wärme in sich zusammenrollen konnte; dieses Herumrennen aber war mir vor allem anderen verhasst. Wir wurden zu diesem Anlass in zwei Gruppen aufgeteilt. Die Besitzer eines Fahrrades bildeten – wie einst die Reiter im Heer – eine mit Neid betrachtete Elite, die unter der Führung eines jungen Leviten auf einem Motorfahrrad für ein weiter entferntes Ausflugsziel ausersehen war. Ich für meinen Teil gehörte zum lumpigen Fußvolk, das mit schweren Schuhen, von einer Meute verdrießlicher Aufsichtspersonen gepiesackt, Kilometer um Kilometer zurücklegte.
Eben gellte der Pfiff zum Abmarsch, als ein Ereignis eintrat, das in der ganzen Schule Sensation machte. Lutigneaux erschien. Er schob ein blinkendes Fahrrad, Nestors Fahrrad. Es war ein Rad der Marke Alkyon von granatroter Farbe, mit jonquillegelbem Netz und einem Rennlenker aus verchromtem Stahl, der links mit einem hübschen Rückspiegel, rechts mit einer dicken Zweitonklingel versehen war. Außerdem hatte es Halbballon-Weißwandreifen und hinten einen Gepäckträger, an dem ein Rückstrahler prangte; schließlich war es – damals etwas fast Unbekanntes – mit einer Dreigangschaltung ausgerüstet.
Wir warteten alle darauf, dass Lutigneaux sich in die Gruppe der Radfahrer einreihe. Nichts von alledem. Er überquerte den ganzen Hof, auf dessen Pflaster das Fahrrad tänzelte wie ein nervöses Pferd, und ging auf mich zu, der ich im Fußvolk verloren dastand. Und er übergab mir das Fahrrad mit den schlichten Worten:
»Von Nestor, für den Ausflug.«
Meine Überraschung war nicht geringer als die der ganzen Schule; man traute mir sogleich eine ungewöhnliche Verstellungskunst zu, denn es schien ja offensichtlich, dass eine lange, enge Freundschaft vorausgegangen sein und für einen so ungeheuerlichen Gunsterweis den Boden bereitet haben musste. Diese Szene mag vielleicht recht nichtssagend erscheinen; sie wäre sicherlich einem Zeugen entgangen, dem das untergründige Leben von St. Christophorus unbekannt war. Ich freilich kann mir diese Szene beinah ein Vierteljahrhundert später noch nicht in Erinnerung rufen, ohne vor Freude und Stolz zu erbeben.
Die ganze folgende Woche schien Nestor mich nicht zu beachten. Inzwischen kannte ich die Gepflogenheiten gut genug, um zu wissen, dass ich mich bei ihm nicht bedanken durfte. Doch am darauffolgenden Samstag kam Lutigneaux nachmittags, als die Externen fort waren, in der großen Fünf-Uhr-Pause zu mir und teilte mir mit, ich würde an einen anderen Platz gesetzt und er helfe mir beim Umzug.
Selbstverständlich wurden die Plätze der Schüler vom Disziplinarpräfekten souverän bestimmt, und dieser bemühte sich nach Kräften, ihre Wünsche zu durchkreuzen, sei es, indem er Freunde auseinandersetzte, sei es, indem er die Plätze in den ersten Reihen den Schlusslichtern und den Träumern anwies, die nur darauf aus waren, im Hintergrund des Klassenzimmers fröhlich im Verborgenen dahinzuleben. Nestor allein konnte ungestraft diese Ordnung umstürzen und seinen Willen an die Stelle der Willkür des Disziplinarpräfekten setzen. Er selbst hatte seinen Platz in der linken hinteren Ecke des Klassenzimmers in der Nähe eines Fensters. Um ständig den Hof im Auge behalten zu können, hatte er sogar seine Bank mit kleinen Holzkeilen erhöht und eine der Mattglasscheiben, mit denen die Fenster aller Klassenzimmer versehen waren, durch eine Scheibe aus gewöhnlichem Glas ersetzt. Nach einer Anordnung, die nur auf ihn zurückgehen konnte, sollte ich nun künftig einen Platz in derselben linken Ecke erhalten, neben ihm, und zwar zu seiner Rechten. Nach dem Eklat mit dem Fahrrad setzte dieser Umzug niemanden mehr in Erstaunen; alle hatten darauf gewartet, die Lehrer und die Aufsichtspersonen wie die Schüler.
Von da an war mein Leben in St. Christophorus von einem ebenso unauffälligen wie wirksamen Schutz umgeben. Keine Woche verging, ohne dass ich in meinem Spind irgendeine Leckerei fand; der Hagel der Bestrafungen schien von meinem Haupt abgewendet; wenn ein Großer mir übel mitgespielt hatte, kam er am nächsten Morgen geheimnisvollerweise bös zugerichtet daher. Doch all das bedeutete wenig im Vergleich zu der Ausstrahlung Nestors, in deren Kraftfeld ich in allen Unterrichts- und Übungsstunden saß. Unter dem Druck seiner ungeheuren Masse schien das ganze Zimmer in dem Winkel hinten, wo sie sich breitmachte, nachzugeben. Für mich lag dort der wirkliche Brennpunkt der ganzen Klasse, jedenfalls viel mehr als auf dem Podest, von wo aus lächerliche Leute, die bald wieder verschwanden, nacheinander auf uns einredeten.
12. Februar 1938. Eine Kundin kommt zu mir mit einem kleinen Mädchen von fünf bis sechs Jahren. Beim Gehen fährt sie das Kind unwirsch an, weil es mir die linke Hand geben will. Mir fällt plötzlich auf, dass die meisten Kinder unter sieben Jahren – das Alter, in dem sie »vernünftig« werden! – tatsächlich dem, dem sie die Hand geben wollen, spontan die linke Hand entgegenstrecken. Sancta Simplicitas! In ihrer Unschuld wissen sie, dass die rechte Hand von den widerlichsten Berührungen besudelt ist, dass sie tagtäglich in die Hand von Mördern, Priestern, Polizisten und Mächtigen schlüpft, wie eine Hure ins Bett der Reichen, während die linke, die sinistre, obskure, totgeschwiegene im Schatten bleibt, wie eine Vestalin, die sich rein erhält für ausschließlich schwesterliche Umarmungen. Diese Lehre darf ich nicht vergessen. In Zukunft will ich Kindern unter sieben Jahren stets die linke Hand reichen.
16. Februar 1938