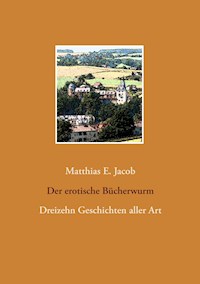
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Gab es Pornografie auf Burg Mylau? Und wissen Sie, was ein Kindermauser ist? Oder wer der einzige Besitzer eines amerikanischen Strassenkreuzers in der DDR war? Kennen Sie den ideologischen Unterschied zwischen Punktuhr und Strichuhr? Oder den östlichsten Piratensender der Welt? Hier erfahren Sie es! In 13 Geschichten erzählt der Autor aus seiner Kindheit in der sächsischen Provinz. Der Leser erfährt etwas von den Freuden und Nöten, den Vorlieben und Ängsten der Menschen in einer vogtländischen Kleinstadt während der 60er Jahre. Ostalgie? Ganz bestimmt nicht. Eher die augenzwinkernde Feststellung: Schön war’s- gut, dass es vorbei ist. In den Geschichten des Autors kristallisieren sich Erfahrungen, wie sie so oder ähnlich typisch sind für eine Kindheit in der DDR. Das Ganze wird erzählt mit einer gehörigen Portion Ironie. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind übrigens nicht völlig ausgeschlossen. Mit 14 Illustrationen
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 73
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zweite, durchgesehene, überarbeitete und bebilderte Auflage.
Wer einen Fehler findet, darf ihn behalten.
Inhalt
Reissmann gegen Wüstenschiff
Der Geruch der Häuser
Punktuhr und Strichuhr
Der gespielte Witz
Dr. S. und der Schlick
Der Kinderdieb
Wir marschieren nach Smolensk!
Knusper-knusper-knäuschen... Eine Mylauer Kriminal- und Sittengeschichte
Freibadgeschichten
oder
Wie wir das King erfanden.
Ein rabenschwarzer Tag
Der östlichste Piratensender der Welt
Der wilde Zahnarzt
Der erotische Bücherwurm
Reissmann gegen Wüstenschiff
Die kleine Stadt Mylau verdankt ihre Lage- wenn man so will- festungstechnischen Überlegungen und der Abneigung der Menschen gegen schlechtes Wetter. Zuerst errichteten böhmische Ritter eine Kaiserpfalz auf dem gut zu verteidigenden Bergsporn über Göltzsch und Seifenbach, danach fanden die einfachen Leute, dass das Tal zu Füssen der Burg recht windgeschützt liegt und man da gut Hütten bauen kann. Auch gab es Bäche, so konnte man Wolle waschen und färben und sich der Abfälle leicht und sicher entledigen. Wer aber von Greiz herauf kam oder von Elsterberg über Netzschkau herüber nach Westsachsen wollte, der musste durchs stille Tal der Mylaner. Also wurden Strassen gebaut und später Eisenbahnen geplant. Letztere sollte von Reichenbach kommend weiter durch das Tal der Göltzsch nach Greiz fahren. Der damals regierende Fürst von Greiz-Schleiz-Lobenstein muss aber ein Ahnvater heutiger Naturschützer gewesen sein - er widersetzte sich dem Bau der Bahntrasse. So kam es, dass Mylau mit kaum 8000 Einwohnern nun der Endpunkt zweier Eisenbahnlinien war und über zwei Bahnhöfe verfügte: einen richtigen, einen für den Gütertransport und darüber hinaus über einen Haltepunkt, da sich die Bahn auch noch nach Lengenfeld verzweigte. Das Tal dorthin war ebenso schützenswert wie das des thüringer Regenten, unterstand aber dem sächsischen König. Der interessierte sich weniger für den Naturschutz in seinen entfernten Liegenschaften, hatte er doch im fernen Dresden jede Menge schöner Landschaft. So wurde das Göltzschtal von Mylau nach Lengenfeld von einer Eisenbahntrasse durchquert- von der man heute kaum noch etwas bemerkt. Die Greizer jedoch mussten sich etwas einfallen lassen, wollten sie göltzschaufwärts nach Mylau oder Netzschkau und von dort weiter mit der Reichsbahn. So kam „der Greizer“ ins Leben der Mylaner.
Wenn die Mylauer in den Jahren des ideologisch korrekten „Ismus“ mit dem Bus in die benachbarte Kreisstadt Reichenbach reisen wollten, dann hatten Sie die Wahl, mit den Bussen des VEB Kraftverkehr zu fahren (mancher nannte den auch „Staatsbus“) oder eben mit dem „Greizer“. Diese Busse unterschieden sich zu aller Erst in der Farbe von ihren staatlichen Konkurrenten. Die Greizer waren in Blau/Grau gehalten, die VEB-Busse waren meist Hellbeige. In den 50ern waren beim staatlichen Kraftverkehr noch VOMAG-Fahrzeuge im Einsatz, also VOgtländische Maschinenbau AG-Busse. Das waren dreiachsige Ungetüme mit langem Vorbaumotor, die sich wegen ihrer Höhe in Kurven bedenklich zur Seite neigten. So kamen sie zu ihrem Spitznamen: Wüstenschiff. Der Staatsbus war also ein schaukelndes gelbes Wüstenschiff.
Der Greizer war zu dieser Zeit ein kleines rundliches Etwas, ein Minibus, eine Art VW-Käfer für 30 Leute, in dem der Fahrer keine eigene Kabine hatte, sondern wie ein Fahrgast auf einem Einzelsitz in der ersten Reihe sass und kaum über das Lenkrad sehen konnte. Primus inter pares sozusagen. Diesen kleinen Bus erkannte man schon am Klang- das hochfrequente Quäken eines Benziners gegenüber dem Dieselgebrumm des Staatskamels.
Aber noch etwas unterschied den Greizer von seinen volkseigenen Kollegen: Die Busse dieser Linie gehörten der Firma Reissmann, waren mithin Privatbesitz. Das war schon etwas Besonderes, auch wenn es im Fahrpreis keinen Unterschied gab. Einmal Mylau-Reichenbach kostete 35 Pfennige, man sparte dadurch einen Fussweg von fast einer Stunde.
Konkurrierte man schon nicht über den Preis, so gab es dennoch subtile Methoden, um den Fahrgast zu kämpfen. In Mylau nämlich liefen die Linien parallel, der Staatsbus fuhr nach Reichenbach ebenso wie sein privater Kollege aus Greiz. Da kam es nun darauf an, wer als erster an der Haltestelle vorfuhr. Häufig kam es vor, dass der VEB Kraftverkehr schon hoffnungslos überfüllt ankam. Dann war man in Gefahr, nicht mehr mitgenommen zu werden. Oder man stand eingezwängt zwischen all den lieben schwitzenden Mitbürgern. Doch schon nahte die grau-blaue private Konkurrenz von hinten und die Schaffnerin winkte den Reisenden, doch bei der Firma Reissmann Platz zu nehmen.
Dann setzten sich beide Fuhrwerke schnaufend und knatternd in Bewegung und der sportliche Teil des Wettbewerbs nahm seinen Lauf. War der „VEB“ voll besetzt und zog möglicherweise noch einen Hänger, dann hatte der „Greizer“ gute Chancen, gleich nach dem Anfahren zu überholen. Dieser Vorgang dauerte mehrere hundert Meter und wurde von triumphierenden Blicken aus dem einen in den anderen Wagen begleitet. Gelang dieser Coup nicht gleich, so hatte der hinten liegende Wagen eine zweite Chance: die Klinckhardtstrasse, die steile Rampe hinauf nach Reichenbach. Hier musste der Angreifer gleich aus der Kurve am E-Werk heraus ansetzen und den richtigen Gang wählen, dann hatte er eine Chance, seinen Mitbewerber zu schlagen. Und so rasten sie dann die Steilstrecke hinan, der eine mit 20 km/h, der andere mit 22 ½ km/h. Spätestens an der Textilfachschule musste das Rennen entschieden sein.
Später beschaffte sich auch die Fa. Reissmann grössere und modernere Busse und das Wüstenschiff wurde nach einer schweren Havarie, bei der es den Motor im Fahren verlor, verschrottet. Statt seiner gab es nun Busse mit Namen Ikarus, benannt nach dem jungen Mann, der mit schlichten Mitteln hoch flog und schnell abstürzte. Die Bahnlinien, die Mylau mit der Welt verbanden, wurden abgerissen. Nur die alte Kaiserpfalz steht heute wie vor 1000 Jahren über der Stadt und grüsst den dahineilenden Automobilisten.
Das Postamt
Der Geruch der Häuser
Unsere kleine Stadt Mylau liegt zwischen sieben Hügeln, die irgendwie alle ineinander übergehen. So könnte man auch sagen, dass das Städtchen in einem Tal liegt, was aber in mehrfacher Hinsicht auch nicht stimmt. Zum einen sind es zwei Täler, nämlich die der beiden kleinen Flüsse, an deren Zusammenfluss Mylau liegt, zum anderen ist die Stadt die Hänge hinan gewachsen. Vor allem die Wohnhäuser wurden in den guten Zeiten des Wohlstands immer höher hinauf gebaut und man kann es dem Baustil ansehen- die modernsten entstanden in den 1920ern und stehen ganz oben. Am interessantesten sind vier Häuser am Südrand der Stadt, die die Leute „Typ Feiler-Häuser“ nennen. Als ich klein war, verstand ich nur „Tippfeilerhäuser“, fragte nicht weiter nach und wusste auch so, dass es da einen Schneider gab, der kleinen Jungs ein Schulanfangsgewand anmessen konnte.
Später wurde mir klar, dass es sich um Typ-Häuser des Architekten Feiler handelte. Der hatte seine Vorbilder offenbar bei den Bauhaus-Architekten gefunden: die Häuser sind kubisch und haben flache Dächer. Die Wohnungen dürften eher klein gewesen sein, denn der besagte Schneider suchte sich eine grössere Wohnung, als seine beiden Mädchen älter wurden.
Am Hang gegenüber, hin zur bäuerlichen Seite der kleinen Stadt, gibt es ebenfalls Häuser aus den Zeiten der schlimmen Wirtschaftskrise. Drei Doppelhäuser waren nach dem Weltkrieg entstanden, den man zu ihrer Bauzeit noch nicht mit Nummer aussprach, weil man nicht wissen konnte, dass er der erste von zweien in diesem Jahrhundert sein würde. In einer der Wohnungen lebten meine Grosseltern seit dem Ende der 1920er Jahre. Sie wollten sich diesen kleinen Luxus leisten - Wohnung mit Badezimmer und eigener Toilette, letztere trotzdem noch „auf der halben Treppe“ und ohne Wasserspülung. Diese Art von Klosetts prägte die Geruchslandschaft meiner Kindheit entscheidend, konnte man doch die Häuser der Verwandten mit verbundenen Augen am Geruch erkennen. Der kam zu aller Erst aus den Trockenklosetts, mischte sich mit dem kühlen Hauch aus modrigen Kellern, in denen Kartoffeln und Kohlen lagerten (auch Briketts haben einen Geruch!) und bekam seine Kopfnote zuletzt aus den Wohnungen mit Küchendunst und Ofenqualm.
Das Haus der Grosseltern hatte eine Strassenseite mit grosser Haustür. Ging man dort hinein, so lag zuerst eine Treppe vor einem - man kennt die Bauart von den Bürgerhäusern der Gründerzeit in grösseren Städten. Benutzte man aber den Hintereingang, den so genannten Dienstboteneingang, dann hatte man auf dem Weg dahin, wegen der Hanglage des Hauses, schon etwas Treppensteigen gespart. Ausserdem war es interessanter, den Hintereingang zu benutzen. Da kam man an einer Wiese vorbei, an den Kräuterbeeten der Hausfrauen, am Waschhaus und an den Kaninchenställen des Nachbarn. Man konnte auch ziemlich sicher sein, dass man jemanden Gleichaltrigen traf und ein Spiel verabreden konnte.
Zur Hintertür hinein gelangte man also ins Haus. Die Grosseltern wohnten Mitteletage. An der Wohnungstür prangte ein Briefschlitz aus Messing, dessen Pflege der Oma trotz erheblichen SIDOL-Einsatzes nicht geringe Mühe machte. Dahinter kam man in einen kleinen Vorraum, der wegen seiner Enge kaum die Bezeichnung Raum verdiente, von allen Leuten aber (und nicht nur in dieser Wohnung) Vorsaal genannt wurde. Als ich einmal ein Mädchen aus einer anderen Gegend kennen lernte und im Gespräch über unsere Wohnung den Vorsaal erwähnte, da meinte das Mädchen, sie sei einem Sohn aus fürstlichen Verhältnissen begegnet: Man hatte da einen Saal vor allen anderen Gemächern!





























