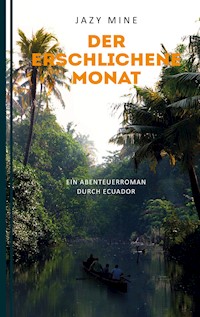
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ein Schweizer Banker im Amazonas
- Sprache: Deutsch
Hätte jemand Leonel vor ein paar Monaten vorausgesagt, dass er bald im Amazonas in der Hütte eines Schamanen sitzen würde, hätte er nur ungläubig gelacht. Und jetzt sitzt er hier, über ihm erstreckt sich ein undurchdringliches, dunkelgrünes Blätterdach, und die rauchdurchzogene Atmosphäre des schamanischen Rituals trägt dazu bei, dass Leonel denkt: Wie seltsam können doch die Fügungen des Schicksals sein. Lange hatte er nur davon geträumt, aus seiner Routine auszubrechen. Als sein Arbeitgeber ihn zu einem Sprachkurs nach Ecuador schickt, erfüllt sich sein Wunsch nach Abenteuern bereits am ersten Tag. Im ecuadorianischen Provinzstädtchen Ambato lernt er eine Gruppe von Strassengauklern kennen - und findet sich unverhofft bei gelegentlichen Auftritten der Truppe wieder. Als seine neuen Freunde ihn bitten, einen kranken Verwandten zu einem bei der indigenen Bevölkerung berühmten Schamanen zu begleiten, ist sein kleinzürcherisches Leben plötzlich weit weg. Auf der Reise begegnet Leonel immer wieder besonderen Menschen, die seine Sicht auf die Welt für immer verändern. Dies hat auch Auswirkungen auf seine bevorstehende Rückkehr in die Schweiz, wo ihn sein altes Leben zurückerwartet. Doch kann er die Menschen und die Erfahrungen, die er in Ecuador gemacht hat, einfach hinter sich lassen? Der erschlichene Monat ist eine Reise ins ferne Irgendwo, wo manches fremd und oft bizarr erscheint. Eine Flucht nach vorn und zu sich selbst. Aber kein New-Age-Roman und auch kein Selbstfindungstrip, sondern Abenteuerroman und Roadmovie eines Rucksackreisenden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 302
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Carmen
Inhalt
1.
Kapitel Leonel
2.
Kapitel Die Gaukler
3.
Kapitel Boton
4.
Kapitel Ecuadors Oriente
5.
Kapitel Die Fahrt von Puyo nach Ayamu
6.
Kapitel Der Schamane
7.
Kapitel Junior
8.
Kapitel Diego
9.
Kapitel Marco
10.
Kapitel Sieben Monate später
11.
Kapitel Leonel
Danksagung
Über die Autorin
1. Kapitel
Leonel
Leonel konnte es kaum fassen: Endlich sass er im Flugzeug. Unter ihm tauchte Zürich auf, wurde rasch kleiner und verschwand schon bald ganz aus seinem Blickfeld. So schnell, wie die Stadt verschwand, fragte er sich, ob die unter ihm auftauchenden Städte überhaupt noch die Schweiz waren oder nicht doch bereits Frankreich.
Das schnelle Überfliegen der kleinen Schweiz versinnbildlichte Leonels derzeitiges Gefühl. Die Schweiz war ihm gewissermassen zu eng geworden. Eine Auszeit, weg von der Arbeit und vor allem von seinem Zuhause, das war es, wovon er seit zwei Jahren geträumt hatte. Endlich konnte er seinen Traum wahr werden lassen und sah drei Monaten in Ecuador entgegen.
Er konnte es selbst nicht erklären, weshalb er sich so ausgelaugt fühlte und wie er sich so weit von dem hatte entfernen können, was er sich damals nach seinen Ausbildungsjahren erträumt hatte. Damals hatte er sich vorgestellt, wie er mit Ende zwanzig eine Hängemattenbar an einem Seeufer betreiben würde. Die Bar würde über einen grossen Garten verfügen, am liebsten mit direktem Seeanstoss. Seine Gäste wären Musiker, Intellektuelle oder Weltverbesserer. Bestimmt keine Banker, so wie er nun einer geworden war.
In seinem Alltag hatte er eine fortwährende innere Unruhe gespürt. Er hatte begonnen, sich zu fragen, ob das schon alles im Leben sei. Weshalb fühlte er sich an manchen Tagen, als liefen seine Motoren nur auf halber Leistung? Lag es an seinem Job? Oder doch an Eveline, die ihm häufig das Gefühl gab, auf dem falschen Weg zu sein?
Aber nun, als er auf die Wolkengebilde hinuntersah, da klopfte sein Herz aufgeregt und er fühlte sich befreit und – ja, glücklich. Allein, endlich allein! Er lachte laut. Für seinen Nachbarn musste es sich wie ein Schluchzen angehört haben, denn dieser fragte in einem mitfühlenden Tonfall, ob er Angst vor dem Fliegen habe. Leonel lächelte ihn an. »Nein, überhaupt nicht. Ausserdem sagen die Statistiken, dass man in einem abstürzenden Flugzeug die besten Chancen auf einen sicheren Tod hat und nicht, wie bei einem Autounfall, verkrüppelt zurückbleibt.«
Der Mann sah ihn verdutzt an. »Nun ja, wer will schon von Statistiken hören, wenn man in einem Flugzeug sitzt? Ich heisse übrigens Ruben und fliege diese Strecke mindestens einmal im Jahr. Meistens wird es erst über dem Pazifik etwas holperig, aber die Swissair ist ja gemäss Statistik eines der am besten gewarteten Flugzeuge der Welt. Also mach dir keine Sorgen. Fliegst du zum ersten Mal nach Quito?«
Ruben hatte ein sympathisches Gesicht, seine lange Nase passte gut zu seinem dünnen Kinnbärtchen. Leonel schätze ihn auf Mitte vierzig.
»Ja, es ist meine erste Reise nach Südamerika. Ich heisse Leonel.« Die beiden Männer schüttelten sich die Hände. Ruben musterte ihn interessiert und versuchte wohl, ihn einzuschätzen. Leonel kannte das schon: Bei der Arbeit passierte ihm das ständig. Er war bei einer Grossbank angestellt und dort galt die Hemd- und Krawattenpflicht. Im Anzug sah er so angepasst aus, dass seine langen schwarzen Haare, die er immer zum Pferdeschwanz zusammengebunden trug, gar nicht zu passen schienen. Doch seine langen Haare gehörten fest zu seinem Erscheinungsbild, und er wollte es beibehalten, auch wenn sein Vorgesetzter ab und zu eine Bemerkung fallen liess. Leonels Unmut gegen die ungeschriebenen Gesetze der zürcherischen Schicklichkeit war nur ein weiteres Zeichen, dass noch etwas anderes in ihm längst nach Freiheit rief.
»Freut mich, Leonel. Was bringt dich nach Quito?«
Der Flug dauerte fast zwölf Stunden und Leonel hatte – erst noch zögernd, als ob es ihm peinlich wäre, sein belangloses Leben einem Fremden gegenüber darzulegen – aufgrund der interessierten Fragen von Ruben viel von sich erzählt. Normalerweise war er nicht der Typ, der seine privaten Angelegenheiten offenlegte. Er erzählte, dass er sich für drei Monate an einer Sprachenschule in Quito eingeschrieben hatte, von seinen beruflichen Aussichten und auch von familiären Momenten. Er beschrieb, wie er und Eveline sich im letzten Schuljahr kennengelernt hatten. Sie waren in derselben Gruppe im 80-Meter-Sprint eingeteilt, und Eveline war als einzige Frau in ihrer Sechsergruppe als Erste durchs Ziel gegangen. Das hatte ihn beeindruckt.
»Wir verliebten uns heftig. Die ersten Jahre waren so aufregend. Neben unserer Ausbildung trieben wir sehr viel Sport, hatten einen grossen Freundeskreis und waren ständig auf Achse. Wir hatten uns immer etwas zu erzählen oder zu bereden. Nach fünf Jahren zogen wir in unsere erste gemeinsame Wohnung. Es war toll! Ich weiss noch, dass ich mich plötzlich so erwachsen fühlte, und ich glaubte, endlich würde das wahre Leben beginnen.« Er hatte die Geschichte schon lange nicht mehr erzählt, sodass ihm nun, während des Erzählens, mehrmals kleine Details in den Sinn kamen, die er längst vergessen geglaubt hatte.
»Das Allerschönste waren die gemeinsamen Urlaube. Ich bin wohl reisesüchtig! Weisst du, mein Vater war Diplomat, und alle vier Jahre wurde er an eine andere Botschaft versetzt. Ich kam erst mit sechzehn zur Matura in die Schweiz. Im Gegensatz zu mir war Eveline mit ihren Eltern nur einmal in Norditalien im Urlaub gewesen. Mit mir lernte sie sprichwörtlich die Welt kennen. Zuerst bereisten wir die Länder, in denen ich schon gelebt hatte. Bulgarien, Vietnam, Kanada und Italien. Ich genoss es, ihr all die Orte zu zeigen, die meine Jugend ausgemacht hatten. Ehemalige Schulen, Sportplätze, beliebte Eisdielen oder schöne Strände.« Er lächelte träumerisch, doch dann seufzte er. »Bei unserer Reise durch Italien passte es zwischen mir und Eveline nicht mehr. Es war offensichtlich, dass sich unsere Interessen verschoben hatten. Wenn ich von den kulturellen Schönheiten von Florenz schwärmte, interessierte sie sich nur für die Einkaufsmeile. Schlug ich einen Abstecher zum Strand vor, wollte sie einen preisgekrönten Friseur aufsuchen. Nach diesem Urlaub waren wir einige Monate angespannt und stritten öfters. Doch die tägliche Routine begradigte es wieder und wir machten einfach weiter. Die nächsten Urlaube führten uns in neue Länder und Eveline übernahm die komplette Planung – und ich liess es einfach geschehen.« Er zuckte mit den Schultern.
»Kürzlich hörte ich sie zu einer Freundin sagen, dass wir eine harmonische Beziehung führen.« Er kratzte sich hinter einem Ohr. »Ich hätte das nicht so ausgedrückt. Ich würde unsere Beziehung eher als eingeschlafen bezeichnen. Versteh mich nicht falsch, Eveline ist ein grossartiger Mensch. Sie ist charakterstark und hat so ein ungebremstes Urvertrauen in sich selbst – da kann ich oft nicht mehr mithalten. Und sie dominiert mich!«, entfuhr es ihm heftiger als beabsichtigt. Die Heftigkeit überraschte ihn selbst und er hielt beschämt inne. Er war es nicht gewohnt, dass tief verborgene Geheimnisse so schnell ans Licht kamen, und er begann, unsichtbaren Dreck unter seinen Fingernägeln zu entfernen.
Als seine Nägel in Ordnung waren, hatte er sich wieder gefasst. »Weisst du, seit einigen Monaten drängt sie darauf, eine Eigentumswohnung zu kaufen. Mein Gott, wir sind noch keine dreissig, und sie plant schon, wo wir unser restliches Leben verbringen werden?« Ungläubig schüttelte er den Kopf. »Ein paar Wochen vor meiner Abreise erfuhr ich, dass ihre Eltern uns eine finanzielle Starthilfe geben würden, sobald wir verheiratet wären! Glaub mir, das hat mich ganz schön ernüchtert. Da sprachen wir von einer Eigentumswohnung, und plötzlich stand eine Heirat an – ganz ohne Antrag? Das war mir zu viel, und eines Abends stellte ich sie zur Rede. Wir stritten heftig, und in diesem Hin und Her von Erwartungen und Anschuldigungen eröffnete mir Eveline dann auch noch, dass sie seit ein paar Monaten die Pille abgesetzt hatte. In diesem Augenblick ging in mir etwas zu Bruch. Ich kann es nicht erklären, was es war – auf jeden Fall fühlte ich mich von ihr hintergangen.« Er schaute zu Ruben, um an seinem Gesichtsausdruck abzulesen, was er dachte.
Ruben hatte mit wachem Blick zugehört und nickte mitfühlend. »Ich denke, mit Abstand wirst du auch wieder klarer sehen und herausfinden, was das Richtige für dich ist. Weg von der Alltagsroutine, sich auf andere Menschen einlassen, eine fremde Sprache lernen – das gibt neue Impulse! Mit den drei Monaten Sprachenschule machst du das genau richtig«, motivierte er ihn.
Leonel lächelte verschmitzt. »Ehrlich gesagt werde ich nur zwei Monate Sprachurlaub machen. Meine Firma bezahlt mir vier Stunden Unterricht pro Tag. Ich habe jedoch mit der Schule vereinbart, dass ich jeden Tag sechs Lektionen nehmen werde, was mir einen freien Monat beschert. Und da kann ich dann machen, was ich will.« Er zwinkerte. »Nun habe ich auch ein Geheimnis. Weder Eveline noch meine Firma wissen davon.« Er spürte, wie ihm die Hitze ins Gesicht kroch, verlegen senkte er den Kopf. Aber es fühlte sich gut an, es jemandem erzählt zu haben.
Ruben schaute ihn überrascht an und klatschte in die Hände. »Ein erschlichener Monat!«, entfuhr es ihm. »Das gefällt mir, Mann! Einen Monat im Leben, wo keiner weiss, wo du bist und was du tust. Das hört sich einfach abenteuerlich an und hat irgendwie etwas Grenzenloses Was würde ich darum geben, wenn ich noch mal jung wäre und einen Monat nur zur freien Verfügung hätte!« Die beiden Männer hingen einen Moment ihren Gedanken nach.
Rubens Augen erhellten sich in Erinnerung. »Es gab eine Zeit in meinem Leben, da hatte ich das durchaus. Ich kam in den Fünfzigerjahren auf die Welt, und als ich mit knapp zwanzig zum ersten Mal selber Backpacken ging, da wehte ein neuer Wind. Ich schloss mich an den Stränden von Indien Hippies an. Ich will ehrlich sein – da habe ich meine Grenzen ausgetestet. Was für schöne Zeiten das waren!« Sein Blick wurde wehmütig und er nahm einen kräftigen Schluck Rotwein. »Ich sag’s dir geradeheraus, Leonel. Ich beneide dich um deinen freien Monat, und die Idee daran rührt mein Herz. Wenn ich du wäre, würde ich es auch weiterhin niemandem erzählen. Es würde mich nicht wundern, wenn du nachher genau weisst, wie dein Leben weitergehen soll. Lass dir von niemandem vorschreiben, was richtig ist oder falsch.«
Kurz vor der Landung gab Ruben ihm seine Kontaktdaten. Er bat ihn, unbedingt mit ihm in Kontakt zu bleiben. »Ich würde sehr gerne wissen, wie es dir in Ecuador gefällt. Und falls du einmal Hilfe brauchst, melde dich bei mir.«
Bei der Gepäckausgabe umarmten sich die zwei wie alte Freunde. Leonel bemerkte, wie Rubens Augen feucht glänzten. Auch er hatte plötzlich einen Kloss im Hals.
2. Kapitel
Die Gaukler
Leonel hatte in den vergangenen zwei Monaten fleissig Spanisch gelernt und konnte sich inzwischen fliessend verständigen. Die Sprache war einfach für ihn zu erlernen, da er bereits fliessend Italienisch sprach und die Grammatikregeln im Spanischen sehr ähnlich waren. Ausserdem bereitete ihm das Lernen keine Mühe, und die sechs Stunden Unterricht pro Tag waren schnell vergangen. Sein Lehrer Jorge war ein junger Literaturstudent, der sein eigenes Studium mit dem Sprachunterricht finanzierte.
Während dieser Zeit hatte Leonel sich neben Jorge auch mit Takahiko, einem anderen Sprachschüler, der aus Osaka stammte, angefreundet. Taka, wie er von allen genannt wurde, war für ein ganzes Jahr an der Sprachenschule eingeschrieben.
Es war Freitagnachmittag, Leonels letzter Schultag. In aufgeräumter Stimmung sass er mit den anderen Studenten an einem breiten Holztisch im schuleigenen Patio. Die Sonne hatte sich bereits hinter die hohen Berge, die Quito einsäumten, geschoben. Leonel hatte Bier und Chips besorgt und wollte in kleiner Runde seinen Abschied feiern.
Er amüsierte sich über die eine oder andere Geschichte, die ein Student erzählte. Aber die meisten Lacher hatte ungeschlagen Taka, den das Pech zu verfolgen schien wie die Schleimspur eine Schnecke. Leonel liebte es, wenn Taka von seinen Pechsträhnen erzählte. Taka bekam dann einen verwandelten Gesichtsausdruck und erzählte, als ob die Peinlichkeit nicht ihm, sondern einem entfernten Verwandten widerfahren wäre.
An diesem Nachmittag lachte die Gruppe wieder einmal über die Episode, die Taka gleich zu Beginn seines Sprachaufenthaltes passiert war. Sein Spanisch war zu der Zeit noch sehr dürftig gewesen, aber er hatte beschlossen, am Wochenende einen Ausflug auf den »Panecillo« zu unternehmen. Er erzählte seinem Lehrer davon, und dieser riet ihm von dem Ausflug ab, denn es war bekannt und auch in jedem Reiseführer vermerkt, dass eine Wanderung auf den »Panecillo« gefährlich war und man mit Überfällen rechnen musste. Der Lehrer empfahl ihm, gemeinsam mit ein paar anderen Studenten ein Taxi zu teilen und auf den Aussichtsberg zu fahren und das Taxi oben warten zu lassen. Doch Taka blieb uneinsichtig und beschloss, den Rat in den Wind zu schlagen. Als erfahrener Bergsteiger empfand er den Aufstieg als nicht anspruchsvoll und wollte den direkten Weg durch mässig besiedeltes Gebiet nehmen. Auf einer Karte zeigte er dem Lehrer sein Vorhaben. Von der am nächsten gelegenen Bushaltestelle bog ein Weg ab zu dem in 50 Minuten erreichbaren Aussichtspunkt. Das Geld für ein Taxi wollte er sich sparen. Der Lehrer erklärte ihm noch einmal die Gefährlichkeit seines Vorhabens aufgrund von Überfällen, doch Taka liess es sich nicht ausreden. Auf heftiges Insistieren des Lehrers versprach er schlussendlich einzig, keine Wertsachen mitzunehmen.
Am darauffolgenden Montag kam Taka mit einem beschämten Gesichtsausdruck zum Unterricht, und der Lehrer vermutete gleich das Schlimmste. Er musste nur die Augenbrauen heben und Taka neugierig anschauen, da erzählte dieser peinlich berührt, dass er tatsächlich ausgeraubt worden war. Der Lehrer stöhnte und Taka erzählte mit gesenktem Blick, wie er am Sonntagmorgen bereits um sieben Uhr losgegangen und kurz vor acht bei der Statue angekommen war.
Den Rat des Lehrers noch in den Ohren, hatte er Kamera und Handy zu Hause gelassen und konnte somit auch kein Foto schiessen. Er erzählte, wie er mental alles gespeichert und die frühe Ruhe genossen hatte. Erst war er noch ganz allein auf dem Berg und hatte sich an der fantastischen Aussicht erfreut. Als gegen zehn immer mehr Taxis auftauchten, machte er sich auf den Rückweg. Er nahm denselben Weg zurück und kam fast bis zur Hälfte, als plötzlich ein paar Jugendliche auf ihn zukamen und ihn um Kaugummis und Zigaretten baten. Da er nichts dabeihatte, verneinte er und neigte, wie es sich für einen gebildeten Japaner gehörte, entschuldigend den Kopf. Er wollte seinen Weg fortsetzen, doch die Jugendlichen blockierten in lässiger Aufstellung den Fussweg. Taka versuchte, keine Panik erkennen zu lassen, und machte ein freundliches Gesicht. Mit einem Lächeln wollte er sich an ihnen vorbeischieben.
Er wusste nicht, woher die Männer kamen, aber plötzlich waren sie hinter ihm und mit ihnen war auch der Rückweg abgeschnitten. Es war ein halbes Dutzend Männer. Erst waren sie durchaus freundlich und ein Mann aus der Gruppe begann ein Gespräch. Er wollte wissen, was er in Quito mache, woher er sei, was er so früh auf dem Panecillo gewollt habe und so weiter.
Takas Herz klopfte vor schierer Angst, er liess sich aber auf das Gespräch ein – was blieb ihm auch anderes übrig? Standen doch vor ihm die Jugendlichen und hinter ihm die Männer. Nach allen Seiten war der Weg versperrt.
Nachdem er alles in seinem gebrochenen Spanisch beantwortet hatte, fragte der Anführer hämisch: »Wie schaut es aus, Chinese, hast du ein Geschenk für meine Neffen?« Er zeigte mit seiner Hand ausladend auf die Jugendlichen.
»Nein«, stammelte Taka, »ich habe nichts dabei.« Zum Beweis stülpte er seine Hosentaschen nach aussen.
»Einzig dieses Kleingeld, das ich für die Busfahrt zurück brauche.« Um es zu verdeutlichen, klimperte er mit den Münzen in der Hand und zeigte dann den Betrag mit geöffneter Hand.
Der Anführer schaute ihn lange an, versuchte offenbar, die Wahrheit von seinen Augen abzulesen, gleichzeitig starrten ihn auch alle anderen an. Taka wagte kaum noch zu atmen und krümmte sich unter ihren Blicken, am liebsten wäre er einfach losgerannt. Doch er sah ein, dass dies zwecklos war.
Der Anführer hatte seine Befragung noch nicht abgeschlossen und fragte: »Hast du denn nicht gewusst, dass man nicht zu Fuss auf den Panecillo soll, weil man hier Gefahr läuft, überfallen zu werden?« Dabei zog er seine Augenbrauen hoch und sah Taka an wie ein Schuldirektor einen Schüler, der seine Hausaufgaben nicht gemacht hatte.
Taka wusste nicht mehr, was er antworten sollte. Er verneigte sich ungeschickt, sagte mehrmals »Gracias« und schob seine Arme gegen die Menschenmauer, um durchgelassen zu werden. Da riss ihn einer der Männer an der Schulter zurück und er warf ihn rückwärts auf den Boden. Taka wagte es nicht, aufzustehen, und wartete einfach ab, was nun kommen würde. Er fühlte sich wie ein Lamm auf dem Weg zum Schlachthof (das spanische Wort »Matadero« für Schlachthof kannten nachher alle Studenten). Der Anführer baute sich wieder vor Taka auf.
»Du glaubst aber nicht wirklich, dass du hier wegkommst, ohne meine Neffen zu beschenken, hä?«, brüllte er plötzlich aggressiv und nannte ihn einen »tremendo tonto«, einen kompletten Idioten. Taka lag immer noch auf dem Boden und wagte nicht, sich zu bewegen. Der Anführer stand mächtig über ihm, streckte seinen Finger aus und zeigte auf ihn herunter. »Dein T-Shirt, los, ausziehen! Das passt meinem Lieblingsneffen perfekt.«
Taka stand zögerlich auf, zog sich das T-Shirt über den Kopf und übergab trotz zitternden Knien dem Jugendlichen sein T-Shirt mit einer Verneigung. Die »Neffen« johlten und der Junge zog das neue Shirt gleich über sein altes an, hob kurz siegessicher die Arme in die Luft und zeigte Taka den Mittelfinger.
Dann wies der Anführer auf einen anderen Jugendlichen und meinte: »Der bekommt zu Hause zu wenig zu essen, er braucht dringend einen Gürtel, damit ihm die Hose nicht mehr runterrutscht.« Taka zog seinen Gürtel aus und gab ihn her. Wieder johlten die Jugendlichen und Taka war schon der Verzweiflung nahe, aber es sollte wohl noch nicht genug sein. Wieder zeigte der Anführer auf den Nächsten. »Was denkst du, Chinese? Deine Schuhe sollten doch diesem Neffen passen? Zieh mal aus und lass sehen.«
Taka zog gehorsam seine Schuhe aus und stellte sie ordentlich vor die Füsse des nächsten »Neffen«. Dieser schleuderte rasch seine zerschlissenen Turnschuhe von seinen Füssen, und tatsächlich, Takas Turnschuhe passten perfekt. Wieder brachen alle in lautes Gejohle aus und Taka verneigte sich erneut. Er konnte es nicht lassen!
Da stand er nun, nur noch mit Socken und einer Jeans bekleidet, aber es war ihm längst klar, dass es noch nicht vorbei war, denn es gab immer noch Jugendliche, die noch kein Geschenk bekommen hatten. Taka musste auch nicht lange warten. Schon zeigte der Anführer auf den Nächsten, den Kleinsten der Jugendlichen, der bestimmt noch keine zehn Jahre alt war. Er nahm die Socken und zog sie sofort über. Dann waren die Jeans an der Reihe, auch diese wurden sofort angezogen und nun stand Taka nur noch in einer blauen Unterhose bekleidet da.
Der Anführer schien zu überlegen, verlangte daraufhin das Kleingeld, das Taka immer noch in der Hand hielt. Er übergab es dem zweitletzten Jugendlichen. Der stierte das wenige Geld an und schmiss es beleidigt in den Gully. Dem Anführer schien diese trotzige Geste nicht zu gefallen – er schaute ihn ärgerlich an, worauf der Jugendliche den Kopf senkte und einen Schritt zur Seite trat.
Der Anführer seufzte und hob die Schultern, dann schaute er den letzten Jugendlichen an und wies stumm mit einem Kopfnicken in Richtung Takas Unterhose. Der Jugendliche schüttelte angewidert den Kopf und der Anführer drehte sich zu Taka um und meinte: »Heute scheint dein Glückstag zu sein. Obwohl mein Neffe«, er deutete mit dem Finger auf den Jungen, der die Unterhose nicht wollte, »ebenfalls ein Recht auf ein Geschenk hat, will er anscheinend keine blauen Unterhosen.«
Mit einer Mischung aus Abscheu und Spott schaute er Taka an. Dann hob er unvermittelt die Hand und die Menschenansammlung teilte sich augenblicklich. Taka machte einen zitternden Schritt darauf zu, worauf der Anführer noch einmal seine Hand auf Takas Schulter legte. »Vergiss nicht, Chinese! Wenn du das nächste Mal kommst, hast du für alle Neffen ein Geschenk dabei. Beim nächsten Mal sind wir nicht mehr so nett und lassen dich mit einer Unterhose bekleidet ziehen. Das nächste Mal ziehen wir dir die Unterhose aus und schneiden dir auch noch deinen Pimmel ab.« Dabei lachte er widerlich und er verneigte sich vor Taka. Darauf begannen alle anderen zu grölen und verschwanden rückwärtsgehend und sich dabei verneigend und immerzu »gracias« rufend in den umliegenden Häusern, bis sich Taka zitternd alleine auf dem schmalen Weg befand.
Niemand war zu sehen, keiner schaute aus den umliegenden Häusern oder half ihm. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als den Weg weiterzugehen, und da er nicht einmal mehr Geld für den Bus hatte, lief er so lange nur mit einer Unterhose bekleidet die Strassen entlang, bis sich ein Taxifahrer seiner erbarmte und ihn zu seiner Unterkunft fuhr.
Obwohl die Studenten Takas Geschichte zum wiederholten Mal gehört hatten, lachten alle vergnügt. Leonel beobachtete eine neue Studentin aus Italien, die mit aufgerissenen Augen und einer Gänsehaut auf den Armen Takas Erzählung lauschte. Er schaute zu Taka, dem die Geschichte offenbar nicht mehr so peinlich war wie noch vor zwei Monaten. In dieser Zeit hatten Taka und er Freundschaft geschlossen und manchen Abend gemeinsam beim Essen oder in einer Billardbar verbracht.
Leonel, der nun seinen freien Monat vor sich hatte und die Abenteuer auf sich zukommen lassen wollte, freute sich auf den nächsten Tag. Er und Taka hatten beschlossen, Ambato, eine Kleinstadt südlich von Quito, zu besichtigen. Takas Lehrer kam ursprünglich von dort und hatte ihm erzählt, dass am Wochenende das berühmte Blumenfestival stattfinden würde, und das wollten sich Leonel und Taka ansehen.
Taka wollte am Sonntagnachmittag zurück nach Quito fahren, um dort weiter Spanisch zu lernen, Leonel hingegen wusste noch nicht, wohin er reisen wollte. Er wollte sich einfach treiben lassen. Seine Firma und Eveline wussten noch immer nichts von seinen Plänen. In den vergangenen zwei Monaten hatte er sich alle vier oder fünf Tage per SMS und E-Mail bei ihr gemeldet und einmal hatten sie auch telefoniert. Er wollte das auch im kommenden Monat so machen, den Unterschied würde Eveline nicht bemerken.
Am nächsten Tag trafen sich Taka und Leonel am Busterminal und bestiegen den nächsten Bus nach Ambato. Die Fahrt dauerte drei Stunden, und Leonel, der am Fenster sass, konnte sich an der abwechslungsreichen Landschaft kaum sattsehen. Im Vergleich zu den hohen Schweizer Bergen reihte sich die Andenkette nahtlos, ohne tiefe Täler, aneinander. Besonders eindrücklich war, dass man trotz der Höhe von über 3 000 Metern über dem Meer gigantische Weiten hatte. Breite Flächen von kultiviertem Acker zogen sich den Hängen entlang, was seine Beobachtung auf den Agrarmärkten bestätigte, dass Ecuadorianer Könner in der Landwirtschaft sein mussten.
In Ambato suchten sie sich ein Zimmer im Herzen der Stadt und machten sich dann auf den Weg, um etwas in den Magen zu bekommen. Auf der Strasse war nicht sehr viel los und sie vermuteten, dass die Parade erst nachmittags stattfinden würde. Sie wollten dann von der Plaza Mayor aus zusehen.
Sie schlenderten zu den Markthallen, wo es allerlei an Gemüse, Gewürzen und exotischen Früchten zu entdecken gab. Taka und Leonel waren aber insbesondere wegen der viel gepriesenen lokalen Spezialität gekommen. Leonel hatte in seinem Reiseführer gelesen, dass man in Ambato gegrillte Meerschweinchen aufgetischt bekam. Die beiden wollten das probieren und sahen es auch als eine Art Mutprobe an, ein Meerschweinchen zu essen.
Auf der linken Seite der Markthalle fanden sie die gesuchten Essstände. Es gab gut zwei Dutzend winzige Buden, und wohin man auch schaute, reihten sich die halbierten Fässer, worin die Kohle glühte. Darüber steckte an einem langen Spiess, der von den Hinterbeinen durch den Kopf führte, ein Meerschweinchen. Die Art, wie die Tiere präsentiert wurden, verdarb Leonel den Appetit auf die kleinen Nagetiere. Gehäutet und angeröstet erinnerte es ihn eher an eine Ratte als an ein putziges Meerschweinchen. Das Zurschaustellen der Tiere – mit abgespreizten Füsschen und dem aufgerissenen Maul, aus dem die Zähnchen entblösst wurden – empfand Leonel als ziemlich makaber. Taka schien es auch bemerkt zu haben. »Sieht aus, als ob sie uns angrinsen würden.« Leonel schauderte es leicht und er erwiderte: »Ich weiss nicht recht, ob ich das essen will!«
Sie sahen sich um, doch das fratzenhafte Aussehen der Nagetiere schien den lokalen Marktbesuchern nichts auszumachen. Hungrige Menschen schlenderten durch die hohen Hallen und es schlug ihnen der Geruch von gegrilltem Fleisch entgegen. Obwohl sich Leonel bereits gegen den Genuss eines Meerschweinchens entschieden hatte, gab sein Magen dem Fleischduft nach und begann plötzlich lautstark zu knurren. Verschämt hielt er sich den Magen und schaute zu Taka hinüber. Sein Freund sah immer noch mit fasziniertem Gesichtsausdruck auf die befremdlichen Spiesse, hockte sich dann aber kurz entschlossen auf einen Schemel und hielt zwei Finger in die Luft. Dabei klopfte er mit der anderen Hand auf den neben ihm stehenden Schemel. So entschlossen kannte Leonel Taka gar nicht und liess sich gehorsam auf dem Schemel neben ihm nieder.
»Na dann … wollen wir mal kosten, wie das schmeckt«, meinte Taka lachend und schaute sich um. Dabei wedelte er mit seinen Händen die vielen Fliegen weg, die um sie herumflogen.
Eine traditionell bekleidete Indigena bediente sie. Routiniert zog sie zwei der Spiesse hervor, blies kurz und kräftig in die Glut und legte die beiden Meerschweinchen mit dem Bauch nach unten auf den Rost. Nachdem sie sie kurz gewendet hatte und noch einmal richtig heiss werden liess, zog sie den Spiess in einem Schwung aus dem Tier, häufte Reis auf einen Teller, legte das komplette Meerschweinchen auf den Reisberg und reichte es Leonel über die Theke.
Ihn schauderte es. Das Tierchen starrte ihm direkt in die Augen und die kleinen Zähne sahen ziemlich unappetitlich aus. Er drehte den Teller, sodass er nun das Hinterteil vor sich hatte, und schaute zu Taka hinüber, um zu sehen, wie er vorging. Taka stach ohne mit der Wimper zu zucken das Messer in den Rücken des Tiers und riss ein Stückchen Fleisch vom Knochen ab. Fasziniert schaute Leonel, wie er es sich hungrig in den Mund schob und kräftig darauf herumkaute. Dann schaufelte er Reis hinterher und schon schnitt er wieder am Rücken des Tierchens herum. »Schmeckt es?«, wagte Leonel zu fragen. »Ja klar. Schmeckt wie Ratte!«, lachte Taka und schnitt schon das nächste Stück Fleisch ab. »Was ist, keinen Hunger mehr?« Leonel liess sein Besteck sinken, eben erinnerte er sich, dass seine Schwester früher einmal ein Meerschweinchen als Haustier gehabt hatte, wenn er sich richtig erinnerte, hatte es Pupi geheissen.
Er kratzte sich am Kopf, aber er wollte sich keine Blösse geben und sich später von Taka aufziehen lassen, weil er es nicht fertiggebracht hatte, die lokale Spezialität zu kosten. Tapfer schnitt er am Rücken ein winziges Stück Fleisch ab und schob es sich in den Mund. Taka, der sich soeben ein weiteres Stück Fleisch in den Mund geschoben hatte, hielt mit dem Kauen inne und sah Leonel erwartungsvoll an. »Wie?«, lachte er ihn aus. »Du solltest dich sehen, Mann! Du kaust mit den Vorderzähnen an einem Zipfelchen Fleisch, das dir bald aus dem Mund fällt, so ungeschickt, wie du dich anstellst. Was ist – traust du dich nicht?«
»Ich weiss nicht, an der Stelle, als du sagtest, es würde wie Ratte schmecken, habe ich ehrlich gesagt den Appetit verloren.«
»Ach, du meine Güte. Bist du heute eine Prinzessin?«, zog ihn Taka auf, »glaubst du ehrlich, ich wüsste, wie eine Ratte schmeckt? Aber im Ernst. Ich finde, es schmeckt wie Ente. Also ehrlich, so schlecht kann es ja nicht sein, wenn die Einheimischen extra dafür hierherkommen. Versuch es einfach mal. Hier schau, der Rücken ist zart!« Dabei neigte er sich zu Leonels Teller hinüber und begann Leonels Meerschweinchen zu zerlegen und Stücke abzuschneiden. Die Messer waren tatsächlich sehr stumpf und schlussendlich nahmen Taka und Leonel ihre Hände zur Hilfe und pulten das Fleisch mit den Fingern von den Knochen. Den Kopf schoben sie über den Tellerrand und Leonel schob auch die Füsschen hinterher, wohingegen Taka die Füsschen in den Mund nahm und das wenige Fleisch davon ablutschte. Es war beiden Männern anzusehen, dass sie ihren Spass hatten. Unterdessen hatten sich noch weitere Gäste an die Theke gesetzt und man unterhielt sich scherzend miteinander. Nachdem Taka siegessicher den ganzen Teller leer gegessen hatte, hielt einer der Gäste seinen Daumen hoch und zeigte dann auf Takas Lenden und zog dabei anzüglich die Augenbrauen hoch. Leonel übersetzte lachend, dass der Mann ihm eben mitgeteilt habe, dass Meerschweinchen als potenzfördernd gelten. Darauf kicherte auch die Bedienung und warf Taka schmachtende Blicke zu, was ihm die Schamröte ins Gesicht schiessen liess.
Sie bezahlten gut gelaunt und wollten zu der Blumenparade, wegen der sie schliesslich gekommen waren. Leonel befragte einen der Gäste und dieser schaute ihn mitleidig an. »Blumenparade? Nein, die findet nur einmal im Jahr statt. Immer im Februar. Heute ist normaler Markttag.« Damit wandte sich der Mann ab. Leonel zuckte die Schulter und nickte, auf Wiedersehen sagend in Richtung Bedienung. Sie beschlossen, trotzdem ins Zentrum zu gehen und sich bei der Plaza Mayor umzusehen.
Sie gingen die Hauptstrasse hinunter und schlenderten Richtung Zentrum. Vor einem Einkaufszentrum standen mehrere Jugendliche, die mit einem Holzblock, einer von schwarzer Schuhwichse eingefärbten Zahnbürste und einem weichen Lappen den Passanten die Schuhe polierten. Leider trugen Taka und Leonel beide Trekkingschuhe, die keiner Politur bedurften. Sie schauten aber einen Moment interessiert zu und Taka machte ein paar Fotos.
Sie umrundeten das Einkaufszentrum und kamen zur Plaza Mayor. Schon von Weitem sahen sie, wie sich in der Mitte des Platzes ein Kreis aus Menschen bildete. Sie gingen näher, um zu sehen, was los war. In der Mitte des Kreises standen drei Männer. Einer der Männer jonglierte gekonnt mit Bällen. Immer mehr Bälle nahm er hinzu, Leonel zählte sechs Bälle, die der Jongleur unglaublich schnell im Kreis fliegen liess. Ein zweiter Mann machte derweil einen Handstand und lief auf den Händen herum. Der dritte Strassenkünstler trug auffallend grüne Pluderhosen, und seinem entblössten Oberkörper war anzusehen, dass auch er einiges von Akrobatik verstand. Er hatte die Arme ausgebreitet und stand wie ein Zirkusdirektor in der Mitte der Arena und rief auffordernd an die Zuschauer gerichtet, näherzukommen. Er pries ihr Spektakel an, das jeden Moment beginnen werde. Leonel und Taka stellten sich neugierig in den Kreis. Der Ausrufer, ein dunkelhäutiger Typ mit Charakternase und wachen Augen, sah die zwei Neuzugänge sofort und kam augenblicklich auf sie zu. Er scheuchte mit wischenden Armbewegungen die vor Taka und Leonel stehenden Zuschauer beiseite, verneigte sich vor Taka und rief: »WELCOME Mister President!« Die Verbeugung war unterwürfig. Dann fegte er mit einem unsichtbaren Besen vor Takas Füssen, als ob er den Platz für ihn sauber machen wollte.
Leonels Blick fiel auf die dichten, kurz geschorenen Haare des Gauklers. Auf dem Hinterkopf hatte er zwei feine Wellen ausrasiert. Der Mann war drahtig und gut trainiert.
Beim Aufrichten rief er nochmals »WELCOME!«, wobei er das O stark in die Länge zog. Er drehte sich zu seinen Kollegen um und erklärte, mit grossen Gesten auf Taka zeigend: »Les presento, el presidente de China!« Die zwei anderen Gaukler kamen näher und neigten grüssend den Kopf. »Aaah! Un presidente importante. Bienvenido! Welcome!«, antwortete derjenige, der jongliert hatte. Taka lief zum zweiten Mal an diesem Tag rot an. Er legte sich seinen Finger auf die Nasenspitze und meinte mehrmals: »No, no! Soy de Japon!«, aber keiner der drei beachtete ihn.
Der Komiker mit der Charakternase drehte eine Pirouette und machte ein verzücktes Gesicht, zog dabei Taka in den Kreis und forderte die Zuschauer auf, zu applaudieren. Lauter Applaus schwoll an und die beiden anderen Gaukler wackelten dabei mit den Beinen wie Charlie Chaplin.
Taka sperrte sich und schaute hilfesuchend zu Leonel, aber dieser nickte nur zustimmend und bedeutete dem Gaukler mit einer Geste, sie sollten Taka mitnehmen und ihre Scherze mit ihm treiben.
Taka machte schlussendlich gute Miene zum lustigen Spiel, und obwohl er das meiste nicht verstand, was die Schauspieler mit ihm trieben, liess er es gutmütig über sich ergehen. Die Gaukler improvisierten ein kleines Theaterstück, in dem Taka den Präsidenten von China darstellte, der zu diesem Zeitpunkt zu Besuch in Ambato war. Die Akrobaten verlangten immer wieder Applaus für Taka. Das Publikum lachte Tränen, allen voran Leonel, der das Spektakel – und seinen Freund als Mr. President – geradezu fantastisch fand.
Als die Schausteller ihren Hut herumgehen liessen, legte Leonel eine 5-Dollar-Note hinein. Der grosse dunkelhäutige Typ bemerkte die grosszügige Bezahlung und kam auf Leonel zu, zog die 5-Dollar-Note aus dem Hut und zeigte auf Leonel. »Allmächtiger«, rief er zum Himmel gewandt, »schenke diesem Mann ein unendliches Leben! Sieh zu, dass es ihm nie an Essen fehlt! Finde für ihn eine hübsche Frau!« Er verschränkte die Arme und legte eine Hand ans Kinn, als müsse er besonders schwer nachdenken. Mit einem verschmitzten Gesicht rief er fragend an Leonel gewandt: »Willst du eine mit grossen Brüsten?« Das Publikum kreischte vor Freude und diesmal war es Leonel, der rot wurde.
»Dachte ich es mir, oh Allmächtiger«, rief der Gaukler und schaute in den Himmel. »Natürlich will er eine mit grossen Brüsten!« Er hob vier Finger in die Höhe und rief: »Schenke ihm vier Kinder!« Wieder grinste er in die Zuschauerrunde und senkte die Stimme, als ob er ein Geheimnis mit dem Publikum teilen wollte. »Für etwas sollen die grossen Brüste ja gut sein, nicht wahr, Sonnyboy?« Dabei klopfte er Leonel anerkennend auf die Schulter. Das Publikum lachte wieder aus vollem Halse, und ohne dass Leonel etwas erwidern konnte, hob der Gaukler erneut sein Gesicht zum Himmel und rief: »Gib ihm Gesundheit, Glück und einen guten Job! Amen!« Er hob den Geldschein gen Himmel, bekreuzigte sich damit und küsste abschliessend die 5-Dollar-Note. Die Zuschauer applaudierten, und Leonel stellte fest, dass das Publikum auf gut 300 Personen angewachsen war.
Der Gaukler liess dem Publikum Zeit, sich zu beruhigen, einen Arm hatte er immer noch um Leonels Schultern gelegt. Er strahlte in die Runde, hob seinen Zeigefinger zum Himmel, um vollständige Aufmerksamkeit zu bekommen, und das Publikum schaute gespannt zu ihnen hin.
Erneut blickte er zum Himmel hinauf und neigte den Kopf in der Art einer Pantomime, so als würde eine nur für ihn hörbare Stimme aus dem Himmel zu ihm sprechen. Er nickte ein paarmal mit dem Kopf und runzelte dann seine Stirn. Streng schaute er zu Leonel.
»ER hat allem zugestimmt, ER wird dir alles wie bestellt geben. Glück! Gesundheit! Einen guten Job! ABER!«, erneut hob er den Zeigfinger und horchte Richtung Himmel.
»Aber ER sagt, um eine Frau mit grossen Brüsten für dich zu finden, musst du nochmals 5 Dollar in den Hut legen!«
Das Publikum johlte und applaudierte laut und aller Augen waren auf Leonel gerichtet. Dieser lachte auch aus vollem Halse, nahm seine Geldbörse hervor und kramte eine weitere 5-Dollar-Note hervor, winkte damit gen Himmel und legte sie mit ausladender Geste in den Hut.
Die ganze Show dauerte zwei Stunden. Die Spässe waren raffinierter als jede Stand-up-Comedy, die Leonel in Zürich auf der Spektakel-Landiwiese oder im deutschen Fernsehen gesehen hatte. Aber was ihn am meisten beeindruckte: Es war hundertprozentig improvisiert.
Als die drei den Kreis schliesslich auflösten, waren sie merklich ausgepowert und hatten den Hut mehrmals im Kreis herumgehen lassen. Leonel fiel auf, dass etliche Zuschauer eine Stunde oder länger dagestanden hatten. Taka und er hatten zwei Stunden lang den Spassmachern zugesehen und gewissermassen nur 10 Dollar bezahlt.
Leonel dachte an das Zürcher Theater Spektakel. Dorthin kamen alljährlich Tausende von Besuchern, um den Gauklern zuzusehen. Beschämend erinnerte er sich, dass es viele Zuschauer gab, die den Gauklern lange zusahen, aber in dem Moment, wo der Hut herumging, sich davonschlichen – Frauen in Abendkleidern und Herren in Krawatten. Es stimmte ihn nachdenklich. Obwohl es den Schweizern finanziell so gut ging, waren sie verdammt kleinlich, wenn es darum ging, einem Künstler für seine Arbeit und die von ihm gebotene Unterhaltung etwas Geld zu geben.
Nachdem die drei Komiker die Show beendet hatten, schüttelten sie noch viele Hände, und auch Leonel und Taka reihten sich ein in die Gruppe derer, die mit den Künstlern noch ein paar Worte wechseln wollten. Als sie sich für die Show bedankt hatten, fragte der dunkle Typ: »Kommt ihr mit zum Essen? Wir sterben vor Hunger und da vorne gibt es das drei B.« Sein offenes Lachen wirkte ehrlich. »Ja, gerne«, meinte Leonel. Taka und er setzten ihre Rucksäcke auf und schlossen sich den Jungs an.





























