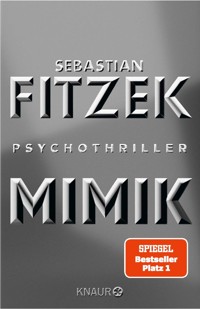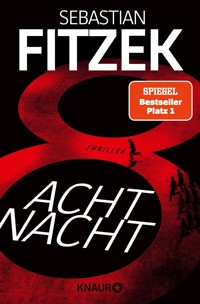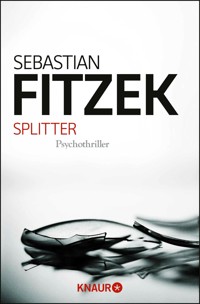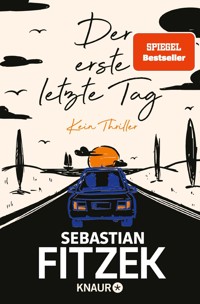
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ab 10 Euro
- Sprache: Deutsch
Was geschieht, wenn zwei Menschen einen Tag verbringen, als wäre es ihr letzter? Ein ungleiches Paar. Eine schicksalhafte Mitfahrgelegenheit. Ein Selbstversuch der besonderen Art. Livius Reimer macht sich auf den Weg von München nach Berlin, um seine Ehe zu retten. Als sein Flug gestrichen wird, muss er sich den einzig noch verfügbaren Mietwagen mit einer jungen Frau teilen, um die er sonst einen großen Bogen gemacht hätte. Zu schräg, zu laut, zu ungewöhnlich - mit ihrer unkonventionellen Sicht auf die Welt überfordert Lea von Armin Livius von der ersten Sekunde an. Bereits kurz nach der Abfahrt lässt Livius sich auf ein ungewöhnliches Gedankenexperiment von Lea ein – und weiß nicht, dass damit nicht nur ihr Roadtrip einen völlig neuen Verlauf nimmt, sondern sein ganzes Leben! Ein Roadtrip voller Komik, Dramatik und unvorhersehbarer Abzweigungen! Von Deutschlands Bestsellerautor Nr. 1 Sebastian Fitzek – mit zwei skurrilen, ans Herz gehenden Hauptfiguren, die unterschiedlicher nicht sein könnten. "Sebastian Fitzek ist in einem für ihn untypischen Literatur-Genre unterwegs – und macht dabei keine schlechte Figur. (...) Ein mit Leichtigkeit geschriebenes Werk voller Humor und Komik." Passauer Neue Presse "Spitzbübisch, ironisch und voll humoriger, aber tiefgründiger Dialoge." Belletristik-Couch
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 242
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Sebastian Fitzek
Der erste letzte Tag
Kein Thriller
Mit Illustrationen von Jörn Stollmann
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Livius Reimer macht sich auf den Weg von München nach Berlin, um seine Ehe zu retten. Als sein Flug gestrichen wird, muss er sich den einzig noch verfügbaren Mietwagen mit einer jungen Frau teilen, um die er sonst einen großen Bogen gemacht hätte. Zu schräg, zu laut, zu ungewöhnlich) – mit ihrer unkonventionellen Sicht auf die Welt überfordert Lea von Armin Livius von der ersten Sekunde an. Bereits kurz nach der Abfahrt lässt Livius sich auf ein ungewöhnliches Gedankenexperiment von Lea ein) – und weiß nicht, dass damit nicht nur ihr Roadtrip einen völlig neuen Verlauf nimmt, sondern sein ganzes Leben!
Inhaltsübersicht
Widmung
Motto
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
Nachwort
Für Linda
Aus Furcht, zu weit zu gehen, gehen wir oft nicht weit genug.
Reinhard K. Sprenger
1. Kapitel
Nehmen wir einmal an, die Welt wird nicht gerade von einer Pandemie gebeutelt, und Sie sitzen in einem Flugzeug, zehn Reihen hinter der Tragfläche, obwohl Sie extra um einen Platz ganz vorne gebeten haben (weil dort die Luft besser ist und es weniger wackelt). Immerhin hat Ihnen die Dame vom Check-in mit dem »Der nächste Trottel, bitte«-Blick den Fensterwunsch erfüllt, nachdem sie eine halbe Ewigkeit auf der Computertastatur rumtippte und Sie schon befürchteten, die Frau würde Ihnen am Ende nicht die Bordkarten, sondern den Leasingvertrag für den Airbus aushändigen … Nehmen wir also einmal an, Sie säßen jetzt in Reihe 33A, die Knie in den Vordersitz gedrückt, den rechten Arm vor der Brust eingeknickt, als wollten Sie beim Tennis eine Rückhand schlagen. Denn die Lehne neben Ihnen ist von einem XXL-Unterarm belegt, an dem ein Hundertzwanzig-Kilo-Mann mit Halbglatze hängt. Ihr Handy ist bereits ausgeschaltet, und Sie sind vorschriftsmäßig angeschnallt, obwohl der Flieger seine Parkposition noch nicht einmal verlassen hat: Tja, ich denke, Sie hätten gewiss einen schönen Blick auf den Kerl mit der Warnweste, der gerade auf dem Rollfeld bei dichtem Schneefall den Inhalt eines aufgeplatzten Koffers aufs Förderband kippt.
Ich zumindest sah genau dieses, und so erklärt sich auch mein Ausruf (»Scheiße«), der mir einen misstrauischen Blick meines Sitznachbarn einbrachte. Der aufgeplatzte Koffer war eindeutig meiner, wie ich unschwer an dem ockergrünen Bärchenpulli erkennen konnte, der gerade im Magen des Flugzeugs verschwand.
Meine Mutter hatte mir den Pullover zu Weihnachten geschenkt. Nein, sie war nicht farbenblind, und noch weniger wollte sie mir mit besonders hässlichen Weihnachtsgeschenken vor Augen führen, dass sie bei meiner Geburt lieber gestorben wäre, als mich die folgenden zweiunddreißig Jahre ihren Sohn zu nennen. Nein, Mama liebte mich. Sehr sogar. Nur hatte sie einen schrecklichen Geschmack, zumindest, wenn es um Mode ging. Einmal hatte ich die Probe aufs Exempel gemacht und bei einem Familientreffen mein Sakko in die Hose gesteckt, und sie hatte mir lediglich mit den Worten »mein hübscher Livius« über den Kopf gestreichelt; ein Kompliment, das ich, wie Sie spätestens jetzt verstehen werden, seit meinem achten Lebensjahr nicht mehr allzu ernst nehme. Genauer gesagt seit dem Tag, an dem sie mir schwor, niemand in der Klasse würde über meinen Mittelscheitel lachen, und es wäre ganz normal, wenn bei Sandalen vorne die Socken wie tote Hundezungen heraushängen.
Dass der Bärchenpulli jetzt ohne seine schützende Samsonite-Hülle vermutlich auf Nimmerwiedersehen im Bauch des Flugzeugs verschwand, war mir also gar nicht mal so unrecht. Was ich vom Verlust meiner übrigen Habseligkeiten allerdings nicht behaupten konnte: meiner weißen Oberhemden, der kaum benutzten Joggingschuhe, eines Ladekabels, des neuen Stephen King (1056 Seiten, die bald das Doppelte wiegen würden, wenn das Förderband noch länger im Schneeregen pausierte) und, last but not least, meines Fünfhundert-Euro-Anzugs. Den hatte ich mir nicht nur für meinen Termin bei dem Verlag gekauft, der mein erstes Buch unter Vertrag nehmen wollte, sondern auch für die »Wollen wir uns noch eine letzte Chance geben?«-Verabredung bei der Paarberatung mit meiner Frau Yvonne, die mich für einen Kollegen verlassen hatte. Doch wie es aussah, hatte der sich ausgerechnet kurz vor Weihnachten aus dem Staub gemacht, was vermutlich der Anlass ihres tränenerstickten Anrufs gewesen war, an dessen Ende wir verabredet hatten, es nach Weihnachten ein zweites Mal mit einer Eheberatung zu probieren. Unser erster Versuch hatte mit ihrem Auszug geendet.
Dass ich morgen bei unserem ersten Wiedersehen nach einem guten Vierteljahr ordentlich gekleidet sein würde, schien mir im Moment eher unwahrscheinlich. Meine Anzughose blähte sich gerade wie der Windschlauch einer Wetterstation. Mein innerer Kompass hingegen drehte von »Das darf doch nicht wahr sein« Richtung »Verdammt, ich muss was tun«.
Ich löste den Gurt und stemmte mich andeutungsweise aus dem Sitz. »Entschuldigung, dürfte ich mal bitte?«, fragte ich meinen Nebenmann, der gerade versuchte, sich in eine BILD-Zeitung zu wickeln. Vielleicht wollte er sie auch lesen, der Unterschied war nicht auszumachen.
»Hä?«
»Ich muss leider aufstehen.«
»Toiletten sind nicht.« Er schüttelte den Kopf und gab mir damit zweierlei zu verstehen: Erstens würde er sich vermutlich nie für meinen Volkshochschulkurs »Kreatives Schreiben« anmelden, den ich in meiner Freizeit gab. Und zweitens kam er wie ich aus Berlin. Es mochte irgendwo Städte geben, in denen die Einwohner noch unhöflicher zu Fremden waren, aber bislang hatte das Hubble-Teleskop sie noch nicht entdeckt.
»Erst nachem Start«, ergänzte er, und sein kotelettengerahmter Quadratkopf verschwand wieder hinter der Zeitungstapete.
»Nein, nein. Ich muss nicht aufs Klo«, wies ich ihn höflich auf das Missverständnis hin.
»Schön«, brummte er.
»Nein, ich meine, Sie verstehen nicht … ähhm …« Ich tippte von meiner Seite der Zeitungswand aus gegen eine Schlagzeile, die man selbst als Kurzsichtiger noch vom Weltall aus hätte entziffern können, und rief ein weiteres Highlight an Eloquenz meines Nachbarn hervor.
»Hä?«
»Es gibt Probleme mit meinem Koffer da unten.« Ich deutete auf die Szenerie auf dem Rollfeld, die sich zu meinem Entsetzen jäh verändert hatte. Kein Gepäckwagen mehr. Das Förderband fuhr zurück. Der Beladevorgang war abgeschlossen, der Westenmann auf dem Rückzug ins Warme.
»Wasislos?« Das Aushängeschild des Berliner Fremdenverkehrsamtes hatte sich tatsächlich dazu bequemt, meinem ungläubigen Blick durch das Fenster zu folgen. Leider verlagerte er dafür seinen Schwerpunkt eindeutig in meinen Strafraum.
»Was quatschen Sie denn da?«, fragte er, die Hälfte seines Körpers auf meinem geparkt. Sein Atem hüllte meinen Kopf in eine Atmosphäre aus Mett und Kaffee.
»Nicht mehr da«, stöhnte ich.
Der Mann wandte sich zu mir. Ich blieb starr, hielt die Luft an und presste die Lippen zusammen. Wir waren uns so nah, eine unbeabsichtigte Bewegung und ich würde ihn küssen.
»Hast du Hallus?«, fragte er mich, und ich hätte gerne geglaubt, dass damit das Eis zwischen uns gebrochen war, er aufstehen und mich vorbeilassen würde, doch ich hatte meine Zweifel. Und der Umstand, dass er wieder sein Zeitungszelt zwischen uns aufspannte, sprach auch nicht gerade dafür.
Da ich mit mitteleuropäischen Kommunikationsgepflogenheiten nicht weiterkam, borgte ich mir die Worte des Poliers, der mich während meines Studentenjobs auf dem Bau folgendermaßen subtil zur Eile gemahnt hatte: »Ich ramm dir gleich einen Schraubenzieher in den Arsch, wenn du nich sofort hinne machst.«
Der Beschimpfte sah mich genervt an, aber immerhin drehte er sich zu der älteren Dame neben ihm und gab ihr höflich zu verstehen, dass sie zuerst aufstehen müsse: »Schieb mal rüber!«, sagte er und gab ihr kaum Zeit, sich abzuschnallen und ihm auszuweichen.
Endlich befreit, lief ich den Gang Richtung Cockpit, verfolgt von misstrauischen Blicken, die meinen Oberkörper nach Sprengstoffgürteln absuchten.
In Reihe zwölf kam ich nicht mehr weiter und blieb vor dem Rücken einer gestressten Stewardess stehen, die mit jemandem sprach, der offenbar in die entgegengesetzte Richtung wollte. Zwischen »Damit kommen Sie …« und »… hier nicht weiter« tippte ich ihr auf die Schulter. Sie drehte sich kurz, um sich mit zerknitterter Miene ein Bild davon zu machen, welcher Abschaum von Passagier es wagte, sie zu stören, dann sagte sie »Augenblick« und riss den Kopf wieder nach vorne.
Oje, dachte ich leicht besorgt. Ich leide nun wirklich nicht unter Flugangst, aber irgendwie fühlte ich mich nun nicht mehr ganz so sicher. Immerhin war diese Flugbegleiterin im Ernstfall dafür zuständig, dass die qualmende Kabine in weniger als dreißig Sekunden geräumt sein musste, und dabei sah sie jetzt schon so gestresst aus, als würde sie geradezu auf einen außerplanmäßigen Druckabfall hoffen, weil sie selbst hin und wieder einen Schluck aus der Atemmaske vertragen könnte.
»Bitte, es ist dringend.« Natürlich war es ein Fehler zu glauben, mit höflicher Kommunikation etwas erreichen zu können. Wie zuvor bei meinem Sitznachbarn scheiterte ich auch bei der Stewardess grandios. Sie hob nur abwehrend die Hand, ohne sich zu mir umzudrehen. Kamen denn hier alle aus Berlin?
»Das müssen Sie aufgeben«, sagte sie zu der verdeckten Gestalt vor ihr.
»Unmöglich«, hörte ich eine junge Frauenstimme lautstark protestieren. »Da ist etwas sehr Wertvolles und Zerbrechliches drin.«
Die Stewardess zeigte sich wenig beeindruckt. »Keine Sorge«, sagte sie mit der Glaubwürdigkeit eines Hütchenspielers, »unser Frachtraum ist sicher, da ist Ihr Gepäck in guten Händen.«
Ah, ja.
Angesichts der Tatsache, dass ich gerade mit eigenen Augen gesehen hatte, wie sich mein Koffer aufs Förderband übergab, hielt ich diese Aussage für leicht korrekturbedürftig und versuchte mich mit einem energischen »Ähemm« konstruktiv in die Unterhaltung einzubringen. »Ich hätte da auch ein Problem mit meinem Gepäck.«
Hmm. Ignoriert zu werden fühlte sich aufregender an. Aber immerhin drehte sich die Stewardess etwas zur Seite und öffnete das Fach über den Reihen zwölf bis sechzehn, wohl um zu beweisen, dass hier alles belegt war. Durch diese Positionsveränderung hatte ich erstmals freie Sicht auf ihre Gesprächspartnerin.
Ach so.
Ich brauchte nur einen Blick, und mir war alles klar.
Vor mir stand ein Klischee – eine »Tofu-Terroristin«, wie mein Freund Eddy sie nennen würde, wenn die junge Frau in seiner Neuköllner Eckkneipe aufkreuzen würde, was sie vermutlich nie tat, weil Eddy keine glutenfreie Sojamilch oder – Zitat Eddy – »anderen Ökomist« auf der Karte hatte. Vermutlich würde er sie gar nicht erst reinlassen oder sich zumindest den Ausweis zeigen lassen, denn ihr Alter war wegen ihrer puppenhaften, kreideblassen Haut nur schwer zu schätzen. Mindestens sechzehn, höchstens dreißig.
Die junge Frau hatte zwei Drittel ihrer dicken, braunen und ansonsten schulterlang herunterhängenden Locken mit einem Haargummi hochgebunden, und das mit einer professionellen Nachlässigkeit, die wohl spontane Natürlichkeit ausdrücken sollte. In Wahrheit hatte sie heute früh sicher stundenlang vor dem Spiegel gestanden, damit der strubbelige Büschelzopf, der wie eine aufgeplatzte Palme aussah, auch wirklich fast mittig vom Kopf abstand.
Das Gesicht war schmal, als besorgter Vater hätte ich es »eingefallen« genannt, und sie trug die obligatorischen Insignien einer Zugezogenen, die ihr ganzes Teenagerleben lang davon geträumt hat, mit Papas Kohle im Prenzlauer Berg einen auf hippes Mädel zu machen: In-ear-Kopfhörer in den durchlöcherten Ohrmuscheln, kajalumrandete Rußaugen, Schmollmund. Nur der obligatorische Nasenring und das Augenbrauenpiercing fehlten.
»Und was jetzt?«
Sie ragte mir nur bis zur Brust, was erstaunlich war, da auch ich nicht gerade mit Basketballergenen gesegnet bin, wobei mir das Schicksal meines Vaters (ein Meter sechsundsechzig, Tendenz fallend) zum Glück erspart geblieben war. Wenn ich geradestand, was selten geschah, kratzte ich die Eins-achtzig-Marke. Ich war also »normal gebaut«, wie meine Mutter sagen würde, ohne sich der sexuellen Implikation bewusst zu sein.
Ob die Palmen-Frisur vor mir auch »normal gebaut« war, ließ sich nicht ohne Weiteres sagen, schirmte sie doch den gesamten Oberkörper bis zur Hüfte mit einem gewaltigen Seesack ab.
Nun verstand ich, warum die Stewardess die junge Frau damit nicht durchlassen wollte. Es war ein Wunder, dass das Monstrum nicht bereits bei der Sicherheitskontrolle im Röntgengerät stecken geblieben war. Zugegeben: Mathematisch bin ich nicht sonderlich begabt, und mein räumliches Denken entspricht in etwa meinen Fähigkeiten, brennende Kernkraftwerke zu reparieren. Aber wenn dieser Sack die Abmessungen eines Handgepäckstücks hatte, dann mussten die Durchschnittshände mitteleuropäischer Fluggäste über Nacht auf Hulk-Niveau angewachsen sein. Ich fragte mich, wie sie es ohne Kran für das Gepäckstück überhaupt bis hierher geschafft hatte.
Na ja, die Pyramiden waren ja auch irgendwie gebaut worden.
»Sie sehen ja, hier ist kein Platz«, fauchte die Stewardess und schloss das Gepäckfach energisch. »Geben Sie mir Ihre Tasche, ich gebe sie für Sie auf.«
»Auf gar keinen Fall!« Die junge Frau stellte den Sack im Gang ab, den Blick auf Angriff programmiert.
Oje. Das kann jetzt heiter werden.
Ich kannte diese Sorte Frauen. Sie saßen in meinen VHS-Kursen mit einem Bio-Latte in beiden Händen (fair gehandelten selbstverständlich: Zwei Cent der überteuerten Brühe spenden wir zur Erhaltung des Regenwalds, den wir für die Millionen an Pappbechern abgeholzt haben, die du nach zehn Schlucken wieder wegwirfst), wollten mit mir über irgendeinen Text reden, den sie über Nacht unter dem Einfluss von einer Flasche Rotwein in die Tastatur gerotzt hatten, und schmissen spätestens in der dritten Woche das Handtuch, weil sie jede Kritik an ihren Aufsätzen als einen Eingriff in ihre künstlerische Hoheitssphäre betrachteten.
Nun gut, der eine oder andere könnte mir entgegnen, dass auch ich ein Klischee lebe – und er hätte recht damit.
Trara, Vorhang auf: Vor Ihnen, eingeklemmt im Gang eines Flugzeugs auf dem Rollfeld des Münchner Flughafens, steht Livius Reimer, Deutsch- und Geschichtslehrer. Der Mann, der so cool sein will wie seine versetzungsgefährdeten Oberstufenschüler. Halbstarke, die alles besitzen, was er als Lehrerkind in seiner Schulzeit nie haben durfte: Markenklamotten, Tätowierungen, Zigaretten und schlechte Noten.
Wie sie trägt er zerschlissene Leinenschuhe, allerdings stecken in seinen Chucks warme Einlegesohlen, weil er im Winter sonst das Gefühl hätte, barfuß auf einer Eisbahn zu laufen. Er kauft sich Jeans mit Löchern, aber nur welche, bei denen man die Haut nicht durchschimmern sieht, weil er so weit nun auch nicht gehen würde. Und er zupft sich einzelne Fransen seiner Kurzhaarfrisur mit Gel in die Stirn, weil er hofft, das würde ihm etwas Verwegenes geben.
Tja, das bin ich. Normal gebaut, normal gewichtig und normal spießig. Das Klischee des Vertrauenslehrers, der denkt, mit seinen Schülern ein Bier auf der Klassenfahrt zu trinken wäre eine vertrauensbildende Maßnahme.
Allerdings – und das ist der Grund, weshalb ich alles in allem ein ganz zufriedener Kerl bin – bin ich mir meiner Pseudospießigkeit bewusst. Offensichtlich ganz im Gegensatz zu der uneinsichtigen Passagierin vor mir.
»Bitte, da hinten ist doch noch ein Platz frei«, sie deutete Richtung Sitz Nummer 33A, »da können wir ihn anschnallen.«
»Der Sitz gehört mir«, wagte ich einzuwenden.
»Und wieso stehen Sie dann hier rum?«, schnauzte mich die Flugbegleiterin an.
Aha. Endlich eine gute Nachricht. Sie redete mit mir. Offensichtlich war ich doch nicht Bruce Willis in Sixth Sense und konnte nur mit Toten reden. »Ich stehe hier, weil der Inhalt meines Koffers verstreut in dem Laderaum Ihres Flugzeugs liegt und …«
»Da hören Sie es«, unterbrach mich die junge Frau. »Unter diesen Umständen werde ich ja wohl kaum meine Tasche aufgeben.« Ihre Augen strahlten dieses beneidenswerte Selbstbewusstsein aus, das einem nur viel Geld oder ein erschreckender Mangel an Lebenserfahrung verleiht. Ich tippte gewagt auf eine Kombination von beidem.
Ohne einen Blick in ihren Sack geworfen zu haben, war ich mir sicher, was ich darin finden würde, nämlich einen Querschnitt der jüngsten Apple-Produktpalette: iPhone, iPad, ein MacBook und, wenn es die geben würde, auch i-Tampons. Keine Ahnung, wie Steve Jobs, Gott hab ihn selig, die Quadratur des Kreises hinbekommen und selbst werbekritische Menschen dazu gebracht hatte, die Apple-Stores mit dem Petersdom zu verwechseln. Kann man da eigentlich auch Kerzen anzünden? In meinen Augen verhielt es sich mit dieser Apfel-Marke wie mit Berlin: Beides hatte offensichtliche Macken, doch entweder sprach man nicht darüber, oder sie wurden einfach zu Kult erklärt.
»Na gut, dann war’s das eben«, sagte die junge Frau und griff wieder nach ihrem Sack, den sie kurz abgestellt hatte. Ich war geneigt, ihr zu helfen, damit ihr ein Bandscheibenvorfall erspart blieb.
»Was haben Sie vor?«, wollte die Stewardess von ihr wissen.
Mittlerweile konnten wir uns der Aufmerksamkeit der Passagiere sicher sein. Bis auf zwei schreiende Kinder und einem schnarchenden Geschäftsmann hatten sich alle zu uns gedreht.
»Ich will hier raus«, sagte die Passagierin.
Hm. Gar keine so schlechte Idee.
»Ich auch«, schloss ich mich an. Meines Wissens konnte man Gepäck nicht ohne seinen Besitzer mitfliegen lassen, sodass es aussortiert werden musste. Und vor dem Start würde die Suche nach meinen Socken und Boxershorts im Frachtraum sicher gründlicher ausfallen als nach der Landung, wenn klar war, dass ich keine Bombe in meinen Bärchenpulli gewickelt hatte.
Allerdings sollte sich mein Plan, mich an der Stewardess vorbeizudrängen, in der Umsetzung als schwierig erweisen. Sie winkte ihre Purserkollegen zur Unterstützung heran. »Sie gehen hier nirgendwohin. Niemand geht hier irgendwohin«, rief sie empört, abwechselnd in meine Richtung und in die der jungen Frau, die sich unbekümmert von uns entfernte.
»Die Türen sind bereits geschlossen. Hören Sie? Da dürfen Sie nicht mehr raus!«
Ich weiß nicht, ob es zehn oder zwanzig Sekunden waren, die es danach noch dauerte, bis der Kapitän sie Lügen strafte. Jedenfalls verging nicht viel Zeit, bis es über unseren Köpfen knackte und Kapitän Schuhmann alle Passagiere dazu aufforderte, das Flugzeug umgehend wieder zu verlassen.
2. Kapitel
Im Terminal vor den Schaltern der Mietwagenverleiher sah es aus wie am Brandenburger Tor kurz nach dem Mauerfall. Menschenmassen drängten nach vorne, bewaffnet mit Taschen, Trolleys oder – so wie ich – mit Plastiktüten, in die ich den Inhalt meines Koffers hatte umtopfen müssen, nachdem er auf dem Gepäckband seine Runden gezogen hatte. Die Menschen benahmen sich, als gäbe es die fahrbaren Untersätze geschenkt – und das mit einem Stapel Begrüßungsgeld im Kofferraum.
Tatsächlich war das Gegenteil der Fall. Wenn man es geschafft hatte, sich unter Einsatz von Neuköllner Straßenkampfmethoden zu der gegelten Aushilfskraft am Counter zu boxen, erfuhr man hier, dass die Mietwagenpreise in den letzten Minuten so explodiert waren, als wäre Deutschland von der dramatischsten Inflation seit der Weimarer Republik heimgesucht worden. Eine logische Nebenwirkung des drohenden Schneesturms, aufgrund dessen sämtliche Flüge bis auf Weiteres gestrichen waren.
Einige Ahnungslose hatten den Fehler gemacht und kostbare Zeit mit einem Abstecher zu den Bahngleisen verplempert, in der Hoffnung, von hier aus weiterzukommen. Natürlich vergebens. Denn wir Menschen mögen es zwar fertiggebracht haben, eine Raumsonde auf dem Mars zu platzieren, doch danach war leider kein Geld mehr dafür übrig gewesen, eine brauchbare Oberleitung zu entwickeln, die nicht bei der ersten Schneeflocke ihren Dienst einstellte.
Während sich also die Ersten der geschätzt zwei Milliarden gestrandeten Passagiere gerade die Nachricht abholten, dass die Bahn ebenfalls streikte, stand ich clevererweise schon in Aftershave-Riechweite des Mannes, der mir hoffentlich gleich einen Wagen aushändigen würde. Ein Auto, mit dem ich es – wenn schon nicht pünktlich, dann wenigstens rechtzeitig – nach Berlin schaffen wollte. Mir blieben noch sechsundzwanzig Stunden bis zu dem Treffen mit Yvonne. Fünfzig Stunden bis zum Verlagsmeeting. Zeit war also nicht das Problem. Eher die Zahl, die mir der Mietwagenverkäufer gerade genannt hatte:
»Eintausendzweihundert Euro?«
Jetzt verstand ich, weshalb die Großmutter vor mir in Tränen ausgebrochen war. Sie hatte gedacht, der Krieg wäre wieder ausgebrochen. (Habe ich schon erwähnt, dass ich zu Übertreibungen neige?)
»Es ist ein 7er BMW mit Luxus-Vollausstattung, mein Herr.«
Für den Fall, dass der Mann keinen Spaß verstand, fragte ich sachlich: »Okay, wie viel kommen Sie mir entgegen, wenn ich das Auto kaufe?«
Er starrte mich an, als hätte ich Kot am Kinn.
»Hören Sie, ich muss dringend nach Berlin. Ich habe dort ein wichtiges Vorstellungsgespräch.«
Eigentlich war das erst am Mittwoch, also übermorgen. Aber die Sache mit der ersten Sitzung meiner zweiten Paartherapie mit Yvonne schien mir etwas zu kompliziert zu erklären, zumal der Schnösel mit der Bifokalbrille und den Schmalzhaaren nicht gerade ein Radikal-Romantiker zu sein schien. Eher wirkte er karrieregeil, und daher versuchte ich es mit der »Ich brauche den Job«-Mitleids-Nummer.
»Ein Verlag will ein Buch von mir kaufen. Das ist meine Chance!«
Der Erfolg war durchschlagend.
»Zwölfhundert Euro«, sagte er. »Und jetzt entscheiden Sie sich bitte, es warten noch andere.«
»Ach was.« Ich drehte mich mit gespielt erstauntem Blick um und sah dem Palmenzopf mit dem Seesack in die Augen. Weiß der Geier, wie sie es direkt hinter mich geschafft hatte. Gerade hatte da noch ein langhaariger Yuppie im Nadelstreifenanzug gestanden, eingerahmt von einer lärmenden Großfamilie. Vermutlich hatte die junge Frau mit ihrem Hulk-Handgepäck alle Konkurrenten in die Flucht geschlagen.
»Wollen Sie den Wagen nun oder nicht?«, fragte mich der freundlichste Autovermieter des Monats.
Ich wog kurz meine Optionen ab und stellte fest, dass ich keine hatte, wenn ich nicht sowohl der Autorenkarriere wie auch meiner Ehe den Todesstoß versetzen wollte, also murmelte ich ein ärgerliches »Meinetwegen«.
»Schön, dann bräuchte ich bitte eine Kreditkarte und Ihren Führerschein.«
Der Führerschein. Verdammt.
Ich tastete nach meiner Brieftasche, zog die Kreditkarte heraus und hörte das schrille Lachen meiner Cousine Paula im Ohr, natürlich nur in meiner Erinnerung, aber das war ja das Schlimme. Hätte Paula jetzt neben mir gestanden, die Hände vor den schwangeren Bauch gepresst, und hätte so laut gekreischt, dass ich fürchtete, die Fruchtblase wäre schon im fünften Monat geplatzt, hätte ich ihr einfach den Führerschein aus den Händen nehmen können. Dessen lächerliches Foto hatte sie nämlich gestern so zum Ausrasten gebracht. So aber blieb mir nichts als die Erinnerung daran, dass sie mit dem alten Lappen in die Küche gerannt war, um meine – Zitat: »Treteimer-Visage« – allen Freunden meiner Eltern zu zeigen. Seitdem hatte ich ihn nicht mehr wiedergesehen, weswegen er sich jetzt natürlich auch nicht mehr in meinem Portemonnaie befand.
»Ähmm, kann ich ihn vielleicht nachreichen?«, fragte ich den Mann am Counter.
»Wie war das?« Er sah mich an, als hätte ich ihn gefragt, ob ich seinen Tresen als Toilette benutzen dürfte.
»Es ist so, ich fürchte, ich habe meinen Führerschein zu Hause liegen lassen …«
»Ach so, kein Problem«, lächelte der Mann. Seine plötzliche Freundlichkeit stimmte mich misstrauisch. Berechtigterweise, wie ich gleich lernen sollte, als er »Der Nächste, bitte!« sagte und mir mit einem Zucken der Augenbrauen zu verstehen gab, in welche Richtung ich zu verschwinden hatte.
Die Seesack-Ninja-Kämpferin boxte sich an mir vorbei und legte triumphierend ihren Führerschein auf den Tresen, womit ich ihr Alter zumindest auf achtzehn plus eingrenzen konnte.
»Sind Sie einundzwanzig?«, fragte der Mietwagenfuzzi misstrauisch.
»Wollen Sie mich in den USA auf einen Drink einladen?«, sagte sie, aber nicht so ironisch, wie ich es getan hätte, sondern mit einem koketten Augenaufschlag. Himmel, die flirtete mit dem Kerl.
Lächelnd legte sie eine Kreditkarte neben den Führerschein. Lea von Armin, konnte ich ablesen, bevor das Guttenberg-Double die Dokumente an sich zerrte.
Na klar. Eine »von und zu«. Reiches Mädel macht auf Berliner-Mitte-Girl. Hatte ich es mir doch gedacht.
»Sie haben Glück, das ist unser letzter Wagen im Fuhrpark«, säuselte der Mietwagenhändler hinter mir, dreitausend Prozent freundlicher, als er mit mir geredet hatte.
»Der letzte Wagen?«, rief ich aus. »Und was mach ich?«
Ich sah mich ängstlich um. Wenn die Meute hinter mir von dem Versorgungsengpass erfuhr, wollte ich nicht in Reichweite des Lynchmobs stehen.
»Tut mir leid«, sagte der Mann, ohne es zu meinen, was unschwer an seinem diabolischen Lächeln abzulesen war, das sich erst veränderte, als er sich wieder Frau von Armins annahm.
Ich wandte mich ab und kämpfte mich durch das Heer der Gestrandeten in die Ankunftshalle zurück.
Und jetzt? Ratlos ließ ich mich auf einer harten Metallbank nieder, die der Renner unter den Wellnessartikeln von Fakiren sein musste. Ich vermag nicht zu sagen, wie lange ich erschöpft auf die Spitze meiner Basketballschuhe gestarrt habe, unfähig, einen vernünftigen Plan zu fassen. Unfähig, überhaupt einen Plan zu fassen: kein Flugzeug, kein Mietwagen, keine Bahn. Und laut der Hotel-App meines Smartphones waren auch alle Zimmer der Umgebung ausgebucht.
Ich sah mich schon im Schlafsack inmitten einer Horde Gestrandeter auf dem Boden liegen, eine RTL-II-Kamera im Gesicht, Futter für die Sondersendung »Die dümmsten Weihnachtsreisenden der Welt«.
Rums! Der Seesack war auf dem Platz neben mir gelandet. Grinsend hatte sich Frau von und zu vor mir aufgebaut, um mir vor ihrem Abgang zum Parkplatz noch einmal ihren Triumph ins Gesicht zu lächeln. »Na, was ist, Beppo?«
Beppo?
Ich überlegte, welche Möglichkeiten es gab, diese Anrede als Kompliment zu betrachten, und scheiterte kläglich.
»Wie war das?«, fragte ich, nicht besonders höflich, also meiner beschissenen Lage durchaus angemessen.
»Lass uns gehen.«
Etwas verwirrt zog ich die Augenbrauen zusammen. »Wohin?«
»Zu unserem Mietwagen.«
»Unserem?«
Sie rollte genervt mit den Augen. »Wir sind hier nicht auf dem Standesamt, Beppo. Du musst nicht alles wiederholen, was ich sage.«
Ich fragte mich immer noch, wieso sie mich wie den Hund meines Nachbarn nannte, der in den Flur kackte, wenn es draußen regnete. Aber wichtig war etwas anderes: »Du willst mich mitnehmen?«
Vielleicht war Beppo ja doch ein Kompliment. Ein neues Szene-Wort, so wie Porno, heiße Scheiße, schwindsüchtig oder was meine Schüler sonst so sagten, wenn sie stoned waren und etwas geil fanden.
»Natürlich nehme ich dich mit«, sagte Lea.
Ihr Nachsatz brachte mein dümmliches Grinsen zum Bröckeln.
»Unter einer Bedingung.«
»Welche?«
»Du gehst noch mal zum Schalter und legst deine Kreditkarte vor. Ich hab dem Typen gesagt, dass du die Karre zahlen wirst.«
3. Kapitel
Und so begann die denkwürdigste Autofahrt meines Lebens wie meine Ehe: mit einer Erpressung. Wobei Yvonne noch vergleichsweise subtil vorgegangen war, als sie mir eines Abends im Bett eröffnete, dass sie sich der »Purity-Bewegung« angeschlossen habe. Nach kurzem Handygoogeln hatte ich sie darauf hingewiesen, dass diese aus den USA importierte Prüderie nur für Teenager-Mädchen gelte, die unberührt in die Ehe gehen wollten. Meinen daraus resultierenden Einwand, dass wir schon bei unserem dritten Date Praktiken vollzogen hätten, die eindeutig nicht dem Verhaltenskodex einer Jungfrau entsprachen, schlug sie mit der Bemerkung in den Wind: »Sei nicht so pedantisch. Du und deine ewigen Regeln. Ich kann doch auch Vegetarierin werden, wenn ich schon mal Fleisch gegessen habe, oder? Also kann ich genauso gut ab sofort mit dem Sex warten, bis wir verheiratet sind.«
Womit die Sache geklärt gewesen war und ich mir nur noch überlegen konnte, ob ich erst auf YouPorn vorbeisurfen oder gleich nach freien Terminen beim Standesamt forschen sollte.
Nun, dreieinhalb Jahre später, war ich (noch) verheiratet, hatte aber trotzdem keinen geregelten Geschlechtsverkehr mehr und musste neben einer Frau sitzen, die mich mit ihrem siegessicheren Grinsen an Yvonne erinnerte, kurz nachdem ich ihr den Antrag gemacht hatte.
»Hast du eine Heizdecke dabei?«, fragte sie mich, als ich den BMW im Parkhaus Richtung Ausfahrt steuerte. Natürlich hatte sie mich zum Chauffeur ernannt, einfach indem sie mir den Schlüssel an den Kopf geworfen und sich kommentarlos auf den Beifahrersitz fallen gelassen hatte.
»Das dauert selbst in so einem Luxusschlitten zehn Sekunden, bis die Heizung läuft«, sagte ich.
»Das meine ich nicht. Ich wollte wissen, ob du ’ne Heizdecke, lange Unterhosen und Haftcreme in deinem Reisegepäck hast.«
»Wie kommst du denn darauf?«
»Weil du eben geblinkt hast, Beppo.«
»Hä?«
»Nur Rentner blinken im Parkhaus. Und ich hab echt die Befürchtung, dass du der am jüngsten aussehende Rentner bist, den ich in meinem Leben getroffen habe. Denn das würde bedeuten, dass du mit Treppenliftgeschwindigkeit über die Autobahn krauchst und wir nicht vor Silvester den Funkturm sehen.«
»Livius.«
»Wer?«
»Livius. So heiße ich. Nicht Beppo.«
»Der Eifersüchtige.«
Für einen kurzen Moment dachte ich, sie würde auf die Affäre meiner Frau anspielen, dann begriff ich, dass sie die Bedeutung meines Vornamens meinte. Meine Magensäure hatte sich ganz umsonst auf meine Schleimhäute gestürzt.
»David hätte besser zu dir gepasst.«
»Wieso das denn?«
»Das bedeutet Liebling. Und du bist so ein Lieblings-Typ. Schwiegermutter-Liebling, Lehrer-Liebling, ›Mein schwuler bester Freund‹-Liebling und so.«
»Ich bin nicht schwul.«
Sie bedachte mich mit einem Blick, den ich von Polizisten kannte, die meinen Führerschein sehen wollten.
»Interessant, dass du das so betonst.«
»Ich betone gar nichts, ich stelle nur etwas fest.«
»Und wieso?«
»Wieso was?«
Sie zog die Brauen zusammen. »Wieso stellst du ausgerechnet das fest. Du hättest ja auch sagen können: ›Hallo, ich bin Livius, und ich bin nicht Linkshänder.‹ Oder: ›Ich bin kein Bluter.‹ Oder: ›Ich bin nicht katholisch.‹ Aber nein, du sagst: ›Ich bin nicht schwul.‹ Ich finde, das lässt tief blicken.«
Ich seufzte. »Oh, Mann, du würdest dich gut mit Yvonne verstehen.«
»Deine Frau?«
Ich nickte.
»Ist sie auch klug, intelligent, wunderschön und anbetungswürdig?«
»Ja, sie leidet auch unter Realitätsverzerrung.«
Lea kicherte. »Du bist lustig. Hätte ich gar nicht gedacht.«
»Sondern?«
»Ich dachte eher, du bist ein knochentrockener Furzer. Ein Beppo, der im Parkhaus blinkt.«
Mit diesen aufmunternden Worten verließen wir das Flughafenareal und steuerten die A92