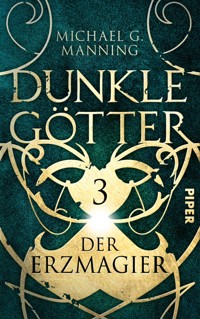
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Der Preis der Magie ist hoch. Sie fordert Entbehrungen und Opfer, und beschwört mächtige Feinde. Der junge Mort hat im Kampf gegen die Gododdin bewiesen, dass er über eine Macht gebietet, die größer ist als die von Königen. Doch dadurch wird er zu einer Bedrohung, selbst für jene, für die er einst zu Felde zog. Feindschaft und Intrige bedrohen das Glück seiner jungen Familie. Selbst Morts Fähigkeiten als Erzmagier können sie nicht vor der Skrupellosigkeit seiner Gegner schützen. Der einzige Weg, um gegen die Dunkelheit bestehen zu können, führt Mort selbst in tiefste Finsternis ... Der düstere Höhepunkt der »Dunkle Götter«-Reihe!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Übersetzung aus dem Amerikanischen von Jürgen Langowski
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe1. Auflage 2014
ISBN 978-3-492-96601-6© 2012 Michael G. ManningDie englische Originalausgabe erschien 2012 unter dem Titel »Mageborn. The Archmage Unbound« bei Gwalchmai Press.Deutschsprachige Ausgabe:© Piper Verlag GmbH, München 2014Covergestaltung: Guter Punkt, MünchenCoverabbildung: Sabine Dunst, Guter Punkt, unter Verwendung von Motiven von shutterstockDatenkonvertierung: psb, Berlin
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwas Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
Vorsichtig stieg ich auf der Steintreppe in die unteren Regionen der Burg Lancaster hinab. In meiner Jugend hatte ich zwar viel Zeit auf der Burg verbracht, doch in diesen Bereich hatte ich mich nie vorgewagt.
James Lancaster war allseits als ein gerechter und nachsichtiger Lehnsherr bekannt. Deshalb waren die Verliese der Burg während seiner Regentschaft bislang kaum benutzt worden, sah man von den gelegentlich hier eingesperrten Dieben einmal ab. In der letzten Zeit hatte der Krieg gegen Gododdin die Lage allerdings ein wenig verändert, wenngleich nicht so sehr, wie man es hätte erwarten können. In diesem Krieg hatte es keine Gefangenen gegeben, dafür hatte ich gesorgt. Die Erinnerung an die Schlacht war immer noch frisch, und hin und wieder erwachte ich mitten in der Nacht und zitterte am ganzen Leib, auch wenn ich mich nur selten an die Träume erinnern konnte, die meinen Schlummer gestört hatten.
Heute war ich gekommen, um eins der Probleme zu lösen, um die ich mich seit Ende des Krieges noch nicht hatte kümmern können. Einer meiner Verbündeten, aus dem beinahe sogar ein Freund geworden wäre, hatte sich am Ende gegen mich gewandt. Allerdings war es kein schlichter Verrat gewesen, und Cyhan hatte durchaus seine Gründe gehabt. Aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, konnte man sogar behaupten, ich hätte eher ihn hintergangen als er mich. Denn der Krieger, der hier eingesperrt war, hatte sich im Grunde vollkommen ehrenhaft verhalten und war dem Vertrauen, das der König in ihn gesetzt hatte, gerecht geworden. Doch ebendieser König hatte mich zum Gesetzlosen erklärt. Je genauer ich die Sache betrachtete, desto stärker kam ich zu der Gewissheit, dass Cyhan es nicht verdient hatte, in der Zelle zu sitzen.
Keiner dieser Gedanken war mir neu; ich hatte sie seit der Schlacht vor der Burg Cameron beinahe täglich hin und her gewälzt. Eigentlich hätte ich schon viel eher herkommen müssen, doch tausend dringendere Angelegenheiten hatten mich davon abgehalten, und in meinen seltenen freien Momenten hatte ich gezaudert – was daran lag, dass dies keine Unterhaltung war, auf die ich mich freute.
Nun stand ich vor einer massiven Holztür und spürte mit meinem Magiersinn den Mann, der drinnen wartete. Schon lange, bevor ich an der Tür eingetroffen war, hatte er mich gehört, aber das war keine Überraschung. Das Verlies war sehr dunkel und still, jedes Geräusch schien hier tausendfach verstärkt zu werden. Obwohl James mich gedrängt hatte, mehrere Wächter mitzunehmen, war ich allein gekommen. Bei unserer letzten Begegnung war Cyhan fest entschlossen gewesen, mich möglichst bald ins Grab zu befördern.
Den angebotenen Begleitschutz hatte ich vor allem abgelehnt, weil ich allein mit ihm reden wollte. Außerdem waren die Wächter – falls er wirklich gewalttätig wurde – ohnehin keine große Hilfe. Der erfahrene Veteran war vermutlich der geschickteste und gefährlichste Krieger, dem ich je begegnet war. Wenn ich ihn nicht selbst aufhalten konnte, bedeuteten die Wachen ohnehin nichts anderes als ein paar zusätzliche Todesfälle. Ich hätte schon jemanden wie Dorian mitnehmen müssen, wenn ich ernstlich mit Gewalttaten gerechnet hätte.
Schließlich schöpfte ich tief Luft, zog den Riegel weg und sperrte die Tür mit einem Gedanken und einem Wort auf. Den Schlüssel hatte ich nicht mitgebracht, denn Schlösser stellten kein großes Hindernis mehr für mich dar. Der Geruch in der Zelle war alles andere als angenehm. Der Mann, den ich aufsuchte, saß am anderen Ende des Raums und beobachtete aufmerksam mein Eintreten. Er machte keine Anstalten, sich zu erheben.
Ich betrachtete ihn genau. Cyhan war zerlumpt, aber bei guter Gesundheit. James hatte dafür gesorgt, dass der Gefangene mit sauberem Wasser und anständigem Essen versorgt wurde. Die Haare waren ungekämmt, ich konnte jedoch erkennen, dass er sich bemüht hatte, sich gelegentlich zu waschen. Ein Mann wie Cyhan ging nicht in dumpfer Verzweiflung unter. »Du siehst schlimm aus«, begrüßte ich ihn zwanglos. Normalerweise beginne ich Gespräche lieber mit einem Kompliment, aber mir war keines eingefallen.
Er schnitt eine Grimasse. Die Miene schien beinahe von Humor zu künden, doch die Regung war vorüber, ehe ich sie richtig erkennen konnte. Eine Antwort schenkte er mir nicht.
»Ich bin gekommen, um die Dinge zwischen uns ins Lot zu bringen«, fügte ich hinzu.
»Dann hast du also einen Tag bestimmt«, entgegnete Cyhan.
Beinahe hätte ich ihn gefragt, was er damit meine, aber dann dämmerte mir, dass er offenbar auf seine Hinrichtung anspielte. »Ich habe nicht die Absicht, dich zu töten«, widersprach ich.
»Dann bist du ein Narr.«
»Erstaunlich, dass du nie ein Ratgeber des Königs geworden bist, denn als Krieger verschwendest du nur deine übergroße Liebenswürdigkeit«, antwortete ich sarkastisch. »Ich bin gekommen, um dir einen Ausweg anzubieten.«
»Vergiss es. Ich habe getan, was ich geschworen hatte. Meine Entscheidungen habe ich selbst getroffen, und im Gegensatz zu einigen anderen habe ich meine Eide nicht gebrochen.« Sein Blick durchbohrte mich, als er mir dies sagte. Es war ein bewusster Versuch, mich zur Weißglut zu reizen.
»Als du das letzte Mal so mit mir umgesprungen bist, ist mir der Kragen geplatzt. Mit dieser Taktik verschwendest du heute nur deine Zeit«, entgegnete ich. Tatsächlich hatte er beim letzten Mal meine Mutter als Versagerin gebrandmarkt, woraufhin ich versucht hatte, ihn anzugreifen. In den letzten Monaten waren aber zu viele Dinge geschehen, als dass ich wegen derart läppischer Beleidigungen noch die Fassung verloren hätte.
»Wenigstens lernst du dazu«, räumte er ein. »Trotzdem, meine Haltung wird sich nicht verändern. Deine einzige Möglichkeit besteht darin, mich zu töten.«
»Ich entscheide selbst, welche Möglichkeiten ich habe«, widersprach ich ruhig, »und du wirst dir anhören, was ich zu sagen habe, ehe du deine Wahl triffst.«
Er verschwendete kein Wort auf eine Antwort, sondern stand lediglich langsam, behutsam und ein klein wenig drohend auf. Ich beobachtete ihn genau und sprach weiter: »Der König hat mir neulich eine Botschaft geschickt.« Nun war mir die Aufmerksamkeit des älteren Kriegers sicher. Seine Körpersprache verriet mir, dass ich sein Interesse geweckt hatte.
»Und?«, fragte er.
»Er wünscht ein geheimes Treffen. Die Gründe hat er nicht genannt, aber ich rechne damit, dass er einen Ausweg aus unserer unerfreulichen politischen Situation sucht.«
»Er wünscht deinen Tod. Dein Sieg hier hat für ihn ebenso viele Probleme geschaffen wie gelöst«, entgegnete Cyhan.
»Ich hätte nicht gedacht, dass dir dies immer noch wichtig ist.« Meine Bemerkung war zwar sarkastisch gemeint, doch verriet mir die Intuition, dass ich nicht sehr weit von der Wahrheit entfernt war.
»Ich glaube, du bist der Untergang der Menschheit, und mein Eid gebietet mir, dich zu töten, nachdem du die Bindung gebrochen hast.« Er hielt einen Augenblick inne, ehe er fortfuhr: »Trotzdem, stünden die Dinge anders, würde ich dich gern als Freund bezeichnen.«
Beinahe hätte ich mich verschluckt. Das musste aus dem Munde dieses wackeren Kriegers als ein äußerst gefühlvolles Eingeständnis gelten. Ich überspielte meinen Schreck mit einem kurzen Lachen. »Du überraschst mich immer wieder. Ehrlich gesagt, ich bin überzeugt, dass du sogar deine eigene Mutter töten würdest, wenn sie an meiner Stelle wäre.«
Er starrte mich unverwandt an, was meine Vermutung viel nachdrücklicher bestätigte, als zahlreiche Worte es vermocht hätten. So beunruhigend diese Vorstellung auch sein mochte, sie war immerhin stimmig. Ich fuhr fort: »Glaubst du denn immer noch, ich werde verrückt? Seit der Auflösung der Bindung ist schon mehr als ein Monat vergangen.«
»Wie soll ich das wissen? Der Wahnsinn kann viele Formen annehmen. Hörst du nach wie vor die Stimmen?«, fragte er. Es klang nach aufrichtiger Neugierde.
»Gewiss. Ich höre sie jetzt sogar ständig und habe mich daran gewöhnt. Es ist lange nicht mehr so beunruhigend, wenn man weiß, was die Stimmen repräsentieren«, erwiderte ich gelassen. In Wirklichkeit hörte ich das tiefe Pochen der Erde sogar in diesem Augenblick, und in der Luft lag ein Murmeln, das ich inzwischen mit dem Wind in Verbindung brachte. Die ganze Welt war lebendig, ich hörte sie mit tausend Stimmen leise flüstern. Da ich inzwischen wusste, was ich da zu hören bekam, hatte ich bei Weitem nicht mehr so viel Angst wie zu Beginn.
Als ich sprach, zog ein Schatten über Cyhans Gesicht, und er wandte sich ab. »Sag mir … was repräsentieren sie?« Scheinbar klang es ruhig, doch meinem Magiersinn entging die zunehmende Spannung in seinem Körper nicht.
»Die Welt ist lebendig, und wer die richtigen Ohren hat, kann sie sprechen hören. Das ist alles«, entgegnete ich.
»Du sagst so etwas und erwartest immer noch, dass ich dich nicht für verrückt halte?«
»Vor dem Großen Sturz kannten die Magier keine Bindung. Einige konnten die Stimme der Erde hören und deren Kräfte zu Hilfe rufen. Moira Centyr hat Balinthor nicht mit der Magie allein besiegt«, antwortete ich.
»Lügen! Hat dir ein dunkler Geist diese Dinge eingeflüstert, damit du deinen Wahnsinn mit Macht verwechselst?« Mit wütend verzerrtem Gesicht drehte sich Cyhan zu mir herum.
»Nein. Ich habe es in einem Geschichtsbuch gelesen, das nicht lange nach dem Großen Sturz entstanden ist. Im Haus meines Vaters gibt es eine umfangreiche Bibliothek, die vor feindseligen Priestern und Politikern gut geschützt wird.«
»Was soll das heißen?«
»Genau das, was ich gesagt habe. Ob du es glaubst oder nicht, ist deine Sache«, entgegnete ich ruhig.
»Natürlich glaube ich es nicht«, gab er zurück.
»Natürlich nicht. Denn wenn du es als wahr annähmest, müsstest du vieles, was man dich gelehrt hat, als Lüge verwerfen und einsehen, dass die Wahrheiten, auf die sich dein Eid gründet und denen du dein Leben gewidmet hast, falsch sind.«
»Du vergeudest deine Zeit«, knurrte der ältere Mann halblaut.
»Beantworte mir eine Frage. Falls du mir irgendwann glauben kannst – sofern du eines Tages erfahren solltest, dass der größte Teil dessen, was man dich gelehrt hat, falsch ist –, was würdest du dann tun?«
Cyhan hielt einen Augenblick inne und dachte ernsthaft darüber nach. Ehe er antwortete, schlich sich etwas wie Trauer in seine Augen. »Ich würde meinen Eid erfüllen.«
»Was für eine Dummheit! Welche Bedeutung hat die Ehre, wenn sie nicht der Vernunft dient?«, fragte ich.
Seine Miene war todernst, als er mir antwortete: »Die Ehre ist alles, was mir bleibt, und sie bedeutete nichts mehr, könnte ich meine Gelübde nach Belieben brechen.«
»Sie ist noch schlimmer als nichts, wenn sie nicht dem Gewissen eines Mannes unterworfen ist!«, fauchte ich. Trotz meiner Zurückhaltung war es dem kräftigen Krieger doch noch gelungen, mich zum Zorn zu reizen. Nicht, dass meine Empörung irgendeine ersichtliche Wirkung zeitigte. »Ich kann kaum glauben, dass du nicht bereit sein solltest, auf Vernunftgründe zu hören.« Damit kehrte ich ihm den Rücken und trat wieder auf den Gang hinaus. »Komm schon.« Ich winkte ihm, mir zu folgen. »Es ist Zeit, dass du gehst.«
Er folgte mir auf den Gang. »Du bist wirklich ein Narr«, murmelte er.
Ich sah ihn nicht einmal an. »Überspann den Bogen lieber nicht.« Mit meinem Magiersinn konnte ich beobachten, wie er sich umsah, als er mir nach oben folgte, aus dem Kerker heraus. Sogar jetzt noch forschte er nach Gelegenheiten – ob zur Flucht oder zum Mord, wollte ich gar nicht wissen. Ich führte ihn durch die Korridore der Burg, bis wir schließlich auf dem Burghof ins Sonnenlicht traten.
»Wohin gehen wir?«, fragte er.
»Zu den Stallungen.« Weitere Erklärungen schenkte ich mir. Ein paar Minuten später erreichten wir die Ställe, wo ich dem Burschen auftrug, mein Pferd zu holen. An diesem Tag war ich nämlich nach Lancaster geritten, statt den Teleportkreis zu benutzen.
Cyhan zog eine Augenbraue hoch, als ich ihm die Zügel reichte. »Was für eine Art Spiel treibst du da mit mir?«, fragte er. Am Ende des Satzes vernahm ich deutlich das Wort »Junge«, auch wenn er es nicht aussprach. Irgendwann während des Krieges gegen Gododdin hatte er zwar damit aufgehört, mich so zu nennen, aber alte Gewohnheiten legt man eben nur schwer ab.
»Der König will mich in zwei Wochen in einem kleinen Dorf namens Tilbrook treffen«, erklärte ich. »Er erwartet meine Antwort, und ich verfüge nicht über viele Boten. Ich entlasse dich in die Dienste des Königs. Du überbringst ihm die Antwort, und ich bin dich los.«
»Soll ich ihm ausrichten, dass du dort sein und den Kopf in die Schlinge stecken wirst?«
»Ich habe nicht die Absicht, dort zu erscheinen. Sage Seiner Majestät, ich werde ihn ein oder zwei Tage nach deiner Ankunft in seinen Gemächern aufsuchen.«
»Das wird ihm wohl nicht gefallen. Solltest du die Absicht haben, dich in den Königspalast zu schleichen, wäre es klug, ihn nicht vorher zu warnen«, meinte er.
»Für einen Mann, der mich töten will, gibst du mir eine Menge guter Ratschläge«, antwortete ich. »Wenn ich ihn vorher warne, sende ich ihm auf einen Streich drei Botschaften. Die erste ist, dass ich nach Belieben kommen und gehen kann, ob er nun eine Vorwarnung erhält oder nicht, und die zweite ist, dass ich ein zivilisierter Mann bin, denn sonst würden wir uns schon jetzt nach einem neuen König umsehen.« Mehr sagte ich zunächst nicht.
»Wie lautet die dritte Botschaft?«
Ich lächelte. »Die ist allein für die Ohren des Königs bestimmt. Sonst gäbe es ja keinen Grund für unseren privaten Plausch.«
Cyhan saß auf und blickte auf mich herab. Seiner Miene sah ich an, dass ihm ein Dutzend Gedanken durch den Kopf schossen. Am Ende beließ er es aber bei einer schlichten Bemerkung. »Ich bedaure schon jetzt unser nächstes Treffen, Mordecai.« Die ruhige Zuversicht, die aus diesen Worten sprach, jagte mir einen Schauer über den Rücken, den ich allerdings rasch mit einem Achselzucken abtat. Schließlich war ich nicht dadurch so weit gekommen, dass ich ängstlich verzagte. Einige Minuten lang blickte ich ihm mit den Augen nach, und sobald ihn die Bäume verdeckten, verfolgte ich ihn mithilfe des magischen Sinns weiter.
Seit Penny und ich die Bindung aufgelöst hatten, war mein Magierblick wieder ebenso scharf wie vorher. Wenn ich mich stark konzentrierte, konnte ich Dinge spüren, die sich etwas mehr als eine Meile entfernt befanden. Verfolgte ich eine bestimmte Person oder einen bekannten Gegenstand, konnte ich die Grenze sogar auf fast anderthalb Meilen erweitern. Soweit ich es zu sagen vermochte, war dies die Grenze meiner Magiersinne, aber ich lernte allmählich, dass es noch andere Wege gab, sich in der Welt umzutun.
Cyhan und das Pferd, das ich ihm gegeben hatte, erreichten gerade die Grenze meiner Wahrnehmung und bewegten sich immer noch in die richtige Richtung – nach Süden zur Hauptstadt hin. Ich beschloss, meine neuen Fähigkeiten zu erproben, holte tief Luft, beruhigte meine Gedanken und lauschte aufmerksam den Stimmen, die mich umgaben. Wie üblich entstand als Erstes ein Gefühl der Verwirrung. Es war mit dem Betreten eines überfüllten Raumes vergleichbar, in dem hundert Gespräche gleichzeitig stattfanden. Der Trick bestand darin, sich zu entspannen und zu lauschen, bis man eine vertraute Stimme erkannte, deren Äußerungen man von da an verfolgen konnte. Dieses Mal hatte ich es auf einen ganz bestimmten Sprecher abgesehen und konzentrierte mich auf das Säuseln des Windes. Im Laufe des letzten Monats hatte ich herausgefunden, dass der Wind ein launenhaftes, chaotisches Wesen war – manchmal leise und sanft, aber dann, ohne Vorwarnung, wild und schrecklich. Mein Geist griff hinaus, während ich den unberechenbaren Strömungen und Gezeiten folgte, bis ich in den weiten Himmel fortgeweht wurde, der voller verstreuter Wolken und von warmem Sonnenlicht erfüllt war. Während sich meine Welt erweiterte, hatte ich Mühe, mich auf das Gebiet rings um Lancaster und auf einen bestimmten Reiter zu konzentrieren, der nicht weit von der Burg entfernt auf der Straße ritt.
Er bewegte sich immer noch nach Süden, und mir war nicht klar, warum ich ihn überhaupt noch beobachtete. Aus irgendeinem Grund wurden die Einzelheiten immer unwichtiger, je weiter sich mein Bewusstsein spannte. Es kam darauf an, das Wissen des sorglosen Windes mit den präzisen Belangen meines sehr begrenzten menschlichen Verstandes in Einklang zu bringen. Öffnete ich mich zu sehr, vergaß ich den Grund, warum ich mich überhaupt umsah, und verlor mich in Tagträumen zwischen nickenden Bäumen und dahineilenden Wolken. Übertrieb ich es aber ins Gegenteil, fand ich nicht das, was ich suchte.
Gedankenverloren stand ich so da, vielleicht eine Stunde, vielleicht einen ganzen Tag … die Zeit spielte keine Rolle mehr. Ich hatte gesehen, wie der winzige Reiter und sein Pferd die Grenze von Lancaster überschritten hatten. Aber diese kleinen Geschöpfe interessierten mich jetzt nicht. Wirklich faszinierend fand ich nun die großen Luftströmungen, die die Wolken nach Südosten trieben. Als mich die Sonne durchflutete, breitete ich mich noch weiter aus, beleuchtete die Erde unter mir und warf die gesprenkelten Schatten der Wolken auf den Boden.
»Mordecai!« Schon wieder brüllte mir jemand ins Ohr. Die Stimme kam mir bekannt vor. Ich blinzelte, was ein seltsames Gefühl war, da ich mich nicht erinnern konnte, dass schon einmal jemand auf diese Weise regelmäßig meinen Blick behindert hatte. Vor mir stand etwas, ein seltsames Wesen mit weichen rotgoldenen Fäden, die es umgaben … wie hieß das noch? Haare. Genau, so nannte ich sie früher, dachte ich bei mir. Außerdem winkte sie mir mit ihren Anhängseln. Sie? Was heißt das denn?, fragte ich mich.
Endlich fügten sich meine zersplitterten Gedanken wieder zusammen, und ich erkannte, dass Ariadne Lancaster vor mir stand und mit den Händen vor meinem Gesicht herumwedelte, um meine Aufmerksamkeit zu gewinnen. »Mordecai! Kannst du mich hören? Sieh mich an!« Es klang aufgeregt. Endlich konnte ich mich auf sie konzentrieren und ihren Blick erwidern.
»Ariadne?«, fragte ich dümmlich. »Was ist los?« Ariadne war die kleine Schwester meines besten Freundes Marcus Lancaster. Sie war zwar ein paar Jahre jünger als wir, hatte sich aber zu einer hinreißenden Schönheit entwickelt und ähnelte ihrer Mutter sehr. Das rotblonde Haar umrahmte ein Elfengesicht, das im Augenblick allerdings höchst besorgt schien.
»Die gleiche Frage sollte ich dir stellen«, erwiderte sie. »Du hast den ganzen Nachmittag hier draußen im Hof gestanden. Ich war schon einmal da, um mit dir zu reden, aber du bist in Trance gewesen, darum habe ich dich lieber in Ruhe gelassen.«
»Den ganzen Nachmittag …«, murmelte ich. Ich hatte immer noch etwas Mühe, diese Worte richtig zu begreifen.
»Ja, den ganzen Nachmittag. Als ich gerade hergekommen bin, um noch einmal nach dir zu sehen, habe ich mir Sorgen gemacht, weil du mir beinahe durchsichtig erschienen bist, als könntest du jeden Augenblick fortwehen. Also habe ich gerufen, um deine Aufmerksamkeit zu erregen, und dich an den Schultern gepackt, konnte dich aber nicht erreichen. Meine Hand ging einfach durch dich hindurch.« Sie hielt inne und schlug mir auf den Arm. »Jetzt bist du wieder ganz fest. Was hast du da bloß gemacht?«
»Ich bin nicht ganz sicher«, erwiderte ich noch immer ein wenig abwesend. »Ich habe Cyhan beobachtet, während er Lancaster verließ … glaube ich.«
»Du bist nicht einmal sicher, was du getan hast? Ich habe mehrere Minuten gebraucht, um deine Aufmerksamkeit zu erregen, denn du hast durch mich durchgestarrt, als wäre ich überhaupt nicht da. Konntest du denn erkennen, ob er sich in die richtige Richtung bewegt hat?« Der Wind war abgeflaut, und ihre Haare lagen jetzt ruhig auf den Schultern.
»In dieser Hinsicht bin ich sicher. Er ist nach Süden in Richtung Albamarl geritten. Falls er heimlich umkehren will, hat er einen wirklich großen Umweg eingeschlagen.« Ganz plötzlich kam mir ein absurder Gedanke: Vom Wind bewegt, hat ihr Haar besser ausgesehen. Eine Bö spielte mit einer Strähne und warf sie hin und her. Habe ich das getan? Ich war nicht sicher, denn ich hatte meine Kräfte nicht eingesetzt. Der Wind war offenbar von selbst aufgekommen.
»Konzentriere dich, Mordecai.« Vor mir schnippte Ariadne mit den Fingern. »Deine Augen sind schon wieder abgeirrt. Muss ich mit Penny darüber sprechen?«
»Nein, mir geht es gut«, log ich. »Ich versuche nur gerade, mich an einige meiner neuen Fähigkeiten zu gewöhnen.« In Wirklichkeit war ich jedoch alles andere als sicher. »Worüber wolltest du denn nun mit mir sprechen, ehe ich dich erschreckt habe?« Ich riss mich zusammen, zog meinen Geist wieder zu mir zurück und setzte mich schon in Richtung des Bergfrieds in Bewegung.
Ariadne hielt Schritt und redete weiter auf mich ein. »Ich wollte dich nach Marcus fragen. Wie geht es ihm?«
Ihr Bruder war nach der Schlacht gegen das Heer aus Gododdin nicht nach Lancaster zurückgekehrt. Seine Göttin hatte sich geweigert, Penny zu heilen, als diese schwer verletzt worden war – angeblich, weil Penny die Bindung zerstört hatte, die meinen Geist abschirmte. Diese Weigerung hatte Marcus veranlasst, sich von der Göttin loszusagen. Danach war ein Gefühl von Leere, Niedergeschlagenheit und Verlorenheit in ihm zurückgeblieben. Seitdem lebte er bei mir auf der Burg Cameron, ich hatte ihn jedoch kaum aufmuntern können. Natürlich machten sich seine Eltern und Geschwister seinetwegen Sorgen.
»Unverändert«, erklärte ich. »Neulich habe ich ihn überredet, mit mir und Dorian ein paar Becher zu leeren, aber besonders umgänglich ist er nicht gewesen.«
Beunruhigt kniff sie die Augenbrauen zusammen. »Ich wünschte, er käme eine Weile nach Hause. Vielleicht könnte ich ihn zur Vernunft bringen.«
Ich hatte ernste Zweifel, ob es hilfreich wäre, wenn ihm seine kleine Schwester auf die Nerven ging, wagte es aber nicht, ihr dies zu sagen, sondern setzte meine beachtlichen Fähigkeiten der Irreführung ein und formulierte den Gedanken etwas anders. »Ich glaube nicht, dass es ihm jetzt hilft, wenn ihm dein Vater Vorträge hält.« Im Laufe der Zeit hatte ich mir doch ein wenig Weisheit erworben.
»Wahrscheinlich hast du damit recht«, stimmte sie zu. »Bleibst du zum Abendessen, oder kehrst du gleich nach Hause zurück?«
Darüber hatte ich noch gar nicht nachgedacht, denn bisher hatte ich mich ausschließlich darauf konzentriert, Cyhan auf den Weg zu bringen. Allerdings war ich recht sicher, dass mich Penelope zum Abendessen erwartete. »Eigentlich wollte ich nicht lange bleiben, aber wenn du möchtest, können wir morgen Abend zusammen essen. Dorian freut sich bestimmt auch über die Gelegenheit, seine Mutter zu besuchen.« Dorian lebte bei uns in Washbrook und diente mir als Seneschall und Waffenmeister.
»Ist Rose noch bei euch? Wenn sie dort ist, solltest du auch sie mitbringen«, fügte Ariadne mit einem schalkhaften Grinsen hinzu. Anscheinend mochte sie Rose Hightower. Als kleines Mädchen hatte sie immer zu der Frau aufgeschaut. Außerdem nahm ich an, dass sie bei ihrem Ansinnen gewisse Hintergedanken hatte. Zweifellos war sie fest entschlossen, Rose und Dorian zu verkuppeln. Penny hegte ähnliche Absichten. Ich dagegen hielt nicht viel von solcher Einmischung, da ich überzeugt war, dass die beiden auch allein sehr gut zurechtkämen.
»Ich denke nicht im Traum daran, sie … auszuschließen«, erwiderte ich höflich. Inzwischen standen wir vor dem Gebäude, das James für meine Teleportkreise in Lancaster errichtet hatte. »Aber jetzt muss ich mich verabschieden und nach Hause zurückkehren. Ich habe nicht damit gerechnet, so lange im Hof herumzustehen.«
»Grüß Penelope von mir. Ich hoffe, ihr kommt morgen Abend zum Essen«, antwortete sie.
»Ich vermag mir gar nicht vorzustellen, dass mich irgendetwas davon abhalten könnte, diese Einladung wahrzunehmen«, entgegnete ich lächelnd. Dann teleportierte ich mich mit einem Gedanken und einem Wort zur Burg Cameron zurück.
Als ich auf der Burg Cameron aus der Nische trat, war der Gang menschenleer. Darüber war ich ein wenig erleichtert, denn in der letzten Zeit hatten mich viele Menschen damit behelligt, ich solle in dieser oder jener Hinsicht Entscheidungen treffen. Die Burg selbst hatte den Krieg weitgehend unbeschadet überstanden, wenn man von der Mauer absah, die an einer einzigen Stelle durchbrochen worden war. Die Reparaturarbeiten gingen zügig vonstatten, und bald konnte ich die Arbeiter einsetzen, um eine neue Außenmauer zu errichten, die unseren rasch wachsenden Ort Washbrook umgeben sollte.
Mit etwas Glück erreichte ich vielleicht sogar meine Werkstatt, ohne jemandem zu begegnen, der mir irgendwelche Entscheidungen abnötigte. Ich hatte die Schmiede meines Vaters übernommen und so lange ausgebaut, bis sie meinen Bedürfnissen entsprach. Ein Meisterschmied wie er würde ich sicherlich nie werden, aber gelegentlich arbeitete ich doch auch mit Metall, und wenn ich ihn brauchte, war mir der Schmiedeofen sehr nützlich. Außerdem gab es womöglich auch einige sentimentale Gründe, über die ich allerdings nicht allzu lange nachdenken wollte.
Als ich den Burgfried durch die Haupttür verließ und über den Hof ging, winkte ich Cecil Draper zu. Damit war meine Glückssträhne auch schon zu Ende, denn Cecil verließ seinen Posten und kam zu mir gerannt, noch ehe ich zehn Schritte in Richtung der Schmiede getan hatte. »Mein Lord! Sir Dorian bat mich, Euch Bescheid zu sagen, dass er Euch sucht.«
Ich blieb stehen und schenkte ihm ein gnädiges Lächeln. »Wo hält sich mein Freund denn gerade auf?« Eigentlich hatte ich nicht die geringste Lust, in diesem Augenblick mit Dorian zu sprechen, aber ich versuchte immer, im Umgang mit den Menschen, die mich unterstützten – und die umgekehrt von mir abhängig waren –, eine besondere Höflichkeit an den Tag zu legen.
»Er sagte, er sei im Wirtshaus, mein Lord«, erwiderte Cecil rasch. Ich nickte und wechselte die Richtung. Die Schenke, die er meinte, wurde von Joe McDaniel betrieben und bewirtschaftet. Er war eng mit Dorian befreundet und leitete inzwischen auch die Stadtwache. Seit sich die Lage etwas beruhigt hatte, lebte er in dem Haus, das Penny und ich vor der Fertigstellung der Burg bewohnt hatten. Er hatte große Anstrengungen unternommen, dort eine anständige Dorfschenke einzurichten.
Bald fiel mein Blick auf das große bunte Schild mit einem dicken Schwein, das sich im Dreck suhlte. Diese künstlerische Darstellung ging auf meine erste Begegnung mit Baron Arundel zurück. Bei dieser Gelegenheit hatte ich mich mit Schlamm vollgespritzt, um einen besonders guten Eindruck zu hinterlassen. Die Wirtshäuser trugen gewöhnlich einfache Namen, die man bildlich darstellen konnte, da viele Menschen des Lesens nicht mächtig waren. In diesem Fall stand »Dreckschwein« in akkuraten Buchstaben unter dem Bildnis. Es war ein bisschen peinlich, dass sie meine Begegnung mit Baron Arundel als Anregung für den Namen des Wirtshauses benutzt hatten, aber ich hoffte, dass die Menschen den wahren Hintergrund bald vergaßen.
Sobald ich durch die Tür getreten war, brauchte ich einen Moment, um mich an das dämmrige Innere zu gewöhnen. Draußen herrschte Zwielicht, drinnen hatte man noch nicht einmal die Lampen angezündet. Bisher waren auch noch nicht viele Gäste eingetroffen, sodass ich Dorian sogleich am Ende der Theke entdeckte. »Hallo, Dorian!«, rief ich, um seine Aufmerksamkeit zu erregen. »Cecil sagte, du suchst mich.«
Mein groß gewachsener Freund drehte den Kopf zu mir herum, sobald er meine Stimme hörte, und heftete den Blick auf mich. »Mort! Schön, dass du wieder da bist. Wie ist es gelaufen?«
Er meinte natürlich meinen Besuch bei Cyhan. »Ich habe ihn gehen lassen, und er sagte mir, ich sei ein Narr«, antwortete ich. Das schien mir eine recht treffende Zusammenfassung der Begegnung zu sein.
Dorian schnaubte. »Das bist du auch und ein störrischer Esel obendrein. Ich halte es nach wie vor für einen Fehler.«
»Das wird die Zeit zeigen, mein Freund. Aber du wolltest doch nicht mit mir sprechen, um mich wegen eines Fehlers zu behelligen, den ich längst begangen habe?« Es fiel mir schwer, meine Ungeduld zu verbergen.
»Hast du es so eilig, an deine Arbeit zurückzukehren? Komm, setz dich, du kannst doch sicher ein paar Minuten erübrigen. Trink was.« Er winkte Joe, der aufmerksam zugehört hatte und jetzt sofort einen Krug für mich zapfte. »Es geht um Marc«, fügte er hinzu.
»Ariadne hat sich auch schon nach ihm erkundigt«, antwortete ich.
»Sie hat einen guten Grund, sich Sorgen zu machen. Es wird und wird nicht besser mit ihm.«
»Er ist nur niedergeschlagen. Früher oder später wird er die Schwermut schon wieder abschütteln. Als wir neulich abends zusammensaßen, war er doch ganz in Ordnung.«
»Ja, sicher, wenn er bei uns ist und trinkt … aber das können wir nicht jeden Tag tun.« Es war seltsam zu hören, dass Dorian so großen Wert auf Nüchternheit legte, denn seit er als Erwachsener galt, hatte er stets eine große Vorliebe für berauschende Getränke an den Tag gelegt.
»Wo ist er heute? Immerhin sitzt du jetzt allein hier«, bemerkte ich.
»Joe bat mich heute Morgen, hier vorbeizukommen und ihn in sein Zimmer zu bringen. Kurz vor der Mittagsstunde ist er ohnmächtig geworden.«
»Verstehe.« Ich schnitt eine Grimasse. »So etwas ist ihm wohl noch nie passiert, oder?«
Dorian seufzte. »Eigentlich spielt es keine große Rolle. So treibt er es jedenfalls schon länger. Er beginnt zu trinken, sobald er aufwacht, was aber gewöhnlich erst am Nachmittag geschieht. Wenn du besser achtgegeben hättest, dann wüsstest du es schon längst.« Das klang durchaus vorwurfsvoll.
»Tut mir leid, Dorian. Ich war stark beschäftigt. Es gibt so viel zu tun …« Ich hoffte, er verstünde es.
»Ja, ich weiß. Es gibt immer viel zu tun, aber man muss sich für seine Freunde auch Zeit nehmen. Woran hast du eigentlich in der letzten Zeit gearbeitet? Du verschwindest ja in jeder freien Minute in der Schmiede.«
Ich war dankbar, dass er die Unterhaltung auf ein erfreulicheres Thema gelenkt hatte. »Ich war ohnehin schon drauf und dran, dich zu bitten, es dir anzusehen. Deine Meinung dazu ist mir wichtig«, antwortete ich lächelnd. Unter allen Menschen, die in der Umgebung lebten, war Dorian der Erste, dem ich mein neues Projekt zeigen wollte. Ich trank einen großen Schluck, um den Bierkrug möglichst bald zu leeren. »Dies wäre ein ausgezeichneter Zeitpunkt. Du solltest mitkommen und es in Augenschein nehmen.« Ich stand auf.
»Immer in Eile, was?« Dorian seufzte schwer und leerte seinen Krug. »Na gut, dann lass uns mal sehen, welche Ungeheuerlichkeit du dieses Mal ausgeheckt hast.« Er stand auf und folgte mir zur Tür.
In der Schmiede hielt ich zunächst einen Moment inne, um ein Wort zu sprechen und den Arbeitsbereich zu beleuchten. Ich hatte ringsherum mehrere verzauberte Kugeln im Raum verteilt, die Licht spendeten. Natürlich hätte ich auch selbst ein Licht heraufbeschwören können, doch hatte ich wieder experimentiert. Diese einfachen Glaskugeln konnten von jedem Menschen entfacht werden, der den richtigen Befehl kannte. Ursprünglich hatte ich sie für Penny erschaffen, doch da die Leuchtkörper schon einmal fertig waren, spielte ich mit dem Gedanken, die ganze Burg damit auszustatten. Außerdem mochten sie nützlich sein, um die Straßen von Washbrook zu beleuchten, doch ich war nicht sicher, ob ich genug Zeit hatte, um eine massenweise Herstellung in Angriff zu nehmen.
»Die sind wirklich hübsch!«, sagte Dorian, der die verzauberten Glaskugeln betrachtete.
»Die meine ich doch gar nicht … die habe ich schon vor Wochen hergestellt«, entgegnete ich. »Hier ist etwas, das dir hoffentlich noch viel besser gefällt.« Ich ging zu einer langen Werkbank, die an der Wand aufgestellt war. Die Arbeitsfläche war mit einem großen Stück Segeltuch verhüllt, unter dem mein jüngstes Werk verborgen blieb. Dorian spähte mir neugierig über die Schulter. »Erinnerst du dich noch, wie ich deine Rüstung verzaubert habe?«, sagte ich.
»Natürlich. Das verdammte Ding rostet nicht einmal«, erwiderte er.
»Das hier ist genauso, nur besser.« Ich zog das Tuch weg und enthüllte eine wunderschöne Rüstung. Im Gegensatz zu den meisten anderen Rüstungen, die wir gegenwärtig benutzten, handelte es sich bei dieser hier um einen echten Plattenpanzer, der aus sorgfältig geformten und geschmiedeten Stahlelementen hergestellt war. Rüstungen dieser Art sah man in Lothion äußerst selten, denn gewöhnlich blieben sie sehr begüterten Menschen vorbehalten. Genau genommen war ich derzeit einer der reichsten Adligen in Lothion, doch da ich als Gesetzloser galt, gab es für mich keine Möglichkeit, mein Geld auszugeben oder auch nur darauf zuzugreifen, denn der größte Teil befand sich noch immer in der Königlichen Bank. Allerdings hatte ich diese Rüstung nicht gekauft, sondern im Verlauf von zwei Wochen mit größter Sorgfalt selbst geschmiedet.
»Ach, du heilige … Mort, wo hast du die denn her?«, rief Dorian. Ich freute mich sehr, dass er so schockiert und überrascht reagierte.
»Ich habe sie geschmiedet«, entgegnete ich bescheiden.
»Jetzt mal ehrlich, woher hast du sie?«, bohrte er nach. Während er damit andeutete, ich hätte in Bezug auf die Herkunft der Rüstung gelogen, strich er mit den Händen über die Beinröhren und bewunderte den schönen braunen Lack, den ich dort aufgetragen hatte. Brustharnisch und Armschienen waren auf ähnliche Weise mit passenden Mustern geschmückt, die Ränder hatte ich vergoldet, und in der Mitte des Brustpanzers prangte ein goldener Falke.
»Ich habe die Rüstung geschmiedet, Dorian. Schau dir doch die Farben und das Symbol an«, antwortete ich.
Nun erkannte er endlich das Wappen der Camerons. »Das sieht wie die Livree deiner Diener aus! Aber wie ist das möglich? So etwas kann man doch nicht kaufen.«
Allmählich wurde ich wütend, weil er es mir immer noch nicht glaubte. »Zum letzten Mal … ich selbst habe diese Rüstung geschmiedet.«
»Nicht einmal dein Vater hätte so etwas tun können!«, rief er. Dann schaute er betreten drein, weil ihm bewusst wurde, was er gesagt hatte. Mein Vater war einige Monate zuvor unmittelbar vor unserer Schlacht gegen das Heer von Gododdin gestorben.
Ich sah ihn gelassen an. »Hätte er sich jemals darauf verlegt, eine Rüstung zu schmieden, so hätte er es zweifellos auch gekonnt.«
»Entschuldige, Mort, das war gedankenlos von mir. Ich meinte nur … nun ja, dein Vater war ein viel besserer Schmied als du, und selbst er hat nie so etwas hergestellt. Warum kannst du es nun?« Dorian streichelte immer noch die Rüstung.
Ich brachte es nicht übers Herz, wütend zu werden. Dorian und ich waren Freunde, solange wir uns überhaupt erinnern konnten, und ich war nicht der Einzige, der den Vater verloren hatte. Deshalb hob ich ein kleines Stück Abfallmetall auf. »Ich verfüge über Hilfsmittel, die mein Vater nicht hatte.« Dann legte ich das Stück in die kalte Asche des Schmiedeofens und erhitzte es mit einem Wort und meiner Kraft. Binnen einer Minute glühte es hell und war dem Schmelzpunkt nahe.
»Normalerweise erhitze ich das Metall in einem ganz gewöhnlichen Feuer, aber da der Ofen kalt ist, zeige ich es dir lieber so.« Leise sprach ich die magischen Worte »Na’Pyrren Ingak mai Lathos« aus, blies auf meine Handflächen und griff in den Schmiedeofen, um das hell glühende Metallstück mit bloßen Händen herauszunehmen.
Dorian zuckte zusammen, als er sah, wie ich ungeschützt das Metall ergriff. Doch er hielt den Mund. Hätte ich es nicht besser gewusst, ich hätte angenommen, dass er sich allmählich an die verschiedenen Erscheinungsformen der Magie gewöhnte. »Ist das wirklich nötig?«, fragte er. »Hier liegen doch genügend Greifzangen herum.«
»Der Spruch hilft mir nicht nur, das Metall zu nehmen, ohne mich zu verbrennen«, erwiderte ich. Schon knetete ich das Material mit den Fingern wie ein Stück zähen Ton. Ich hatte meinen Händen ein übermenschliches Maß an Stärke und Härte verliehen, denn so heiß das Eisen auch sein mochte, normalerweise wäre es mir nicht möglich gewesen, es ohne Hammer und Amboss zu bearbeiten. Rasch formte ich es zu einem Stab, indem ich es zwischen den Händen rollte und abermals erhitzte, wenn es nötig wurde. Schließlich bog ich es zu einem Ring und verschweißte die Enden miteinander. Da ich das Metall mit bloßen Händen bearbeitete, brauchte ich höchstens zwei Minuten.
»Warum hast du es in den Schmiedeofen gelegt, obwohl du es allein mit der Magie erhitzen könntest?«, wollte Dorian wissen.
»Aus Gewohnheit … und ich wollte nicht die Werkbank verbrennen oder den Amboss beschädigen.« Inzwischen bog ich das heiße Metall zu einer Spirale.
Dorian sah fasziniert zu, wie ich das orangefarben glühende Stück bearbeitete. »Was soll das werden?«
»Nichts Bestimmtes«, antwortete ich. »Ich wollte es dir nur demonstrieren. Mithilfe der Magie lässt sich das Metall beinahe so formen, wie ein Töpfer den Ton bearbeitet. Dadurch wird vieles erheblich einfacher als bei der Arbeit mit Hammer und Greifzange.«
»Du hattest schon immer geschickte Hände«, meinte Dorian, »aber irgendwie hätte ich doch angenommen, dass du nicht nur hier herumsitzt und Kunstwerke erschaffst.«
»O du Ungläubiger«, entgegnete ich im Singsang eines Priesters. »So habe ich auch das da gemacht.« Ich deutete auf die Rüstung, die schimmernd auf der Werkbank lag.
»Für so etwas brauchen die besten Rüstungsschmiede des Königs ein halbes Jahr«, entgegnete Dorian. Der Zweifel stand ihm deutlich ins Gesicht geschrieben.
»Anscheinend bist du nicht so leicht zu überzeugen. Bleib mal einen Augenblick da stehen.« Ich ging an ihm vorbei und hob hinter ihm etwas auf, das auf einer Werkbank lag.
Dorian drehte den Kopf, um mich zu beobachten. »Warte mal, Mort. Du wirst doch jetzt nicht irgendwelche komischen Sachen machen?«
Innerlich lachte ich. Hatte ich schon erwähnt, dass mir meine Freunde jederzeit blind vertrauen? »Bleib ruhig! Ich werde keine Magie gegen dich wirken.« Ich beugte mich vor und griff nach seinem Fußgelenk, doch mein furchtloser Freund wich mit einem fast komisch anmutenden Hüpfen seitlich aus.
»Was ist das?«, fragte er nervös.
»Ein Bandmaß … nun halt doch mal still, sonst erwürgt es dich noch«, bemerkte ich trocken. Ich machte einen Schritt auf ihn zu und maß ihn sorgfältig. Gleich darauf entspannte er sich, auch wenn wir einen etwas peinlichen Moment erlebten, als ich seine Schrittlänge abnehmen musste. Ich will an dieser Stelle gar nicht auf die Einzelheiten eingehen.
»Ich warte immer noch geduldig auf deine umfassende Erklärung. Möchtest du eine weitere Rüstung von der gleichen Art für mich herstellen?«, fragte Dorian. Er wusste es gut zu verbergen, doch sein heimliches Begehren entging mir nicht. Welcher Krieger hätte sich nicht eine solche Rüstung gewünscht wie diejenige, die direkt vor ihm auf der Werkbank lag?
»Nicht direkt«, entgegnete ich geheimnisvoll. Natürlich wusste ich, dass ihn die ausweichende Antwort in den Wahnsinn trieb, aber ich genoss es, die Sache hinauszuzögern. »Ich hatte zunächst nur eine Rüstung, die wir zusammen mit meinen eigenen Waren aus dem Lagerhaus des Königs geholt haben, kopiert. Inzwischen bin ich aber einen Schritt weiter und kann sie vermutlich sogar noch verbessern.«
»Wie denn?«
»Nun ja, da wären zunächst die Verzauberungen, damit das Material außergewöhnlich widerstandsfähig und stabil wird. Außerdem kann ich vermutlich einige Scharniere neu gestalten und ein paar überflüssige Teile weglassen, die bisher die Unterarme und die Ellenbeugen geschützt haben. Und so weiter.« Ich deutete auf die vorstehenden Flügel, die zum Ellenbogenschutz gehörten.
»Meinst du die Mäusel?«, fragte Dorian und deutete auf das Metallgelenk. Vermutlich war dies der richtige Name für das Stück.
»Ja, richtig, die Mäusel für Ellenbogen- und Kniegelenk«, antwortete ich aufgeregt, weil ich endlich den richtigen Begriff kannte.
»Die fürs Knie heißen natürlich Kniekacheln«, berichtigte er mich kichernd. Es geschah nicht oft, dass Dorian im Vorteil war, wenn es um theoretisches Wissen ging, aber das Kriegshandwerk beherrschte er viel besser als ich, und außerdem war dies ein Thema, für das er sich regelrecht begeistern konnte. »Du solltest nicht auf diesen Schutz verzichten«, fügte er ernst hinzu.
»Aber diese Teile sind nicht nötig«, beharrte ich. »Das Kettenhemd ist an diesen Stellen stark genug, um den Träger vor Stichverletzungen zu schützen.«
Dorian seufzte. »Mordecai, du bist so klug, dass ich manchmal ganz vergesse, wie dumm du auch sein kannst. Die Platten sollen nicht vor Schnitt- oder Stichwunden schützen. Was glaubst du denn, was ein Träger dieser Art von Rüstung am meisten fürchtet?« Er hielt inne, um mir eine Gelegenheit zu geben, von selbst auf die Antwort zu kommen. Doch ich wollte nicht mitspielen und wartete ab. Schließlich fuhr er fort: »Er fürchtet den Streitkolben und die Axt. Die Bleche sollen Knie und Ellenbogen davor schützen, zerschmettert zu werden.«
»Oh …«, antwortete ich nicht besonders intelligent. »Gilt das auch hier?« Ich deutete auf die runden Platten, die unter den Schulterklappen montiert waren.
»Schwebescheiben«, meinte Dorian. »Sie heißen Schwebescheiben … ja, die Begründung trifft auch hier zu. Sie schützen die Achselhöhlen.«
»Bei deiner jetzigen Rüstung gibt es sie nicht«, widersprach ich.
»Mein Kettenhemd schützt mich vor Schnittwunden und Pfeilen, aber gegen Waffen, die mir die Knochen brechen, richtet es rein gar nichts aus. Deshalb hat man auch irgendwann begonnen, diese Art von Rüstung zu entwickeln«, erwiderte er.
In dieser Hinsicht war Dorians Wissen dem meinen eindeutig überlegen. Deshalb holte ich meine sorgfältig ausgeführten Pläne für die nächste Rüstung hervor und zeigte sie ihm. Ich wies ihn auf die Änderungen hin, die ich vornehmen wollte, und nach ein paar Stunden hatte er mir die meisten ausgeredet. Hätte mein Vater noch gelebt, er hätte gelacht und mir gesagt, ich hätte von Anfang an einen Fachmann zurate ziehen sollen. Andererseits hatte ich schon immer darauf beharrt, erst die Fehler zu machen und danach aus ihnen zu lernen.
Wir vertieften uns so sehr in die Diskussion, dass die Stunden wie im Fluge vergingen, bis die Zeit zum Abendessen längst vorbei war. Wie üblich schien auch dieser Tag nicht lang genug zu sein. Als wir die große Halle betraten, verstummten viele Gespräche, und die meisten anwesenden Menschen schwiegen. Zuerst hatte ich mir deshalb Gedanken gemacht, doch inzwischen war ich daran gewöhnt. Jetzt nickte ich den Leuten nur noch zu und ging zu meinem Platz an der Haupttafel.
Vor meinem Stuhl blieb ich stehen und betrachtete das Essen, das bereits serviert war. Penelopes wütender Blick verbrannte mich beinahe, als ich sie verlegen anblickte. »Meine liebe Hausherrin und Ehegattin«, sagte ich laut genug, damit es überall gut zu hören war, »ich hoffe, du hast dir keine Sorgen gemacht.« Damit drehte ich mich zu den anderen Anwesenden um. »Bitte esst nur weiter.« Ich sprach absichtlich freundlich, um sie zu beruhigen. Es schien auch zu wirken, denn die Gespräche im Raum lebten wieder auf, und die Menschen entspannten sich und machten sich über das Essen her. Ich hatte beobachtet, wie James Lancaster mit seinen Leuten umging, und dabei viel gelernt. Innerlich war ich aber immer noch unsicher.
Penny beugte sich zu mir vor, sobald ich mich gesetzt hatte. »Du machst das inzwischen viel besser, aber es ist trotzdem peinlich, wenn ich allein beginnen muss und nicht weiß, wann du eintriffst.« Sie sprach so leise, dass uns niemand belauschen konnte, und ich konnte ihrem Tonfall entnehmen, dass sie nicht allzu gereizt war.
»Entschuldige«, antwortete ich aufrichtig.
»Schick mir einfach eine Nachricht, wenn du spät kommst, damit ich die Leute nicht herumstehen und auf dich warten lasse, bis wir am Ende doch beschließen, ohne dich mit dem Essen anzufangen«, erwiderte sie. Seit sie das Gewand der Burgherrin trug, war sie bemerkenswert sittsam und höflich geworden … zumindest in der Öffentlichkeit. Ich ließ den Blick über sie wandern und betrachtete das schlichte Kleid, das sie trug. Es wurde durch Saphirohrringe und ein Halsband ergänzt. Ihre Aufmachung war zwar geschmackvoll, aber nicht extravagant, und ich konnte nicht anders, als ihre Schönheit zu bewundern. Penny suchte meinen Blick, dann sagte sie: »Starr mich nicht so an … die Leute reden schon über uns.«
Ich grinste sie an. »Lass sie doch reden. Ich bin mit der schönsten Frau auf der Welt verheiratet. Es wäre noch viel seltsamer, würde ich dich nicht ab und zu anstarren.« Ich gab mir nicht die geringste Mühe, die Stimme zu senken.
Sie errötete und warf mir einen Blick zu, der mir verriet, wie bitter ich später würde büßen müssen, weil ich sie jetzt in Verlegenheit gebracht hatte. Aber es war doch ein angenehmer Blick. Abrupt wechselte sie das Thema: »Was hast du denn mit Dorian getan, das wichtig genug war, um nicht rechtzeitig zum Essen zu erscheinen? Lady Rose war sehr enttäuscht, dass er nicht von Anfang zugegen war.«
Rose Hightower saß zufällig direkt neben ihr und warf Penny einen warnenden Blick zu. »Ich bin nur ein wenig beunruhigt gewesen.« Sie tupfte sich die Lippen mit einem Mundtuch ab.
Nun schaltete sich Dorian ein: »Verzeih mir, dass ich dir dies zugemutet habe. Ich habe nur meinen guten Freund, den Grafen, ins Bild gesetzt, weil er bezüglich der Kunst der Rüstungsschmiede ein paar Fragen hatte.« Wie üblich bemerkte er rein gar nichts. Allmählich zweifelte ich, ob ihm jemals dämmern werde, dass seine Liebe nicht unerwidert blieb. Andererseits zog er es womöglich vor, ganz bewusst nicht allzu scharf hinzuschauen. Falls er sich selbst jemals eingestand, dass sie das Gleiche empfand wie er, war es am Ende ja sogar möglich, dass er sich gezwungen sah, in dieser Hinsicht etwas zu unternehmen. Doch diese Aussichten fand er wahrscheinlich noch erschreckender, als sich dem Heer von Gododdin zu stellen.
»Die Kunst der Rüstungsschmiede?« Rose zog eine Augenbraue hoch und brachte einen bemerkenswerten Ausdruck des Erstaunens zustande. »Plant der gute Graf denn schon wieder einen Krieg?« Ich beobachtete sie genau, während sie sprach, denn trotz ihrer Schlagfertigkeit im Gespräch verweilten ihre Augen viel länger auf Dorian als auf jedem anderen.
»Hör auf damit, Rose, und du auch, Dorian. Ich habe euch beiden gesagt, ihr sollt mich beim Namen nennen. Wir haben hier doch keine offizielle Versammlung, sondern nichts weiter als ein Abendessen, und ich bin hier zu Hause«, sagte ich.
Dorian kicherte. Die beiden zogen mich mit meiner neuen Stellung gern auf. »Vorsicht, Rose. Wir dürfen unseren freundlichen Gastgeber nicht beleidigen«, entgegnete er in gespieltem Ernst.
»Wie wahr, Dorian! Bitte verzeih uns, Mordecai«, fuhr Rose fort und ging auf sein Spiel ein. Während sie sprach, legte sie ihm leicht die Hand auf den Unterarm. Es war allerdings nur eine kleine Geste, die ihre Worte unterstreichen sollte, aber ich hätte ein Pfund Gold gewettet, dass er den Arm um keinen Preis bewegen würde, solange ihre Hand dort liegen blieb. Wahrscheinlich wusste sie das auch. Frauen sind hinterhältig.
Ich seufzte und tat so, als sei ich gereizt, damit sie das Spiel fortsetzen konnten. »Darf ich um etwas Wein bitten?« Ich sprach laut genug, damit der Mann, der hinter mir vorbeilief, es auch hören konnte, denn ich vermutete, dass er ein Diener war. Ganz recht, inzwischen hatte ich Diener … ganz zu schweigen von meinem hauptamtlichen Herold. Doch wer dieser Mann auch gewesen sein mochte, er ignorierte meine Bitte jedenfalls, ging weiter und verließ den Raum durch die Tür, die in die Küche führte. »Das ist seltsam«, sagte ich zu Penny. »Habe ich zu leise gesprochen?« Ich hatte den Kopf nicht herumgedreht und war deshalb nicht ganz sicher, wer mich da übersehen hatte.
Sie lächelte mich an. »Vielleicht hilft es, wenn ein Diener nahe genug steht, um dich zu hören.«
»Aber da war jemand!«, protestierte ich. »Ein großer Bursche, fast so groß wie ich.«
»Ich fürchte, dieses Mal hast du dich geirrt, Mort. Seit einer Minute oder noch länger ist niemand mehr vorbeigekommen. Ich glaube aber, ich habe da eine Dienstmagd bemerkt, die gleich zu uns herüberkommen wird …« Sie hob die Hand und winkte eine Dienerin herbei. Ich glaube, sie hieß Lisette. Gleich darauf eilte das Mädchen fort, um mir einen Becher Wein zu holen.
Ich runzelte die Stirn und schloss den Mund. Gewiss, ich hatte mich nicht umgedreht, denn ich war so daran gewöhnt, meinen Magiersinn zu nutzen, dass ich oft auf die herkömmlichen Sinne verzichtete. Trotzdem war ich völlig sicher, dass ein Mann vorbeigekommen war, auch wenn ihn Penny nicht bemerkt hatte. Es war jedoch wenig sinnvoll, darüber zu streiten. Der Wein war unterwegs, und ich hatte keinen Grund zur Klage.
»Mordecai, du hast meine Frage noch nicht beantwortet«, erinnerte mich Rose.
Ich schreckte aus meinen Gedanken auf. »Welche denn?« Es dauerte einen Augenblick, bis ich mich erinnerte. »Oh, die Rüstung!«, rief ich. »Darüber möchte ich hier lieber nicht sprechen. Ich will die Einzelheiten für mich behalten, bis ich die Arbeit vollendet habe. Könnten wir vielleicht später darüber reden?«
»Oh, ein Geheimnis!«, entgegnete Rose mit blitzenden Augen.
»Glaub mir, ganz so aufregend ist es dann doch nicht«, versicherte ihr Penny. »Es wäre viel interessanter, wenn du uns etwas über deinen heutigen Besuch bei Cyhan erzähltest. Bisher hast du mit keinem Wort erwähnt, wie die Begegnung verlaufen ist.«
Anscheinend war Penny nicht allein mit ihrer Neugierde, denn auch die anderen beugten sich vor. Ich holte tief Luft und hoffte, die Geschichte in einem Aufwasch für alle vortragen zu können, um mich nicht wiederholen zu müssen. »Es ging so gut, wie man es eben erwarten konnte. Wir kamen darin überein, dass wir unterschiedlicher Meinung sind.«
Rose unterbrach mich: »Das klingt bemerkenswert zurückhaltend, wenn man bedenkt, dass euer Streit um die Frage ging, ob du überhaupt noch atmen darfst.« Sie sprach jetzt äußerst ernst. Rose war sehr empört über Cyhans Entscheidung gewesen, unsere Beziehung derart gewalttätig zu beenden. Ich war mir nicht sicher, ob es daran lag, dass er dabei Penny wehgetan hatte, oder ob er bei dem Versuch, mich zu erledigen, jederzeit auch Dorian getötet hätte.
Dorian legte ihr eine Hand auf die Schulter, als wollte er sie beruhigen. Die Geste wirkte sehr vertraut, auch wenn es ihm offenbar nicht bewusst war. »Rose, er mag jetzt unser Feind sein, aber eins muss man ihm doch lassen – er hat sich immer seinem Schwur und seinen Prinzipien entsprechend verhalten.« Ich staunte nicht schlecht, dass Dorian den Mann jetzt verteidigte, nachdem er mich nur ein oder zwei Stunden zuvor gescholten hatte, weil ich so töricht gewesen sei, diesen Feind freizulassen.
Rose warf ihm einen scharfen Blick zu. »Die verdammte Ehre! Er hat das Schwert gegen seine Schülerin und seinen Freund erhoben.« Sie sah Penny und mich abwechselnd an. »Gegen dich auch.« Sie stupste Dorian fest vor die Brust. »Ein Schwur, der so etwas gebietet, ist doch mehr als fragwürdig. Blinder Gehorsam ist die Zuflucht des Narren, der Angst hat, selbst nachzudenken!«
Pennys Miene zeigte widerstreitende Gefühle, die sie schließlich aber zur Seite schob, um sich wieder praktischen Dingen zuzuwenden. »Von alledem mal abgesehen, was hast du eigentlich getan, Mort?«
»Ich habe ihn mit einer Botschaft zum König geschickt«, antwortete ich einfach.
»Das war eine verdammte Dummheit«, warf Dorian ein.
»Wenigstens sind wir in dieser Hinsicht einer Meinung«, schnaubte Rose.
»Wahrscheinlich habt ihr recht, aber ich wollte den Mann nicht hinrichten lassen, nur weil er seine Pflicht getan hat«, entgegnete ich.
Dorian schnitt eine Grimasse. »Seine Pflicht besteht darin, dich zu töten, und man muss ihn unbedingt ernst nehmen. Ich respektiere seine Haltung, aber wenn du einen eingeschworenen Feind im Griff hast, dann gibst du ihm keinen Dolch in die Hand und lässt ihn laufen.«
»Welche Botschaft hast du ihm mitgegeben?«, fragte Rose leise.
»Der König hatte mich um ein vertrauliches Treffen gebeten. Ich habe Zeit und Ort neu bestimmt und Cyhan die Nachricht mit auf den Weg gegeben«, erklärte ich.
Penny sah mich scharf an. »Du hast doch gesagt, du gingest nicht hin.« Es klang gelassen, doch ich hörte die Sorge um mich heraus.
»Ich hab’s mir inzwischen anders überlegt. Trotzdem werde ich mich nicht zu der Zeit und an dem Ort, die er vorgegeben hat, mit ihm treffen, sondern lieber zu meinen eigenen Bedingungen.«
»Das ist gewiss klug, denn es spricht vieles dafür, dass du sonst in einen Hinterhalt laufen wirst. Wenn er dich beseitigt, könnte der König mit einem Schlag eine Menge Probleme lösen. Wo willst du ihn denn treffen?«, fragte Rose gespannt.
»In seinem Schlafzimmer«, erwiderte ich lächelnd.
»Ich habe den Verdacht, dass sich Seine Majestät darauf nicht einlassen wird«, meinte Dorian.
»Er wird keine Gelegenheit bekommen, dies abzulehnen«, warf Penny ungeduldig ein. Die Anspannung, die sich auch in den hochgezogenen Schultern zeigte, war unübersehbar. »Bist du sicher, dass es klug ist? Über diese Möglichkeit haben wir noch gar nicht gesprochen.« Wir hatten uns am Vorabend über dieses Thema unterhalten, und ich hatte den Plan ohne Rücksprache mit ihr geändert.
Dies musste ich meiner Gattin lassen: Sie war kein Angsthase. Ich achtete sie vielmehr als eine mutige und äußerst entschlossene Frau, doch wenn es um mein Wohlbefinden ging, konnte sie manchmal auch übervorsichtig sein. Allerdings war das durchaus verständlich, denn wir erwarteten gerade unser erstes Kind. Ich betrachtete ihren runden Bauch, und dann suchte ich ihren Blick. »Es tut mir leid, Liebste. Ich weiß, dass du dir Sorgen machst, aber ich muss diese Sache mit dem König klären, sonst werden wir niemals Frieden finden, und ich glaube, dies ist die einzige Gelegenheit, die wir bekommen.«
Sie sah meinen Augenausdruck und erkannte, dass es wenig sinnvoll war, mir zu widersprechen. »Hoffentlich hast du recht, denn sonst werde ich dafür sorgen, dass der Rest von dir, der übrig bleibt, dein Leben lang Buße tut.« Wenn sie so etwas sagte, war es keine leere Drohung.
»Unser Kind wird einen Vater haben«, versprach ich ihr. Pennys Entschlossenheit war möglicherweise eine ihrer schönsten Qualitäten.
»Ein überraschendes Treffen wird eure Unterhaltung mit einer gewissen Spannung belasten. Bist du sicher, dass du das willst?«, gab Rose zu bedenken.
»Auf jeden Fall«, entgegnete ich. »Edward muss begreifen, dass ich aus einer Position der Stärke verhandle, sonst wird er sich nicht an die getroffenen Abmachungen halten.«
Danach setzte sich die Diskussion noch gut eine Stunde fort, doch ich hatte meinen Entschluss bereits gefasst. Am Ende war zwar niemand mit meiner Entscheidung glücklich, aber es kamen auch keine besseren Vorschläge auf den Tisch. Nur die Zukunft würde zeigen, ob es eine gute Idee gewesen war oder nicht.
Am folgenden Morgen beschloss ich, von dem gewohnten Tagesablauf abzuweichen. Statt in der Schmiede am nächsten Rüstungsteil zu arbeiten, suchte ich einen anderen Freund aus meiner Kindheit auf. Dank Dorians Hinweisen hatte ich am Vorabend beim Essen genau aufgepasst und tatsächlich bemerkt, dass bei Tisch eine Person gefehlt hatte.
Ich fragte mich, wie viele Mahlzeiten Marc schon versäumt hatte, ohne dass ich mich nach ihm erkundigt hätte. In solchen Momenten musste ich mir vorwerfen, nicht immer der beste aller Freunde zu sein. Gewiss, ich konnte eine Menge Ausreden vorweisen – meine frisch angetraute Frau, das Land, das ich führen musste –, aber diesen Luxus durfte ich mir nicht erlauben. Ausreden gab es zuhauf, aber gute Freunde waren selten.
Da ich Marc auch beim Frühstück nicht entdeckte, machte ich mich zu dem Zimmer auf, das er bewohnte. Ich blieb an der Tür stehen und lauschte einen Augenblick. Zu hören war nichts, und meine besonderen Sinne verrieten mir, dass sich mein Freund allein in dem Raum aufhielt und wach war. Fast hatte ich gehofft, er hätte eine Gefährtin bei sich, denn das hätte meine Sorgen erheblich beschwichtigt. Es entsprach ihm überhaupt nicht, so viel Zeit allein zu verbringen. Marc war schon immer ein höchst geselliger Zeitgenosse gewesen. Ich klopfte an und wartete.
Er rührte sich nicht, doch ich konnte mit meinem Magiersinn deutlich spüren, dass er sich gerade aus einer Flasche nachschenkte. Vermutlich handelte es sich dabei um Wein. Ich klopfte abermals an und sagte laut: »Marc, ich bin es, öffne doch!« Er antwortete aber nicht, sondern sackte in sich zusammen, als schliefe er. Natürlich wusste er, dass ich fähig war, ihn durch die Tür zu spüren. »Das nützt dir gar nichts«, schrie ich die Holztür an. »Ich weiß längst, dass du wach bist.«
»Geh weg!«, ertönte drinnen seine gedämpfte Stimme.
Jetzt hatte ich genug, entriegelte die Tür mit einem magischen Wort und öffnete sie. Marc hockte auf der anderen Seite des Raumes auf dem Diwan und starrte mich düster an, als ich eintrat. In einer Hand hielt er eine Weinflasche auf recht merkwürdige Weise fest.
»Was hast du damit vor?«, fragte ich.
»Ich habe ernsthaft darüber nachgedacht, sie nach dir zu werfen«, entgegnete er trocken, »aber dann beschloss ich, den guten Wein lieber nicht zu verschwenden.« Er wechselte den Griff, hob die Flasche und nahm einen langen Zug.
»Du siehst erbärmlich aus.«
»Danke«, erwiderte er. »Das bedeutet mir sehr viel … aus deinem Mund.« Er klang verdrossen. Mir war sofort klar, dass er sich mit mir streiten wollte.
»Wenn das deine Vorstellung von einer witzigen Entgegnung ist, dann bist du wirklich betrunken.«
»Noch nicht. Ich bin gerade erst aufgewacht. Lass mir noch eine Stunde Zeit«, gab er zurück.
»Könntest du den Wein nicht heute mal in Ruhe lassen und mir bei den Planungen helfen?«, fragte ich. Zum Teil war dies nur ein Vorwand. Natürlich hätte es mir gut gefallen, zu meinen zukünftigen Plänen den Rat meines Freundes zu hören, aber noch wichtiger war mir, ihn aus seiner düsteren Stimmung zu reißen.
»Ich habe eine bessere Idee, Mort!« Abrupt richtete er sich auf, als erfülle ihn auf einmal eine neue Energie und Begeisterung. »Schmiede du doch einfach deine Pläne und lass mich in Ruhe. Auf diese Weise bekommst du geeignetere Pläne, und ich muss mir deinen Mist nicht anhören!« Wieder hob er die Flasche, um sich einen weiteren großen Schluck zu gönnen.
»Wenn du schon sarkastisch sein willst, dann kannst du das auch ohne Wein tun.« Ehe er zu reagieren vermochte, nahm ich ihm mit einer geschickten Bewegung die Flasche weg. Normalerweise waren seine Reflexe so gut, dass mir dies auf keinen Fall gelungen wäre, aber der regelmäßige Genuss hochprozentiger Getränke hatte ihn langsamer werden lassen.
»Du Mistkerl!« Er war zu schwerfällig, um die Flasche zu schnappen, konnte mir aber immerhin die Hände auf den Oberkörper legen und mir einen festen Stoß versetzen. Ich stürzte rückwärts über einen kleinen Tisch und krachte schwer auf den Boden. Marc beugte sich vor und wollte mir die Flasche wieder abnehmen, doch ich pflanzte ihm einen Fuß auf die Brust und schleuderte ihn durch den ganzen Raum. Er prallte vom Eckpfosten des Bettes ab und landete auf der Kommode. »Verdammt! Das wirst du bereuen!« Blitzschnell ergriff er einen Wasserkrug, ehe dieser zu Boden fallen konnte.
Er war verkatert und erschöpft, was meine Bewunderung für seine Geschicklichkeit nur noch verstärkte … bis er sich entschloss, mit besagtem Krug nach meinem Kopf zu werfen. Die rasche Attacke überrumpelte mich, und ich konnte mich nicht rechtzeitig ducken. Glücklicherweise verhinderte der magische Schild, den ich gewöhnlich um mich errichtet hatte, dass mir der Krug den Schädel brach. »He! Damit hättest du mich schwer verletzen können!« Als Kinder hatten wir uns einige Male gestritten und stets die unausgesprochene Regel beachtet, dass es nicht erlaubt war, schwere Gegenstände auf den anderen zu werfen oder auf irgendeine Weise einen bleibenden Schaden anzurichten.
»Als ob ich dich verletzen könnte! Du und dein dummer Schild … warum lässt du ihn nicht wenigstens ein Mal fallen und kämpfst mit mir wie ein richtiger Mann?«, forderte er mich heraus.
»Na gut!«, rief ich zurück. »Du kannst auf jeden Fall eine Abreibung vertragen. Ist dir eigentlich schon mal in den Sinn gekommen, dass sich deine Familie um dich sorgt?« Während ich sprach, ließ ich den Schild in sich zusammenfallen, auch wenn äußerlich nichts davon zu sehen war.
»Was ist mit meinem Vater, hm? Er hat sich doch sicherlich nicht die Mühe gemacht, nach mir zu fragen, oder?« Marc war aufgestanden und kam vorsichtig näher.
»Wenigstens hast du noch einen Vater!«, gab ich hitzig zurück.
»Wie lange willst du deshalb eigentlich noch um Mitleid buhlen?«, höhnte er.
»Bis ich dir den Arsch vermöbelt und dir etwas Verstand in den Kopf geprügelt habe«, antwortete ich eine Spur ruhiger. Meine Wut war nur zur Hälfte echt. Nebenbei überlegte ich mir immer noch, wie ich meinen Freund am besten zur Vernunft bringen konnte.
»Bist du immer noch von einem Schild geschützt?«, fragte er. Ein unbefangener Beobachter hätte gestaunt, wie gelassen er blieb, als er diese Frage stellte, aber in diesem Augenblick kam es mir ganz normal vor.
»Nein, ich habe ihn gerade eben …« Ehe ich den Satz beenden konnte, traf ein rascher Fausthieb meinen Mund. Ich wich zurück, ehe er nachsetzen konnte, doch er beließ es dabei. Ich wischte mir das Blut von den Lippen, die bereits anschwollen. »Nicht schlecht«, sagte ich.
»Vielleicht verbessert das sogar dein Aussehen«, fauchte er.
Ich trat vor und ließ einen schnellen Hieb los, traf aber nur die leere Luft. Einige weitere Versuche liefen ebenfalls ins Leere, bis er einen Angriff abblockte und mir einen Schlag auf den Bauch versetzte. Gleichzeitig konnte ich ihm jedoch den linken Arm um die Schultern legen. Sein zweiter Hieb trieb mir zwar die Luft aus den Lungen, aber ich hielt fest und setzte einen Klammergriff an.
Danach lief es erheblich besser für mich. Wie bei unseren Raufereien in der Kindheit war ich, wenn wir direkte Hiebe austauschten, kein Gegner für ihn, doch im Nahkampf zeigte ich mich als der bessere Ringer. Mit meinen längeren Armen und Beinen konnte ich eine günstigere Hebelwirkung entfalten, und er verlor den Vorteil, den ihm seine schnelleren Reflexe normalerweise schenkten. Wir stolperten einige Augenblicke durch den Raum, bis er versuchte, mich gegen einen Bettpfosten zu drücken. Mit einer Drehung leitete ich seinen Schwung um, und die harte Holzkante traf seinen Rücken.
Er stieß einen erstickten Schrei aus und verzichtete darauf, den Versuch zu machen, sich aus dem Klammergriff zu befreien. Das war meiner Ansicht nach eine gute Idee. Ich ließ ihn los, rollte von ihm herunter und keuchte erschöpft. »Alles in Ordnung?«, fragte ich.
»Teufel, nein! Es tut höllisch weh!« Er rieb sich das Kreuz. »Das war ein gemeiner Trick.«





























