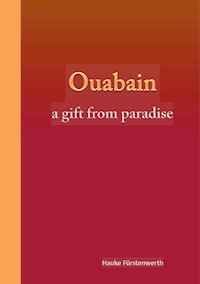Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
2.700 Meter tief im Ozean wächst ein thermophiles Bakterium. Es enthält eine Substanz mit geheimnisvollen Wirkungen. Der Venture Capital Fonds Exquisit Venture möchte in Kooperation mit dem Schweizer Biotech start-up Syntargion den Wirkstoff isolieren und großtechnisch herstellen, ist aber nicht bereit, offenzulegen, wofür der Wirkstoff eingesetzt werden soll. Syntargion hat mit großen Problemen zu kämpfen. Seine Entwicklungsprodukte haben sich in klinischen Studien als unwirksam erwiesen. Die Investoren drängen auf eine Neuausrichtung des Unternehmens. Dr. Felix Termeeren vermittelt eine Kooperation mit Dr. Lena Marbach, Biochemikerin an der LMU in München, mit Spezialisierung auf thermophile Organismen. Getrieben von finanziellen Nöten geht Syntargion auf eine Kooperation mit Exquisit Venture ein. Die Exquisit Kooperation stellt Felix und Lena vor eine Vielzahl von Problemen und Konflikten. Mit Mut und großem persönlichen Einsatz lösen sie das Rätsel des Bakteriums. Sie haben bei ihrer Arbeit in Fidschi und in den dunklen Tiefen des Ozeans, in Laboren in München und in Zürich, und in einer kleinen Wohnung in Wiedikon etwas viel Wertvolleres gewonnen als wissenschaftliche Erkenntnis: die intimste Verbindung zwischen zwei Menschen entsteht durch Vertrauen, Respekt und Liebe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 193
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ich habe beschlossen, dass ich den Rest meines Lebens zu der besten Zeit meines Lebens mache.
Unbekannt
Ich habe keine besondere Begabung, ich bin nur leidenschaftlich neugierig.
Unbekannt
Liebe ist im Grunde eine chemische Reaktion. Aber es macht Spaß, nach der Formel zu suchen.
Hildegard Knef
Der Horizont der meisten Menschen ist ein Kreis mit dem Radius null. Und das nennen sie ihren Standpunkt.
Albert Einstein
Inhaltsverzeichnis
Fidschi
Vula ni moce
Das Mondblumen Ritual
Tropennacht
Syntargion
München
Zürich
München
Der Vertrag
Exquisit Venture
Verlockende Angebote
Verhandlungen
Hotel Memox
Frühstück
Tauchgang
Die Wirkung
Burg Hirschhorn
Porto Fino
zerplatzte Träume
Das Experiment
Synergien
Epilog
Fidschi
Die Sonne brennt golden über der Lagune. Türkisfarbenes Wasser schwappt sanft gegen den feinen, weißen Sandstrand der Fidschi-Insel Taveuni. Zwischen tropischen Gärten, türkisblauem Wasser und schneeweißen Korallenstränden schmiegen sich luxuriös ausgestattete Bungalows des Öko-Luxusresorts ´Matavuralevu Eco Retreat‘. Alle aus heimischem Holz und Pandanusblättern gebaut, versteckt unter schattigen Kokospalmen. Das Resort ist bekannt für seine Nachhaltigkeit: Solarstrom, Meerwasserentsalzung, Bio-Küche. Jeder Bungalow ist mit nachhaltigem Teakholz, handgewebten Stoffen und Solarpaneelen ausgestattet, die das Resort fast vollständig autark machen. Eine eigene Veranda mit Hängematte, Außendusche und Meerblick vervollständigen die luxuriöse Ausstattung der Bungalows. Das Haupthaus des Resorts ist im traditionellen Bure-Stil errichtet, mit offenem Strohdach, geschnitzten Holzsäulen und einem luftigen Restaurantbereich, der bei Sonnenuntergang in goldene Farben getaucht wird.
Dr. Lena Marbach, 38, Biochemikerin mit Spezialisierung auf thermophile Organismen und Wirkstoffanalyse, sitzt barfuß in einem luftigen Strandkleid auf der Veranda ihres Bungalows und trinkt Kokoswasser aus einer frisch aufgeschlagenen Nuss. Ihre dunklen Haare sind locker hochgesteckt, mit ihren haselnussbraunen Augen blinzelt sie in den tropischen Sonnenuntergang und blickt fasziniert auf die goldorangen Spiegelungen auf der Wasseroberfläche, in denen die Sonne langsam versinkt.
Sie hat sich nach intensiven Jahren in der Forschung bewusst für eine Auszeit in dieser tropischen Oase der Ruhe entschieden. Kein Labor, keine Konferenzen – nur Wellenrauschen, Salzwind, Stille.
»Entschuldigung – darf ich?«
Eine Stimme durchbricht die Abendruhe. Ein schlanker Mann mit sonnengebleichtem Hemd, Mitte vierzig, mit graumelierten Schläfen und einem entspannten, aber wachen Blick, steht vor ihrer Veranda. In der rechten Hand hält er ein Buch über pharmazeutische Chemie, in der linken einen Cocktail. Er lächelt höflich.
»Ich habe bemerkt, dass Sie auch ohne Begleitung hier sind. Dachte, ich sage mal Hallo – bevor man sich die ganze Woche verstohlen beim Frühstück anstarrt.«
Lena lacht leise. »Na, dann lieber jetzt. Kommen Sie rauf. Ich bin Lena. Dr. Lena Marbach. Mikrobiologin.«
Er reicht ihr die Hand. »Dr. Felix Termeeren. Pharmakologe. Ich arbeite... na ja, sagen wir: Ich bin gerade auch auf der Flucht vor Meetings.«
»Pharmakologe? Dann kennen Sie sich mit Wirkmechanismen aus.«
»Mehr als mir manchmal lieb ist. Vor allem im Bereich Rezeptorbindung und Wirkstoffdesign. Ich habe viel mit klinischen Tests zu tun gehabt.«
Lena lacht. »Und jetzt sind Sie auf der Flucht?«
»Flucht ist ein gutes Wort. Ich habe meine Mail-App auf dem Handy vorübergehend deaktiviert.«
»Klingt gesund. Ich habe alle meine Geräte stummgeschaltet.«
Lena lächelt und zeigt auf sein Buch. »Pharmazeutische Chemie im Urlaub? Entweder Sie sind ein Workaholic, oder Sie haben einen sehr speziellen Geschmack für Strandliteratur.«
Felix lacht leise und legt das Buch zur Seite. »Schuldig im Sinne der Anklage. Aber ich finde, ein gutes Molekül ist spannender als jeder Krimi.«
Lena schüttelt seine Hand. »Und ich dachte, ich wäre die Einzige, die im Urlaub nicht abschalten kann. Was macht ein Pharmakologe auf Fidschi? Forschungspause oder geheime Mission?«
»Ein bisschen von beidem, wenn ich ehrlich bin. Ich arbeite für ein Biotech-Unternehmen in Zürich, Syntargion. Wir entwickeln neue Antibiotika – oder versuchen es zumindest. Aber hier?« Er hebt sein Glas. »Offiziell Urlaub. Inoffiziell... sagen wir, ich halte die Augen offen. Tropische Regionen sind ein Schatz für neue Wirkstoffe.«
Er setzt sich auf den gegenüberliegenden Hocker. »Was ist Ihr Fachgebiet, wenn ich fragen darf?«
»Biochemie, ich arbeite am Institut für Biochemie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Schwerpunkt unserer Arbeiten sind natürliche Wirkstoffe, insbesondere die Abwehrmechanismen von Mikroorganismen in Extremhabitaten. Organismen, die unter Bedingungen überleben, die jedes andere Lebewesen umbringen würden.«
Felix hakt nach: »Sie meinen so etwas wie Thermophile aus Tiefseequellen oder Bakterien aus Vulkanböden?«
»Genau. Manche dieser Mikroben produzieren Sekundärmetabolite mit erstaunlicher Wirkung – antibiotisch, fungizid, teils sogar zytotoxisch.«
Felix nickt anerkennend. »Das klingt nach einem faszinierenden Forschungsfeld. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, mit der Industrie zusammenzuarbeiten? Pharmaunternehmen lechzen nach solchen Erkenntnissen.«
Lena zögert und nippt an ihrem Drink. »Ich bin eher der Typ ‚reine Wissenschaft'. Die Industrie... sagen wir, ich habe gemischte Erfahrungen. Zu viele Kompromisse, zu wenig Transparenz.«
Felix lehnt sich zurück und mustert sie. »Eine Puristin, was? Das respektiere ich. Aber die Industrie ist nicht immer der Bösewicht. Manchmal braucht es Kapital, um Wissenschaft in die Welt zu bringen.«
Sie sieht ihn an – länger diesmal.
»Ich finde es gut, mit jemandem zu reden, der nicht sofort an Rendite denkt, wenn das Wort ‚Wirkstoff' fällt.«
»Ich finde es gut, mit jemandem zu reden, der nicht sofort an Ideologie denkt, wenn das Wort ‚Pharma' fällt.«
Beide lachen und genießen die tropische Abendstimmung, die von der untergehenden Sonne in ein warmes Licht getaucht wird. Aus der Ferne klingt das Rauschen der Wellen, vermischt mit vereinzeltem Vogelruf.
»Was bringt jemanden wie Sie auf diese Insel?« erkundigt sich Lena.
»Mein Sabbatical. Ich wollte eigentlich mit einem Kollegen an marinen Neurotoxinen arbeiten, aber der ist krank geworden. Jetzt kombiniere ich Literaturrecherche und Erholung.«
»Neurotoxine im Meer?« Lena lächelt. »Jetzt wird's interessant.«
Felix lehnt sich zurück. »Kennen Sie Palytoxin? Gehört zu den stärksten natürlichen Giften überhaupt. Wird von bestimmten Korallen produziert. Eine winzige Dosis kann das Natrium-Kalium-Gleichgewicht der Zellmembran stören – Herzstillstand inklusive.«
Felix ist jetzt in seinem Element. »Wenn Sie Lust haben, zeige ich Ihnen morgen eine Koralle, die es angeblich nur hier geben soll.«
»Für morgen habe ich einen Bootsausflug zu den Nachbarinseln gebucht. Vielleicht ergibt sich später einmal die Gelegenheit für einen gemeinsamen Schnorcheltrip in der Lagune.«
»Dazu bin ich jederzeit bereit. Sie sind bestimmt eine ausgezeichnete Taucherin.«
»Charmant.« Lena lacht. »Aber zurück zu Ihren tödlichen Korallen: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, außer Gift auch medizinisch verwertbare Stoffe zu finden?«
»Die Erfolgswahrscheinlichkeit lässt sich noch nicht quantifizieren. Wir befinden uns noch in der Phase der Grundlagenforschung. Was uns antreibt, ist wissenschaftliche Neugier.«
Lena lächelt verschmitzt. »Bei so vielen Gemeinsamkeiten sollten wir das formale Siezen lassen und zum vertrauteren Du übergehen. Einverstanden?«
»Einverstanden.«
Felix strahlt. »Und du? Hast du auch eine wissenschaftliche Nebenmission hier auf der Insel?«
Lena zögert. »Eher ein Rückzug. Zu viel Arbeit, zu viel Druck. Ich glaube, ich wollte einfach irgendwohin, wo alles... klar ist, wo ich weiß, wer ich bin.«
Felix nickt bedächtig. »Klarheit. Guter Grund.«
Ein Windstoß lässt die Palmwedel rascheln. In der Ferne klingt das rhythmische Trommeln einer traditionellen Feier vom Nachbardorf herüber.
»Wissen Sie was?« sagt Felix schließlich. »Wenn Sie Lust haben – heute Abend ist Kava-Zeremonie mit den Einheimischen. Gehört zum Touristen-Pflichtprogramm. Ich gehe hin.«
Lena lächelt. »Warum nicht. Aber wenn du mich noch einmal siezt, breche ich den Kontakt ab, noch bevor ich mit dir Kava getrunken habe. Bula!«
Vula ni moce
Früh am Morgen des nächsten Tages versammeln sich zwanzig Gäste des Resorts am Bootsanleger. Mit Schnorchel und Flossen ausgerüstet besteigen sie das Ausflugsboot. Die dreiköpfige Besatzung verstaut Essen und Getränke für das Barbecue, das nach dem Schnorchelausflug stattfinden soll. Die Sonne steht noch tief, als das Ausflugsboot ablegt.
Es ist ein traditionelles Langboot mit Außenbordmotor, wettergegerbtem Holz und einem improvisierten Sonnendach aus Bambus und Segeltuch. Die Planken sind mit bunt bemalten Mustern im fidschianischen Stil verziert. Die See liegt ruhig da, das Wasser klar wie Glas. Das Boot gleitet durch die Lagune, vorbei an flachen Sandbänken und der dichten Mangrovenküste. Unter ihnen ziehen bunte Rifffische im flachen Wasser ihre Kreise.
Am Steuer steht Manasa, ein drahtiger Mann um die fünfzig mit wettergegerbtem Gesicht, freundlichen Augen und einem breiten Lächeln, das seine Zähne wie Perlen aufblitzen lässt. Er navigiert das Boot mit der Gelassenheit eines Mannes, der das Meer besser kennt als die Straßen seiner Heimatinsel.
»Wir nennen das hier ‚wai siliva' – silbernes Wasser«, erklärt Manasa. »Wenn die Sonne so steht, scheint es, als ob die See selbst atmet.«
»Schön gesagt«, meint Lena und lehnt sich zurück. Sie schirmt die Augen mit der Hand ab. »Wie viele Inseln steuern wir heute an?«
»Zwei«, antwortet Manasa. »Die kleine Wailoa und die größere Nabukalou. Aber wir machen auch Halt an einem Riff zum Schnorcheln, wenn Sie möchten.«
»Gerne«, erwidert Lena. »Wie heißen Sie eigentlich?«
»Manasa. Ich bin hier geboren – meine Familie lebt seit Generationen auf Vanua Levu.«
»Lena Marbach, Mikrobiologin.« stellt Lena sich vor. »Dann kennen Sie sich mit den Pflanzen auf diesen Inseln aus?«
Er lächelt und zeigt eine Lücke zwischen den Schneidezähnen. »Ein bisschen. Genug, um zu wissen, was hilft – und was man besser nicht anfasst.«
Lena wird neugierig. »Was meinen Sie damit?«
Manasa deutet auf eine dicht bewachsene Insel, die sich am Horizont abzeichnet – ein grünes Juwel im Blau. »Auf Naqara wachsen Pflanzen, die man kaum noch findet. Früher haben unsere Heiler aus ihnen Tränke gebraut. Für Rituale. Für Übergänge – Geburt, Tod, Krankheit, Träume.«
»Träume?« Lena beugt sich interessiert vor. »Was für Träume?«
»Geführte Träume«, sagt Manasa. »Die Ältesten nannten es ‚vula ni moce' – der Schlafmond. Man trank einen Sud aus den Blättern der ‚walo ni damu', einer seltenen roten Pflanze. Sie wächst nur im feuchten Inneren der Insel. Danach… sah man Dinge. Antworten. Oder Fragen, die man vorher nicht kannte.«
Manasa steuert das Boot näher an die Küste einer kleinen, flachen Insel. Er schaltet den Motor zurück. Ein dichter Gürtel aus Palmen und Farnen empfängt sie, dahinter ragen vulkanische Felsformationen auf. In einer malerischen Bucht mit feinem Sandstrand geht das Boot vor Anker.
Die Resortgäste legen ihre Schnorchelausrüstung an und springen mit freudigem Gejauchze in das glasklare, smaragdgrüne Wasser. Die Männer der Bootsbesatzung bereiten am Strand das Barbecue vor. Manasa bleibt an Bord und macht sich an den Armaturen des Motors zu schaffen.
Lena nutzt die Gelegenheit, ihn um nähere Angaben zu den Ritualpflanzen zu bitten.
»Manasa, Sie sagten, die Mondblume wurde für Rituale verwendet. Können Sie mehr darüber erzählen? Wie haben Ihre Vorfahren sie eingesetzt? Ich meine, was genau haben sie gemacht, und was ist passiert?«
Manasa zögert. Es scheint ihm schwer zu fallen, auf Lenas Fragen zu antworten. Mit gesenkter Stimme antwortet er: »Die ‚vula ni moce' wächst nur auf Naqara, tief im Regenwald, wo die Schatten am dichtesten sind. Ihre Blätter schimmern silbern, aber nur nachts, wenn der Mond scheint. Die Ältesten sagten, die Pflanze spricht mit dem Mond, deshalb heißt sie so.«
Er macht eine kurze Pause. »Meine Großmutter sagte immer, dass die Geister dort tanzen, wenn der Mond voll ist. Sie war eine Daunivucu – eine Heilerin. In ihren Erzählungen öffnet ‚vula ni moce' den Geist, lässt einen die Welt der Ahnen sehen. Aber es war nicht für jeden. Manche, die es nahmen, wurden krank – oder Schlimmeres. Für unsere Ahnen wurde ‚vula ni moce' aus dem Paradies zur Erde geschickt, damit sie Menschen – je nach ihrem Verdienst – heile oder strafe.«
»Wie lief das Ritual ab?«, fragt Lena fasziniert.
»Nur die Daunivucu durften die Blätter pflücken, und das nur in der Vollmondnacht. Sie gingen barfuß in den Wald, sangen alte Lieder, um die Geister der Insel zu ehren. Dann pflückten sie die Blätter – nie mehr als fünf pro Pflanze, um sie nicht zu töten.«
»Was haben sie mit den Blättern gemacht?«
»Die Blätter wurden in der Sonne getrocknet, bis sie knisterten wie Pergament. Dann zermahlten sie sie in einer Schale aus Korallenstein – kein Metall, das war wichtig, weil sie glaubten, Metall würde die Kraft der Pflanze stören. Das Pulver mischten sie mit frischem Kokosöl und ein paar Tropfen Meerwasser, das bei Flut gesammelt wurde. Das war die Sila Vula, die Mondessenz. Sie wurde in kleinen Muschelschalen aufbewahrt, bis das Ritual begann.«
»Faszinierend. Und das Ritual selbst? War es eine Art Trance oder etwas Medizinisches?«
Manasa lächelt gequält. Wieder scheint ihm die Antwort Überwindung zu kosten: »Ein bisschen von beidem. Ich war noch ein Junge, als ich das letzte Ritual gesehen habe, bevor es verboten wurde. Es war 1992, glaube ich. Mein Onkel Tui war krank – ein Fieber, das kein Arzt heilen konnte. Die Daunivucu riefen das Dorf zusammen, nachts, am Strand von Naqara. Sie hatten ein Feuer entzündet, und die Muschelschale mit der Sila Vula wurde herumgereicht. Jeder, der teilnahm, bekam einen kleinen Tropfen auf die Zunge. Meine Großmutter sagte, es schmeckt bitter, wie Medizin, aber dann...«
Er macht eine Pause, als ob er die Worte abwägt.
Lena rückt näher zu Manasa und fragt mit leiser Stimme: »Was dann, Manasa? Was haben Sie gesehen?«
Manasa senkt erneut die Stimme, seine Augen auf die Insel gerichtet: »Sie sagten, die Welt verändert sich. Die Sterne wurden heller, die Wellen flüsterten Geschichten, und manchmal sahen sie die Ahnen – oder etwas, das sie für Ahnen hielten. Mein Onkel Tui stand auf, nachdem er die Essenz genommen hatte, obwohl er tagelang nicht gelaufen war. Er tanzte, lachte, sprach in einer Sprache, die niemand verstand. Am nächsten Morgen war sein Fieber weg. Aber...«
Lena zieht die Augenbrauen fragend hoch. »Aber? Es gibt immer ein ‚Aber', nicht wahr?«
Manasa nickt langsam, seine Miene verdunkelt sich. »Ja. Nicht jeder kam gut durch. Eine Frau aus dem Nachbardorf, Mere, nahm die Sila Vula in einem anderen Ritual. Sie war jung, stark, aber nach dem Tropfen schrie sie stundenlang, sagte, sie sehe Schatten, die sie jagten. Am nächsten Tag fand man sie im Wald, bewusstlos. Sie sprach nie wieder davon, aber sie war... anders danach. Die Ältesten sagten, die Mondblume prüft dein Herz. Wenn du unreine Absichten hast, bestraft sie dich.«
Lena lehnt sich zurück. »Und… was sehen Sie? Bei den Sitzungen, meine ich.«
Manasa antwortet nicht sofort. »Das ist schwer zu sagen. Was wir sehen, ist nicht immer das, was geschieht. Aber manchmal sehen wir das, was wir sonst nicht verstehen können.«
Er sieht sie ernst an. »Ich weiß, Sie sind Wissenschaftlerin. Sie möchten Erklärungen. Moleküle, Rezeptoren. Doch die ‚vula ni moce' führt zu einer anderen Wahrheit.«
Lena will mehr wissen. »Gibt es immer noch solche Zeremonien?«
Manasa zögert, seine Augen flackern, als ob er abwägt, wie viel er preisgeben soll. »Wir leben sie noch immer. Nicht für Touristen. Nicht für Geld. Aber ja. In Momenten, die uns wichtig sind. Geburt. Krankheit. Entscheidung. Verlust.«
Er senkt die Stimme fast zu einem Flüstern. »Offiziell sind sie verboten. Die Regierung will nicht, dass Touristen oder Außenstehende davon erfahren. Aber... die alten Wege sterben nicht so leicht. Es gibt immer noch Daunivucu, die die Rituale durchführen, tief im Wald, wo niemand hinsieht. Nur wenige, nur die, denen sie vertrauen.«
Lena erwidert mit einem charmanten, aber leicht angespannten Lächeln. »Das klingt nach einer gut gehüteten Tradition. Wie entscheiden sie, wer teilnehmen darf?«
Manasa mustert Lena kritisch, bevor er antwortet. »Es ist für die, die Respekt zeigen – für die Insel, für die Ahnen. Nicht für Leute, die nur nehmen wollen.«
»Manasa, ich respektiere Ihre Kultur zutiefst. Als Wissenschaftlerin finde ich die Mondblume faszinierend, aber ich verstehe, dass sie mehr ist als nur eine Pflanze. Wenn es diese Rituale noch gibt... wie wäre es für jemanden wie mich, daran teilzunehmen? Nur um zu lernen, nicht um zu nehmen.«
Manasa schweigt für einen langen Moment. Schließlich dreht er sich zu Lena, seine Augen suchen in ihrem Gesicht nach etwas – Ehrlichkeit, vielleicht.
»Das ist keine leichte Bitte, Dr. Marbach. Die Daunivucu wählen sorgfältig. Aber... Sie haben gute Augen.« Er macht eine Pause. »Ich kenne jemanden, meine Tante Sala. Sie ist eine der letzten, die die Sila Vula zubereitet. Morgen Nacht, wenn der Mond aufgeht, wird sie ein Ritual abhalten. Wenn Sie wirklich lernen wollen, kann ich Sie hinbringen. Aber nur Sie. Keine Notizen, kein Handy, nur beobachten. Oder… tiefer gehen. Das entscheiden Sie selbst.«
Seine Stimme wird eindringlich. »Unsere Tradition verbietet es eigentlich, Fremden Zugang zur ‚vula ni moce' zu erlauben. Doch ich vertraue Ihnen. Ich komme morgen Abend. Wenn die Sonne tief steht, kann ich Sie führen. Aber nur bis zum Rand des alten Pfades. Den Rest… müssen Sie selbst entscheiden. ‚Vula ni moce' ist keine Pflanze, die man leichtfertig benutzt. Sie ist... wie ein Schlüssel zu einer Tür, die nicht jeder öffnen sollte.«
Lena schweigt lange, dann nickt sie langsam. »Ja. Ich möchte es. Nicht aus Neugier. Aus Respekt.«
Manasa legt ihr kurz eine Hand auf die Schulter. »Dann morgen Nacht. Der Mond wird hoch stehen.«
Freundlich lächelnd beendet Manasa das Gespräch: »Nutzen Sie die verbleibende Zeit bis zum Barbecue zum Schnorcheln, Dr. Marbach. Sie werden staunen, welch bunte Vielfalt an Fischen und Korallen unsere Unterwasserwelt zu bieten hat.«
Das Mondblumen Ritual
Die Nacht ist hereingebrochen, und der Vollmond taucht Naqara in silbriges Licht. Lena folgt Manasa durch den dichten Regenwald, ihre Sandalen knirschen auf dem weichen Boden. Der Duft von feuchter Erde und süßen Blüten erfüllt die Luft. Das Zirpen der Insekten mischt sich mit dem fernen Rauschen der Wellen.
Manasa führt sie zu einer kleinen Lichtung, wo ein Feuer in einem Kreis aus Steinen flackert. Fünf Personen sitzen im Schneidersitz um die Flammen: Sala, eine ältere Frau mit grauem, geflochtenem Haar und einem ruhigen, aber durchdringenden Blick, und vier weitere Einheimische, deren Gesichter im Feuerschein schimmern. In der Mitte steht eine flache Schale aus Korallenstein, gefüllt mit der Sila Vula, deren bittersüßer Geruch Lena in die Nase steigt.
Sala spricht mit einer tiefen, ruhigen Stimme. »Dr. Marbach, Manasa sagt, du bist hier, um zu lernen. Die vula ni moce ist ein Geschenk der Ahnen, aber auch eine Prüfung. Bist du bereit, dich ihr zu stellen?«
Lena schluckt und nickt. »Ja, ich bin bereit. Ich will verstehen, nicht stören.«
Sala nickt und beginnt, ein leises Lied zu singen, eine Melodie, die wie ein Flüstern des Windes klingt. Die anderen stimmen ein, und die Luft scheint zu vibrieren. Sala nimmt die Muschelschale und reicht sie Lena, die einen kleinen Tropfen der Sila Vula auf ihre Zunge legt. Der Geschmack ist bitter, fast beißend, gefolgt von einer seltsamen Wärme, die sich in ihrer Brust ausbreitet.
Die Welt beginnt sich zu verändern. Die Flammen des Feuers tanzen in Mustern, die Lena wie lebendige Formeln erscheinen – fast wie die biochemischen Reaktionen, die sie in ihrem Labor studiert. Die Sterne über ihr leuchten intensiver, und die Geräusche des Waldes werden zu einem Chor von Stimmen, die sie nicht versteht, aber fühlt. Sie sieht Bilder: einen Mann, der am Strand tanzt, wie Manasa es von seinem Onkel Tui beschrieben hat; dann eine Frau, die durch den Wald rennt, von Schatten verfolgt. Lena spürt ihr eigenes Herz schneller schlagen, doch sie bleibt ruhig, ihre wissenschaftliche Neugier hält sie geerdet.
Sala beobachtet Lena und fragt mit sanfter Stimme: »Was siehst du, Fremde?«
Lena atmet tief, ihre Stimme zittert leicht. »Ich sehe... Bewegung. Leben. Aber auch Angst. Es ist, als ob die Pflanze mit mir spricht, aber ich verstehe die Sprache nicht ganz.«
Sala lächelt leicht. »Das ist genug für die erste Nacht. Aber sei vorsichtig. Sie zeigt dir, was du wissen musst – und manchmal, was du fürchtest.«
Das Ritual endet, als die Gruppe das Feuer löscht und sich in die Nacht zurückzieht. Lena fühlt sich gleichzeitig erschöpft und lebendig, ihre Gedanken rasen mit Fragen über die Geheimnisse der Mondblume.
Zurück in ihrer Bungalowhütte, wo der Wind durch die geflochtenen Palmwände streicht, sitzt Lena seit Stunden über ihrem Laptop. Es ist spät, die Sterne funkeln durch das offene Fenster. Der Bildschirm wirft ein kühles, blaues Licht auf ihr Gesicht. Ihre Finger fliegen über die Tastatur, während sie Datenbanken, wissenschaftliche Artikel und obskure Foren durchforstet, auf der Suche nach Informationen über die vula ni moce.
Sie hat Suchbegriffe wie »Mondblume Fidschi«, »Sila Vula«, »psychoaktive Pflanzen Pazifik« und sogar »fidschianische Rituale« eingegeben, doch die Ergebnisse sind enttäuschend. Auf allen einschlägigen Plattformen – Pub Med, Scopus, ethnobotanische Datenbanken, sogar digitale Archive lokaler Universitäten in der Südsee – nichts. Selbst Recherchen mit künstlicher Intelligenz – ChatGPT und Grok – bringen keine verwertbaren Ergebnisse.
Ein paar vage Erwähnungen von Heilpflanzen in ethnobotanischen Studien, ein Blogpost über fidschianische Mythen, aber nichts Konkretes über die Mondblume. Kein wissenschaftlich erfasster Wirkstoff. Keine Erwähnung in pharmazeutischen Studien, keine ethnographische Dokumentation. Die wissenschaftliche Welt scheint die Pflanze ignoriert zu haben.
Sie lehnt sich zurück, ihre Gedanken rasen. Das Ritual mit der Sila Vula hat etwas in ihr geweckt – nicht nur wissenschaftliche Neugier, sondern eine tiefere, fast spirituelle Faszination. Die Bilder, die sie gesehen hat, die Stimmen, die sie gehört hat, waren mehr als nur eine biochemische Reaktion. Sie spürt, dass die Mondblume Antworten birgt, nicht nur über ihre chemische Zusammensetzung, sondern auch über sie selbst.
Doch wie kann sie mehr erfahren, ohne die Grenzen der Ethik zu überschreiten? Sie denkt an Manasa und Sala, an ihren Respekt vor der Pflanze, und doch nagt die Wissenschaftlerin in ihr: Was, wenn die Mondblume ein Durchbruch ist? Ein neues Antibiotikum? Ein Neurotransmitter-Modulator? Aber dann schleicht sich ein anderer Gedanke ein – einer, der sie überrascht: Was, wenn sie die Pflanzeninhaltsstoffe patentieren könnte? Der Reichtum, der damit einherginge, wäre enorm.
Lena schüttelt den Kopf, als könnte sie den Gedanken vertreiben. »Ich bin nicht so«, flüstert sie zu sich selbst, doch die Idee bleibt wie ein Schatten in ihrem Hinterkopf. Sie greift nach ihrem Handy und tippt Manasas Nummer ein, um die sie nach ihrer Rückkehr vom Bootsausflug gebeten hatte.
»Manasa.«
»Guten Abend, Manasa, Lena Marbach hier. Ich habe noch viele Fragen zur vula ni moce. Gibt es eine Möglichkeit, noch einmal an einer Sitzung teilzunehmen? Ich verspreche, respektvoll zu sein.«
»Dr. Marbach, das ist gefährlich.«
»Ich will nicht stören oder entweihen, Manasa. Aber ich möchte verstehen. Nicht aus Neugier, sondern aus Achtung. Sie wissen, dass ich Wissenschaftlerin bin. Mein Blick ist oft kühl. Aber ich fühle... dass hier etwas ist, das sich nicht messen lässt.«
»Sala sagt, vula ni moce hat Sie akzeptiert. In zwei Nächten, zur Neumondzeit, halten wir eine Sitzung ab. Mein Neffe, der Älteste meiner Familie, steht an einem Scheideweg. Sie dürfen dabei sein. Sie werden zuhören, nichts fragen, nichts anfassen. Vula ni moce wird Sie finden.«
»Danke, Manasa, ich werde am Strand auf Sie warten.«
»Gute Nacht, Frau Marbach.«
Nach dem Telefonat spürt Lena einen Adrenalinschub. Sie weiß, dass sie an einem Scheideweg steht, aber die Neugier ist stärker als die Vorsicht.
≈≈ ≈
Die Nacht ist tief und still, als Lena erneut mit Manasa durch den Regenwald von Naqara streift. Sala hat sie am Strand abgeholt, ihre Augen wachsam, aber nicht unfreundlich. Der Mond steht als schmale Sichel am Himmel. Die Lichtung ist dieselbe wie zuvor: ein Kreis aus Steinen, ein kleines Feuer, dessen Flammen in der Dunkelheit tanzen, und die kleine Gruppe von Einheimischen, die leise singen. Sala hält die Muschelschale mit einem dampfenden Sud aus vula ni moce, deren bittersüßer Geruch Lena sofort wiedererkennt.
Mit ruhiger Stimme wendet sie sich an Manasas Neffen, Viko – einen jungen Mann mit ruhigem Blick. »Dein Geist hat gerufen. Die Pflanze hört. Wenn du bereit bist, tritt in deinen Kreis.«