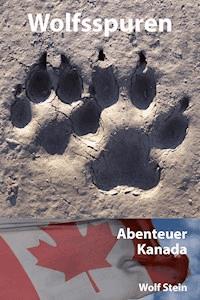Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Sommer. Ein See. Eine handbetriebene Fähre. Jan Becker zieht es wieder ins wilde Mecklenburg. In der Fortsetzung zu Der Praktikant heuert er als Fährmann an einem Ort an, der seine ganz eigenen Geschichten schreibt und Sehnsüchte weckt. Fern des Alltags treffen Mensch auf Natur, Touristen auf Einheimische, Liebe auf Leidenschaft und der Ernst des Lebens auf würzigen Humor. Und dann ist da noch dieser Lärm.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 188
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wolf Stein
DER FÄHRMANN
Roman
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
DER FÄHRMANN – Kapitel I
DER FÄHRMANN – Kapitel II
Impressum neobooks
DER FÄHRMANN – Kapitel I
Der Herbst erwachte ‒ und mit ihm das Monster. Pünktlich um 8! Wie konnten sie es freilassen? Wie konnten sie nur? Tief und fest schlief es in einer finsteren Ecke, eingeschlossen, weggesperrt. Ruhe und Glückseligkeit herrschten. Doch nun treibt es sein Unwesen. Wie konnten sie nur? Barbaren! Die fruchtbare Jahreszeit liegt in den letzen Zügen, atmet tief ein, bäumt sich auf, haucht ein leises Lebewohl. Erste Blätter fallen. Am Morgen ist es kühl, am Mittag warm. Meinen russischen Wildtomaten auf der Terrasse fällt das Reifen schwerer und schwerer. Schaffen sie es, schmecken die tiefgelben Früchte vollmundig süß. Den Abend durchzieht eine feuchte Kälte. Das Jahr wendet sich der Dunkelheit zu. Und pünktlich um 8 wird es geweckt. Bald jeden Tag! Sein stinkender Atem nimmt mir die Luft. Sein lautes Gebrüll schmerzt in den Ohren. Diese Ausgeburt der Hölle, ich hasse sie! Das Ungetüm nagt an meinen Nerven. Es zerreißt sie gar. Von Montag bis Freitag zerreißt es meine Nerven. Die Zeit, in der es wütet, ist grausam, lebensfeindlich. Nur an den Wochenenden bin ich vor ihm sicher. Dann schließen sie es ein. Dann muss es sich ausruhen. Das ist gesetzlich so vorgeschrieben, verzeichnet in der Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung. Doch lassen sie es frei, sorgt das Biest in meiner Nachbarschaft für Angst und Schrecken. Es ist ein Laubbläser – die wohl dümmste Erfindung aller Erfindungen, der rektale Auswurf menschlicher Experimentierfreudigkeit. Wo sind sie geblieben, die Zeiten, als Laub noch Laub sein durfte, als die bunten Blätter Käfern und Krabbeltieren Unterschlupf boten, als es Harken und Besen gab, als sich Mensch und Baum respektierten? Sie wurden zu Grabe getragen. Beerdigt. Beerdigt von der Friedhofsverwaltung Burgstadt. Die ist der Meinung, dass ein Laubbläser die Produktivität erhöht – die Produktivität ihres Friedhofswartes. Im Frühjahr hatte der noch Kollegen, meist Hilfskräfte, 1-Euro-Jobber und Jugendliche, die gemeinnützige Arbeit verrichten mussten. Seit ich wieder zu Hause bin, sehe ich ihn nur allein. Niemand, der ihm zur Seite steht. Einst sind sie zu dritt oder zu viert mit Schubkarren, Schippen und anderen Gerätschaften ausgezogen und haben, während die Morgensonne erste Strahlen durch das Geäst auf die Gräber warf, fleißig geharkt und gepflegt. Damit ist es vorbei, ferne Erinnerung. Nun ziehen nur noch zwei über den Gottesacker: der Friedhofswart und seine Krawalltüte. Ich genieße es, in der Stadt direkt an einem Friedhof zu wohnen, nicht eines morbiden Fetischs wegen, ich genieße es wegen der Ruhe, wegen der freien Aussicht, die nicht verbaut werden kann. Nach meinem Abenteuer als Praktikant im Nationalpark Seelitz vor einem Jahr, bin ich extra ein paar Häuser weiter gezogen. Ein Freund gab mir den Tipp. Die neue Wohnung am Südfriedhof ist klein, aber reizend gemütlich. Holzbalken liegen frei unterm Dach. Eine bodentiefe Glasfront erhellt zwei Zimmer und die halboffene Küche. Das Bad ist geräumig, aber fensterlos. Mein altes Zuhause gefiel mir auch, doch das Hauptargument für den Umzug war die von beiden Räumen zugängliche Dachterrasse und der damit verbundene Ruf nach ein bisschen mehr Freiheit. Von hier aus blicke ich auf Linden, Birken, prächtige Kastanienbäume, auf Tannen, Büsche, Hecken, auf Spaziergänger, Amseln, Buntspechte, auf geschmückte Gräber und auf frisch gefallenes Laub, das nun fast jeden Morgen ab 8 mit dem Laubbläser von einem Grabstein zum anderen geblasen wird. Das Modell Nervensäge leistet ganze Arbeit. Der als Plastikrucksack getarnte Verbrennungsmotor bläst gigantische Blattmengen mit Leichtigkeit dahin – samt Hundekacke und Staub. Alles fliegt und flattert durch die Gegend, landet, fliegt wieder hoch, landet wieder. Mit Hörschutz bewaffnet kämpft sich der Friedhofswart voran. Vorne schwingt er den Rüssel, hinten entweichen die Abgase. Und Lärm! Gigantischer Lärm! Ein kleiner Benziner auf dem Rücken eines Mannes kann einen unglaublichen Geräuschpegel erzeugen. Höchst nervenbelastend ist das unstete Dröhnen. Wenn es wenigstens ein gleichbleibender Ton wäre! Der Bläser geht an, bläst 3 Sekunden, mein Trommelfell schreit auf, der Motor geht aus. Eine Sekunde ist es ruhig. Sofort spüre ich die Erleichterung im Inneren meines Ohres. Der Bläser geht wieder an, bläst 2 Sekunden, dann geht er wieder aus. An, aus, an, aus. Die Schallwellen fliegen zwischen den Häuserwänden hin und her, schaukeln sich auf. Ich halte es nicht aus, bekomme Aggressionen. Die Ideenschmiede in meinem Hirn ist am Überlegen, wie ich den Friedhofswart samt seines schrecklichen Apparates am unauffälligsten unter die Erde bringe. Bald jeden Tag ab 8! Bald jeden Tag! Zumindest kommt es mir so vor. Der Friedhofswart ist ein netter Kerl. Ich unterhalte mich gern mit ihm. Aber mit seiner Krawalltüte macht er sich keine Freunde. Was mich zudem entsetzt: Die Monster vermehren sich – blasend schnell! Meine Hausverwaltung hat die Produktivität des Hausmeisters ebenfalls erhöht. Es muss sich um eine Verschwörung handeln. Wenn der Friedhofswart die Ohren voll hat vom Laubblasen und seine Höllenmaschine einsperrt, betritt sogleich unser Hausmeister die Bühne und zeigt, dass er mindestens genauso laut Blätter und Staub durch die Gegend blasen kann wie der Grabeswächter nebenan. Auch er hat keine Helfer mehr. Er laubsaugt einsam und allein auf dem Hof. Sein Kollege, der Besen, ist spurlos verschwunden. Produktivität erhöht, Personaleinsatz und -ausgaben gesenkt. Ach, wie mir meine Hausverwaltung schmeckt – besonders Herr Strunz, seines Zeichens Geschäftsführer. Mit dem gab es von Anfang an Probleme. Ich habe kein gutes Gefühl bei ihm. Gerüchte gehen um, er wirtschafte in die eigene Tasche, gründe Unterfirmen, die er selbst engagiert. Beweisen ließ sich bisher nichts, doch ich traue ihm nicht über den Weg. Der Ruf eines eingebildeten Aals, der sich am Anblick seines eigenen Spiegelbildes ergötzt, eilt ihm voraus. Er kann Beschwerden der Hausbewohner und kritische Anfragen in unnachahmlicher Manier ignorieren, eigene Nachlässigkeiten hingegen bei den regelmäßig einberufenen Eigentümerversammlungen, ohne rot zu werden, zu seinen Gunsten auslegen. Wie eine Schlange schlängelt er sich aus der Verantwortung. Herr Strunz hat eine Schwäche: die Rechtschreibung. Seine Briefe sorgen bei ihren Empfängern gern für Schmunzeln. Im Winter hatte ich ihn darauf hingewiesen, dass schon seit Wochen mehrere Lampen im Hausflur defekt wären, dass die Lampenschirme fehlten, die Fahrstuhlbeleuchtung flackere, die Postfrau noch immer keinen Schlüssel für die neue Schließanlage habe, weshalb sie täglich klingeln muss, und dass im Eingangsbereich erhöhte Unfallgefahr drohe. Der in den Boden eingelassene Fußabtreter fehlte, wodurch eine fünf Zentimeter tiefe Stolperfalle hinter der Haustür auf ihre Opfer wartete. Alles Kleinigkeiten, die schnell erledigt sind, dachte ich. Eine Antwort seitens der Hausverwaltung blieb aus, die Situation unverändert. Ich rief bei meinem Vermieter an, dem Eigentümer der Wohnung. Mit Sven verstehe ich mich gut. Er versprach, sofort bei Strunz durchzuklingeln und ihm Feuer unterm Hintern zu machen. Sven muss dem Herrn mächtig eingeheizt haben. Am nächsten Morgen brannten alle Lichter im Hausflur, neue Lampenschirme schmückten die Wände, der Fahrstuhltechniker kam, der Postfrau wurde ein Schlüssel überreicht und eine neue Fußmatte lag passgenau in der dafür vorgesehenen Vertiefung.
»Na bitte! Geht doch!«, dachte ich.
Im Briefkasten fand ich am gleichen Tag einen Brief. Strunz‘ Unterschrift zertifizierte ihn. Wortwörtlich und formvollendet stand darin:
Sehr geehrter Herr Becker,
nach Begehung des o.g. Hauses wurde im Flurbereich des Dachgeschosses mehrere Gegenstände (Truhe, Stuhl, u.s.w.) gesichtet, das vermutlich Ihnen gehört, bitte entfernen Sie diese Gegenstände umgehend, da im Flurbereich, solche Sachen nichts zu suchen haben, Flutweg!
Offenbar konnte jemand die Beschwerde nicht auf sich beruhen lassen. Ich zeigte Lisa den Brief, als sie aus Berlin zu mir kam. Sie fand ihn genauso erheiternd wie ich.
… wurde mehrere Gegenstände … gesichtet, das vermutlich Ihnen gehört …
»Ich lache mich schlapp. Wenn er schon kein Talent für Rechtschreibung und Grammatik hat, dann soll er es doch wenigstens von seiner Sekretärin korrigieren lassen.«
»Das sollte er! Die Punkt- und Kommasetzung ist auch fraglich. Das Beste ist aber der fettgedruckte Flutweg.«
»Was ist denn ein Flutweg? Wusste gar nicht, dass wir den hier haben.«
Die im Schreiben beklagten Gegenstände wie Stuhl und Truhe stehen tatsächlich dort. Sie passen nicht mehr in meine zwei Zimmer. Dafür wertet das Ensemble die farbliche Eintönigkeit des Flurbereiches auf, finden Lisa und ich. Das denkmalgeschützte Gebäude ist ein saniertes Schulhaus, ein erhabener Backsteinbau mit überaus breiten Treppenaufgängen und hohen Fluren. Herzen aus Eisen schwingen sich am Geländer von Stockwerk zu Stockwerk. Jede Wohnung diente bis zur Wende als Klassenzimmer für Berufsschüler. Treppen und Flure sind Fluchtwege. Mieter dürfen dort nichts hinstellen, was bei einer Notsituation zur Gefahr werden könnte. Alles andere kann von der Hausverwaltung geduldet werden. Muss nicht, kann aber! In der Weitläufigkeit des Hausinneren schienen die besagten Objekte niemanden zu stören – bis zum Tag des Beschwerdetelefonates zwischen Herrn Strunz und Vermieter Sven. Nun sollten sie plötzlich weg. Aus einem unbeachteten Fluchtweg wurde ein umgehend zu räumender, in fetten schwarzen Lettern gedruckter Flutweg. Es ist gemein und man soll sich nicht über die Schwächen anderer lustig machen, doch ich konnte mir ein Rückschreiben an Strunz nicht verkneifen. Lisa und mich überkam eine wunderbare Idee für eine Antwort.
Sehr geehrter Herr Strunz,
bezugnehmend auf Ihr Schreiben teile ich Ihnen mit, dass mir die Gefahr einer Flut im Dachgeschoss des Hauses durchaus bewusst ist. Nur aus diesem Grund stehen die von Ihnen aufgeführten Gegenstände dort. Sie sind für uns überlebenswichtig. Der Holzstuhl und die -truhe dienen im Fall der Fälle als Schwimmhilfen! In der Truhe lagere ich zudem mehrere Rettungswesten!
Vielen Dank für Ihr Verständnis
Jan Becker
Seitdem steht dort alles so wie immer. Ein Blumentopf hat sich sogar hinzugesellt. Von einer Flut wurden alle Etagen bisher verschont, von einer strunzigen Antwort auch. Dafür rächt er sich jetzt vermutlich mit dem Einsatz des Laubbläsers. Ich schaue nach unten, schüttele den Kopf, gehe rein, schließe das Fenster, schließe meine Augen und denke: »Irgendwann werde ich euch zeigen, was `ne Harke ist!« Dumpf und leise drückt das Dröhnen vom Hof durch die Scheiben. Ich sehne mich zurück an meinen See – zurück an den Juwelin. In Gedanken drehe ich das Rad der Fähre. Lisa sitzt vor mir in einem Sommerkleid. Nächste Saison werde ich wieder beim Fährmann anheuern, ganz bestimmt, im nächsten Jahr wieder. Der Juwelin hat mich gefangengenommen, wie den Fährmann auch, mit seiner wilden Schönheit.
»Ich hänge hier fest, fest am Seil, fest am Seil der Fähre«, sagt der Fährmann und blickt melancholisch über das Wasser.
Der Juwelin leuchtet pastellblau im Spiegel des wolkenlosen Himmels. Es ist Juni, früh in der Saison. Nur wenige Urlauber lassen sich übersetzen. Wir lassen unsere Beine vom Bootssteg baumeln. Mein Blick streift entlang der Ufer. Schwarzerlen und Rotbuchen besiedeln die steilen Hänge. Hin und wieder eine Eiche, Birken, weiter südlich drängen sich Fichten eng aneinander. Das Wasser ist klar, glasklar. Metertief gewährt es Einblick ins Innerste des Sees. Barsche und Rotfedern schwärmen unter uns entlang.
»Unter den Ruderbooten stehen die größten Fische. Solche Dinger!«
Der Fährmann hebt seine Arme, streckt die Zeigefinger und hält die Hände etwa 30 Zentimeter weit auseinander.
»Und? Denkst du, dass du es hier drei Monate aushältst?«
»Ganz bestimmt!«
»Seefahrt ist kein Zuckerschlecken! Ruderboote ausschöpfen, Kajaks putzen, sich mit Touristen rumärgern. Hier ist es nicht immer so idyllisch. Ab Juli ist hier richtig was los. Da kommen sie alle auf einmal. Dann steht die Fähre kaum mehr still. Und wenn es mal ein paar Tage am Stück regnet, kann es ganz schön trist und langweilig werden. Dann muss ich aufpassen, dass sich hier nicht alle gegenseitig auf den Sack gehen. Aber ich habe dir ja gesagt, nicht jeder kann Fährmann am Juwelin werden.«
»Das hast du Fährmann. Das hast du.«
»Am Anfang hilfst Du erst mal beim Bootsverleih mit. Wenn du das drauf hast, darfst du auch das Rad der Fähre drehen. Beim Übersetzen aber immer gut gelaunt sein und den Leuten Geschichten erzählen. Das mögen sie.«
Vom anderen Ufer aus ertönt ein lautes: »Fährmann, hol över!«
»Oh, da wollen welche rüber.«
Wir stehen auf.
»Geht gleich los! Ich hol euch gleich!«
Der Ruf des Fährmanns kehrt als Widerhall zurück vom Hollerkamm. Die handbetriebene Seilfähre zieht sich 150 Meter bis rüber. Zu jeder halben und vollen Stunde legt sie ab. Es sei denn, es sind keine Passagiere zu sehen. Die können von drüben entweder rufen oder sie klappen einen roten Pfeil nach unten. Das ist das Zeichen zum Überholen. Ein unbefestigter Waldweg schlängelt sich hinunter zu diesem Pfeil. Genau gegenüber führt eine steile Treppe aus Naturstein zum Fährhaus. Hundertfünf Stufen. Schon beim Abstieg überkommt viele Menschen das Gefühl, an einen besonderen Ort abzutauchen. Der Juwelin nimmt eines jeden Seele ein. Über sieben Kilometer streckt er sich. Seine Ufer liegen nicht weit auseinander. Das Fährhaus wacht einsam mittendrin. Es ist mit rotbraunen Holzleisten umzogen. Weiße Schiebefenster reihen sich rundum. Ein kurzer Anleger führt zur Fähre, ein breiter Steg seeseitig am Haus entlang zum Bootsverleih. Auf dem Steg stehen Tische und Stühle aus Holz. Geländer schützen vor einem ungewollten Sturz in die Fluten. Im vorderen Teil wartet ein Imbiss-Café auf hungrige und durstige Gäste. Hier hat Hacki das Sagen. Hacki ist ein liebenswerter Vogel, eigenartig und einzigartig. Er ist vollschlank, trägt eine Brille, hat Sommersprossen im Gesicht und kurzes rotblondes Haar.
»Ich bin einer, wat?«, sagt Hacki immer und grinst dabei schelmisch.
Fragen ihn Gäste nach dem WC, antwortet er: »Das ist nur ein C, ein WC gibt es hier nicht, nur ein C.«
Das Dixi Klo steht versteckt. Pflanzenumrankt tarnt es sich rechts am Fuße der Steintreppe. Jeden Mittwoch kommt der Klofahrer und pumpt die Schiete ab. Sonst darf kaum jemand hier herunterfahren, nur der Fährmann und sein Trupp. Der Juwelin liegt in einem Naturschutzgebiet. Autos parken oben auf dem Parkplatz, Wanderer nehmen die Treppe und Radfahrer den Schotterweg, die einzige Zufahrt zur Fähre. Man kann den See einmal komplett umlaufen oder mit dem Rad umfahren. Oder man nimmt die Abkürzung durch die Mitte: die Fähre. Entlang eines Stahlseils zieht sie sich von Ufer zu Ufer und transportiert Menschen, Hunde, Fahrräder, Kinderwagen und Gepäck.
Mein Handy vibriert. Es empfängt eine SMS. Das Brummen auf der Holzkommode reißt mich aus meinen Erinnerungen. Es ist Sascha. Er plant gerade den Dezember und möchte wissen, ob ich wieder auf dem Burgstädter Weihnachtsmarkt dabei sein werde. Ich antworte ihm: Auf jeden Fall! So viele Schichten wie möglich! Seit ich beim Radio gekündigt habe, verdiene ich mein Geld mal hier, mal da. Kurz bevor ich auf Sascha traf, ereilte mich auf meiner Stellensuche für den Winter eine denkwürdige Offenbarung, eine Art der Diskriminierung, die mich verstört zurück ließ. Die Konstellation der Gestirne meinte es dabei nicht gut mit mir, der Kosmos hatte sich gegen mich verschworen. Ein Weihnachtswarenhändler namens Dr. Fröstel befand sich auf der Suche nach saisonalen Lieferkräften. Meine Bewerbung wurde von ihm begrüßend aufgenommen. Der persönliche Kontakt ließ nichts Ungewöhnliches erahnen. Sein Handel mit zerbrechlichen Glaswaren schien hervorragend zu laufen, sein Verkaufskonzept von genialem Geist ersonnen. Er fand mich gut, ich fand ihn gut. Die Erscheinung des Doktors, der tatsächlich promoviert hatte, wirkte intelligent, doch leicht hyperaktiv. Ohne Umschweife wurde das Angestelltenverhältnis besiegelt, zunächst mündlich und per Handschlag. Von diesem Moment an ging ich fest davon aus, dass ich während der heiligen Zeit fragile Weihnachtsschmucklieferungen für Dr. Fröstel von Verkaufsstand zu Verkaufsstand fahren würde – bis zu jenem Tag, an dem die Grundfesten meines Denkens erschüttert wurden. Zur Besprechung und zur Einweisung trafen wir uns in des Doktors Warenlager. In der modernen Leichtbauhalle stapelten sich Kisten über Kisten. Manche Türme reichten bis unter die Decke. Zusammen mit zwei weiteren Bewerbern bekam ich von Fröstel und seiner Frau das Einmaleins der Firmenphilosophie und die ausgeklügelte Bestückungslogistik seiner Weihnachtsmarkthütten erklärt. Nachdem wir alles erfahren hatten, durften wir Fragen stellen, die ausführlich beantwortet wurden. Im Laufe des Gesprächs kamen wir irgendwie auf Geburtstage. Als jenes Datum in sein Ohr drang, an dem ich den Leib meiner Mutter verlassen habe, wurde er hellhörig. Ein misstrauischer Blick entfloh seinen Augen.
»Bist du ein Skorpion?«
»Also, mein Sternzeichen ist Skorpion, ich bin ein Mensch.«
Nach dieser Antwort erklärte er meine Fahrerkarriere als beendet, noch bevor sie begonnen hatte. Wie sich herausstellte, war Dr. Fröstel astrologischer Fundamentalist. Bei Skorpionen sah er rot. Mit denen hatte er bisher nur schlechte Erfahrungen gemacht. Selbst der Bruder seiner Frau, auch ein Skorpion, sei schon mal mit den Tageseinnahmen abgehauen. Diesem Sternzeichen könne man nicht über den Weg trauen. Ich hielt seine Argumentation für einen Scherz. Doch Dr. Fröstel meinte es bitterernst. Somit war ich raus aus seiner Truppe. Nichteinstellung aufgrund meines Sternzeichens – mich fröstelt es heute noch, wenn ich daran denke. Die Arbeit in Saschas himmlischer Markthütte erfüllt mich hingegen mit weihnachtlicher Freude. Das Familienunternehmen verkauft liebevoll gefertigte Leuchtsterne und Leuchthäuser aus handgeschöpftem Papier. Unser Stand ist ein echter Hingucker. Eingekeilt zwischen Sauf- und Fressbuden entfaltet er seine ganz eigene visuelle Wirkung. Die Auskleidung mit schwarzem Samt verstärkt den warmen Schein der bunten Sterne und Häuser. Oft gehen Besucher vorbei, drehen den Kopf, sehen unsere Hütte und fangen verzaubert an zu lächeln. Kinderaugen leuchten, wenn sie uns entdecken. So verkaufe ich gerne. Meinen vier Kollegen geht es genauso. Wir haben uns alle auf eine Anzeige im Internet beworben. Schon das erste Treffen verlief vielversprechend. Sascha als Chef ist ein Glückstreffer. Er vertraut uns, wir vertrauen ihm. Alles läuft wie von selbst. Wir stehen in einer gemütlichen Hütte mit Heizmatte und Gasheizung und verdienen überaus zufriedenstellend. Der Burgstädter
Weihnachtsmarkt geht länger als die meisten – von Mitte November bis Ende Dezember. Am Nikolaustag, zu den Weihnachtsfeiertagen und zum Jahresausklang legt Sascha für jeden von uns eine Aufmerksamkeit ins Regal, ohne großes Aufsehen, einfach so. Das ist sehr angenehm und wertschätzend. Saschas Familie ist noch vom alten Schlag, Unternehmer mit sozialer Ader. Der Umsatz stimmt, das Wohlbefinden aller Beteiligten auch. Derart gut haben es nicht alle auf dem Weihnachtsmarkt. Mir wurde von einem Glühweinstand berichtet, dessen Betreiber Studentinnen einstellt, die den ganzen Tag ausschenken, einen Appel und ein Ei dafür bekommen, das Trinkgeld nicht behalten dürfen und sich Taschenkontrollen unterziehen müssen. Auf- und Abbau der Hütte sowie das Öffnen, das Schließen und die Reinigung übernehmen ausländische Billiglohnarbeiter. Der gepanschte Glühwein wird dafür gegen teure Taler zu einer wärmenden Weihnachtsmusikmischung aus Aprèski-Hits und Bumm-Bumm-Schlagern an den feierwütigen Endverbraucher gereicht. Der Rubel rollt! »Oh Du fröhliche, oh Du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit!« So gut meine Kollegen und ich es haben, etwas stört auch uns: der Broilerstand. Hinter unserem Leuchthäuschen verkauft ein nettes Pärchen alkoholische Getränke, daneben eine gut aufgelegte Damenbrigade aus Polen Fischbrötchen. Linksseitig füllen Lichterketten und Räuchermännchen die Auslage. Mit allen Betreibern verstehen wir uns gut, nur nicht mit dem Broilerstand rechts nebenan. Unter unserem Verkaufstresen befindet sich der Zugang zur Burgstädter Unterwelt: der Abfluss in die Kanalisation. Den nutzen die Damen vom Hähnchengrill täglich, um ihre fettige Restbrühe den Ratten zu überlassen. Sie kommen mit ihrem Eimerchen, beugen sich über den gusseisernen Deckel und kippen die nahrhafte Soße in den Gully. Unsere erstaunten Blicke werden dabei gekonnt ignoriert. Das Gesicht einer jeden Sondermüllentsorgerin drückt demonstrative Gleichgültigkeit aus, als wolle es sagen:
»Guckt nich‘ so blöde! Das haben wir immer schon so gemacht, das machen wir auch weiter so.«
Hundert Meter um die Ecke befindet sich die extra für den Weihnachtsmarkt eingerichtete Sammelstelle. Container für Papier, Glas, Plastik, Fette und Lebensmittel stehen Reih an Reih. Beim Sortieren helfen fleißige Mitarbeiter. Man muss nichts alleine tun. Der Weg ist den Damen offenbar zu weit. Sie interpretieren den Zugang zum Kanal als Standortvorteil. Aufsteigender Duft von ranzigem Fett und überreifem Geflügel reizt die Nasenschleimhäute. Nach einer Woche ist der Bereich vor unserer Hütte gut geschmiert und freut sich auf den ersten Ausrutscher. Bisher hat sich zum Glück niemand langgelegt. Spuren von wässrigem Blut, vermischt mit faserigen Fleischresten, verschönern das Abflussambiente. Steht der Wind ungünstig weht uns die Aasbriese direkt in die Hütte. Die ersten Kunden fragen uns, was hier so stinkt. Stumm zeigen wir zuerst auf die Fressbude, danach auf den Gully. Die Leute rümpfen die Nase und verziehen das Gesicht. Wir beschweren uns bei Sascha, der beschwert sich bei der Marktleitung. Die alten Hennen von nebenan kippen fröhlich weiter.
Ich sage einer von ihnen: »Wenn ihr euer altes Fett schon hier reinkippt, dann spült wenigstens richtig nach. Hier ist alles glatt und es sieht schlimm aus!«
»Das war ich nicht, das war meine Kollegin. Ich passe immer auf, dass nichts danebengeht.«
Gerda, meine Kollegin, eröffnet den Damen, dass ein furchtbarerer Geruch aus dem Gully steigt und sich die Besucher ekeln. Mit bitterböser Miene wird sie abgestraft. Hier sind Hopfen und Malz verloren. Wir reden aneinander vorbei. Sie stehen bereits seit Jahren hier, wir sind neu. Die Marktleitung sagt nichts – stecken wahrscheinlich alle unter einer Decke. Eine neue Beschwerde bei Sascha mit angehängtem Beweisfoto führt letztendlich doch zu einer Ermahnung. Zwei Tage ist Ruhe. Der Gestank bleibt. Dann entdeckt Gerda ein gut getarntes Rohr. Es entspringt hinter dem Broilerstand und führt bis kurz vor den Kanaldeckel. Wir sind sprachlos. Das Jahr nähert sich dem Ende. Der Weihnachtsmarkt schließt. Hoffentlich stehen wir im nächsten Jahr woanders. Doch halt! Dann würden wir den Höhepunkt der Weihnachtssaison verpassen: die Niederkunft des Heilandes, der sich getarnt als peruanischer Indianerhäuptling vors Kaufhaus stellt und Tag für Tag die heilige Botschaft mittels seiner Panflöte verbreitet. Es ist wie mit dem Laubbläser. Wehe, wenn er losgelassen. Das Kaufhaus liegt vis-à-vis unserer Sternenhütte. Somit erfahren wir dauerhaften Hörgenuss. Nur die Burgstädter Straßenbahnen unterbrechen die volle Beschallung des Öfteren. Ich kann inzwischen alle traditionellen Hochlandvolksweisen seines Stammes mitsummen. Zumindest die fünf, die in Dauerrotation aus dem CD-Player dudeln. Ich weiß, wann der Adler schreit, wann die Fußrasseln rasseln und wann der Flötist aus den Anden seinen Kopfschmuck aufsetzt. Die Melodien haben sich in meinen Datenspeicher eingebrannt. Jeden Tag spielt er die immergleichen Lieder. Menschentrauben bilden sich um ihn. Die Tonträger gehen weg wie warme Semmeln. Je kitschiger die Lieder, desto begeisterter die Leute. Für mich grenzt es an Folter, stundenlange Folter. Besonders tiefen Eindruck hinterlassen die weltberühmten peruanischen Panflötenhits Griechischer Wein, Ein Schiff wird kommen und das fulminante ABBA-Medley. Die hat er drauf wie kein zweiter. Dank der ständigen Wiederholung werden sie zum chronischen Ohrwurm. Auch meine Kollegen empfinden die musikalische Untermalung der Arbeitszeit als großen Segen. Wenn wir Glück haben, flötet er uns zur kommenden Weihnachtszeit wieder den Gehörgang voll.