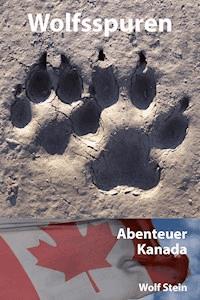Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Jan Becker hat die Schnauze voll vom Radio. Er kündigt seinen Job als Redakteur in Burgstadt und bewirbt sich als Praktikant im Nationalpark Seelitz in Mecklenburg-Vorpommern. Was er dort erlebt, ist ein amüsantes, spannendes, ja sogar hocherotisches Abenteuer, das sein Leben verändert. Eine überaus witzige und eindringliche Geschichte aus dem Reich von Kranich, Fischadler und Co.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 252
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wolf Stein
Der Praktikant
Erzählung
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Die Ankunft
In Amt und Würden
Auf Tour mit Klaus
Der Dieb
Die Hunde von Zhirow
Die Vogelstimmenwanderung
Bienenstich
Je oller, je doller
Die Zaster Bank
Auf der Jagd
Alles hat ein Ende
Impressum neobooks
Die Ankunft
Hans drehte sich zu mir.
»Als nächsten schlachten wir Seehofer.«
Verdutzt sah ich ihn an.
»Morgen geht es dem alten Rammler an die Gurgel. Dann kommt er in den Ofen.«
»Du gibst deinen Kaninchen Politikernamen?«
»Nur denen, die wir einen Kopf kürzer machen.«
Es war Anfang April und ungewöhnlich warm. Bereits der März hatte sich als sehr sonniger Monat präsentiert. Die Knospen der majestätischen Rotbuchen begannen früher zu sprießen als in anderen Jahren. Die Natur erblühte mit voller Wucht. Ich wollte mir von Hans nur eines seiner Fahrräder ausleihen und die neue Gegend erkunden. Doch der musste mir gleich sein ganzes Grundstück zeigen. Und nun stand er mit geschwollener Brust vor seiner Kaninchenzucht.
»Letzte Woche war Putin an der Reihe. Den hat der alte Hermann bekommen.«
Hans schmunzelte.
»Der hat sich dann erst mal bei mir beschwert, warum ich ihm ausgerechnet Putin bringe. Mensch Hans, hat er gesagt, Putin schmeckt bestimmt nicht, der ist doch ein zäher Hund.«
Putin - zäher Hund - das gefiel mir.
»Und was ist mit Merkel?« fragte ich grinsend.
»Ach, der haben wir schon vor Jahren das Fell über die Ohren gezogen. Konnte ja keiner ahnen, dass die als Ossi mal so hoch aufsteigt. Hätten wir gewusst, dass Merkel mal Bundeskanzlerin wird, hätten wir sie noch behalten. Aber geschmeckt hat Angie, das muss man ihr lassen.«
Einen köstlichen Humor besaßen sie offensichtlich, die Einwohner von Zhirow. Das beruhigte mich, denn mit ihnen sollte ich die nächsten drei Monate verbringen.
»Wir hatten mal einen mit extrem großen Löffeln, den nannten wir Genscher, und einen richtig fetten Sack, das war Kohl. Ich frage mich heute noch, wie der so dick werden konnte. Der hat bis zum Schluss nicht verraten, wer ihm heimlich das ganze Futter zugesteckt hat. Kaninchenehrenwort, verstehste? Der Kleine dahinten mit den Schlitzaugen hat auch schon seinen Namen weg …«
»… lass mich raten, der heißt bestimmt Rösler.«
»Genau! Ich sehe, du kennst dich aus. Wenn du mich fragst, ist der kleine Phillip ein von den Chinesen eingesetzter Geheimagent, der die deutsche Wirtschaft ausspionieren soll. Kleiner Scherz am Rande. Der helle da, das ist übrigens Brüderle, weil es der Bruder von Seehofer ist. Brüderle ist auch bald dran. Die alte Schnapsdrossel schenken wir meiner Schwester. Aber zuerst wird Seehofer das Zeitliche segnen. Zuerst die CSU und dann die FDP.«
Während wir über die Reihenfolge ihres Ablebens philosophierten, blickten uns die zum Tode verurteilten Politikerkaninchen unbeeindruckt an und mümmelten frisches Gras. Ich mochte Hans auf Anhieb - ein freundlicher Mann mit rauen Händen und halblangen blonden Haaren. Er war 55 Jahre alt und beim Nationalparkamt Seelitz als leitender Ranger angestellt. Der Schutz der hiesigen Umwelt, besonders der der uralten naturbelassenen Buchenwälder sowie der Seen- und Moorlandschaften im Herzen des Nationalparks fielen in seinen Zuständigkeitsbereich. Darauf war Hans stolz. Das konnte er auch sein. Von solch einem schönen und ehrenwerten Arbeitsplatz können die meisten nur träumen.
Dies tat auch ich, Jan Becker. Jan Becker aus Burgstadt. Nach etlichen Jahren als Redakteur beim Radio hatte ich die Schnauze voll. Nun war ich 33 und wollte meinem Leben endlich eine sinnvolle Wendung geben. Um genau zu sein: Ich wollte Parkwächter werden! Ich wollte wie Hans den ganzen Tag im Grünen verbringen und im Einklang mit der Natur meinen Alltag verleben. Wer zu lange beim Radio arbeitet, wird, wenn er es nicht schon von Anfang an ist, früher oder später irre. Das wollte ich mir ersparen. Radio Burgstadt war ein privater Radiosender mit einer durchaus respektablen Hörerreichweite. Knapp hunderttausend Stammhörer hatten ihre Empfangsgeräte dauerhaft auf unsere Frequenz justiert. Als Redakteur wurde ich gut bezahlt. Doch Geld ist nicht alles im Leben. Die Dinge liefen lange nicht mehr so wie zu Beginn. Auch privat lag einiges im Argen. Radio Burgstadt war nicht mehr Radio Burgstadt, wie ich es kannte. Es ging nur noch ums Verkaufen. Musik und Inhalt spielten kaum noch eine Rolle. Die Hörer wurden für blöd verkauft. Die Leidenschaft für meine Arbeit hatte mich verlassen. Meine Freundin, die ebenfalls bei Radio Burgstadt arbeitete, hatte einzig und allein ihre Karriere im Sinn und ließ sich mehr und mehr auf die dunkle Seite der Macht ziehen. Für meinen Geschmack nahmen sich einige Kollegen selbst viel zu ernst und wähnten sich als Mittelpunkt des Universums. Aber wir machten nur Radio. Sollte es Radio Burgstadt von heute auf morgen nicht mehr geben, wen würde es jucken? Die Welt würde sich genau so weiter drehen wie bisher. Ich hatte genug von alldem. Also kündigte ich meinen Job und meine Beziehung und bewarb mich kurzerhand im Nationalpark Seelitz um eine Praktikantenstelle, deren Ausschreibung ich zufällig im Internet entdeckt hatte.
Nationalparks interessierten mich seit meiner Jugend. Bevor ich mit 21 als Volontär bei Radio Burgstadt anheuerte, hatte mich mein Drang nach grenzenloser Freiheit bereits ins ferne Australien gezogen. Mehrere Monate tingelte ich durch das Land der Kängurus und Koalas. Wie viele meiner Altersgenossen reiste ich nur mit dem Rucksack auf dem Rücken. Das war ein Erlebnis! Auf einem Rastplatz in der Nähe von Alice Springs traf ich damals auf einen Australier namens Tony. Als er mir ein Bier anbot, konnte ich noch nicht ahnen, welch grandioses Abenteuer er mir bescheren würde. Wir verbrachten einige Tage zusammen und freundeten uns schnell an. Tony war ein absoluter Känguruexperte. Lag irgendwo eine Kängurukunkel im Sand, kniete sich Tony davor nieder, nahm sie zwischen Daumen und Zeigefinger, hielt die kleine Kugel gegen die Sonne, roch einmal daran, zerrieb das Ganze in der Hand, kostete ein Stück, spuckte es wieder aus und schon wusste er genau, welche Känguruart den Köttel wann dort abgelegt hatte. Ganz nebenher listete er im gleichen Zug die ausgeschiedenen Inhaltsstoffe auf. Einfach so. Dank dieser herausragenden Fähigkeiten leitete Tony als verantwortlicher Biologe und Ranger ein Projekt zur Wiederansiedelung einer vom Aussterben bedrohten Spezies im Grampians National Park in Victoria. Es handelte sich um sogenannte Brush-Tailed Rock-Wallabies, also um Bürstenschwanz Felsenkängurus. Diese Art war ungefähr zehn Jahre zuvor als in der Wildnis ausgestorben deklariert worden. Einige Monate, bevor ich Tony traf, hatte man als Krönung eines langwierigen Auswilderungsprozesses mehrere männliche und weibliche Zootiere wieder in den australischen Busch entlassen. Dank Tony durfte ich Teil des Einsatzteams werden und ein paar Wochen als Freiwilliger unbezahlt an dem Projekt mitarbeiten. Etwas Besseres hätte mir nicht widerfahren können. Ich konnte mein Glück kaum fassen. Die Wallabys wurden in einem kleinen Canyon ausgesetzt durch den ein nahezu ausgetrockneter Fluss seinen Weg geschnitten hatte und weiterhin schnitt. In den hohen Felswänden gab es genügend Höhlen und Spalten, in denen sich die Tiere verstecken konnten. Regelmäßig marschierten wir zu zweit in das für Besucher gesperrte Gebiet. Wir kontrollierten die an den Futterstellen installierten automatischen Kameras und die umliegenden Fuchsfallen, die zum Schutz der Tiere vor dem nicht gern gesehenen und vom Menschen eingeschleppten Invasor schützen sollten.
Als ich zum ersten Mal mit Tony entlang der Felsen kletterte, wunderte ich mich, dass er nichts trank. Das Klettern war sehr anstrengend und die australische Sonne brannte. Im Gepäck hatte ich eine Flasche Wasser, von der ich jedoch nichts trank. Im Geiste hatte ich einen kleinen sportlichen Wettbewerb eröffnet und wollte sehen, wer von uns der Fitteste war. Tony kletterte und kletterte, ohne zu trinken. Ich hinter ihm her.
»Der muss doch bald mal anhalten und etwas trinken«, dachte ich irgendwann.
Nichts. Tony kletterte immer weiter voran. Durst schien ein Fremdwort für ihn zu sein. Ich hielt lange mit, doch schließlich musste ich schwitzend und halb ausgetrocknet aufgeben.
»Warte Tony! Ich kann nicht mehr. Ich muss was trinken.«
Gierig öffnete ich meinen Rucksack und nahm einen belebenden Schluck aus der Wasserflasche.
»Sag mal, hast du überhaupt keinen Durst?«
Tony lachte und sagte: »Doch, aber ich trinke schon die ganze Zeit. Siehst du den Schlauch hier? «
Er deutete auf seinen schwarzen Rucksack.
»Den brauche ich nur zu nehmen und daran zu saugen. Das ist ein Rucksack mit Trinkvorrichtung.«
Ich hatte Tony schon für den direkten Nachfahren eines Wüstenkamels gehalten, aber so brauchte ich mich nicht zu wundern. Solch einen Wunderrucksack wollte ich nun auch unbedingt haben. Den sportlichen Wettbewerb erklärte ich sogleich für ungültig. Als ich mich ausreichend regeneriert hatte, ging unsere Kletterpartie weiter.
Die Tage in der Wildnis der Grampians waren spannend wie in einer Naturdokumentation. Nur eines störte mich. Ich hatte nicht nur keinen Rucksack mit integriertem Trinkschlauch, sondern auch keine Rangeruniform wie die Anderen. Die durfte ich als einfacher Hilfsarbeiter nicht tragen. Das wollte ich aber.
»Wenn schon, denn schon!« dachte ich mir.
Ich zerbrach mir den Kopf darüber, wie ich an solch eine Uniform mit Hose, T-Shirt, Hemd und Hut kommen würde. Eines Tages kam mir die zündende Idee. Die Australier essen gern, auch gern süß. Doch aufgrund der englischen Küche in Australien und der im Land vorherrschenden, für europäische Verhältnisse eher bescheidenen Esskultur kann man durchaus geteilter Meinung über Qualität und Geschmack der angebotenen Lebensmittel sein. Darin sah ich meine Chance. Untypisch für einen Jungen hatte ich mir von meiner Oma bereits frühzeitig das Backen beibringen lassen. Denn ich liebe Kuchen über alles - besonders Torten. Und meine Oma konnte Torten backen wie nur Omas Torten backen können. Bereits im frühen Jugendalter hatte ich meine Backtechniken perfektioniert und gelernt, diese Fähigkeit bei meinen Mitmenschen, gewinnbringend einzusetzen - gerade auch bei jungen Damen, auf die ich ein Auge geworfen hatte. Der Zufall wollte es, dass eine Frau für die Verteilung der Uniformen im Grampians National Park verantwortlich war. Also ging ich zu ihr, lehnte mich lässig über den Tresen und unterbreitete ihr ein verführerisches Angebot.
»Wenn ich eine Rangeruniform bekomme …«
»Was dann?« antwortete die Dame, indem auch sie sich lässig über den Tresen beugte.
»… dann backe ich drei Torten für euch.«
Ihre Augen wurden größer.
»Drei unterschiedliche Torten!« betonte ich.
Die Sache musste nicht länger diskutiert werden. Wenige Tage später standen eine Buttercremetorte, eine Apfelmarzipantorte und eine mit Puddingquark gefüllte Pfirsichtorte auf dem Tisch - bereit, mit Genuss verspeist zu werden. An die benötigten Zutaten zu kommen, gestaltete sich nicht ganz einfach, doch der Triumph sollte mir gehören. Heute hängt nicht nur eine Uniform in meinem Kleiderschrank in Burgstadt, nein, gleich zwei komplette Naturhütermonturen waren die Torten den Australiern wert. Das Ergebnis des Tauschgeschäfts konnte sich sehen lassen.
Komplett neu eingekleidet, wurde ich kurz vor meiner Rückreise nach Deutschland Zeuge einer atemberaubenden Expedition. Diese Expedition führte Biologen, Tierärzte und Wissenschaftler aus ganz Australien in die Grampians. Viele kamen nur, um die Felsenkängurus einmal in freier Wildbahn beobachten zu können. Zuvor hatten Tony und ich eine Woche lang spezielle Fallen in das Wallabygebiet geschafft. Jeden Tag lockten wir die Tiere mit neuem Futter direkt in die zwischen Felsbrocken und an Bäumen fixierten weichen Käfige. Die Fallen blieben zunächst offen, um die Tiere daran zu gewöhnen. Einige Zeit später, an einem ruhigen Sommerabend in der Dämmerung, wurden sie scharfgestellt. Brush-Tailed Rock-Wallabies sind sehr scheu. Kaum ein Mensch hat die Tiere je in der Natur zu Gesicht bekommen. Wenn überhaupt, vernimmt man oft nur einen flüchtenden Schatten. Deshalb nennen die Aborigines sie auch `The Shadow´. Als wir im Morgengrauen des nächsten Tages im Canyon einmarschierten, saßen alle Wallabys wie geplant in Gefangenschaft. Nun musste alles sehr schnell gehen, um die Beuteltiere nicht unnötigem Stress auszusetzten. Wir griffen beherzt in die Käfige, zogen die niedlichen Wallabys am Schwanzansatz heraus und stopften sie in braune Transportsäcke. Auf einer flachen Steinplatte im trockenen Flussbett hatten die Wissenschaftler und Tierärzte eine mobile Krankenstation errichtet. Dorthin brachten wir einen gefüllten Stoffsack nach dem anderen. Mit Lachgas wurden die Wallabys betäubt, vermessen und auf Herz und Nieren gecheckt. Blut wurde entnommen, die Antennen der Radiohalsbänder überprüft und die Beutel der Weibchen nach Jungen durchsucht. Die Wiederansiedelung schien erfolgsversprechend, denn zwei gesunde Beuteljungen im Frühstadium bekam ich an diesem aufregenden Tag zu Gesicht. Bis auf eines waren alle Tiere wohlauf. Das Sorgenkind hatte eine kleine Entzündung am Maul, die die Nahrungsaufnahme behinderte. Trotz der ärztlichen Versorgung fand Tony es Wochen später halb verwest im Canyon. Zu diesem Zeitpunkt war ich bereits wieder zu Hause. Als mein Visum ablief, musste ich die Grampians und die Wallabys schweren Herzens verlassen.
Seither hatten mich meine Urlaubsreisen immer wieder in die Nationalparks dieser Welt geführt. Und immer wieder spielte ich mit dem Gedanken, ein echter Ranger zu werden. Einen Versuch war es auf jeden Fall wert. Wenn nicht in Australien, Kanada oder sonst wo, dann eben in Deutschland. Und wenn nicht jetzt, wann denn dann? Mit 33 Jahren war ich nicht gerade der jüngste Praktikant aller Zeiten, doch Alter ist relativ. Der Nationalpark Seelitz schien genau das Richtige für mich zu sein - ein ziemlich großer Nationalpark in Mecklenburg nahe der polnischen Grenze mit traumhafter Landschaft.
Hans kramte in seinem verstaubten Holzschuppen und zottelte ein altes Herrenfahrrad hervor.
»Hier! Das sollte gehen, Verzeihung, fahren natürlich. Das sollte fahren. Licht und Klingel funktionieren zwar nicht, aber die Bremse haut hin. Quietscht ein bisschen, aber fährt. Warte, ich mach noch etwas Kettenöl dran.«
Er stiefelte zurück in den Schuppen.
»Weißt du was?« rief Hans. »Ich habe auch noch Bienen, bin Hobbyimker. Wenn du willst, kannst du mit zum Honigschleudern kommen.«
»Sehr gern, da sage ich nicht nein«, antwortete ich.
»Dauert aber noch bis Mai. Dann schleudern wir den ersten Honig.«
Hans kam wieder heraus mit einer Plastikflasche Universalöl in der Hand. Behutsam fettete er Glied für Glied und wischte einmal mit dem Lappen über die Kette.
»So! So gut wie neu!« meinte er. »Ich hoffe, du bist nicht allergisch gegen Bienenstiche? Kann durchaus sein, dass du den einen oder anderen abbekommst.«
Ich erwiderte: »Als Kind haben mich schon viele Bienen gestochen. Das macht mir nichts.«
Dann nahm ich den klapprigen Drahtesel, verabschiedete mich und radelte los.
»Also, bis später Hans.«
»Ja, mach‘s gut Junge.«
Von Hans hatte ich bei meiner Ankunft den Schlüssel für die Praktikantenunterkunft abgeholt. Er war mein Ansprechpartner für alles Organisatorische.
»Wenn du etwas brauchst, komm einfach vorbei«, gab er mir mit auf den Weg, nachdem er mir mein neues Zuhause gezeigt hatte.
Mein Wohnsitz im Nationalpark war für mich das Paradies - das Forsthaus von Zhirow. Frisch restauriert und sogar mit einer stabilen Internetverbindung versehen, lag es inmitten eines urigen, uralten Buchenwaldes, der zwei Jahre zuvor von der UNESCO zum Weltnaturerbe deklariert wurde. Es befand sich direkt an der Grenze zur Kernzone des Nationalparks. Außer mir durfte dort niemand wohnen. Ein Privileg, das ich zu schätzen wusste. Von Zhirow aus führte ein fünf Kilometer langer Waldweg durch den Buchenhain zu meiner einsamen Behausung. Für alle motorisierten Fahrzeuge, die nicht zum Nationalparkamt gehörten, herrschte striktes Durchfahrverbot. Ich hatte zwei Tage Zeit, um mich häuslich einzurichten, bevor mein Dienst an der Umwelt offiziell beginnen sollte. Also radelte ich mit Hans‘ klapperndem Fahrgestell in die nahegelegene Kleinstadt Altstielitz. Dort wollte ich mich mit ausreichend Lebensmitteln eindecken. In Zhirow gab es nichts, keinen Bäcker, keinen Fleischer, keinen Supermarkt. Nur köstliche Eier und Kartoffeln von Bauer Albrecht, wie ich herausfand.
»Hallo, ich bin Jan aus Burgstadt, der neue Praktikant aus dem Forsthaus«, sagte ich, als sich die Tür des Bauernhauses öffnete.
Bauer Albrecht stand im Blaumann vor mir und antwortete gelassen: »Selbst schuld, was?«
»Ich habe gehört, hier gibt es die besten Eier in ganz Mecklenburg.«
»So, hast du also gehört. Das möchte wohl sein. Na dann komm mal mit nach hinten. Eine Packung ist noch da. Bist ein Glückspilz, würde ich sagen.«
Gemeinsam gingen wir auf den Hof.
»Albrecht, der junge Mann hier ist der neue Praktikant aus dem Forsthaus! Möchte Eier von uns!« rief Bauer Albrecht.
Moment! Irgendwas konnte hier nicht stimmen. Wenn der Kerl im Blaumann nicht Bauer Albrecht war, wer dann?
»Gut Giesela. Dann werde ich die mal holen. Kannst du inzwischen die Hühner füttern?«
Der Hofbesitzer ging ins Haus und kam mir mit einer Packung Eier entgegen.
»Tach, ich bin Bauer Albrecht. Meine Frau Giesela hast du ja schon kennengelernt.«
»Frau?« dachte ich.
Giesela musste als Kind vertauscht worden sein. Hätte ich Albrecht und Giesela bei einer Gegenüberstellung als Bauersfrau und Bauer identifizieren müssen, ich hätte versagt. Auch eine Stimmenanalyse hätte sie nicht als Frau entlarvt.
»Was guckst du denn so? Ist dir nicht gut?« fragte Bauer Albrecht.
Ich versuchte, wieder ein normales Gesicht aufzusetzen und antwortete: »Nö, alles bestens. Danke für die Eier. Was bekommen Sie dafür?«
»Das macht 2,- Euro. Wenn’s geht, passend.«
Ich kramte das Geld aus meiner Hosentasche, bezahlte und stiefelte davon.
An Eier zu kommen war somit kein Problem. Für alles Weitere blieb mir keine andere Wahl, als wöchentlich den Weg zum Supermarkt nach Altstielitz auf mich zu nehmen - per Muskelkraft. Mein Fahrrad stand zu Hause in Burgstadt. Bevor ich es holen würde, musste Hans‘ Leihgabe für meine Touren herhalten. Es pendelte zwar ein Bus zwischen Zhirow und Altstielitz, aber das nur alle Jubeljahre. Und die Busfahrer in dieser Gegend hatten ebenfalls ihre Eigenarten.
Als ich einen Tag zuvor am Bahnhof in Altstielitz mit Sack und Pack in den Bus stieg und dem Fahrer freudig mein Ticket präsentierte, guckte mich dieser in aller Seelenruhe an, drehte gelangweilt den Kopf zurück, stierte aus dem Fenster und sagte `einfühlsam´: »Da fahr ich aber nich hin.«
Stille.
In Erwartung einer hilfreichen Erklärung verharrte ich stumm auf den Stufen des Eingangsbereiches. Vom Busfahrer, der unbeeindruckt auf seinem Lenkrad lehnte, kam nichts, keine Regung. In diesem Moment bog ein zweiter Bus um die Ecke. Der störrische Angestellte der Mecklenburger Verkehrsbetriebe runzelte leicht die Stirn, hob langsam die rechte Hand und deutete mit dem Zeigefinger auf den Kollegen im zweiten Bus.
Ja, so sind sie, die Mecklenburger. Mit denen muss man erst einmal warm werden.
Die Reise nach Zhirow wurde mir wahrlich nicht leicht gemacht. Bereits am Bahnhof in Burgstadt ging einiges schief. Nicht nur, dass mein Zug 30 Minuten Verspätung hatte und die deutsche Bahn so zuvorkommend war, den dadurch ohnehin schon völlig überfüllten Regionalexpress mit nur einem Abteil fahren zu lassen, nein, bereits der Ticketkauf war ein Fall für sich. Der Fahrkartenautomat konnte mich nicht leiden. Die Ticketausgabe blinkte und der Fahrschein wurde problemlos gedruckt, nur die mir zustehenden 4,50 Euro Wechselgeld behielt die Maschine für sich.
»Das fängt ja gut an«, dachte ich und murmelte: »Du blödes Ding!«
Verbale Beschimpfungen halfen jedoch nicht. Selbst die Androhung körperlicher Gewalt brachte den Automaten nicht dazu, mir mein Geld zurückzugeben. Ich ging zum Kundenschalter. Die diensthabende Bahnangestellte nahm meine Beschwerde mit einem Lächeln entgegen.
»Das ist kein Problem Herr Becker. Der Schaden wird selbstverständlich sofort von uns beglichen«, sagte sie freundlich.
Ich bin kein Pfennigfuchser, aber was sein muss, muss sein. Die Frau griff in ihre Kasse, öffnete eine frische Münzrolle und legte die zurückgeforderten Taler passend in meine Hand. Auf dem Weg zum Gleis kreuzte mein Weg dann erneut den widerwilligen Fahrscheinautomaten. Zwei junge Mädchen standen davor. Auch sie hatten eine Karte gelöst. Doch nun spielten sich ganz andere Szenen ab. Die Mädchen konnten es kaum fassen.
»Oh mein Gott«, schrie eine von ihnen, »wir sind reich!«
Währenddessen blinkte die Kartenausgabe unaufhörlich und spuckte ein Geldstück nach dem anderen aus. Es schien, als hätten die beiden Glückspilze den Jackpot des einarmigen Banditen im Spielcasino geknackt. Laut juchend hielten sie die Taschen auf. Alle angestauten Münzen ihrer Vorgänger wurden unaufhaltsam ans Tageslicht gespült.
»So ist es im Leben«, dachte ich, »manchmal verliert man und manchmal gewinnen die Anderen.«
In der Bahn ereignete sich die nächste Geschichte. Die Menschen drängten sich dicht an dicht - so, wie man sich eine gemütliche Zugfahrt vorstellt. Der einzige Sitzplatz, den ich gerade noch ergattern konnte, lag direkt vor der Zugtoilette. Auf dieser verrichtete seit einer gefühlten Ewigkeit eine alte Frau ihr Geschäft.
»Mensch Oma! Wie lange brauchst du denn? Wirst du heute noch fertig?« rief ihr vielleicht achtjähriger Enkel lauthals durch den Zug.
Damit sorgte er für schmunzelnde Gesichter unter den Fahrgästen. Er musste offensichtlich dringend selbst auf das besetzte stille Örtchen. Seine Eltern orderten ihn zurück an seinen Platz.
»Aber ich muss mal! Oma soll hinmachen!«
Schließlich kam seine Oma vom WC. Der Junge sprang auf, lief hinein und verschloss die Tür. Keine Sekunde später schnellte die Drehtür wieder auf und der Enkelsohn stürzte mit großen Augen hervor.
»Orrrr, Oma! Daaaaas stiiinkt! Da kann ich nicht rein gehen. Mama, Oma hat richtig einen in die Schüssel gelegt. Das hält kein Mensch aus.«
Leises Kichern verbreitete sich im Abteil.
Peinlich berührt sagten die Eltern: »Musst du nun, oder musst du nicht?«
Der Junge sah mich mit ängstlichen Augen an. Mit einem tiefen Atemzug und dicken Backen verabschiedete er sich und schloss todesmutig die Tür. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, er schaffte es, drei Minuten lang die Luft anzuhalten.
Als der vollbeladene Schweinetransport Altstielitz erreichte, atmete ich auf. Mich dürstete es nach frischer Luft. Mit der Bahn kannst du immer was erleben. Ich war heilfroh, die Zugfahrt überlebt zu haben. Wobei, die Tour war ja noch lustig und harmlos. Ein Freund von mir arbeitet als Seelsorger bei der Bahn. Der kann Geschichten erzählen! Leider handeln fast alle von Personenschäden im Gleisbett. Die kommen öfter vor, als man gemein hin denkt. Besonders in den dunklen und nebligen Monaten stürzen sich Menschen jeden Alters vor einen Zug. Die Wahl der Lebensmüden fällt dabei häufig auf Güterzüge. Das sind die beliebtesten Todmacher unter den Schienenfahrzeugen. Um das unter Schock stehende Bahnpersonal und um jene, die das, was übrig bleibt, von den Gleisen kratzen müssen, kümmert sich mein Kumpel Rainer. Beim ICE-Unglück von Enschede war er einer der ersten vor Ort, um den Seelenzustand der Helfer und Retter wieder geradezubiegen. Ich könnte das nicht. Was soll man auch groß sagen, wenn Eltern ihren beiden Kindern die Augen zubinden, sich zu viert auf die Gleise stellen und auf den nächsten ICE warten? Ist alles schon passiert. Besser, man erfährt von solchen Dingen gar nicht erst.
»Vor Jahren«, erzählte mir Rainer einmal, »kam eine junge Notärztin an die Unglücksstelle. Plötzlich rannte sie weg. Apathisch und kreidebleich fanden wir sie auf einem Rapsfeld wieder. Weißt du, warum sie weggerannt ist? Es war ihr eigener Mann, dessen Einzelteile dort unter dem Güterzug lagen. Der hatte sich aus Eifersucht das Leben genommen. Das Schlimme ist, dass er sich die Strecke und den Zeitpunkt extra ausgesucht hatte, weil er genau wusste, dass seine Frau zu diesem Zeitpunkt Notdienst haben und wahrscheinlich diejenige sein wird, die man zum Ort des Geschehens ruft. Ein schöner Abschied, nicht wahr?«
Bei solchen Geschichten stellen sich einem doch die Nackenhaare nach oben. Was Menschen sich und anderen alles antun, da kann man nur mit dem Kopf schütteln. Solche Geschichten konnten mir in meinem neuen Zuhause, dem Forsthaus von Zhirow, egal sein. Hier hatte ich meine Ruhe vor eifersüchtigen Selbstmördern und Personenschäden im Gleisbett. Um mich herum entfaltete sich die pure Natur. Zurück aus Altstielitz stellte ich den Drahtesel gegen die rote Backsteinwand und trug meine Einkäufe in die Küche. Es wurde langsam dunkel. Drei Stunden hatte es mich gekostet, in der Stadt alles Nötige zu besorgen. Ich nahm ein altes Holzbrett von der Wand, schmierte mir ein Salamibrot, stellte den Küchenstuhl nach draußen, setzte mich und feierte die neue Freiheit mit einem Willkommensbier.
In Amt und Würden
Vor dem Forsthaus erstreckte sich eine wilde Wiese mit einem kleinen matschigen Teich in der Mitte. Dahinter lag ein großes Moor, das wiederum in den Zhirower See überging. Der Teich war Heimat unzähliger Moorfrösche. Die Amphibien befanden sich in der Balz. Das Gute an Moorfröschen ist, dass sie nicht lautstark um die Wette quaken, um bei den Weibchen Eindruck zu schinden. Anstatt zu lärmen, färben sich die Männchen im Frühjahr für kurze Zeit blau und buhlen mit der Pracht ihrer Farbe um die Gunst der auserwählten Fröschin. Nie zuvor hatte ich dieses Phänomen, das nur wenige Tage andauert, mit eigenen Augen beobachten können. Als die Sonne über die Wipfel der Bäume blinzelte, erstrahlte der gesamte Tümpel im typisch bläulich-violetten bis himmelblauen Moorfroschblau. Es war mein erster Arbeitstag. Erst gegen Mittag musste ich im Nationalparkamt erscheinen. Also schnappte ich meinen Fotoapparat und knipste wild auf meine balzenden Nachbarn los. Die Fotografie war eines meiner Hobbys. Fototechnisch war ich nicht die hellste Leuchte im Lampenladen, doch ich hatte den Blick für das Motiv. Der ist oft wichtiger als die richtige Belichtungszeit. Meine technischen Defizite glich meine vollautomatische Kamera problemlos aus.
Dank der Liebe zur Fotografie und meiner Arbeit in Burgstadt bekam ich den Zuschlag für das Praktikum. Das Nationalparkamt suchte einen Praktikanten für das SG ÖA - das Sachgebiet Öffentlichkeitsarbeit. Hierfür war ich genau der Richtige. Texte schreiben konnte ich und der Umgang mit der Presse, den Medien und der Öffentlichkeit stellte ebenfalls kein Problem dar. Die Zaster Bank Altstielitz, Partner des Nationalparks, sponserte seit einigen Jahren das Praktikum. Ich hätte den Job auch umsonst gemacht, doch so erhielt ich jeden Monat ein Gehalt von 500,- Euro, für einen Praktikanten nicht schlecht. Dazu noch die Wohnlage - fast könnte man meinen, ich wäre im Urlaub.
Nachdem ich das Balzverhalten der blauen Frösche digital für die Ewigkeit festgehalten hatte, ging ich mit nassen Füßen zurück ins Forsthaus und machte mir ein Pausenbrot für die erste Schicht. Nun musste ich mich beeilen, denn ich kannte den Weg zum Nationalparkamt noch nicht. Mit dem Fahrrad würde es sicher eine ganze Weile dauern, erst recht mit Hans‘ Klapperkiste. Das Amt lag ungefähr 20 Kilometer von meiner Position entfernt in einem Ort namens Bergwitz. Die Strecke musste ich von jetzt an zweimal pro Tag bestreiten - zum Nationalparkamt hin und wieder zurück ins Forsthaus. Eine Gesamtstrecke von 40 Kilometern, die sollte fithalten.
Im spartanisch eingerichteten Wohnzimmer lag eine Wanderkarte, in der auch die alten Wege der Forstwirtschaft eingezeichnet waren. An denen orientierte ich mich. Ich nahm die Karte und ging aus dem Haus. In kurzen Hosen und mit Rucksack auf dem Rücken trat ich in die Pedale. Ich bin ein guter Radfahrer, doch mein klappriges Fortbewegungsmittel erschwerte mir das Vorankommen.
»Meine Güte«, dachte ich, »am Wochenende hole ich sofort mein eigenes Fahrrad hier her.«
Hans‘ Leihgabe in allen Ehren, aber hier musste ein richtiges Kettenfahrzeug an den Start, mit Gangschaltung. Der hüglige Weg nach Zhirow verlangte mir alles ab. Vereinzelte Betonplatten wechselten sich mit mal festerem, mal weicherem Wald- und Sandboden ab. Das ging in die Beine. Doch so schwer der Weg, so schön das Drumherum. Ich kam mir vor wie in einem grünen Tunnel. Kathedralengleich überdachten beeindruckende Rotbuchen den Weg. Unzählige Sonnenstrahlen durchbrachen das frisch grünende Dach des Waldes wie Scheinwerfer. Ein märchenhafter Moment. Das Licht fiel auf ein Meer von weiß- und gelbblühenden Buschwindröschen. Diese umbetteten alte moosbewachsene Baumstämme. In diesem Augenblick war ich mir sicher, mit dem Antritt meines Praktikums alles richtig gemacht zu haben. So etwas kann man mit keinem Geld der Welt bezahlen. Die Natur zog mich mit ihrer Schönheit in den Bann. Unterbrochen wurde dieser bezaubernde Buchenhain nur von einigen riesigen Douglasien, die sich am Wegesrand kerzengerade in den Himmel bohrten. Aus den Stämmen der Nadelbäume wurden früher die Masten großer Schiffe gebaut. Fasziniert nach oben blickend, bemerkte ich nicht, dass vor mir gerade eine Bache dabei war, ihren niedlichen Frischlingen die Welt zu zeigen. Ebenso wenig achtete die Wildschweinfamilie auf mich. Erst als die kleinen Schweinchen verängstigt quickten und sich Schutz suchend neben mir auf den Waldboden drückten, registrierte ich die Ferkelbande. Die Mutter befand sich glücklicherweise einige Meter entfernt. Sie grunzte tief und laut. Schnell sprangen die Frischlinge auf und suchten eiligst das Weite. Das Fahrrad und ich lagen im Sand. Durch ein beherztes Brems- und Fallmanöver hatten wir uns direkt in die waagerechte Position begeben. Beinah wäre es zu einem blutigen Wildunfall zwischen Drahtesel und Schwein gekommen, doch so konnten sich alle Beteiligten unversehrt an die Verrichtung ihres Tagwerks machen. Hier draußen galten keine Verkehrsregeln und Vorfahrtsschilder gab es nicht.
Kurz vor Zhirow änderte sich das Bild. Der nahezu unberührte Buchenwald wandelte sich in einen Forst aus gepflanzten Kiefern. In Reih und Glied standen die Nadelbäume mit ihren dünnen Stämmchen nebeneinander. Viele halten das für echten Wald. Sie finden es sogar schön, weil alles so ordentlich aussieht und man dort unbeschwert Pilze sammeln kann. Doch echter Wald sieht anders aus. Den hatte ich gerade verlassen. Kiefernforste sind reine Nutzwälder. Witterungs- und schädlingsanfällig, dienen solche Monokulturen der reinen Holzgewinnung. Hier im Nationalpark bildeten sie die Überreste einer alten Zeit. Nachdem das ganze Gebiet unter Schutz gestellt wurde, holzte man die Forste aus, um dem natürlichen Regenerationsprozess unter die Arme zu greifen. Irgendwann würden die jungen Buchen, die sich bereits mühsam durch die übriggebliebenen Kiefern nach oben kämpften, ihre Kronen ausbreiten und wieder die alleinige Herrschaft übernehmen.
Ich erreichte Zhirow und fuhr vorbei an Hans‘ Kaninchen und Bauer Albrechts Hühnern. Dann überquerte ich die einzige asphaltierte Straße, die Landstraße nach Altstielitz. Ich passierte das Dorf und schon ging es wieder in den Wald. Laut Karte musste ich immer nur geradeaus, über die Bahnschienen, einmal nach links und wieder nach rechts. Komischerweise gab es weitaus mehr Forstwege, als auf meiner Karte verzeichnet waren. Und so kam, was kommen musste. Nach einer zweistündigen Irrfahrt durch ein Labyrinth aus Waldstraßen erreichte ich Bergwitz - durchgeschwitzt und mit einiger Verspätung. Ausgerechnet am ersten Tag. Gekrönt wurde die Odyssee kurz vor Erreichen des Nationalparkamtes von einem ungemein steilen Anstieg, der sich mir unverhohlen in den Weg warf. An dessen Ende thronte erhaben ein kleines, herausgeputztes Schloss, Schloss Bergwitz, seines Zeichens Sitz des Nationalparkamtes.
»Nicht schlecht für ein Amt«, dachte ich.
In unmittelbarer Nähe erhoben sich zwei Plattenbauten aus dem Boden. Ohne Fenster, grau und verlassen bildeten sie einen krassen Gegensatz zum ehemaligen Adelssitz - optisch, politisch und geschichtlich. Ich fuhr bis zur Schlosstreppe, stellte das Fahrrad ab und ging hinein. Auf meinem Weg zum Sekretariat, der mich durch hohe Flure führte, traf ich Hans. Normalerweise arbeitete er in seinem Büro in der Nationalparkinformation in Altstielitz oder war irgendwo im Park unterwegs, doch heute besuchte er das Amt, um an der wöchentlichen Sachgebietsleiterversammlung teilzunehmen.
»Tag Jan. Gut geschlafen?«
»Naja, war ein bisschen laut draußen.«