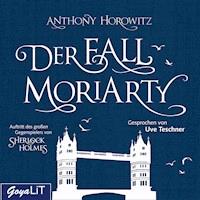
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Goyalit
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Londoner Unterwelt ist in Aufruhr: Der gefürchtete amerikanische Gangster Clarence Devereux will seine Geschäfte nach England ausdehnen. Auch Professor Moriarty soll seine Hände im Spiel haben – aber ist er nicht, ebenso wie Sherlock Holmes, an den Reichenbachfällen in den Tod gestürzt? Und welche Rolle spielt der undurchsichtige Detektiv Chase, der plötzlich in London auftaucht? Als der Machtkampf der Giganten des Verbrechens seine Opfer fordert und eine grausam zugerichtete Leiche gefunden wird, macht sich Inspector Jones von Scotland Yard daran, die Machenschaften des Amerikaners aufzudecken. Eine blutige Spur führt von den Docks bis in die Katakomben des Smithfield Meat Market. Kann es sein, dass Moriarty noch lebt? Ganz in der Tradition seines Sherlock-Holmes-Romans Das Geheimnis des weißen Bandes schickt Anthony Horowitz erneut die Ermittler von Scotland Yard auf Verbrecherjagd – und Athelney Jones beweist, dass er Sherlock Holmes ein würdiger Nachfolger ist.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Londoner Unterwelt ist in Aufruhr: Der gefürchtete amerikanische Gangster Clarence Devereux will seine Geschäfte nach England ausdehnen. Auch Professor Moriarty soll seine Hände im Spiel haben – aber ist er nicht, ebenso wie Sherlock Holmes, an den Reichenbachfällen in den Tod gestürzt? Und welche Rolle spielt der undurchsichtige Detektiv Chase, der plötzlich in London auftaucht? Als der Machtkampf der Giganten des Verbrechens seine Opfer fordert und eine grausam zugerichtete Leiche gefunden wird, macht sich Inspector Jones von Scotland Yard daran, die Machenschaften des Amerikaners aufzudecken. Eine blutige Spur führt von den Docks bis in die Katakomben des Smithfield Meat Market. Kann es sein, dass Moriarty noch lebt?
Ganz in der Tradition seines Sherlock-Holmes-Romans Das Geheimnis des weißen Bandes schickt Anthony Horowitz erneut die Ermittler von Scotland Yard auf Verbrecherjagd – und Athelney Jones beweist, dass er Sherlock Holmes ein würdiger Nachfolger ist.
Anthony Horowitz, geboren 1956 in Stanmore, lebt mit seiner Familie in London. Er ist einer der erfolgreichsten Autoren der englischsprachigen Welt, in Deutschland ist er vor allem durch seine Jugendbuchreihe um Alex Rider bekannt. Neben zahlreichen Büchern hat Anthony Horowitz Theaterstücke und Drehbücher zu verschiedenen Filmen und Fernsehserien (unter anderem Inspector Barnaby) verfasst. 2003 wurde Anthony Horowitz der renommierte Red House Children's Book Award verliehen.
ANTHONY HOROWITZ
Der Fall Moriarty
Eine Geschichte von Sherlock Holmes'großem Gegenspieler
Roman
Aus dem Englischen von Lutz-W. Wolff
Insel Verlag
Die Originalausgabe erschien 2014 unter dem Titel Moriarty bei Orion Books, London
eBook Insel Verlag Berlin 2015
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des insel taschenbuchs 4409.
© Insel Verlag Berlin 2014
© Anthony Horowitz 2014
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr.
Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Umschlaggestaltung: glanegger.com, München
Umschlagabbildung: shutterstock
Satz: Satz-Offizin Hümmer GmbH,Waldbüttelbrunn
Für meinen Freund Mathew Marsh und in Erinnerung an Henry Marsh 1982-2012
Der Fall Moriarty
The Times, London, 24. April 1891
leiche in highgate gefunden
Die Polizei hat offenbar keine Erklärung für einen besonders brutalen Mord in der Nähe der Merton Lane in der sonst so lieblichen und stillen Gemeinde Highgate. Der Tote, ein junger Mann Anfang zwanzig, ist in den Kopf geschossen worden, aber von besonderem Interesse für die Polizei ist die Tatsache, dass seine Hände gefesselt waren. Inspektor George Lestrade, der die Ermittlungen leitet, neigt deshalb zu der Ansicht, dass die schreckliche Tat die Form einer Hinrichtung hatte und möglicherweise in Zusammenhang mit den Unruhen steht, die Londons Straßen kürzlich erschüttert haben. Nach seinen Angaben handelt es sich bei dem Opfer um Jonathan Pilgrim, einen Amerikaner, der in einem privaten Club in Mayfair gewohnt hat und aus geschäftlichen Gründen in der Hauptstadt gewesen sein soll. Scotland Yard hat Kontakt mit der amerikanischen Botschaft aufgenommen, aber die Heimatadresse des Toten konnte bislang noch nicht festgestellt werden und es kann Wochen dauern, bis sich etwaige Angehörige melden. Die Ermittlungen dauern an.
1Die Reichenbachfälle
Glaubt irgendjemand wirklich, was an den Reichenbachfällen passiert ist? Viele Berichte sind darüber geschrieben worden, aber mir scheint, dass bei allen das Wichtigste fehlt … nämlich die Wahrheit. Nehmen wir zum Beispiel das Journal de Genève und Reuters. Ich habe sie von vorn bis hinten gelesen, was keineswegs leicht ist, denn sie sind in dieser qualvoll trockenen Art der meisten europäischen Blätter geschrieben, bei denen man immer den Eindruck hat, dass sie die Nachrichten nur zwangsweise abdrucken und nicht weil sie irgendwem etwas mitteilen wollen. Und was genau haben sie mir mitgeteilt? Dass Sherlock Holmes und sein herausragender Widersacher, Professor James Moriarty, sich getroffen haben und beide gestorben sind. Wenn man danach geht, wie viel Dramatik diese beiden maßgeblichen Presseorgane in ihre spröde Prosa einfließen ließen, könnte man denken, dass es um einen Verkehrsunfall ging. Sogar die Überschriften waren todlangweilig.
Aber was mich am meisten verblüfft, ist der Bericht von Dr. John Watson. Er beschreibt die ganze Geschichte im Strand Magazine, und sie fängt damit an, dass jemand am Abend des 24. April 1891 an die Tür seines Sprechzimmers klopft. Dann berichtet er von seiner Schweizreise. In meiner Bewunderung für den Chronisten, der die Abenteuer, Heldentaten, Fallstudien und Erinnerungen des großen Detektivs niedergeschrieben und veröffentlicht hat, lasse ich mich von niemandem übertreffen. Jetzt, wo ich vor meiner Remington-Nummer-Zwei-Schreibmaschine sitze (einer amerikanischen Erfindung natürlich) und dieses große Werk beginne, ist mir vollkommen bewusst, dass ich mich mit der Genauigkeit und Unterhaltsamkeit nicht messen kann, die er bis zuletzt aufrechterhielt. Dennoch muss ich mich fragen: Wie konnte er das alles so falsch verstehen? Wie konnte er Widersprüche übersehen, die selbst dem hirnlosesten Polizeichef noch absolut offensichtlich gewesen wären? Robert Pinkerton pflegte zu sagen: Eine Lüge ist wie ein toter Coyote. Je länger man ihn liegen lässt, desto mehr stinkt er. Er wäre der Erste gewesen, der gesagt hätte, dass die Geschichte von den Reichenbachfällen stank.
Sie müssen mir vergeben, wenn ich allzu emphatisch erscheine, aber meine Geschichte – diese Geschichte – beginnt nun einmal am Reichenbach und das Folgende ist unverständlich ohne eine genaue Untersuchung der Fakten. Wer ich bin? Nun, damit Sie wissen, in wessen Gesellschaft Sie sich befinden, will ich Ihnen sagen, dass mein Name Frederick Chase ist, ferner gehört es zu meiner Geschichte, dass ich Chefermittler bei der Detektivagentur Pinkerton in New York bin und damals zum ersten und wohl auch letzten Mal in Europa war. Meine Erscheinung? Nun, es ist wohl für niemanden einfach, sich selbst zu beschreiben, aber ich will ehrlich sein und gestehen, dass ich keine Schönheit bin. Mein Haar war damals noch schwarz, meine Augen sind von einem unauffälligen Braun. Ich war schlank, aber obwohl ich erst Mitte vierzig war, war ich von den Herausforderungen, die mir das Leben gestellt hat, schon arg mitgenommen. Verheiratet war ich nicht, und ich fragte mich manchmal, ob man das meiner Garderobe ansah, die wahrscheinlich ein bisschen zu gut getragen war. Wenn ein Dutzend Menschen in einem Raum saßen, war ich immer der Letzte, der etwas sagte. Das war meine Natur.
An den Reichenbachfällen war ich fünf Tage nach dem Zusammenstoß, den die Welt als »Das letzte Problem« kennt. Nun, wie wir heute wissen, war es durchaus nicht das Letzte, sondern eher das Erste von vielen Problemen.
Also! Fangen wir beim Anfang an!
Sherlock Holmes, der größte beratende Detektiv, der je gelebt hat, flüchtet aus England, weil er um sein Leben fürchtet. Dr. Watson, der diesen Mann besser als jeder andere kennt und nicht dulden würde, dass jemand ein böses Wort über ihn sagt, muss zugeben, dass Holmes derzeit nicht gerade in bester Form ist, sondern völlig ermattet von einer Zwangslage, die er nicht beherrscht. Kann man es ihm verübeln? Im Verlauf eines einzigen Vormittags ist er nicht weniger als dreimal angegriffen worden. Auf der Welbeck Street ist er nur um Haaresbreite einem zweispännigen Fuhrwerk entronnen, das ihn zu überrollen drohte. Beinahe wäre er von einem Ziegelstein erschlagen worden, der von einem Dach an der Vere Street auf ihn herunterfiel – oder geworfen wurde. Und direkt vor Watsons Tür wird er von einem netten Menschen angegriffen, der dort mit einem Knüppel auf ihn gewartet hat. Hat er überhaupt eine andere Wahl, als zu flüchten?
Ja, hat er. Es gibt so viele andere Möglichkeiten, dass man sich fragt, was eigentlich in seinem Kopf vorging – wie so oft, wenn man seine Geschichten liest. Mir ist es jedenfalls nie gelungen, das Ende vorher zu erraten (was vielleicht nicht viel bedeutet). Zunächst einmal: Wieso glaubt er eigentlich, dass er auf dem Kontinent sicherer wäre als zu Hause in England? London ist eine eng verflochtene, brodelnde Stadt, die er genau kennt, und wo er (wie er Watson einmal anvertraut hat) fünf Zufluchtsorte hat, kleine, überall in der Stadt verteilte Wohnungen, deren Adressen nur ihm bekannt sind.
Er hätte sich auch verkleiden können. Das tut er doch sowieso. Gleich am nächsten Tag bemerkt Watson, als er Victoria Station betritt, einen alten italienischen Priester, der mit einem Gepäckträger streitet. Später setzt sich der alte Mann zu ihm ins Abteil, und die beiden plaudern ein paar Minuten, ehe Watson seinen besten Freund in dem Priester erkennt. Die Verkleidungen von Sherlock Holmes waren so brillant, dass er die nächsten drei Jahre als katholischer Priester hätte verbringen können, ohne dass jemand etwas gemerkt hätte. Er hätte in ein italienisches Kloster eintreten können. Padre Sherlock … Das hätte seine Feinde total in Verwirrung gestürzt und ihm vielleicht sogar Zeit für einige seiner Hobbys gelassen wie zum Beispiel die Imkerei.
Stattdessen bricht Holmes zu einer wilden Hetzjagd auf, die keinerlei Plan zu folgen scheint, und bittet Watson auch noch, ihn zu begleiten. Warum? Auch der unfähigste Kriminelle wird doch darauf kommen, dass sich da, wo der eine ist, früher oder später auch der andere einfinden wird. Und dabei dürfen wir nicht vergessen, dass wir hier von keinem gewöhnlichen Kriminellen reden, sondern von dem Meister seines Fachs, einem Mann, der von Holmes persönlich ebenso gefürchtet wird wie bewundert. Ich glaube keine Minute, dass er Moriarty irgendwie unterschätzt hat. Der gesunde Menschenverstand sagt mir, dass er ein ganz anderes Spiel gespielt haben muss.
Sherlock Holmes reist über Canterbury, Newhaven und Brüssel nach Straßburg und wird dabei auf jedem Schritt seines Weges verfolgt. In Straßburg erhält er ein Telegramm von der Londoner Polizei, das ihn darüber informiert, dass alle Mitglieder von Moriartys Bande festgesetzt worden seien. Das ist, wie sich bald herausstellt, vollkommen falsch. Zumindest eine Schlüsselfigur ist durch das Netz geschlüpft, obwohl ich diesen Ausdruck hier gänzlich zu Unrecht verwende; denn der dicke Fisch – und als solchen kann man Colonel Sebastian Moran wohl bezeichnen – ist nicht einmal in die Nähe der Maschen gekommen.
Colonel Moran, der beste Scharfschütze in Europa, war übrigens auch der Agentur Pinkerton bestens bekannt. Am Ende seiner Karriere kannten ihn alle amtlichen und privaten Gesetzeshüter auf dem Planeten. Er war berühmt und berüchtigt dafür, dass er in Rajasthan einmal innerhalb einer Woche elf Tiger erlegte, eine Heldentat, die andere Großwildjäger ebenso verblüffte, wie sie die Mitglieder der Royal Geographical Society empörte. Holmes nannte ihn den zweitgefährlichsten Mann in ganz London – vor allem auch deshalb, weil seine einzige Motivation das Geld war. Den Mord an Mrs Abigail Stewart aus Lauder zum Beispiel, einer überaus ehrbaren Witwe, der während einer Partie Bridge in den Kopf geschossen wurde, hat er nur begangen, damit er seine Spielschulden im Bagatelle Card Club bezahlen konnte. Es ist schon eigenartig, sich vorzustellen, dass Moran nur hundert Meter entfernt auf einer Hotelterrasse saß und Kräutertee trank, als Holmes das Telegramm von Scotland Yard las. Nun ja, die beiden würden sich bald genug treffen.
Von Straßburg fährt Holmes nach Genf und verbringt eine Woche damit, die schneebedeckten Höhen und hübschen Dörfer des oberen Rhonetals zu erkunden. Watson beschreibt dieses Zwischenspiel als »bezaubernd«, was nicht gerade das Wort wäre, das ich unter den gegebenen Umständen gebraucht hätte, aber ich glaube, man kann nur staunen, wie diese beiden Männer sich in solcher Gefahr zu entspannen vermochten. Holmes fürchtet immer noch um sein Leben, und es kommt auch tatsächlich zu einem weiteren Zwischenfall: Als sie auf einem Fußweg am stahlgrauen Wasser des Daubensees dahinwandern, wird Holmes fast von einem Felsbrocken erschlagen, der plötzlich von dem darüberliegenden Berghang herabrollt. Der örtliche Führer versichert ihm, dass Steinschlag in dieser Gegend nichts Ungewöhnliches sei, und ich neige dazu, ihm zu glauben. Ich habe mir die Karte angesehen und die Entfernungen verglichen. Soweit ich erkennen kann, ist sein Feind ihm längst voraus und wartet auf ihn. Trotzdem ist Holmes überzeugt, dass es ein Attentat war, und verbringt den Rest des Tages voll Angst.
Schließlich erreicht er das Dorf Meiringen an der Aare, wo er und Watson im Englischen Hof übernachten, einem Gasthaus, das von einem früheren Kellner des Grosvenor Hotels in London betrieben wird. Dieser Mann, ein gewisser Peter Steiler, ist es auch, der den Vorschlag macht, dass Holmes die Reichenbachfälle besuchen soll, und die Schweizer Polizei wird ihn deshalb eine Zeitlang verdächtigen, im Auftrag von Moriarty gehandelt zu haben, was wohl einiges über die Ermittlungstechnik der Schweizer Polizei aussagt. Wenn Sie mich fragen: Die hätten die größten Schwierigkeiten, eine Schneeflocke auf einem Alpengletscher zu finden. Ich bin in diesem Gasthof gewesen und habe Steiler persönlich befragt. Er war nicht bloß unschuldig. Er erwies sich als ein sehr einfältiger Mensch, der kaum seine Nase aus den Töpfen und Pfannen hob (eigentlich führte seine Frau das Hotel). Ehe ihm alle Welt die Bude einrannte, hat er gar nicht gewusst, wer sein berühmter Gast gewesen war, und seine erste Reaktion auf die Nachricht vom Tod des Detektivs bestand darin, dass er auf seine Speisekarte ein Fondue Sherlock Holmes setzte.
Natürlich empfahl er die Reichenbachfälle. Es wäre verdächtig gewesen, wenn er das nicht getan hätte. Sie waren schon damals ein beliebtes Reiseziel für Romantiker und Touristen. In den Sommermonaten findet man bis zu einem halben Dutzend Künstler auf dem bemoosten Pfad, die festzuhalten versuchen, wie das Schmelzwasser des Rosenlauigletschers in eine dreihundert Fuß tiefe Schlucht fällt. Und dabei scheitern. Denn es liegt eine absolut unwirkliche Aura über diesem düsteren Ort, die sich nur den Pastell- und Ölgemälden der allergrößten Maler erschließen würde. Ich habe in New York Werke von Alfred Parsons und Emanuel Leutze gesehen – vielleicht wären die in der Lage, aus den Reichenbachfällen etwas zu machen. Diese Schlucht war wie ein Weltuntergang, eine ständige Apokalypse von donnerndem Wasser und dampfender Gischt, die Vögel mieden sie und kein Sonnenstrahl drang hinein. Eingeschlossen war diese rasende Sintflut von steil aufragenden Felswänden, die so alt wie Rip van Winkle sein müssen. Eine Neigung zum Melodramatischen hatte Sherlock Holmes ja schon mehrfach bewiesen, aber noch nie so wie hier. Es war das perfekte Bühnenbild für ein großes Finale, das – wie der Wasserfall selbst – durch kommende Jahrhunderte nachhallen sollte.
An dieser Stelle allerdings werden die Dinge ein wenig unklar.
Holmes und Watson stehen eine Weile zusammen und wollen ihren Weg gerade fortsetzen, als sie vom Eintreffen eines blonden, pausbäckigen, etwas dicklichen Jungen von etwa vierzehn Jahren überrascht werden. Und diese Überraschung ist nicht unberechtigt. Denn der junge Mann ist bis aufs i-Tüpfelchen in die traditionelle Schweizer Tracht gekleidet – mit engen schwarzen Bundhosen, weißen Kniestrümpfen, einem weißen Hemd und einer lose hängenden roten Weste darüber. Das finden Sie in allen Berichten (einschließlich Watsons). Ich kann nicht leugnen, dass ich diesen Auftritt sehr unpassend finde. Wir sind hier im Schweizer Hochgebirge, nicht im Palace Theatre bei einer Varieté-Veranstaltung. Ich finde, der Junge übertreibt's einfach.
Auf jeden Fall behauptet er, er sei aus dem Englischen Hof geschickt worden. Eine englische Touristin sei krank geworden, weigere sich aber, sich von einem Schweizer Arzt untersuchen zu lassen. Das ist es, was der junge Mann sagt. Was würden Sie jetzt an Watsons Stelle tun? Würden Sie sich weigern, diese an den Haaren herbeigezogene Geschichte zu glauben, oder würden Sie tatsächlich Ihren Freund an dieser wirklich teuflischen Stelle und zu diesem kritischen Zeitpunkt allein lassen? Das oben Gesagte ist übrigens alles, was wir von dem Jungen erfahren – aber Sie und ich werden ihn nur allzu bald wiedertreffen. Watson deutet an, er hätte möglicherweise für Moriarty gearbeitet, erwähnt ihn dann aber nicht mehr. Stattdessen verabschiedet Watson sich eilig und rennt zu seiner nicht-existenten Patientin – großzügig, aber verbohrt bis zuletzt.
Bis zu Holmes' Wiederauftauchen müssen wir jetzt drei Jahre warten, und es ist sehr wichtig zu bedenken, dass er während der ganzen Zeit, von der ich hier berichte, als mausetot galt. Erst sehr viel später erklärt er sich (in seiner Erzählung »Das Leere Haus« hat Watson das alles berichtet), und obwohl ich bei meiner Arbeit schon viele Erklärungen gehört habe, gibt es darunter kaum eine, die eine ähnliche Fülle von Unwahrscheinlichkeiten auftürmt. Andererseits ist es sein eigener Bericht, und deshalb müssen wir ihn wohl einfach so akzeptieren, wie er ist, schätze ich.
Nachdem Watson gegangen ist, erscheint nach Aussage von Holmes Professor James Moriarty auf der Bildfläche. Er kommt den engen Pfad herunter, der halbwegs um den Wasserfall herum in den Felsen gehauen ist. Dieser Pfad endet ziemlich abrupt, so dass an eine Flucht für Holmes nicht zu denken ist, auch wenn ihm eine solche Maßnahme wohl nie in den Sinn gekommen wäre. Das muss man ihm lassen: Dieser Mann hat sich mit seinen Ängsten immer direkt auseinandergesetzt, ob es sich nun um eine tödliche Sumpfotter, ein abscheuliches Gift, das einen zum Wahnsinn treibt, oder einen Höllenhund handelte, der sich im Moor herumtreibt. Holmes hat viele Dinge getan, die, ehrlich gesagt, recht verblüffend sind – weggelaufen ist er aber nie.
Die Männer wechseln einige Worte. Holmes bittet um Erlaubnis, seinem alten Freund eine Nachricht hinterlassen zu dürfen, und Professor Moriarty erlaubt es. Das zumindest kann verifiziert werden, denn diese drei Blätter Papier gehören zu den geschätztesten Exponaten im British Library Reading Room in London, wo ich sie persönlich gesehen habe. Aber kaum sind diese Höflichkeiten ausgetauscht, gehen die beiden Männer aufeinander los, und was dann folgt, scheint weniger ein Kampf zu sein als ein Selbstmordpakt: Jeder ist bemüht, den anderen in den tosenden Sturzbach zu ziehen. Und so hätte es auch ohne weiteres kommen können. Aber Holmes hat immer noch einen Trick im Ärmel. Er hat bartitsu gelernt. Ich hatte im Leben noch nichts davon gehört, aber wie es scheint, handelt es sich um eine spezielle Kampfkunst, die ein britischer Ingenieur erfunden hat. Sie verbindet Boxen und Judo, und Holmes versteht es, sie für sich zu nutzen.
Moriarty wird überrumpelt. Er wird über den Rand des Abgrunds gestoßen und fällt mit einem schrecklichen Schrei in die Tiefe. Holmes sieht noch, wie er einen Felsen streift, ehe er im Wasser verschwindet. Er selbst ist in Sicherheit. Verzeihen Sie mir, aber ist diese Darstellung nicht etwas unbefriedigend? Man muss sich doch fragen, warum Moriarty es zulässt, auf diese Weise angegriffen zu werden. Heldentaten der alten Schule sind wunderbar (obwohl ich nie einen Kriminellen getroffen habe, der sich ernsthaft dafür begeistert hätte), aber zu welchem Zweck soll er sich dergestalt in Gefahr gebracht haben? Um es ganz direkt zu sagen: Warum hat er nicht einfach einen Revolver herausgezogen und seinen Widersacher aus nächster Nähe erschossen?
Und wenn das schon merkwürdig ist, dann ist das, was Holmes anschließend tut, vollkommen unerklärlich. Aufgrund einer plötzlichen Eingebung beschließt er, die Ereignisse zu nutzen, um seinen Tod vorzutäuschen. Er klettert die senkrechte Felswand über dem Pfad hinauf und versteckt sich dort, bis Watson zurückkehrt. Auf diese Weise vermeidet er, dass weitere Fußabdrücke entstehen, die zeigen würden, dass er überlebt hat. Was soll das? Professor Moriarty ist tot, und die britische Polizei hat ihm mitgeteilt, dass auch die ganze Bande festgesetzt worden ist. Warum also glaubt er sich immer noch in Gefahr? Was genau hofft er jetzt zu erreichen? Wenn ich Holmes gewesen wäre, wäre ich schnellstens in den Englischen Hof zurückgekehrt und hätte mir zur Feier des Tages ein Wiener Schnitzel gegönnt und ein Glas Neuchâteller.
Dr. Watson hat inzwischen gemerkt, dass er ausgetrickst worden ist, und eilt mit einigen Männern aus dem Hotel und einem örtlichen Polizeibeamten namens Gessner zum Tatort zurück, wo ein zurückgelassener Spazierstock und eindeutige Fußabdrücke ihre eigene Geschichte erzählen. Holmes sieht sie zwar, gibt sich aber nicht zu erkennen, obwohl er sich darüber im Klaren sein muss, wie viel Kummer er seinem vertrautesten Freund damit macht. Sie finden den Brief. Sie lesen ihn, stellen fest, dass nichts mehr zu machen ist, und dann gehen sie. Holmes beginnt aus der Felswand herunterzusteigen, und jetzt nimmt die Geschichte erneut eine unerwartete und gänzlich unerklärliche Wendung. Wie es scheint, ist Professor Moriarty doch nicht allein zu den Reichenbachfällen gekommen. Als Holmes seinen Abstieg beginnt – schon das keine leichte Sache –, erscheint plötzlich oberhalb von ihm ein Mann und versucht, ihn mit Steinwürfen von seinem Felsvorsprung zu vertreiben und in den Abgrund zu schicken. Dieser Mann ist Colonel Sebastian Moran.
Was um alles in der Welt tut der hier? War er schon da, als Holmes und Moriarty gekämpft haben? Und wenn ja, warum hat er nicht eingegriffen? Wo ist seine Waffe? Hat der beste Schütze der Welt sie versehentlich im Zug liegen lassen? Weder Holmes noch Watson, noch sonst irgendjemand hat diese Fragen je vernünftig beantwortet. Dabei scheint mir doch, während ich hier sitze und in die Tasten schlage, dass sich diese Fragen ganz zwangsläufig stellen. Und wenn ich einmal damit begonnen habe, kann ich gar nicht mehr aufhören. Ich fühle mich wie ein Kutscher, dem die Pferde durchgegangen sind und der jetzt die Fifth Avenue hinunterrast und an keiner Querstraße anhalten kann.
Das ist ungefähr alles, was wir über die Reichenbachfälle wissen. Die Geschichte, die ich jetzt erzählen muss, beginnt fünf Tage später in der Krypta der St. Michaelskirche in Meiringen. Drei Männer sind hier zusammengekommen. Einer ist ein Kriminalinspektor von Scotland Yard, der berühmten Einsatzzentrale der britischen Polizei, sein Name ist Athelney Jones. Der Zweite bin ich.
Der Dritte ist hochgewachsen und dünn mit einer markanten Stirn und tief eingesunkenen Augen, die wahrscheinlich mit kalter Tücke und Bösartigkeit auf die Welt schauen würden, wenn irgendwelches Leben in ihnen wäre. Aber zumindest jetzt sind sie glasig und leer. Gekleidet ist dieser Mann äußerst förmlich: Er trägt ein Hemd mit steifem Kragen und einen langen Gehrock. Er wurde aus dem Reichenbach gefischt, in einiger Entfernung vom Wasserfall. Das linke Bein ist gebrochen, und er hat weitere schwere Verletzungen an Schultern und Kopf, aber es handelt sich um einen Tod durch Ertrinken. Der linke Arm liegt auf seiner Brust, und am Handgelenk hängt ein kleines Schildchen der örtlichen Polizei. Darauf steht: James Moriarty.
Er ist der Grund, warum ich mich auf den weiten Weg in die Schweiz gemacht habe. Aber wie es scheint, bin ich zu spät gekommen.
2Inspektor Athelney Jones
»Sind Sie sicher, dass er es wirklich ist?«
»Ich bin mir dessen so sicher, wie ich nur sein kann, Mr Chase. Aber lassen Sie uns, ganz unabhängig von persönlichen Überzeugungen, von den Tatsachen reden. Sein Aussehen und die Umstände seiner Auffindung passen zu allem, was wir derzeit wissen. Wenn er nicht Moriarty wäre, müssten wir uns fragen, wer er tatsächlich ist, wie er getötet wurde und natürlich auch, was mit Moriarty selbst passiert ist.«
»Es wurde nur eine Leiche gefunden.«
»Das hab ich gehört. Der arme Mr Holmes … Dass er ohne den Trost einer christlichen Beerdigung auskommen muss, die doch jeder verdient! Aber eins ist sicher: Sein Name wird weiterleben. Das zumindest ist tröstlich.«
Das Gespräch fand im feuchtkalten, düsteren Keller der Kirche statt, einem Ort, der von der Wärme und den Wohlgerüchen dieses Frühlingstages in keiner Weise berührt wurde. Inspektor Jones stand neben mir, und als er sich jetzt über den Ertrunkenen beugte, hielt er seine Hände fest hinter dem Rücken verschränkt, als ob er Angst hätte, er könnte irgendwie kontaminiert werden. Ich sah, wie seine dunklen, grauen Augen an der Leiche entlangwanderten, bis sie zu den Füßen kamen, von denen einer unbeschuht war. Wie es schien, hatte Moriarty eine Schwäche für bestickte Seidensocken gehabt.
Jones und ich hatten uns erst kurz zuvor auf dem Polizeirevier in Meiringen kennengelernt. Ehrlich gestanden war ich überrascht, dass ein so kleines, von Ziegen und Butterblumen umgebenes Dorf in den Schweizer Bergen eine solche Einrichtung überhaupt brauchte. Aber das Dorf war mittlerweile ein beliebtes Ziel für Touristen, und seit es neuerdings auch eine Eisenbahnlinie nach Meiringen gab, kam wohl eine ständig wachsende Zahl von Reisenden hierher. Als ich auf der Polizeiwache eintraf, taten zwei Beamte in schwarzen Uniformen mit Stehkragen und zwei Reihen glänzender Knöpfe dort Dienst. Sie standen hinter der hölzernen Schranke, die das Wachzimmer teilte. Einer von ihnen war der arme Wachtmeister Gessner, der an die Reichenbachfälle geholt worden war – und schon jetzt wusste ich, dass er sehr viel glücklicher gewesen wäre, wenn er sich weiter mit verlorenen Pässen, Fahrscheinen, Wegbeschreibungen und sonstigen Auskünften hätte beschäftigen dürfen als mit einem Mord.
Er und sein Kollege verstanden nur wenig Englisch, und deshalb war ich gezwungen, mein Anliegen mit Hilfe der Bilder und Schlagzeilen einer britischen Zeitung zu erläutern, die ich eigens zu diesem Zweck mitgebracht hatte. Ich hatte gehört, dass unterhalb der Reichenbachfälle eine Leiche aus dem Wasser geholt worden war, und bat jetzt, sie sehen zu dürfen, aber die beiden Schweizer Beamten waren so stur, wie man das häufig bei Männern findet, die man in eine Uniform gesteckt und mit gewissen beschränkten Machtbefugnissen ausgestattet hat. Sie redeten durcheinander und gestikulierten angestrengt, und schließlich wurde erkennbar, dass sie auf die Ankunft eines höheren Beamten aus England warteten, der allein befugt sei, irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Ich hatte ihnen erläutert, dass meine Anreise noch sehr viel weiter gewesen und mein Anliegen durchaus seriös war, aber das zählte offenbar nicht. I'm sorry, mein Herr. Sie könnten mir leider nicht helfen.
Ich zog meine Uhr aus der Tasche und warf einen Blick darauf. Es war mittlerweile schon elf, der halbe Vormittag war verschwendet und ich befürchtete schon, dass es dem Rest nicht besser ergehen würde, als sich hinter mir die Tür öffnete. Ich spürte einen kalten Luftzug im Nacken, und als ich mich umwandte, sah ich einen Mann, dessen Umriss sich scharf vor dem Morgenlicht abzeichnete. Er sagte nichts, aber als er hereinkam, sah ich, dass er ungefähr in meinem Alter war, vielleicht noch ein bisschen jünger. Sein dunkles Haar lag flach auf dem Kopf, und seine sanften grauen Augen stellten alles in Frage. Er hatte etwas sehr Ernstzunehmendes an sich. Wenn er einen Raum betrat, musste man einfach innehalten und ihn zur Kenntnis nehmen. Er trug einen braunen Straßenanzug und einen hellen Mantel, der ihm nur lose über die Schultern hing. Es war erkennbar, dass er kürzlich sehr krank gewesen sein musste. Er hatte stark abgenommen, was man daran sah, dass sein Anzug ihm etwas zu weit war. Auch sein Gesicht war eingefallen und blass. Er hielt einen Gehstock aus Rosenholz mit einem eigenartig komplizierten silbernen Knauf in der Hand. Als er die Schranke erreicht hatte, stützte er sich darauf, um sich etwas auszuruhen.
»Können Sie mir helfen?«, fragte er. Sein Deutsch war korrekt, aber es klang nicht sehr natürlich, es schien, als hätte er zwar die Wörter gelernt, aber nie gehört, wie jemand sie tatsächlich aussprach. »Ich bin Inspektor Jones von Scotland Yard.«
Er hatte mich kurz gemustert, als ob er mich zum späteren Gebrauch archivieren wolle, ignorierte meine Gegenwart ansonsten aber vollkommen. Auf die beiden Polizisten wiederum hatte sein Name eine sofortige Wirkung.
»Jones? Inspektor Jones?«, wiederholten sie, und als er ihnen sein Empfehlungsschreiben hinhielt, nahmen sie es mit breitem Lächeln und einer Verbeugung entgegen. Sie baten ihn, einen Augenblick zu warten, während sie den Vorgang ins Wachbuch eintrugen, und zogen sich in ihr Büro im Inneren des Gebäudes zurück, so dass ich mit dem Inspektor allein blieb.
Sich zu ignorieren war jetzt nicht länger möglich, und er war es, der als Erster das Schweigen brach. Er übersetzte, was er schon einmal gesagt hatte.
»Mein Name ist Athelney Jones«, sagte er, jetzt auf Englisch.
»Habe ich richtig verstanden, dass Sie von Scotland Yard sind?«
»In der Tat.«
»Ich bin Frederick Chase.«
Wir gaben uns die Hand. Sein Handschlag fühlte sich merkwürdig lose an, als ob die Hand nur unzureichend mit dem Arm verbunden wäre.
»Das ist ein schönes Fleckchen«, fuhr er fort. »Ich hatte noch nie das Vergnügen, die Schweiz zu besuchen. Es ist erst das dritte Mal, dass ich überhaupt ins Ausland komme.« Er wandte seine Aufmerksamkeit für einen kurzen Moment meinem Überseekoffer zu, den ich mangels einer Unterkunft hatte mitbringen müssen. »Sie sind gerade angekommen?«
»Vor einer Stunde«, sagte ich. »Ich schätze, wir waren im selben Zug.«
»Und was führt Sie hierher?«
Ich zögerte. Die Unterstützung eines britischen Polizeibeamten konnte entscheidend für die Lösung der Aufgabe sein, deretwegen ich hier war, aber ich wollte nicht zu direkt werden. In Amerika gab es immer wieder Interessenkonflikte zwischen Pinkerton's und den Regierungsbehörden. Warum sollte das hier anders sein? »Ich bin in einer privaten Angelegenheit hier …«, begann ich.
Darüber lächelte er, obwohl ich in seinen Augen auch einen zarten Schleier von etwas bemerkte, das vielleicht Schmerz gewesen sein könnte. »Dann erlauben Sie mir, dass ich Ihnen sage, worum es hier geht, Mr Chase«, bat er höflich. Dann überlegte er einen Moment. »Sie sind ein Beauftragter der Agentur Pinkerton in New York. Sie sind vor einer Woche nach England aufgebrochen, weil sie hofften, dort Professor James Moriarty zu finden. Er hatte nämlich eine Nachricht erhalten, die für Sie wichtig ist und die Sie von ihm haben wollten. Sie waren sehr erschrocken, als sie von seinem Tod hörten, und sind dann direkt hierhergekommen. Ich sehe auch, dass Sie von der Schweizer Polizei nicht viel halten …«
»Moment mal!«, rief ich und hielt eine Hand hoch. »Jetzt machen Sie mal einen Punkt! Haben Sie mir nachspioniert, Inspektor Jones? Haben Sie Kontakt mit unserem Büro aufgenommen? Ich finde es ziemlich übel, dass die britische Polizei sich hinter meinem Rücken in meine Angelegenheiten einmischt …«
»Seien Sie unbesorgt«, sagte er und wieder erschien dieses seltsame Lächeln in seinen Augen. »Alles, was ich Ihnen gesagt habe, ließ sich aus Beobachtungen an Ihrer Person deduzieren, die ich hier in diesem Raum gemacht habe. Wenn Sie möchten, kann ich noch ein paar mehr hinzufügen.«
»Warum nicht?«
»Sie wohnen in einem der oberen Stockwerke in einem altmodischen Wohnblock. Sie finden, dass Ihre Firma sich nicht genug um Sie kümmert, obwohl Sie doch einer ihrer erfolgreichsten Ermittler sind. Sie sind nicht verheiratet. Es tut mir leid, dass Ihre Überfahrt offenbar besonders unangenehm war – und zwar nicht nur wegen des scheußlichen Wetters am zweiten oder vielleicht dritten Tag. Sie haben den Verdacht, dass Ihre gesamte Reise ein völlig sinnloses Unterfangen ist. Ich hoffe aber um Ihretwillen, dass dies nicht der Fall ist.«
Er verstummte, und ich starrte ihn an, als ob ich ihn zum ersten Mal sähe. »Sie haben mit fast allem recht, was sie gesagt haben«, murmelte ich heiser. »Aber woher zum Teufel Sie das alles wissen, ist mir vollkommen unerfindlich. Können Sie mir das bitte erklären?«
»Ach, das ist alles recht offensichtlich«, erwiderte er. »Man könnte fast sagen, elementar.« Das letzte Wort wählte er so sorgfältig, als ob es eine besondere Bedeutung hätte.
»Das können Sie leicht sagen.« Ich warf einen Blick auf die Tür, die uns jetzt von den beiden Schweizer Polizisten trennte. Wachtmeister Gessner schien zu telefonieren. Ich hörte seine Stimme, die eifrig in den Hörer hineintönte. Die Schranke und der dahinterstehende, leere Tisch bildeten eine solide Barriere. »Bitte, Mr Jones, würden Sie mir erklären, wie Sie zu diesen Schlussfolgerungen gelangt sind?«
»Wie Sie wollen. Ich muss Sie allerdings warnen: Sobald es erklärt wird, scheint alles ganz schrecklich einfach.« Er suchte einen etwas bequemeren Stand und verlagerte sein Gewicht auf den Gehstock. »Dass Sie Amerikaner sind, ist wegen der Art, wie Sie reden, und Ihrer Kleidung ganz offensichtlich. Vor allem Ihre gestreifte Weste mit den vier Taschen würde man in London wohl schwerlich finden. Auch Ihr Vokabular ist mir aufgefallen. Gerade eben haben Sie gesagt: ›Ich schätze‹, wo wir sagen würden: ›Ich glaube‹. Meine Kenntnis der amerikanischen Dialekte ist überschaubar, aber Ihr Akzent lässt mich vermuten, dass Sie von der Ostküste stammen.«
»Meine Heimat ist Boston«, sagte ich. »Aber jetzt lebe und arbeite ich in New York. Bitte fahren Sie fort.«
»Als ich hereinkam, haben Sie gerade Ihre Uhr konsultiert, und obwohl es zum Teil von Ihren Fingern bedeckt war, ist mir das Symbol auf dem Deckel durchaus nicht entgangen: ein Auge und die Worte ›Wir schlafen nie‹. Das ist natürlich das Motto der Pinkerton Detektivagentur, deren Hauptsitz, soviel ich weiß, in New York ist. Dass Sie sich dort eingeschifft haben, geht aus dem Siegel der New York Port Authority hervor, das sich auf Ihrem Gepäck findet.« Er warf einen zweiten Blick auf meinen Überseekoffer, den ich, ohne es zu merken, unter dem Steckbrief eines besonders übellaunigen örtlichen Tatverdächtigen abgestellt hatte. »Was Ihre Zweifel an der Schweizer Polizei betrifft: Warum wohl haben Sie auf Ihre eigene Uhr geschaut, wenn da drüben an der Wand doch eine große und absolut funktionstüchtige, ja geradezu amtliche Uhr hängt? Die Polizei war Ihnen gegenüber offenbar nicht gerade hilfreich, scheint mir.«
»Sie haben vollkommen recht, Sir. Aber woher wissen Sie von meinem Interesse an Professor Moriarty?«
»Was sonst sollte Sie hierhergelockt haben? Nach Meiringen! Ich könnte wetten, dass Sie bis zu den Ereignissen von letzter Woche noch nie von diesem doch eher unauffälligen Dörfchen gehört haben.«
»Ich hätte ja auch mit Sherlock Holmes zu tun haben können.«
»In diesem Falle wären Sie sicher in London geblieben und hätten mit Ihren Nachforschungen in der Baker Street angefangen. Hier gibt es ja nichts weiter als eine Leiche, und um wen immer es sich dabei handelt: Sherlock Holmes ist es bestimmt nicht. Nein. Wenn Sie aus New York gekommen sind, dann war der Hafen, in dem Sie von Bord gegangen sind, wahrscheinlich Liverpool – was von der zusammengefalteten Ausgabe des Liverpool Echo bestätigt wird, die aus ihrer rechten Jackentasche herausragt. Das Datum auf dem Titelblatt ist der 7. Mai, wie ich sehe, was bedeutet, dass Sie das Blatt wahrscheinlich gleich im Hafen gekauft haben und dann gezwungen waren, eiligst auf den Kontinent weiterzureisen. Was also war die Nachricht, die Sie hierhergebracht hat? Es kann nur Moriarty sein.« Er lächelte. »Ich bin erstaunt, dass wir uns nicht schon früher getroffen haben. Wir müssen tatsächlich im selben Zug gereist sein, wie Sie ganz richtig gesagt haben.«
»Sie haben eine Nachricht erwähnt.«
»Es gibt nichts, was Moriarty Ihnen sagen könnte. Er ist tot. Es ist unwahrscheinlich, dass Sie ihn identifizieren können – nur wenige Menschen kennen ihn von Angesicht zu Angesicht. Es muss also irgendein Gegenstand in seinem Besitz sein, der Sie interessiert. Etwas, das er bei sich trug, als er ins Wasser fiel, und was Sie jetzt bei ihm zu finden hoffen – ein Brief oder ein Päckchen aus Amerika. Ich nehme an, darüber haben Sie mit der Polizei geredet, als ich hereinkam.«
»Ich habe sie gebeten, mich die Leiche untersuchen zu lassen.«
»Nun ja, viel hinzuzufügen gibt es wohl nicht mehr.«
»Und das mit der Überfahrt?«
»Sie waren gezwungen, Ihre Kabine zu teilen …«
»Woher wissen Sie das?«
»Ihre Zähne und Ihre Fingernägel beweisen, dass Sie nicht rauchen. Aber ich kann immer noch riechen, dass Sie sich längere Zeit in einem Raum voller Tabakrauch aufhalten mussten. Das deutet darauf hin, dass Ihre Arbeitgeber zwar ihren besten Mann in Marsch gesetzt haben – sonst hätte man Sie nicht um die halbe Welt geschickt – andererseits aber zu sparsam waren, eine Einzelkabine für Sie zu bezahlen. Es war sicher nicht angenehm, die Kabine mit einem Raucher zu teilen.«
»Das stimmt.«
»Und das Wetter hat es noch schlimmer gemacht.« Er hob die Hand und wischte damit meine Frage weg, noch ehe ich sie gestellt hatte. »Sie haben da einen üblen Schnitt am Hals. Wahrscheinlich war es nicht einfach, sich an Bord zu rasieren, besonders bei einem Sturm.«
Ich musste laut lachen. »Inspektor Jones«, sagte ich. »Ich bin ein einfacher Mann. Was ich im Leben erreicht habe, beruht auf Sorgfalt und harter Arbeit. Von solchen Methoden habe ich bis eben noch nie gehört, und ich hatte keine Ahnung, dass englische Kriminalbeamte so etwas in ihrer Ausbildung lernen.«
»Es werden auch nicht alle so ausgebildet«, sagte er leise. »Aber man könnte sagen, dass ich eine besondere Schulung erhielt … ich hab von dem Besten gelernt.«
»Eins noch. Sie haben mir noch nicht gesagt, woher Sie meinen Familienstand und meine Wohnsituation in New York kennen.«
»Sie tragen keinen Ehering, was an sich noch nicht schlüssig ist, aber – Sie verzeihen bitte – keine Ehefrau würde zulassen, dass ihr Mann mit solchen Flecken auf den Manschetten oder Schuhen mit derartig schiefen Absätzen das Haus verlässt. Was Ihre Wohnung angeht, so ist es wieder einmal eine Frage der Beobachtung und Deduktion. Mir ist aufgefallen, dass der Stoff Ihres Jackenärmels auf der rechten Seite sehr abgeschabt ist. Wie anders soll das passiert sein, als dass Sie beim Treppensteigen regelmäßig an einem Geländer entlangstreifen? In Ihrem Büro gibt es bestimmt einen Aufzug. In einem alten Wohnblock vielleicht noch nicht.«
Er unterbrach sich, und ich konnte sehen, dass seine Ausführungen ihn ziemlich angestrengt haben mussten, denn er stützte sich jetzt noch deutlicher auf seinen Stock. Ich wiederum betrachtete ihn mit einer Bewunderung, die zu verbergen ich mir gar keine Mühe gab, und ich wäre wohl noch ein bisschen länger so dagestanden, wäre nicht plötzlich die Tür aufgegangen. Die beiden Polizeibeamten kehrten zurück. Sie redeten lebhaft auf uns ein, und obwohl ihre Sprache für mich gänzlich unverständlich war, war der Tonfall doch freundlich genug, und ich entnahm daraus, dass sie jetzt bereit waren, den Mann von Scotland Yard dahin zu bringen, wo sich die Leiche befand. Und so war es tatsächlich. Jones richtete sich auf und begann, auf die Tür zuzugehen.
»Darf ich Sie etwas fragen?«, sagte ich hastig. »Ich bin sicher, Sie haben Ihre Anweisungen, Inspektor Jones, aber es könnte durchaus sein, dass ich Ihnen helfen kann. Alles, was Sie gerade – bei dieser eindrucksvollen Demonstration Ihrer Fähigkeiten – gesagt haben, trifft vollkommen zu. Ich bin Moriarty hierher gefolgt, weil es vor drei Wochen eine Nachricht gab, die ernste Folgen für Sie und für mich haben könnte. Es stimmt zwar, dass ich Moriarty nicht identifizieren kann, aber es ist von größter Wichtigkeit, dass ich zumindest seine Leiche ansehen darf.«
Der Mann von Scotland Yard zögerte. Seine Hand umklammerte den Knauf seines Gehstocks. »Sie verstehen sicher, Sir, dass ich die Befehle meiner Vorgesetzten befolgen muss …«
»Sie haben mein Wort, dass ich mich nicht einmischen werde.«
Die Polizisten warteten. Jones gelangte zu einer Entscheidung und nickte. »Er kommt mit uns.« Er wandte sich mir zu. »Bitte begleiten Sie uns.«
»Ich bin Ihnen sehr dankbar«, sagte ich. »Und ich gebe Ihnen mein Wort, dass Sie es nicht bedauern werden.«
Wir ließen mein Gepäck auf der Polizeiwache und durchquerten das Dorf, das eigentlich nur aus ein paar Häusern und Bauernhöfen bestand, die um die Hauptstaße verstreut lagen. Die ganze Zeit über unterhielten sich Jones und Gessner mit leisen Stimmen auf Deutsch. Schließlich erreichten wir die Sankt Michaelskirche, ein eigenartiges Gebäude mit einem etwas kopflastigen Glockenturm. Die Polizisten schlossen die Tür für uns auf und ließen uns eintreten. Ich verneigte mich vor dem Altar, bemerkte aber, dass Inspektor Jones dies nicht tat. Wir kamen zu einer Treppe, die in die Unterkirche hinabführte, und Jones bedeutete den Polizeibeamten, dass er allein mit mir weitergehen wolle. Gessner brauchte nicht überredet zu werden. Obwohl es in der Kirche mit ihren dicken Steinmauern sehr kühl war, war der Geruch des Todes schon sehr präsent.
Die Leiche war so, wie ich sie beschrieben habe. Als er noch lebte, war der Mann, der da ausgestreckt vor uns lag, offenbar sehr groß gewesen, wenn auch mit gebeugten Schultern. Ich konnte ihn mir als Bibliothekar oder Universitätslehrer vorstellen, was James Moriarty natürlich auch zeitweilig gewesen war. Seine altmodischen, schwarzen Kleider hingen wie Seetang von ihm herunter – mir schien fast, dass sie noch nass waren. Es gibt viele Möglichkeiten zu sterben, aber nur wenige hinterlassen einen hässlicheren Eindruck auf dem menschlichen Körper als das Ertrinken. Sein Fleisch war schwer und faulig. Die Farbe war zu abscheulich, um sie zu beschreiben.
»Wir wissen nicht mit Sicherheit, ob das Moriarty ist«, sagte ich. »Sie hatten vollkommen recht, als Sie sagten, dass ich ihn nicht identifizieren kann. Aber können Sie das denn?«
Jones schüttelte den Kopf. »Ich habe ihn nie gesehen. Und auch keiner von meinen Kollegen. Moriarty hat sein ganzes Leben lang in den Schatten gelebt. Er hat sich das zum Prinzip gemacht. Es könnte sein, dass wir in absehbarer Zeit jemanden finden, der mit ihm in seiner Zeit als Mathematikprofessor zusammengearbeitet hat. Aber so viel können wir sagen: Der Mann hat das richtige Alter. Die Kleider, die er trägt, stammen ohne Zweifel aus England. Sehen Sie die silberne Taschenuhr? Darauf steht der Name des Herstellers: John Myers of London. Er ist nicht wegen der Schönheit der Landschaft hierhergekommen. Er ist zur selben Zeit gestorben wie Sherlock Holmes. Also frage ich: Wer soll es sonst sein?«
»Ist die Leiche durchsucht worden?«
»Gessner sagt, sie hätten nachgesehen, was er in den Taschen hatte, ja.«
»Und da war nichts?«
»Ein paar Münzen. Ein Taschentuch. Sonst nichts. Was hatten Sie denn zu finden gehofft?«
Ich hatte auf diese Frage gewartet und zögerte nicht. Ich wusste, dass alles, zumindest aber meine unmittelbare Zukunft, von der Antwort auf diese Frage abhing. Bis zum heutigen Tag kann ich uns da zusammen sehen: zwei Männer allein in der dunklen Krypta, vor uns die lang ausgestreckte, schwarz gekleidete Leiche. »Moriarty hat einen Brief erhalten«, sagte ich. »Am zweiundzwanzigsten oder dreiundzwanzigsten April. Geschrieben von einem Mann, der Pinkerton's bestens bekannt ist. Es handelt sich um einen Kriminellen, der in jeder Hinsicht genauso bösartig und gefährlich ist wie Moriarty selbst. Es ging darum, dass die beiden sich treffen wollten. Selbst wenn Moriarty jetzt tot ist, hatte ich doch gehofft, diesen Brief hier zu finden. Wenn nicht in seiner Kleidung, dann vielleicht doch in seiner Unterkunft.«
»Also interessieren Sie sich gar nicht für Moriarty, sondern für den Absender dieses Briefes?«
»Ja, das ist der Grund dafür, dass ich hier bin.«
Jones schüttelte den Kopf. »Wachtmeister Gessner sagt, die polizeilichen Ermittlungen seien ganz ergebnislos geblieben. Sie hätten nicht feststellen können, wo er hier gewohnt hat. Vielleicht ist er in einem Nachbarort abgestiegen und hat von dort aus operiert, aber dann hat er mit Sicherheit einen falschen Namen benutzt. Wir können also nur hier suchen. Was bringt Sie zu der Annahme, er könnte den Brief bis zuletzt bei sich gehabt haben?«
»Vielleicht klammere ich mich ja nur noch an einen Strohhalm«, sagte ich. »Nein, ich muss es wohl zugeben: Es ist wirklich nur eine verzweifelte Hoffnung. Aber so, wie diese Leute arbeiten … manchmal benutzen sie ja geheime Symbole und Zeichen, um sich zu identifizieren. Vielleicht hätte der Brief als Ausweis und Pass benutzt werden sollen, und wenn das der Fall wäre, hätte Moriarty ihn bestimmt ganz in seiner Nähe behalten.«
»Wenn Sie wollen, können wir ihn ja noch einmal untersuchen.«
»Ich glaube, das sollten wir«, sagte ich.
Es war eine grausige Arbeit. Die kalte, wasserdurchtränkte Leiche unter unseren Händen hatte nichts Menschliches an sich, und als wir sie umdrehten, konnten wir geradezu spüren, wie sich das aufgequollene Fleisch von den Knochen löste. Die Kleider waren schleimig. Als ich in die Jacke griff, stellte ich fest, dass das Hemd hochgerutscht war und meine Hand berührte kurz die tote, weiße Haut. Obwohl wir das nicht verabredet hatten, konzentrierte ich mich auf die obere Körperhälfte, während Jones sich der unteren annahm. Ebenso wie vor uns die Polizei fanden wir gar nichts. Die Taschen waren leer. Wenn sie außer den wenigen Dingen, die Jones erwähnt hatte, noch etwas anderes enthalten hatten, musste es vom reißenden Wasser der Reichenbachfälle brutal herausgefetzt worden sein. Wir arbeiteten in völligem Schweigen. Schließlich musste ich mich abrupt zur Seite wenden, um meinen Mageninhalt wieder herunterzuwürgen.
»Da ist nichts«, brachte ich mühsam heraus. »Sie hatten recht. Es war Zeitverschwendung.«
»Moment noch.« Jones glaubte offenbar, etwas gesehen zu haben. Er griff nach dem Gehrock des Mannes und untersuchte die Naht an der Brusttasche.
»Ich hab nachgeschaut«, sagte ich. »Da ist auch nichts.«
»Nicht in der Tasche«, sagte Jones. »Aber schauen Sie sich mal diese Naht an. Da ist nachgearbeitet worden. Diese Stiche gehören da gar nicht hin.« Er rieb den Stoff zwischen den Fingern. »Vielleicht steckt da etwas im Futter.«
Ich beugte mich vor. Er hatte recht. An der Tasche waren ein paar Stiche zu sehen. »Ich habe ein Messer«, sagte ich und zog das Taschenmesser heraus, das ich immer bei mir trage, und gab es meinem neuen Freund.
Jones setzte die Spitze an der Naht an und trennte sie vorsichtig auf. Ich sah, wie sich der Stoff öffnete. Im Gehrock des Toten gab es eine Geheimtasche – und wie es schien, war dort auch tatsächlich etwas verborgen. Behutsam zog Jones ein zusammengefaltetes Stück Papier heraus. Es war völlig durchweicht und wäre bestimmt zerrissen, wenn er es nicht mit größter Vorsicht behandelt hätte. Er benutzte die flache Seite des Messers, um das Papier auf den Steintisch neben der Leiche zu legen, und er benutzte die Klinge erneut, um es aufzufalten. Es war ein einzelnes Blatt, und die Schrift darauf war so ungeschickt wie die eines Kindes. Wir beugten uns darüber, und das, was wir lasen, war dies:
HoLmES WaR EiN aNgENEHMeR KOMPaGnoN. eR warSeHr RUhIG unD pFlEgTe Die IMMEr gleicheNRiTUaLe. SELten GiNg ER NAcH ElF UHR INS BETT,UND iMMER HAtTe ER bereiTs GegeSSen und WARAUsGEGANGeN, EhE iCh Mich ErhobeN HAtTE.MAnChmAL BRAcHte ER DEN Tag iM ChEmiELaBOR Hin,MAnCHmal in deN sEkTIONSKAmMERN, Und BeIEiNIGEN GeLegeNhEiten fLAnieRt ER aNScHEINendLAnGe in dEn sCHLECHtEsTeN beREicheN DER cITYUMHer. sEInE enERGIE WaR RiEsIg, wEnN DaSARBeItSFiEBeR IHN gEPaCkT hATTE.
Wenn Jones enttäuscht war, dann zeigte er das zumindest nicht. Aber der Brief, den ich erwartet hatte, war das wohl nicht. Der Zettel schien überhaupt nichts damit zu tun zu haben.
»Was halten Sie davon?«, fragte er.
»Ich … ich weiß nicht, was ich sagen soll.« Ich las die Worte ein zweites Mal. »Ich kenne diesen Text. Natürlich kenne ich ihn. Das ist Teil eines Berichts von Dr. John Watson. Er muss abgeschrieben worden sein aus Lippincott's Magazine.«
»Ich glaube eher aus Beeton's Christmas Annual«, sagte Jones trocken. »Aber deshalb ist er immer noch mysteriös genug. Ich gehe davon aus, dass es sich nicht um das handelt, was Sie erwartet haben?«
»Es ist so ziemlich das Letzte, was ich erwartet hätte.«
»Rätselhaft genug ist es. Aber wir waren jetzt wirklich lange genug hier. Ich schlage vor, wir ziehen uns aus diesem düsteren Ort zurück und stärken uns mit einem Glas Wein.«
Ich warf einen letzten Blick auf den toten Mann auf der Steinplatte, dann wandte ich mich ab, und wir kletterten zusammen wieder hinauf in die Oberwelt.
3Die Mitternachtswache
Athelney Jones hatte sich im Englischen Hof einquartiert und schlug vor, ich solle dasselbe tun. Nachdem wir uns von den Schweizer Polizisten verabschiedet hatten, gingen wir gemeinsam dorthin. Wir schlenderten bei wolkenlosem Himmel im strahlenden Sonnenschein durch das Dorf, und außer unseren Schritten hörte man nur das Bimmeln der Glöckchen, die irgendwelche Schafe oder Ziegen in den Bergen am Hals trugen. Jones war tief in Gedanken versunken. Er dachte offensichtlich über das Dokument nach, das wir in der Tasche des Toten entdeckt hatten. Was um alles in der Welt machte Moriarty mit einem Auszug aus einer Sherlock-Holmes-Geschichte? Hatte er sich auf besondere Weise in seinen Widersacher hineinzuversetzen versucht, ehe er an den Reichenbachfällen mit ihm zusammentraf? Oder war es womöglich doch die Nachricht, deretwegen ich die lange Reise in die Schweiz gemacht hatte? Konnte eine geheime Botschaft darin verborgen sein, die wir nicht kannten? Inspektor Jones stellte mir diese Fragen nicht, aber ich konnte deutlich sehen, dass er darüber nachgrübelte.
Das Hotel war klein und charmant, mit hübschen Holzarbeiten, bemalten Fensterläden und bunten Blumenkästen unter den Fenstern – ein perfektes Schweizer Chalet, wie es sich jeder englische Reisende erträumt. Glücklicherweise hatten sie auch noch ein Zimmer für mich, und der Hausbursche wurde sogleich losgeschickt, um mein Gepäck vom Polizeirevier abzuholen. Jones verabschiedete sich auf der Treppe von mir. Er hatte das bewusste Blatt in der Hand.
»Mit Ihrer Erlaubnis werde ich es noch eine Weile behalten«, sagte er.
»Glauben Sie, Sie können rauskriegen, was sich dahinter verbirgt?«
»Nun, ich kann mich zumindest mal gründlich damit beschäftigen, und wer weiß?« Er sah müde aus. Der Weg von der Polizeiwache war zwar nicht lang gewesen, aber in Verbindung mit der beträchtlichen Meereshöhe hatte er ihn wohl sehr erschöpft.
»Natürlich«, beeilte ich mich zu sagen. »Sehen wir uns heute Abend?«
»Wir könnten zusammen essen. Sagen wir acht Uhr?«
»Das passt mir sehr gut, Inspektor. Abgesehen von allem anderen habe ich dann noch ein bisschen Zeit, um die berühmten Reichenbachfälle anzuschauen. Ich hätte nie gedacht, dass ich je in die Schweiz komme, und schon gar nicht in so eine reizende Gegend. Dieses Dorf ist entzückend – wie aus einem Märchen.«
»Sie können ja vielleicht mal nach Moriarty fragen. Wenn er nicht in einem Hotel oder Gasthaus abgestiegen ist, hat er wahrscheinlich in einem Privathaus gewohnt. Vielleicht hat ihn jemand gesehen, ehe er Holmes getroffen hat.«
»Ich dachte, die Schweizer Polizei hat sich danach schon erkundigt.«
»Wachtmeister Gessner? Ein bewundernswerter Mann, der sein Bestes tut. Aber es kann nicht schaden, noch einmal zu fragen.«
»Sehr gern. Ich werde sehen, was ich tun kann.«
Ich tat, worum er gebeten hatte. Ich schlenderte noch einmal durchs Dorf und redete mit den Leuten, die meine Sprache verstanden – nicht dass es besonders viele gewesen wären. Aber zwei Worte gab es, die jeder verstand: »Sherlock Holmes«. Bei der Erwähnung seines Namens wurden sie ganz ernst und schienen zugleich sehr beflügelt. Dass ein solcher Mann nach Meiringen gekommen war, war schon ungewöhnlich genug, und dass er hier gestorben sein sollte, war völlig unglaublich. Natürlich wollten sie mir gern helfen. Aber leider, leider hatte niemand Moriarty gesehen. Kein Fremder hatte in ihren Häusern ein Zimmer genommen. Außer schlechtem Englisch und viel Sympathie hatten sie mir nichts zu bieten. Nach einer Weile kehrte ich in mein eigenes Zimmer zurück. Zu den Wasserfällen zu gehen hatte ich keine Lust mehr, der Weg war ja mindestens zwei Stunden lang. Außerdem konnte ich nur mit Schaudern an sie denken, und alles, was ich dort hätte erfahren können, wusste ich ohnehin schon.
Athelney Jones und ich aßen an diesem Abend erst spät, und ich freute mich, dass er offensichtlich wieder zu Kräften gekommen war. Wir saßen in dem gemütlichen Restaurant des Hotels, dessen Tische eng beieinanderstanden. An den Wänden hingen die Köpfe von Hirschen und anderen Tieren, und im Kamin prasselte ein Feuer, das viel zu groß für den kleinen Raum war. Es wurde aber durchaus gebraucht, denn mit der Dunkelheit war kalte Luft von den Alpenpässen in das Tal gesunken und hatte sich über dem Dorf niedergelassen. Wir hatten schließlich erst Mai und befanden uns fast sechshundert Meter über dem Meeresspiegel. Es waren nur wenige andere Gäste im Raum, und wir hatten einen Tisch in der Kaminecke, so dass wir uns ungestört unterhalten konnten.
Begrüßt wurden wir von einer kleinen rundlichen Frau, die ein Schürzenkleid mit Puffärmeln und eine Stola trug. Sie brachte uns einen Korb mit Weißbrot und einen Krug Rotwein. Sie stellte sich als Greta Steiler, die Schweizer Ehefrau des englischen Besitzers vor. »Heute Abend gibt es nur Suppe und Braten«, sagte sie. Ihr Englisch war hervorragend, und ich hoffte sehr, dass auch das Essen so gut war. »Mein Mann ist heute allein in der Küche. Sie haben Glück, dass nicht so viele Gäste da sind. Ich wüsste sonst nicht, wie wir das alles schaffen sollten.«
»Haben Sie keinen Koch?«, fragte Jones.
»Der ist nach Rosenlaui hinaufgegangen und besucht seine Mutter. Es geht ihr nicht gut. Eigentlich hätte er schon vor ein paar Tagen wieder zurückkommen sollen, hat aber nichts von sich hören lassen. Und das, obwohl er schon fünf Jahre bei uns ist! Na ja, und dann diese Geschichte mit den Reichenbachfällen! Die Polizei und die Kriminalbeamten, die uns all diese Fragen gestellt haben. Ich kann es gar nicht erwarten, dass Meiringen wieder so friedlich wird, wie es mal war. Wir brauchen diese ganze Aufregung nicht.«
Damit eilte sie wieder davon. Ich schenkte mir Wein ein, aber Jones lehnte ab und nahm sich nur Wasser. »Dieses Dokument …«, begann ich. Seit wir uns zu Tisch gesetzt hatten, hatte ich fragen wollen, was er davon hielt.
»Ich glaube, in diese Angelegenheit kann ich ein wenig Licht bringen«, erwiderte Jones. »Um es gleich vorweg zu sagen: Höchstwahrscheinlich handelt es sich tatsächlich um die Nachricht, von der Sie mir erzählt haben. Auf jeden Fall scheint sie von einem Amerikaner zu stammen.«
»Woher wissen Sie das so genau?«
»Ich habe das Papier untersucht und dabei festgestellt, dass es sich um einen mit Kreide gestrichenen Holzschliff handelt, wie er in Amerika hergestellt wird.«
»Und der Inhalt?«
»Dazu kommen wir gleich. Aber zuvor, denke ich, sollten wir eine Vereinbarung treffen.« Jones hob sein Glas und ich sah, wie das Kaminfeuer sich darin spiegelte. »Ich bin hier als Vertreter der Londoner Polizei. Als wir hörten, dass Holmes tödlich verunglückt war, kam Scotland Yard zu der Ansicht, dass einer von uns in die Schweiz fahren müsste. Schon aus Höflichkeit und Respekt. Schließlich hat er uns, wie Sie vielleicht wissen, bei einigen Fällen geholfen. Und alles, was die Aktivitäten von Professor James Moriarty betrifft, ist natürlich auch von Interesse für uns. Was an den Reichenbachfällen passiert ist, scheint klar genug, aber trotzdem ist da etwas im Gange, wie Holmes gesagt hätte. Ihre Anwesenheit und der Hinweis, dass Moriarty Kontakt zu einem Mitglied der amerikanischen Unterwelt hatte …«
»Nicht nur einem ›Mitglied‹, der Mann ist der Großmeister.«


![Der Tote aus Zimmer 12. Susan Ryeland ermittelt [Band 2] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/f29b5c5fba27049bb29f9e3f1876fde2/w200_u90.jpg)


![Mord in Highgate. Hawthorne ermittelt [Band 2] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/089fc19c4ec8b4ecb2d6573d5df1cc74/w200_u90.jpg)
![Alex Rider. Stormbreaker [Band 1] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/a50942d1747f6f8e55b49793c0526659/w200_u90.jpg)

![Alex Rider. Gemini-Project [Band 2] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/5c4cca9cd875693fa38bd1fe5643672c/w200_u90.jpg)
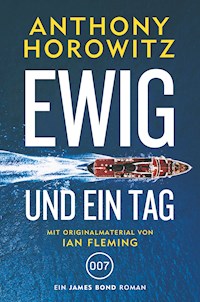
![Wenn Worte töten. Hawthorne ermittelt [Band 3] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/fd859681bbb599e306846498660819cf/w200_u90.jpg)

![Alex Rider. Skeleton Key [Band 3] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/320ebe043418750c249478304f43c699/w200_u90.jpg)

![Mord stand nicht im Drehbuch. Hawthorne ermittelt [Band 4] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/048a0a8d746eaaf2e78653d44c492732/w200_u90.jpg)
![Alex Rider. Ark Angel [Band 6] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/0edb9586d5f912fe388eb13780edd96f/w200_u90.jpg)
![Alex Rider. Scorpia [Band 5] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/8818b99503b4fee6aa78484cc0275aa9/w200_u90.jpg)
![Alex Rider. Eagle Strike [Band 4] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/e46a21054c8da2b3c0d46afe9bc7c865/w200_u90.jpg)
![Alex Rider. Scorpia Rising [Band 9] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/3c94c2aaec60d2997fb8da5488146852/w200_u90.jpg)
![Alex Rider. Crocodile Tears [Band 8] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/3d4c3c2ca6b7c5bf541a32fa57f1bbf3/w200_u90.jpg)









