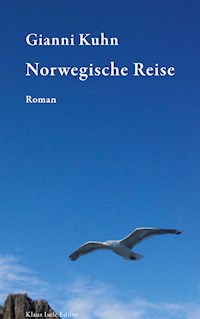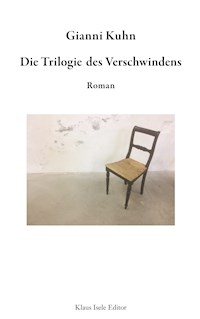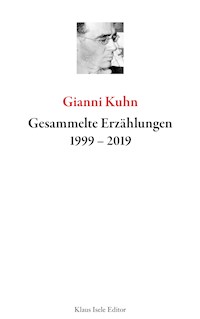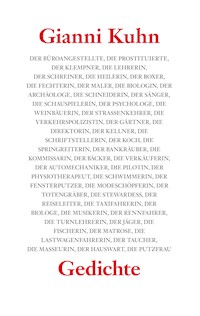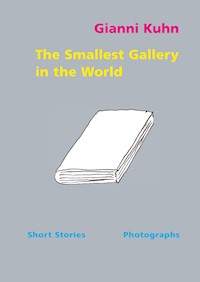7,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In einer Stadt am Meer drohen immer mehr Einwohner zu erblinden. Als der Drogennachschub, der sie vor dem Erlöschen des Augenlichts bewahren soll, von der Polizei unterbunden wird und sich gleichzeitig gemalte Personen aus Kunstgemälden zu entfernen scheinen, gerät die Stadt zusehends aus den Fugen. Gianni Kuhn versteht es aufgrund seiner profunden Kenntnis des Kunstbetriebs, die Leser anschaulich und spannend immer weiter in die Romanhandlung hineinzuziehen, so dass diese nicht mehr sicher sein können, ob sie nicht auch schon von der schleichenden Erblindung erfasst sind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 274
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
1
Eine Glühbirne. Ein rissiger Boden. Ein Hotelzimmer.
Während der Maler Francis Bacon mit den letzten Vorbereitungen seiner Retrospektive im Grand Palais in Paris beschäftigt ist, stirbt sein Freund George Dyer an einer Überdosis Barbiturate am Abend des 24. Oktober 1971 in einem Hotel in der Rue des Saints-Pères, zusammengekauert auf einer Kloschüssel sitzend. Dies spiegelt sich auch in Bacons Bild »Triptychon Mai – Juni 1973« wider.
In einem schäbigen Hotelzimmer sitzt ein nackter Mann auf einer Kloschüssel, kein dürrer Mann, kein ausgemergelter, sondern ein muskulöser. Es ist Bacons toter Geliebter. Ein vitaler Geliebter mit verwischtem Gesicht, Fleischgesicht, Muskelvisage unerkennbar, das blutverschmierte hochrote Ohr scheint zu brennen. Der Körper verdreht, verrenkt, die Wirbelknochen scheinen sich befreien zu wollen aus den Bergen von Fleisch, die allein von den straffen Bändern, den überdehnten Sehnen gehalten werden.
Eine Glühbirne, ein rissiger Boden, ein kahles Zimmer.
Auf der rechten Tafel des Triptychons erbricht sich ein Mann in ein Waschbecken. Als wollte er schlafen, als sei er des Malers Muse. Auch Blut rinnt aus seinem schmerzverzerrten Mund. Und doch ist er in der Pose eines Schlafenden, das Waschbecken sein Kopfkissen. Im Mittelteil sitzt er da, fast schon tot unter einer nackten Glühbirne, die seinen Kopf und Oberkörper hell beleuchtet, einen schwarzen Schatten gegen den Betrachter schlägt, eine schwarze Sauce von einem Schatten, ein Fliessen von Dunkelheit, als träumte er von seinem Geliebten.
Im linken Bildteil das Ende. Embryonal zusammengekauert George Dyer wie eine verdrehte Sphinx auf der Kloschüssel sitzend. Waden-, Gesäss-, Rücken-, Nacken- und Armmuskeln gewaltige runde und längliche Fleischpakete. So fand ihn die Polizei.
Ein schäbiges Hotelzimmer. Eine Glühbirne. Ein rissiger Boden.
Ein Mann erbricht sich, torkelt durch das Badezimmer, setzt sich auf die Toilettenschüssel und stirbt. Aus dem Türrahmen ein Schatten wie eine Fledermaus, ein angeketteter Schatten, der nie weichen will. Die Figur mit Pinsel und Öl hingeworfen, den flächigen Hintergrund auf der Rückseite der Leinwand mit matter Acrylfarbe aufgetragen, daher das Schimmern, daher das Rohe, fast schon Tapete, rissige, abblätternde Wand. Stahlwolle, Scheuerbürsten, Farbtubendeckel: Alles, was ihm als Pinselersatz in die Hände kam, war ihm recht, um seine Figuren zum rauhen Leben zu erwecken. Sein Atelier? Nackt, zwei Glühbirnen, ein schmaler Schacht zu einer Luke im Dach.
Es war Donnerstagabend. Am Samstagabend würde Vernissage sein. Iwan Sterner, ein Mann um die vierzig mit kurz geschorenen blonden Haaren, stahlblauen Augen und einer Nase, von der er spasseshalber sagte, dass man daran Kleider aufhängen könnte, bohrte mit dem Akkubohrer die Löcher für das letzte Bild, das er heute noch aufhängen wollte, stopfte zwei Dübel in die weiche Gipswand und drehte von Hand die zwei Winkelschrauben hinein. Der Schweiss perlte auf seinem Gesicht. Er zog sich den ultramarinfarbenen Pullover aus und legte die dünnen weissen Baumwollhandschuhe an. Erst jetzt wagte er es, das Bild zu berühren. Zu genau wusste er, was für Schäden der menschliche Schweiss auf Bildern, sei es direkt auf der Leinwand, sei es auf den teilweise vergoldeten Rahmen, anrichten konnte. Er griff sich das Bild, auf dessen Rückseite er zuvor sorgfältig die zwei Ringschrauben hineingedreht hatte, die genau in die Winkelschrauben in der Wand passen würden. Die elektronische Sicherung hatte Sterner schon vorher montiert. Er legte die Wasserwaage auf die obere Kante des Bilderrahmens. Die Luftblase blieb genau in der Mitte stehen wie ein kleiner gebannter Kobold.
»Perfekt!« rief Sterner erfreut, legte die Wasserwaage wieder auf den Werkzeugwagen und schaute noch einmal auf die paar letzten Bilder, die er aufgehängt hatte.
»Jetzt lass ich euch alleine mit euern nackten Körpern. Dass ihr mir aber nichts anstellt, wenn ich weg bin. Ihr seid jetzt euch selber überlassen. Ist das in Ordnung? Oder friert ihr? Soll ich die Heizung über Nacht etwas aufdrehen?«
Sterner verliess den grossen Ausstellungssaal und schloss die fast schon gotisch hohe hellgraue Türe hinter sich. Er schaltete die Alarmanlage für jeden einzelnen Raum separat ein. Draussen auf der Terrasse sass niemand mehr im Gartencafé, die weissen Stühle waren leer, keiner diskutierte mehr über die Werke von Juan Miró oder Paul Cézanne, Georges Seurat, Camille Pissarro oder Berthe Morisot, niemand nuckelte an seinem Espresso oder stocherte im Pouletsalat. Und hatte er am frühen Nachmittag dort nicht auch den leicht übergewichtigen Fridolin Berger in seinem zerbeulten Sommeranzug zusammen mit Dora de Keun, der grossgewachsenen Leiterin des Museums, einen Kaffee trinken, plaudern oder gar schäkern gesehen? Schon seit Wochen trieb sich dieser Berger hier im Museum herum. Offiziell betitelte er sich als Erfinder und war bekannt dafür, dass sich die Katzen von ihm wie magisch angezogen fühlten.
»Hat es an einem Ort mehrere Katzen, ist der Erfinder nicht weit«, sagten die Bewohner der Stadt.
Die Katzen mussten sich wie an einer unsichtbaren Schnur zu ihm hingezogen fühlen, und das war schon so gewesen, als Berger noch den Kindergarten besucht hatte. Man nannte ihn damals den Katzensucher.
»Er konzipiert für das Museum eine neue Beleuchtungs- und Alarmanlage«, hatte Dora de Keun vor ein paar Wochen zu Sterner gesagt und ihn dabei mit ihren grünen Augen angeschaut, dass es Sterner vorkam, als wollte sie ihm ein Geheimnis anvertrauen. Es blieb aber bei dieser Sehsucht in den Augen seiner Chefin, dieser Tiefgründigkeit mit einem Schimmer von Heiterkeit und Schalk.
In Bezug auf Berger hatte Sterner ein eigenartiges Gefühl. Was führte er wirklich im Schilde? Irgendetwas verbargen die beiden. Es wäre nicht das erste Mal gewesen, dass Fridolin Berger in eine Geschichte mit Ölbildern involviert gewesen wäre. Vielleicht waren die zwei nur verliebt ineinander. Aber das war ja nicht sein Bier. Sterner blickte hinunter zum Meer.
»Nimmt denn das Arbeiten nie ein Ende? Bis Morgen muss diese Ausstellung hängen, dann muss ich eine Ausstellung über die römische Vergangenheit unserer Stadt unten im Stadthaus konzipieren, dann folgt hier oben wieder eine kleinere Graphikausstellung. Bin ich zum Bilderaufhängen geboren oder bin ich ein Dichter? Bin ich ein Mann des Bildes, der Augen oder bin ich ein Mann der Wörter, der Sprache? Gespannt bin ich allerdings auf die Ausstellung der Fotografien von Henriette Lelong, die oben auf den Hügeln wohnt. Von ihr habe ich jede Ausstellung gesehen. Ihre Fotos sind wirklich sehr poetisch. Und auch als Frau ist sie sehr attraktiv, aber leider verheiratet. Ich sollte allen Mut zusammennehmen und ihr einen Brief schreiben. Ja, das sollte ich.«
Dies sagte er halblaut vor sich hin, dabei ins Meer hinausschauend, in dem sich die Lichter der Stadt diffus spiegelten, eine Art Lichterhaufen, ein Funkeln aus Licht, als hätte Albert Starmarker, der stadtbekannte Strassenkehrer, für einmal mit einem gigantischen Besen das Meer dort gewischt, wo es nun hell schimmerte.
»Vielleicht besteht ja das Meer aus Licht, das man nur wegen fehlender Reinigung nicht sehen kann. Vielleicht müsste man eine Meerreinigungstruppe aufstellen.«
Zwei Katzen rannten jaulend hintereinander her und verschwanden schnell hinter ein paar Ginsterbüschen. Viel war bei der schwachen Beleuchtung nicht zu sehen.
»Keilförmiger Kopf, hohe Beine. Das müssen diese norwegischen Waldkatzen gewesen sein, welche die Schwedin, diese Astrid Lelong, die Mutter von Henriette, aus ihrer Heimat mitgebracht hat.«
Schweden, Norwegen, Finnland, das waren hier unten im Süden Europas einfach die kalten Länder im hohen Norden. Also nannten die Bewohner der Stadt die aus Schweden importierten Katzen und all ihre aus Abenteuern mit einheimischen Katzen hervorgegangenen Nachkommen eben Schwedenkatzen, auch wenn sich dieser Name in keinem Katzenbuch finden liess.
Sterner ging die steilen Marmorstufen des gewundenen Spazierweges hinunter, so dass die Sohlen seiner rehbraunen Schuhe auf den Steinen ein helles Clip-Clap erzeugten. Dabei sagte er, ohne sich dessen richtig bewusst zu werden, in einem eigenartigen Singsang das Gedicht »Moguer« von Juan Ramón Jiménez vor sich her:
»Ertrinkt das Dorf bei Einbruch der Nacht in grossen Wolken…«
Noch bevor er den alten Teil der Stadt erreicht hatte, wo die gotische Kathedrale mit ihren zwei hohen Türmen stand, stieg ihm der Geruch von Salz und Fisch in die Nase. Es kam ihm so vor, als bade sein ganzer Körper in diesen Gerüchen, die nur in der Nacht eine so geheimnisvolle Mischung von süss, faulig und herb zu erzeugen vermochten. Ging er einmal nicht hinauf ins Museum, wo die Gerüche nach Erde und Pflanzen des Hinterlandes in der Luft lagen, so fiel ihm der Fischgeruch, von dem die Stadt durchzogen war, nicht besonders auf.
»Ganz anders als oben im Museum, diesem Kunsttempel, nicht wahr, Iwan?« sagte er zu sich selbst, »dort riecht es nach Lavendel. Der Wind ist immer zu Angriffen bereit, und die Sonne lässt den ganzen Sommer über nicht viel Schatten zu. Aber was tust du dort oben? Sitzst du im Café und fängst Gesprächsfetzen auf, wanderst du über die Hochebenen und lässt dir dabei die Beine von den Disteln zerkratzen oder verbringst du halbe Tage im Schatten eines Feigenbaumes und sinnst dem Weltenlauf nach?«
Sterner wich geschickt, als wäre er ein Tänzer, einem Haufen Hundekot aus, den er erst im letzten Augenblick bemerkt hatte.
»Nein, seit zwei Wochen arbeitet der Iwan Tag und Nacht dort oben wie ein Besessener, holt Bilder aus ihren Holzkisten, lässt sie vom Restaurator kontrollieren, stellt sie auf hellblaue Schaumstoffe, damit ihre Rahmen ja keinen Schaden nehmen, bezeichnet mit Bleistift die genaue Position an der Wand und montiert sie schliesslich an eben dieser. Gewiss, tagsüber hat er seine Gehilfen, etwa Pedro mit dem langen, blonden Haar, doch der muss dreimal pro Stunde austreten, um eine Zigarette zu rauchen. Und wenn es dunkel wird, zieht es ihn unter irgendeinem Vorwand hinunter in die Kneipen. Nun ja, da arbeitet der Sterner noch weiter, ohne auch nur einen klitzekleinen Satz zu schreiben. Da mache ich meinem Namen keine grosse Ehre. Die Sterne sollte ich suchen und nicht die Erde. Wie soll da je ein Gedichtband von mir erscheinen?«
»Hallo, Blaumann, was redest du da vor dich hin? Suchst du das blaue Meer? Das ist gleich da unten. Nur immer geradeaus! Du kannst es nicht verfehlen!«
Sterner hatte erst jetzt bemerkt, dass er unter Menschen war. Er kümmerte sich nicht weiter um die Studenten, die ihn eben angepöbelt hatten. Dazu war er zu müde und zu hungrig, und zudem dachte er ans Schreiben.
Als er bei seinem kleinen Haus ankam, das sich unten bei der marinen Anlage befand, wie sie den Bouleplatz am Meer nannten, trottete vor ihm ein weisser Hund mit kurzen Haaren vorbei, und Sterner beneidete ihn um sein Dasein.
»Du hast alle Zeit der Welt, treibst dich am Hafen rum, schnappst dir ein paar Fische, schaust den Matrosen zu, wie sie die Tanker reinigen, hüpfst über die Gleisanlage, schnupperst am Fruchtschuppen, suchst dir eine schöne Hündin, und wenn du Lust hast, trottest du nach Hause.«
»He, Sterner«, riefen ihm ein paar Kollegen zu, »wie wär’s mit einer Runde Nacht-Boule?«
»Ein andermal, heute bin ich zu müde, muss zuerst noch einen Happen essen. Ihr wisst ja, die neue Ausstellung.«
»Er arbeitet Nachtschicht im Museum, gibt’s denn sowas. Die könnten ihre Bilder auch ein paar Wochen früher anliefern, dann könntest du diese tagsüber aufhängen. Dann hättest du schon gegessen und könntest mit uns spielen.«
»Nächste Woche, versprochen.«
Durch das grosse, bis zum Boden reichende Fenster im ersten Stockwerk seines kleinen Hauses, das wie ein Fleischstück in einem Sandwich zwischen zwei stattlicheren Gebäuden eingeklemmt war, sah er seine Kollegen im Schein eines Autoscheinwerfers Boule spielen. Clic-Clac tönte es von den aneinanderstossenden Kugeln, und bei jedem Clic-Clac wurde Sterner schläfriger. Die tagsüber schattenspendenden Bäume mit ihren hellgrauen, leicht gelblichen Stämmen und den grossen, fünflappigen, saftgrünen Blättern standen da wie Gespenster. Es war das letzte, was Sterner sah, bevor er in seinem roten Ledersessel einnickte.
2
In einer Scheune in Horta wird einem toten Mädchen in einer Notfall-Autopsie die linke Gesichtshälfte abgetrennt. Im Laternenschein schaut ein junger Mann zu. Der Jüngling wird angesichts dieses übermächtigen Eindrucks ohnmächtig. Sein Inneres, das sich später als malendes Auge offenbaren wird, ist von einem atemberaubenden Blau erfüllt. Entsetzt verlässt der junge Mann die Scheune.
Klafft etwa nicht die »Buste de femme et de marin«, 1907 gemalt, fleischrosarot in das Auge des Betrachters? Für Pablo folgen Jahre im Innersten des Äussersten, doch noch lange nicht der Tod, sondern die Erkrankung an der Syphilis. Dieser erneute Bruch erhöht den Preis für ein wenig wärmendes Licht gewaltig, das Sezieren wird zum Dauerzustand. Einfache Schatten in den Gesichtern der Menschen gilt es für ihn reglos zu ertragen. Er setzt hier Tintenfische ein für das nicht mehr auszuradierende Blau, als hafteten die Tentakeln leibhaftig auf den aufgerauhten Poren der Leinwand. Er zerschmettert dieses Plattenschiefergrau, diese Verschattung eines Frauengesichts durch heftige Stösse, durch in die gemalten Körper geschleudertes Ergussgestein. Er reisst alle Lamellen weg von den lieblichen Augen, zerschneidet sie, durchlöchert sie, stopft sie voll mit kosmischem Schwarz, um immer wieder die Teerschicht aufzureissen, den gewohnten Fahrweg der Wahrnehmung, zu tun, was alle fürchten und sich trotzdem insgeheim erhoffen: dass ihnen jemand die Welt aus den Angeln hebt. Noch früh genug werden sie sich daran gewöhnt haben, werden nicht mehr richtig hinschauen, werden all die eben noch so schrecklich hechelnden Ölbilder zwischen den Deckeln der Kunstbücher geglättet sehen, werden sie digitalisiert durchs Internet jagen, werden sie auf ihre Computer herunterladen und auf ihren wunderbar flachen Bildschirmen anschauen, ohne befürchten zu müssen, dass von diesen nun aus Pixeln zusammengesetzten Gesichtern auch nur ein Blutstropfen auf ihre Computertastatur fiele; und so warten sie darauf, dass immer wieder aufs neue jemand kommt, der sie aufschreckt, der sie aus dem Schlaf reisst, ihre Körper, ihre Gefühle, ihren Intellekt nachhaltig durcheinanderwirbelt, der sie betroffen macht und so die Welt für eine gewisse, wenn auch nur begrenzte Zeit, vor ihren Augen neu zu erschaffen vermag.
»Das wäre dann also noch der Teil über Picasso. Hast du das nicht gut gemacht?« lobte sich die Museumsleiterin Dora de Keun selber.
Zugegeben, dachte sie weiter, ich hatte gestern eine Zwischenbesprechung mit Sten de Nada. Schliesslich ist er Kunstwissenschaftler wie ich auch. Den kennen hier alle wegen seiner wöchentlich in der Stadtzeitung erscheinenenden Kunstkolumnen. Aber haben wir nicht schon gemeinsam die Schulbank gedrückt? Natürlich! Schon damals haben wir uns gegenseitig geholfen. Ich, die Grosse und er, der Hagere. Dabei ist es geblieben. Mal haben wir uns Jahre nicht mehr gesehen, dann wieder täglich. Manch mal hatten wir wegen der Kunst miteinander zu tun, manchmal, weil wir uns zueinander hingezogen fühlten, und manchmal wegen beidem. Beim Diskutieren über ein Bild landeten wir oftmals im Bett, und im Bett begannen wir wieder über die Kunst zu sprechen. Wir sind dabei nicht jünger geworden. Seine Haare werden allmählich silbrig und meine sind gefärbt. Kein Wunder, in drei Jahren werden wir beide fünfzig. Da lassen wir eine mordsmässige Kunstparty steigen.
Fast etwas wehmütig über das schnelle Verrinnen der Zeit stand sie auf, stellte sich vor das grosse Fenster, das nachts wie ein Spiegel wirkte. Sie war hochgewachsen, hatte halblanges, schwarzes Haar im Pagenschnitt, grün funkelnde Augen, einen Riecher für gute Kunst und die entscheidenden Beziehungen. Sie war mit sich zufrieden.
Mitternacht war längst vorbei. Das ganze Wochenende hatte sie an diesem Text gearbeitet. Es war bereits Montagmorgen zwei Uhr in der Früh. Am Samstag würde die Vernissage der Ausstellung sein, die den Titel »Mit Haut und Haar« trug. Dora de Keun war froh, dass sie den Rest des Textes für den Ausstellungskatalog noch hatte fertigstellen können. Jules, der Graphiker, würde den Text in das ansonsten fertiggestellte Layout einfügen. Im Laufe des Nachmittags bekäme sie dann das »Gut zum Druck« und würde den Text nochmals auf Fehler durchschauen. Am darauffolgenden Tag ginge dann der Katalog in Druck. Die Druckbogen mussten danach so schnell wie möglich in die Buchbinderei. Am Freitagnachmittag war schliesslich Pressekonferenz, und da mussten die ersten Presseexemplare vorliegen. Knapper ging es nicht mehr. Das war sie gewohnt.
Draussen hörte sie das Schaben der Blätter des Feigenbaumes an der Aussenwand, das entfernte Klappern von ein paar Fensterläden, und ab und zu das Jaulen eines Katers, das sie an ihre eigene Katze gemahnte, die sicherlich auf Futter wartete, wenn sie überhaupt wieder fressen mochte. In den letzten Tagen war sie appetitlos gewesen. Die ockerfarbene Katze der Nachbarin hatte eingeschläfert werden müssen, weil sie an der felinen Katzenleukose, einer tödlich endenden Krankheit, auch bekannt als Katzenaids, erkrankt war. Wenn nur Miou nicht krank war, dachte Dora de Keun.
»Das wäre schrecklich, wenn ich nicht mehr über das tiefgraue Fell meiner Kartäuserkatze streichen und sie mich nicht mehr mit ihrem Schnurren erfreuen könnte.«
Sie glaubte, die Stimmen von Albert, dem dicklichen Strassenkehrer mit der Hasenscharte, und Gaston Ferrand, dem Chef der Reinigungsequipe, welcher für die Sauberkeit im Museum verantwortlich war, zu hören.
Sie öffnete das Fenster: »Gaston Ferrand, sind Sie das?«
Die Stimmen verstummten. Es war nur noch ein Rascheln zu hören.
»Hallo, ist hier jemand?«
Dora de Keun stellten sich die Nackenhaare. Dann hörte sie schnelle Schritte und das grelle Aufheulen eines Motorrads, das sich rasch entfernte. Dann nur noch die Stimmen von ein paar Betrunkenen in der Ferne.
»Eigenartig. Gaston Ferrand arbeitet doch nicht mehr um diese Zeit. Und Albert, dieses Original von einem fotografierenden Strassenkehrer, was hätte der um diese Zeit hier verloren?«
Sie streckte die Arme gegen die Decke ihres Büros und schloss das Fenster, das gegen Westen ging.
»Dem Ferrand ist hoffentlich nichts aufgefallen bei diesem Bild mit dem Falschspieler. Sonst müsste ich mich von ihm trennen. So einen guten Reinigungsmann hatte ich noch nie, und man weiss ja, wie schwierig es heutzutage ist, gutes Personal zu finden. Aber vielleicht waren es ja nicht Gaston oder Albert.«
Sie löschte kurz das Licht. Jetzt sah sie durch das geschlossene Fenster das Meer. Sie öffnete es wieder. Bei windigem Wetter, wie in dieser Nacht, war das Rauschen für sie allerdings mehr wie ein äusserer Herzschlag, der, so kam es ihr vor, ihren eigenen Herzschlag berührte. Es war ihr, als spielten das Meer und ihr Herz zusammen ein Musikstück.
»Das hast du wirklich gut gemacht«, wiederholte sie und knipste das Licht wieder an. »Wo ist denn die neue E-Mail-Adresse von Jules? Ah, hier. Morgen früh hat er, was er braucht. Der Rest ist dann seine Sache. Ich hab genug für heute.«
Sie kannte das bei sich nur zu gut: Sie wurde mit ihren Texten für Kunstkataloge immer erst im letzten Augenblick fertig. Sie hatte so viel um die Ohren mit den Künstlern, die bei ihr ausstellen wollten, mit dem Ausstellungsprogramm, den Sponsoren, den Finanzen, den Versicherungen, den Besuchern, selbst mit dem Museumspersonal. Darüber hinaus sass sie auch noch in den meisten Kommissionen, in denen es um Kunst im öffentlichen Raum oder um Förderbeiträge an Künstler ging.
Sie löschte das Licht in ihrem Büro endgültig und spürte erst jetzt, wie müde sie war. Iwan hatte die Alarmanlage im Bilderlager, den Werkstätten und den Ausstellungsräumen längst eingeschaltet. Gut hatte sie ihn, dachte sie, so brauchte sie sich wenigstens nicht auch noch um das Technische der Ausstellungen zu kümmern. Sie ging die Zufahrt entlang, auf der die grossen Laster jeweils die Bilder für Spezialausstellungen anlieferten und ein paar Monate später wieder abholten, bis zum Parkplatz, der nördlich des Museums lag. Sie stieg in ihr Auto, startete den Motor und fuhr los. Sie fühlte sich in diesem durch die Nacht fahrenden Gehäuse ein wenig wie eine Sternschnuppe. Sie dachte an Sten, zu dem sie sich in letzter Zeit wieder mehr hingezogen fühlte.
3
Albert Starmarker war früh auf den Beinen. Er war der bekannteste Strassenkehrer der Stadt, der Mann mit dem Besen. In der Schule hatten sie ihn immer wegen seiner Hasenscharte gehänselt, dieser angeborenen Spaltung der Oberlippe.
»Da kommt der kleine Hasenfuss«, hatten sie ihn ausgemacht, jedenfalls bis zu jenem Tag, an dem in ihrem Schulhaus ein Brand ausbrach. Alle Schüler, Lehrer und auch der Hausmeister François Glombink standen draussen auf dem Pausenplatz, das Sirenengeheul der Feuerwehr war schon, wenn auch erst von weitem, hörbar.
»Die Anaïs, wo ist Anaïs?« Alle schauten sich um, doch da war keine Anaïs.
»Dann ist sie noch im Schulzimmer«, rief ein Lehrer voller Entsetzen. Fassungslos sahen die Schüler, wie der kleine Albert zum Schuleingang rannte und dort im Rauch verschwand. Allen stockte der Atem, doch niemand, auch keiner der Lehrer, folgte dem Jungen. Die Zeit schien stillzustehen. Plötzlich ein lauter Knall, begleitet von einer Staffel von Stichflammen, die sämtliche Fensterscheiben der Schulzimmer im oberen Stockwerk bersten liess. Alle befürchteten, dass die beiden in den Flammen umgekommen waren, als unten aus dem Eingang plötzlich Albert, Anaïs auf den Händen tragend, aus dem Qualm her auskam. Da er selbst so klein war, schien es, als ob Anaïs schwebte. Tatsächlich trug er sie hinaus bis zum verdutzten Haufen von Schülern, wo sich die Lehrer um sie kümmerten. Im selben Augenblick erschien die Feuerwehr mit lautem Getöse und grosser zielgerichteter Betriebsamkeit.
Von da an wurde Albert nicht mehr gehänselt. Er war der eigentliche Held der Schule, ja, der Stadt. Er wurde interviewt, fotografiert und erschien landesweit in der Presse. Er erhielt von der Stadt sogar einen Orden für sein beherztes Handeln.
In der Pubertät wuchs Albert zu einem stattlichen Jüngling heran, und hätte er nicht diese Hasenscharte gehabt, wäre er bald der Liebling aller Mädchen gewesen.
Und jetzt war er ein Mann. Gewichtig stand er da mit seinem Besen. Etwas klein mit dicken Beinen, einem Bauchansatz und immer gerötetem Gesicht, einer grobporigen Nase, schütterem Haar und grossen Ohren. Mit seinen Augen pflegte er zu zwinkern, und dies vor allem, wenn er schräg nach oben schaute. Man nannte ihn den Mann mit dem Besen. Auf das Fegen verstand er sich nämlich wie kein Zweiter, und darauf war er stolz. Im Ansatz bestimmt, aber weich, dann gleichmässig wie ein Schnitter mit der Sense.
»Nur so wird die Stadt sauber«, pflegte er zu sagen. »Die Augen musst du immer offen halten. Papierfetzen, Zigarettenkippen, verfaulte Früchte, Platanenblätter. Die Hauptfeinde sind die halbdurchsichtigen leeren Kunststofftüten, die von jedem Windstoss weitergetragen werden. Die verstehen sich auf ihr Geschäft. Sie verstecken sich hinter Bäumen, unter Autos oder schmiegen sich gar an Abfallkörbe an. Sie wollen den Eindruck erwecken, als wollten sie am liebsten in diese rein. Ich sage ihnen: Alles nur Täuschung. Der Dreck und der Unrat will sich verbreiten. Überall rumliegen will er, mit dem Wind herumtanzen und uns verhöhnen. Aber nicht mit Albert.«
Die Stadt war durchzogen von den feinen Texturen, den Spuren seines Fegens. Für Albert Starmarker war die Stadt wie eine grosse graue Katze, deren Fell er täglich ein kleines Stückchen reinigte.
»Ich bin die Zunge der Katze«, murmelte er manchmal vor sich hin, wenn die Welt im Fegen gleichsam stillzu stehen schien.
»Ich bin eigentlich Maler«, flüsterte er den Touristen zu, die seine harmonischen Bewegungen und seine Würde bei der Arbeit bewunderten. Manche Leute glaubten gar, er sei ein Zen-Meister.
»Sind Sie nicht der Autor des Buches ›Zen oder die Kunst des Fegens‹?« fragten sie ihn etwa oder »Hören Sie Musik oder innere Klänge, wenn Sie den Boden kehren? Vielleicht Stimmen, die Sie anleiten?«
»Haben Sie keine innere Stimme?« fragte er dann zurück, und die Fragenden schwiegen.
Jetzt war er voll und ganz in seine Arbeit vertieft. Ein geschäftiger Herr in dunklem Anzug mit hellblauer Krawatte und rosa Hemd sagte zu ihm: »Sie sollten das als Kunst betreiben. Sie sollten ins Museum gehen und dies dort als Performance aufführen. Am Samstag haben die wieder eine Vernissage. Heute ist«, und dabei schaute er auf seine Armbanduhr, »Dienstag. Sie hätten noch genügend Zeit, um sich darauf vorzubereiten.«
»Aber die haben dort ihr eigenes Reinigungspersonal. Und zudem arbeite ich lieber im Freien. Was soll ich diese alten Ölbilder abstauben? Und was ist überhaupt eine, was haben Sie gesagt?«
»Eine Performance«, gab der Herr zurück. »Ich denke, wir sollten eine Reportage über Sie machen. Sie sind ja ein Ausbund von Authentizität. Diese Innigkeit bei der Arbeit, diese Asphaltverbundenheit, dieser Hang zur Sauberkeit. Dazu Ihr Äusseres: Kräftig gebaut, Charakterkopf mit beginnender Glatzenbildung, imponierender Schnurrbart, ausgeprägte Nase, durchdringende Augen. An Ihnen ist alles echt.«
»Sie meinen?«
»Ja, gewiss. Sie stehen Ihren Mann. Mehr noch, Sie sind der Vorreiter der heutigen Zeit. Sie könnten selbst in die Politik einsteigen.«
»Jetzt muss ich aber wieder an die Arbeit.«
»Natürlich. Nur noch eine Frage. Sie gleichen dem Jungen, der damals das Mädchen gerettet hat. Kennen Sie ihn?«
»Der wen gerettet hat?«
»Anaïs. Die kennt doch heute jeder Mann in dieser Stadt. Sie verstehen?« Dabei zwinkerte er und stiess Albert leicht mit dem Ellbogengelenk an.
»Ja, ich war ihr Retter. Ich hab sie aus dem brennenden Schulzimmer geholt«, sagte Albert mit geschwellter Brust.
»Sehen Sie. Sie waren einmal ein Held, und Sie werden es wieder sein. Schauen Sie sich doch die Fussballer an. Zuerst schiessen sie jahrelang Tore, werden bejubelt, und nachher, wenn sie schlau sind, dann werden sie Trainer einer Mannschaft, wenn nicht gleich der Nationalmannschaft. Auch Sie sind ein Vorbild. Sie haben das Zeug zum Feuerwehrhauptmann oder noch besser zum Künstler.«
»Sie meinen?«
»Ja, gewiss.«
Albert schüttelte den Kopf und begann die Strasse zu kehren.
»Sie müssen an die Arbeit. Was halte ich Sie denn auch so lange auf. Gehen Sie nur an die Arbeit, gehen Sie.«
Dabei zog der Herr an seiner Zigarre, einer frischen Cohiba Esplendidos.
»Sie wissen doch«, erklärte er dem fegenden Albert, »die kommt direkt aus Kuba. So wie Sie der Kaiser der Strassenreinigung sind, so ist das die Königin unter den Havanna-Zigarren. Eine sehr aromareiche, würzige Zigarre mit einem sehr glatten, mitteldunklen Deckblatt.«
Albert fegte sanft, aber bestimmt über den Boden, wobei er sich allmählich vom rauchenden Herrn entfernte.
» Die Cohiba wurde 1961 vom damaligen Revolutionsführer Che Guevara geschaffen«, rief ihm der Herr mit erhobenem, allmählich röter werden dem Kopf nach, »und wird seit 1981 exportiert. Ein Mann von Ihrem Format, dieser Che Guevara, nicht wahr, Albert? Hören Sie mich? Ich darf Sie doch so nennen. Gewiss doch. Alle nennen Sie hier so. Sie tragen schliesslich das Banner der Reinigung hoch. Sie wissen noch, gegen was Sie zu kämpfen haben.«
Albert schob das Zusammengekehrte in die beinahe im rechten Winkel abgeknickte Aluminiumschaufel und entleerte diese in sein mitgeführtes zweirädriges Gefährt. Und bald schon hatte er die nächste Häuserecke erreicht. Dabei dachte er an Anaïs, in die er immer noch verliebt war. Er besuchte sie jede Woche einmal. Dass der Herr gesagt hatte, jeder Mann in der Stadt kenne sie, hatte ihn etwas gekränkt. Natürlich wusste er, was für einem Gewerbe sie nachging, aber er wollte es nicht wahrhaben. Wenn er sie nicht gerettet hätte, tröstete er sich, wäre sie tot, und niemand würde sie kennen. Er war ihr Retter, das hatte ihm der Herr wieder einmal in Erinnerung gerufen. Er würde sie demnächst, am besten noch heute, besuchen gehen.
4
Der Wind vom Land her hatte wieder aufgefrischt und zerrte an der Kamera, dem Balg, an Henriette Lelongs roten Haaren. Bald würde es regnen. Der Tramontan hatte ihr vor ein paar Jahren eine Fotoausrüstung ins Meer hinuntergekippt. Alles war zerbeult und voller Salz gewesen, als wär’s ein Fundstück aus der Titanic. Dies würde ihr nicht noch einmal passieren. Sie hatte jetzt immer drei Heringe und einen Hammer dabei, mit dem sie diese ins Erdreich trieb, um daran das Stativ zu befestigen. Das war hier oben auf diesem Plateau über den Klippen allerdings nicht so einfach, denn der Untergrund bestand vor allem aus porösem, ockerfarbenem Gestein und verkrümelter Erde. Zum Glück hatte sie Satoshi, ihren japanischen Assistenten, dabei.
»Meine Kamera geht vor Anker«, sprach sie vor sich hin. »Es ist sowieso ein Irrsinn, mit einer solchen Kamera in diesem Staub, in dieser Salzluft zu fotografieren.« Aber was hätte sie tun sollen. Sie war, und sie kannte da niemanden, dem es mit dem Fotografieren anders erging, sie war von ihren Sujets besessen.
»Was sagen Sie?«
»Was? Habe ich etwas gesagt?«
»Ja, etwas von Staub und Salzluft.«
»Ah, ja? Entschuldige. Normalerweise bin ich allein mit der Natur und der Kamera. Da kann es schon vorkommen, dass ich zu mir selber spreche. Das sind für mich mehr so Gedanken als wirkliche Sprache.«
»Natürlich, ich verstehe.«
»Du musst dich auf die Dinge, die dich anziehen, einlassen, du musst ihnen die Zeit lassen, sich in dir drinnen zu einem Bild zu formen, du musst mit ihnen sprechen«, erklärte sie ihrem japanischen Laborgehilfen. Sie hatte früher geglaubt, Japaner seien eher schweigsam, doch nicht Satoshi, der sie immer wieder, und heute, wo er das erste Mal bei Aussenaufnahmen dabei war, mit besonders vielen Fragen belagerte.
»Aber sagen Sie mir, wie lange muss ich Ihrer Meinung nach warten, bis ich an einem neuen Ort die erste Fotografie machen kann? Einen Tag, eine Woche, einen Monat?«
»Ich kann dir das nicht so genau sagen. Das musst du selber spüren. Da gibt es kein Rezept. Du bist ein Mann und ich eine Frau, du bist Japaner und ich halb Französin, halb Schwedin. Zudem haben wir nicht dasselbe Naturell. Ich jedenfalls kann erst nach langer Zeit am gleichen Ort mit Fotografieren beginnen. Verstehst du? Bei mir gibt es keine Schnellschüsse. Das ist wie mit der Ölmalerei. Auch dort muss sich das Bild zuerst innerlich, tief in dir drinnen«, und dabei klopfte sie sich mit der flachen Handinnenseite auf die Brust, »hier muss es sich aufbauen, der Druck muss allmählich steigen. Komm doch am Samstag zur Vernissage bei Dora de Keun oben im weissen Museum. Du wirst auch in den Ölbildern dieses Suchen, dieses ausdauernde Arbeiten, dieses Umkreisen des selben entdecken können.«
Wieder fegte ein heftiger Windstoss über die Ebene.
»Wie heisst die Ausstellung?« fragte Satoshi.
»Mit Haut und Haar«, rief Henriette zurück .
Die Windböe hatte sich wieder gelegt. Sie mussten ob ihrer Ruferei lächeln, wobei Satoshis Augenschlitze noch schmaler wurden, als sie es eh schon waren.
»Und glaube mir, auch in der Ölmalerei kannst du viel über die Fotografie lernen, über den Bildaufbau, über den Lichteinfall, über die Oberfläche – eben über die Haut der Dinge. Zudem gibt es im sogenannten Kleinen Kabinett des weissen Museums eine dokumentarische Fotoausstellung über die ausgestellten Maler, wo es vor allem um diejenigen Sujets geht, die zuerst fotografiert und erst dann gemalt wurden. Der Weg geht also nicht immer von der Natur über den Maler zum Bild, sondern oft auch über den Umweg der Fotografie.«
»Und wer wird da gezeigt?« wollte der Japaner wissen.
»Camille Pissarro, Georges Seurat, Edouard Manet, Claude Monet, Pablo Picasso, Francis Bacon, um nur einige zu nennen.«
Henriette Lelong liebte diese Interferenzen zwischen der Fotografie und der Malerei. Manchmal kam sie sich sogar vor wie eine Bildhauerin, die immer wieder von neuem ansetzt, immer ein- und denselben Stein bearbeitet. Nur war es bei ihr das Licht, welches das vier Mal fünf Inch grosse, in eine Kassette eingespannte Negativ bearbeitete.
»Hast du gehört, Satoshi, ich arbeite mit Licht. Ich ritze das Licht ins Negativ. Ich lasse ritzen. Und du fertigst im Labor das Positiv an. Und wer hat uns das alles ermöglicht?«
»Der Gott der Fotografie.«
»Der Gott der Fotografie? Ja, vielleicht hast du recht«, lächelte Henriette Lelong. »Für mich heisst dieser durchaus irdische Gott allerdings William Fox Talbot.«
»Sie sprechen vom berühmten William Fox Talbot?«
»Ja, von dem spreche ich. Du kennst ja sicher die Geschichte vom Comersee?«
Der Wind pfiff nun heftiger über die Ebene. Beide schwiegen, bis es wieder etwas ruhiger wurde.
»Nein, die kenne ich nicht«, antwortete Satoshi, »wie geht denn diese Geschichte?«
»Gut. Ich werde sie dir kurz erzählen. Aber nachher muss ich mich auf das Fotografieren konzentrieren. Dafür sind wir schliesslich hier hinaufgefahren.«
»Ja, natürlich«, nickte Satoshi.
»William Fox Talbot zeichnete auf seiner Hochzeitsreise 1833 an den Ufern des Comersees mit Hilfe der Camera obscura die Landschaft nach. Und wieso? Weil er diese Landschaft so wunderbar fand, sie aber nicht so perfekt abzeichnen konnte wie seine Freunde.«
»Er begann mit der Fotografie, weil er ein schlechter Zeichner war?«
»Ja. Weil er die einzigartige Schönheit der Natur mit Bleistift und Pinsel nicht festzuhalten vermochte, arbeitete er mit der Camera obscura.«
»Bei der aber die entstehenden Bilder damals nur so lange anhielten, wie Licht durch die Linse einfiel, nicht wahr?«
»Das war der schmerzliche Punkt. Talbot versuchte deshalb, diese Schöpfungen des Augenblicks auf die eine oder andere Art chemisch festzuhalten.«
»Und wie bewerkstelligte er das?« fragte Satoshi, den es offensichtlich nicht störte, dass eine Fliege auf seiner Stirn durch den Wald seiner sehr kurz geschnittenen schwarzen Haare weitertippelte. Offensichtlich suchte sie Schutz vor dem heftigen Wind.
»Er tauchte ein feines Schreibpapier in eine Kochsalzlösung, liess es trocknen und bestrich es danach auf einer Seite mit einer Silbernitratlösung.«
»Und dann?«
»Dann belichtete er das so präparierte Papier in der Camera obscura für eine Stunde. Zum Haltbarmachen tauchte er das belichtete Papier in eine stärkere Kochsalzlösung. Ab ungefähr 1839, so meine ich mich zu erinnern, verwendete er Bromsilber als lichtempfindliche Schicht.«