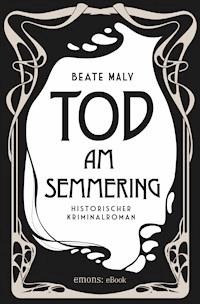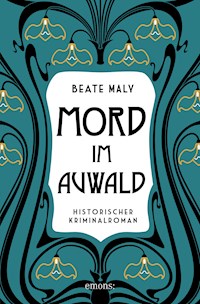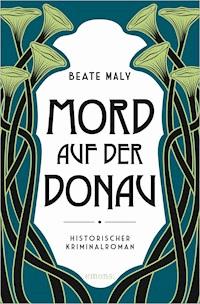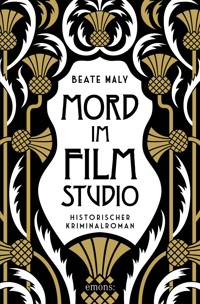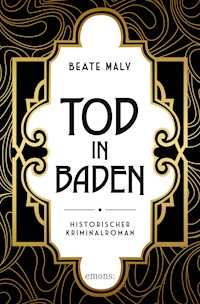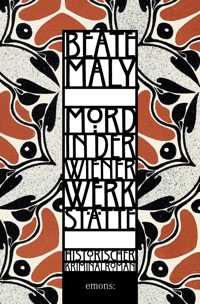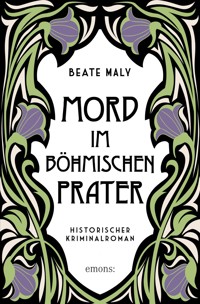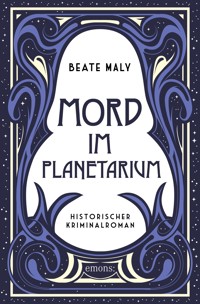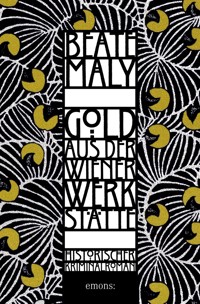8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
1618: Die junge Apothekerin Jana und ihr Mann Conrad reisen in die Neue Welt. Sie folgen den Hinweisen des geheimnisvollen Sündenbuchs auf der Suche nach einem sagenumwobenen Schatz im Herzen Amerikas – El Dorado. Doch Gefahren lauern überall: Auf dem Meer entkommen sie nur knapp Piraten, und an Land erwarten die Schatzsucher dessen feindselige Bewohner. Und dann ist da noch der dunkle Mönch, der Jana und Conrad folgt, seit sie die Alte Welt verlassen haben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Der Fluch des Sündenbuchs
BEATE MALY, geboren in Wien, ist Bestsellerautorin zahlreicher Kinderbücher, Krimis und historischer Romane. Ihr Herz schlägt neben Büchern für Frauen, die entgegen aller Widerstände um ihr Glück kämpfen.
Von Beate Maly sind in unserem Hause bereits erschienen:
Die Hebamme von WienDie Hebamme und der GauklerDer Fluch des SündenbuchsDie DonauprinzessinDer Raub der StephanskroneDie SalzpiratinDie KräuterhändlerinFräulein Mozart und der Klang der LiebeDie Frauen von SchönbrunnDie Bildweberin
Im Herbst 1618 besteigen die junge Apothekerin Jana Jeschek und ihr Geliebter, der Arzt Conrad Pfeiffer, ein Schiff in Richtung Amerika. Sie sind im Besitz einer geheimnisvollen Schatzkarte. Ziel ihrer Suche ist das sagenumwobene El Dorado. Doch die beiden sind nicht die Einzigen, die sich auf den Weg in die Neue Welt machen. Ein hochverschuldeter Engländer und ein katholischer Mönch wissen ebenfalls davon. Ein gefährliches Wettrennen – auf dem Meer und auf einem Kontinent, den zu dieser Zeit nur wenige Europäer gesehen haben – beginnt. Die Reise führt von der Karibik aufs Festland und in eine unbekannte Welt voller Abenteuer und Gefahren. Werden Jana und Conrad finden, was sie suchen?
Beate Maly
Der Fluch des Sündenbuchs
Historischer Roman
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
Originalausgabe im Ullstein Taschenbuch1. Auflage November 2013© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2013Umschlaggestaltung: zero-media.net, MünchenTitelabbildung: Frau und Schiff: © getty images, Pergament: © FinePic®Karte im Innenteil: © Peter Palm, Berlin Autorenfoto: © Fabian Kasper E-Book powered by pepyrusAlle Rechte vorbehalten.Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.ISBN 978-3-8437-0634-6
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Das Buch
Titelseite
Impressum
London,
Gran Canaria,
Lissabon,
Atlantik,
Plymouth,
Atlantik,
An Bord der Anne Rose,
An Bord der Santa Lucia,
An Bord der Santa Lucia,
Tobago,
Vor Trinidad,
Tobago,
Trinidad,
Cumaná, am Festland auf der Höhe der Isla de Margarita,
Tobago,
Trinidad,
Tobago,
Trinidad,
Santiago de Léon de Caracas,
Orinoco Delta,
Santiago de León de Caracas,
Orinoco Delta,
Santiago de León de Caracas,
Santiago de León de Caracas,
Orinoco Delta,
Auf dem Weg von Santiago de León de Caracas nach Barinas,
Kurz vor Barinas,
Apurito,
Barinas,
Barinas,
Auf dem Weg nach San Cristóbal,
Auf dem Weg nach San Cristóbal,
Barinas,
Auf dem Weg nach Zipaquirà,
San Cristóbal,
San Cristóbal,
Zipaquirà,
Zipaquirà,
In der Nähe der Lagune von Guatavita,
In einem kleinen Dorf in der Nähe von Zipaquirà,
Zipaquirà,
Karte Mittelamerika 1618
Nachwort
Leseprobe: Die Bildweberin
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
London,
London,
September 1618
Aqua Vitae. Das Getränk wärmte den Magen, vernebelte die Sinne und half dabei, die eigenen Fehler und Unzulänglichkeiten zu vergessen. Es war Richard Waltons Lebenselixier. Der Saft, der ihn am Leben hielt, seine Medizin gegen Selbstzweifel und Angst, die ihn großzügig alle eigenen Fehler verzeihen ließ. Nichts hätte er im Moment dringender gebraucht als jenen starken Brand gemalzter Gerste, den man in der Heimat seiner Mutter Usquebaugh nannte. Ein Wort, das nur aus dem Mund eines Schotten so klang, wie der Brand schmeckte: herb, scharf und, erst wenn er längst den Gaumen passiert hatte, überraschend malzig mild. Aber ausgerechnet jetzt war Richard so trocken wie selten zuvor. Dabei befand er sich an einem der feuchtesten Orte der Stadt: auf einem wackeligen Ruderboot mitten auf der Themse.
Angeekelt hielt er sich die Hand vor Nase und Mund, um sich vor dem entsetzlichen Gestank zu schützen, der vom Wasser her aufstieg. Er hasste schlechte Gerüche. Konnte es sein, dass alle Bewohner Londons ihren Abfall in den Fluss kippten? Schwamm dahinten ein totes Kaninchen? Oder waren es die Überreste eines üppigen Abendessens? Wegen des immer dichter werdenden Nebels und der mondlosen Dunkelheit der Nacht konnte Richard nicht erkennen, worum es sich bei dem leblosen Bündel handelte, das auf der schwarzen Wasseroberfläche neben ihm trieb. Süßlicher Leichengeruch stieg ihm in die Nase, und er schluckte hart, um ein Würgen zu unterdrücken. Vergeblich versuchte er seine Gedanken auf erfreulichere Dinge zu lenken, zum Beispiel auf seine hübsche Frau Julia. Aber sosehr er sich auch konzentrierte, das Bild wollte nicht auftauchen.
Nun durchdrang die stinkende, feuchtkalte Nachtluft seinen Mantel und kroch ihm bis unter die Haut. Richard zitterte, doch das Klappern seiner Zähne rührte nicht von der Kälte, sondern von seiner Angst. Sein Ziel war der Tower. Er war noch nie zuvor in der Festung gewesen. Es hieß, nur wenige Männer, die das Gebäude betraten, verließen es lebend.
Was hätte er jetzt für eine Flasche Aqua Vitae gegeben. Das Getränk hätte ihm geholfen, sein Zittern zu verbergen. Aber bevor er in das wackelige Boot des alten Fährmanns gestiegen war, hatte Tom ihm die Flasche mit dem kostbaren Inhalt abgenommen. Wie einem Kleinkind, dem man ein Stück Kuchen verweigerte.
»Denkt an Julia«, hatte der Diener seiner Frau gesagt und ihn anklagend angesehen. So wie er es immer tat, wenn Richard sich Mut antrank, was in den letzten Jahren immer öfter geschehen war. Er wusste genau, warum er den Saft dringend brauchte, doch die Antwort war so entsetzlich, dass er sie vergessen wollte.
Sein Boot, das bisher lautlos durchs eiskalte Wasser geglitten war, schrammte nun unsanft gegen eine graue Steinmauer, die plötzlich aus dem dicken Nebel auftauchte.
Der Fährmann, ein alter, zahnloser Mann mit einem Mantel, der aussah, als diente er einem ganzen Heer von Wanzen und Flöhen als Unterkunft, hob den Kopf und nickte ihm zu. Sie hatten ihr Ziel erreicht.
Nur widerwillig erhob sich Richard von der nassen Holzbank. Er war das Schwanken des kleinen Bootes nicht gewöhnt und wankte unbeholfen an dem alten Mann vorbei, bemüht, den Mantel nicht zu berühren. Ungeschickt kletterte er eine feuchte, glitschige Strickleiter hoch. Seine glatten Stiefelsohlen und seine klammen Finger drohten am kalten Schleim, den Wasser und Algen hinterlassen hatten, abzurutschen. Aber er gelangte oben an, landete allerdings unsanft auf allen vieren. Schon als Kind hatte er Klettern und Balancieren gehasst. Warum sollte er jetzt als Erwachsener Freude daran haben?
Für einen kurzen Moment war er dankbar für den dichten Nebel und die Dunkelheit. Erst als er sich wieder aufrichtete und rasch seine Hosen abklopfte, erblickte er den jungen Wachmann in königlicher Uniform. Richards Unbehagen wuchs. Was hatte er erwartet? Dass man ihn allein in den Tower spazieren ließ? Der Bursche war sehr jung, Richard schätzte ihn auf zwanzig Lenze oder weniger. Trotzdem hatte er Schultern, die doppelt so breit waren wie Richards. In seiner Linken hielt er eine rußende Fackel, seine Rechte ruhte auf dem Griff einer Waffe. Ein Degen, der in einem ledernen Gürtel steckte.
»Master Richard Walton?«, fragte der Junge. Seine Stimme überschlug sich, als wäre er immer noch im Stimmbruch.
»Habt Ihr jemand anderen erwartet?«, fragte Richard, bemüht, lässig zu klingen.
Der Junge antwortete nicht und bedeutete ihm zu folgen. Seine schweren Stiefel knirschten laut auf dem gekiesten Weg. Er führte Richard durch die Byward-Seitenpforte gegenüber dem Ende der Mint Street. Das kleine Tor wurde durch ein keilförmiges Türmchen geschützt. Der Bau stammte noch aus der Regierungszeit Eduard I., trotzdem war er mit Schießscharten versehen, die dem neuesten Stand der Technik entsprachen. Im Moment war der kleine Turm unbewacht.
»Hier entlang«, sagte der junge Bursche.
Richard beeilte sich, mit dem Jungen mitzuhalten. Auf jeden Schritt des Burschen kamen zwei von Richard. Er stellte sich vor, dass er aussah wie eine der zappelnden Puppen seiner vierjährigen Tochter Mary. Der Gedanke amüsierte ihn.
Zu Richards Linken erhob sich eine massive Mauer, sie musste Teil des Bell Towers sein. Wenn es stimmte, was Tom ihm erzählt hatte, würde er nun gleich den Bloody Tower erreichen, jenen Turm, der für besonders prominente Gefangene vorgesehen war. Der Diener seiner Frau hatte Richard nicht verraten, warum er so genau über den Tower Bescheid wusste, und Richard hatte nicht nachgefragt. Es gab Dinge im Leben eines jeden Mannes, über die man besser schwieg.
Vor einer schweren Holztür stand ein weiterer Wachmann in königlicher Uniform. Er war deutlich älter als Richards Begleiter und mindestens doppelt so dick.
»Wurde aber auch Zeit«, brummte er unfreundlich, öffnete die beschlagene Tür und ließ die beiden eintreten.
Richard wich dem eisigen Blick des dicken Wachmanns aus und heftete sich dem Jungen an die Fersen. Rasch lief er hinter ihm her und folgte ihm über eine schmale, ausgetretene Steintreppe. Um im Dunkeln auf dem glatten Stein nicht auszurutschen, hielt er sich mit seiner Rechten an der rauen Steinmauer fest.
Vor einer niedrigen Holztür blieb der Uniformierte stehen, klopfte und holte gleichzeitig einen schweren Schlüsselbund unter seinem Rock hervor. Mit einem besonders großen Schlüssel sperrte er die Tür auf und stieß sie vorsichtig auf.
Einladende Wärme, der behagliche Schein eines offenen Kaminfeuers und der köstliche Duft gebratenen Hühnchens schlugen Richard entgegen.
»Sir, Euer Besuch ist da«, sagte der Bursche. Er sprach mit der Unterwürfigkeit eines Bediensteten, nicht mit der Strenge eines Gefängniswärters.
»Lasst uns allein!« Der Befehl kam aus dem hintersten Teil des Raums, von dort, wo sich ein offener Kamin befand. In einem komfortablen, breiten Holzstuhl neben dem knisternden Feuer saß ein alter Mann. Sir Walter Raleigh. Er war einst einer der einflussreichsten Männer des Reichs, Abenteurer, Entdecker und Pirat von Elisabeth I. gewesen, heute war er ein zum Tode verurteilter Gefangener.
Der junge Wachmann verbeugte sich und verließ ohne sich dabei umzudrehen den Raum.
Als die Tür hinter ihm ins Schloss fiel, zuckte Richard zusammen. Es war anzunehmen, dass der König nichts von seinem Besuch wusste. Was, wenn der junge Bursche ihn nicht wieder abholte und zurückbrachte? Würde man ihn gemeinsam mit Raleigh köpfen? Er spürte, wie seine Hände feucht wurden, dabei fürchtete er den Tod seit langem nicht mehr. Dennoch zitterte er heftig. Nur ein Schluck Aqua Vitae, und er würde sich deutlich besser fühlen.
Vorsichtig schaute er sich um. Der Raum war prunkvoll eingerichtet. Verglaste Fenster, gerahmte Bilder an den weiß getünchten Wänden, ein massives Schreibpult, eine Truhe, ein Himmelbett, zwei kunstvoll verzierte Stühle vor einem Tisch, einladend gedeckt mit einer köstlichen, aber noch unberührten Abendmahlzeit. Es gab unerfreulichere Orte in der Stadt und ganz sicher auch im Tower.
»Nehmt Euch einen Stuhl und kommt zu mir«, sagte Raleigh. Es war mehr ein Befehl als eine freundliche Aufforderung. Der alte Mann hatte trotz seiner Gefangenschaft nichts an Würde eingebüßt. Unter einer bestickten Samtjacke trug er ein makelloses Hemd mit sauberem Spitzenkragen. Sein schütteres Haar war penibel frisiert, sein Bart säuberlich gestutzt. Sicher kam regelmäßig ein Diener, der ihm bei seiner Toilette half und ihm seine schmutzige Kleidung abnahm, um sie zu waschen. Kerzengerade saß Raleigh in seinem Stuhl und beobachtete jede von Richards Bewegungen. Etwas ungeschickt schnappte dieser einen der Stühle beim Esstisch. Die Holzbeine scharrten über den sauber gekehrten Steinfußboden. Richard trug den Stuhl zum Feuer. Rasch wurde ihm in seinem dicken Wollmantel heiß. Aber er weigerte sich, das Kleidungsstück auszuziehen, denn er wollte keinen Moment länger als notwendig hier verbringen.
»Ihr fragt Euch sicher, warum ich Euch an diesen garstigen Ort bestellt habe«, begann Raleigh. Auf einem kleinen Beistelltischchen neben seinem Stuhl standen ein Weinkelch und ein Krug aus geschliffenem Glas. Die Flüssigkeit funkelte rubinrot im Licht des offenen Kamins. Richards Kehle war ausgedörrt. Er schleckte mit der Zunge über seine trockenen Lippen.
»Ich bin mit Eurer Tochter verheiratet«, sagte er vorsichtig. Er wollte nicht zugeben, dass er gekommen war, weil Tom ihn dazu überredet hatte, der Einladung nachzugehen. Von sich aus hätte er das Schreiben heimlich verschwinden lassen.
»Ihr seid mit meiner unehelichen Tochter verheiratet«, korrigierte Raleigh ihn. Es klang bitter, und in den Augen des alten Mannes lag Bedauern. Julia hatte Richard erzählt, dass Raleigh ihre Mutter aufrichtig und innig geliebt hatte und sie geheiratet hätte, wenn die Umstände andere gewesen wären. Aber wie so oft, war es zu keiner Ehe gekommen, weil Julias Mutter weder die richtige gesellschaftliche Stellung gehabt noch über die entsprechende Mitgift verfügt hatte. Sie war nicht einmal eine Engländerin gewesen, sondern war mit ihren Eltern aus Hamburg zugewandert.
So als könnte Raleigh Richards Gedanken lesen, schüttelte er den Kopf und fuhr mit ernster Stimme fort: »Ich habe Julias Mutter bis zu ihrem Tod finanziell unterstützt und danach Julia. Gott ist mein Zeuge, und niemand kann das besser wissen als Ihr.«
Richard zuckte mit den Schultern. Wohl wissend, dass es besser war zu schweigen als zu erwähnen, dass das Geld nie ausgereicht hatte. Sicher wusste Raleigh von Richards Vorliebe für Aqua Vitae. Julias kleiner Wollladen hatte nicht genug Geld abgeworfen, und letzten Monat hätten sie beinahe das kleine Häuschen in der Roseline räumen müssen. Aber irgendwie hatte seine Frau es geschafft, die Gläubiger zu beruhigen.
Raleigh holte Richard aus seinen Überlegungen: »Nächste Woche werde ich einen Kopf kürzer gemacht, und das ist sowohl für mich als auch für Julia unerfreulich.«
Etwas an dem Satz irritierte Richard. Wo war die Angst in Raleighs Stimme? War der Vater seiner Frau ein begnadeter Schauspieler, ein Freund des verstorbenen William Shakespeares womöglich, oder hatte er tatsächlich keine Angst vor dem Tod?
»Weder meine Frau noch meine Kinder werden sich um Julia kümmern. Verständlicherweise haben sie kein Interesse an ihr. Meine Familie muss froh sein, wenn sie ihren eigenen Lebensstandard halten kann. Deshalb liegt es nun an Euch, tatsächlich für Julia und Eure Kinder zu sorgen.«
Richard öffnete den Mund, um etwas einzuwenden, aber Raleigh hielt ihn mit einer ungehaltenen Handbewegung davon ab.
»Die wenigen Stunden, die mir noch bleiben, sind zu kostbar, als dass ich Eure armseligen Entschuldigungen hören möchte.«
Richard fühlte sich ertappt. Verlegen blickte er zu Boden und klopfte mit seinen Fingern auf die Oberschenkel. Hätte er sich bloß nicht von Tom zu diesem Besuch überreden lassen. Während Raleigh ihn schweigend musterte, wurde er immer nervöser. Schweiß bildete sich auf seiner Stirn und seiner Oberlippe. Am liebsten wäre er aufgestanden. Warum tat er es nicht einfach?
Schließlich brach Raleigh das Schweigen und sagte: »Ihr seid ein Versager, der beim kleinsten Problem zur Flasche greift. Julia hat etwas Besseres als Euch verdient.«
Richard hob seinen Kopf und erwiderte gekränkt: »Wie ich meine Probleme zu lösen versuche, ist meine Sache.«
»Das sehe ich anders. Ihr tragt die Verantwortung für Eure Frau und Eure Kinder.«
Richard schluckte hart. Er war selbst der Meinung, dass Julia einen besseren Mann verdient hatte. Sie war nicht nur schön, sondern auch ausgesprochen klug und geduldig. Gott allein wusste, warum sie sich für ihn entschieden hatte. Vielleicht weil Richard zu den wenigen Menschen gehörte, die mit einem wohlgeformten Körper und einem ansprechenden Äußeren ausgestattet waren. Oder aber weil Richard mit ihr in der Sprache ihrer Mutter reden konnte. Während Richards Mutter eine waschechte Schottin gewesen war, stammte sein Vater aus Hannover. Ehrlicherweise verwarf Richard beide Möglichkeiten wieder. Er wusste, dass Julia sich nicht in den Mann verliebt hatte, der er heute war, sondern in einen Burschen, der weder getrunken noch auf Kosten seiner Frau gelebt hatte.
»Ich werde Euch eine einmalige Gelegenheit bieten, Julia und der ganzen Welt zu beweisen, was in Euch steckt«, sagte Raleigh.
Überrascht hob Richard seine Augenbrauen. Was sollte das für eine Möglichkeit sein? Plötzlich traf ihn die Erkenntnis wie ein Schlag. Raleigh wollte, dass er sich statt seiner opferte und vom Henker köpfen ließ. Warum sonst hätte er ihn heimlich nachts kommen lassen sollen? Der alte Mann war in einer Luxuszelle gefangen, bewacht von Wärtern, die ihm jeden Wunsch von den Augen ablasen und ihn behandelten wie einen Herzog. Niemand wusste von seiner Anwesenheit hier. Was für ein groteskes Ende eines tragischen Lebens. Schade, dass niemand davon erfahren würde. Er zuckte zusammen, als Raleigh sich umständlich von seinem Stuhl erhob und die hölzernen Beine über den Steinboden kratzten.
Jetzt sah Richard, dass Raleigh ein alter, magerer und gebrechlicher Mann war, der nur im Sitzen noch gebieterisch und resolut wirkte. Mit unsicheren Schritten ging Raleigh zu seinem Schreibpult, griff zielsicher nach einem Bogen Papier und kam wieder zurück. Direkt vor Richard blieb er schnaufend stehen.
»Ich mache das nicht, weil ich glaube, dass Ihr der fähigste Mann für diese Aufgabe seid, sondern weil ich keine andere Wahl habe.«
Richard überlegte, was man falsch machen konnte, wenn man sich anstelle eines anderen köpfen ließ? Es wollte ihm nichts einfallen.
Aber Raleigh fuhr rasch fort: »Ich habe die letzten Wochen genutzt, um eine Karte zu zeichnen.«
»Was für eine Karte?«, fragte Richard vorsichtig und wischte sich mit dem Handrücken die Schweißperlen von Stirn und Oberlippe. Neben dem offenen Feuer war es fast unerträglich heiß.
Raleigh senkte seine Stimme und blickte zur Tür. Als fürchtete er, etwaige Zuhörer könnten sie belauschen.
»Es ist das Duplikat der wertvollsten Schatzkarte der Welt.«
»Schatzkarte?«, fragte Richard überrascht. Er hatte mit einer Wegbeschreibung zum Schafott gerechnet.
»Pssst!«, zischte Raleigh ungeduldig und starrte erneut zur Tür.
»Wollt Ihr, dass der ganze Tower mithört?«, rügte ihn der alte Mann.
»Habt Ihr je von El Dorado gehört?« Raleighs Stimme war nicht mehr als ein Flüstern.
»Der sagenumwobene Goldschatz, den die Spanier und die Portugiesen in der Neuen Welt suchen? Und den auch Ihr auf Eurer Expedition entlang des Orinokos finden wolltet?«, fragte Richard. Ihm war immer noch nicht ganz klar, worauf Raleigh hinauswollte.
»Genau der«, Raleigh grinste. Es war erstaunlich, wie viele Zähne er trotz seines Alters noch im Mund hatte.
Er hielt ein zusammengerolltes Schriftstück knapp vor Richards Nase. »Hier ist die Karte. Leider ist es nicht das Original, denn die wurde mir auf der Rückfahrt meiner letzten Reise geraubt.«
»Wer hat Euch die Schatzkarte geraubt?«, fragte Richard. Sein Interesse war nun geweckt.
»Männer der Kirche«, antwortete Raleigh. »Ich kam erst kurz vor unserer Abfahrt in den Besitz der Karte. Es war purer Zufall, denn eigentlich war das Schriftstück dafür bestimmt gewesen, vernichtet zu werden. Wie auch immer. Plötzlich hatte ich die Karte und konnte mein Glück nicht fassen. Ich wollte mich sofort auf die Suche begeben, aber wir hatten uns an den Befehl der Krone zu halten, und der hieß: sofortige Rückkehr nach England. Mit diesem Befehl begann eine Serie von Unglücksfällen. Vor Trinidad, der spanischen Insel der Dreifaltigkeit, wurden wir von Piraten überfallen. Zumindest dachten wir, es wären ausschließlich Piraten. In Wirklichkeit waren auch Jesuiten an Bord gewesen, die von der Karte erfahren hatten.«
Raleigh setzte sich und schloss für einen Moment die Augen. Richard hatte Angst, der alte Mann würde einschlafen, und fragte neugierig: »Was ist bei dem Überfall passiert?«
Raleigh öffnete die Augen wieder und zuckte mit den Schultern: »Wir haben alles verloren, was wir in den Wochen davor erbeutet hatten, und die Jesuiten nahmen die Karte an sich.«
»Das heißt, Ihr seid mit leeren Händen nach Hause gekommen.«
Raleigh nickte mit einem bitteren, humorlosen Lächeln. »Nicht nur das, unser ehrenwerter König hat bei meiner Heimkehr beschlossen, mich ins Gefängnis zu stecken, und was nächste Woche passieren wird, wisst Ihr bereits.«
Zum ersten Mal schwang Bedauern in Raleighs Stimme, aber immer noch keine Angst.
»Das heißt, die Originalkarte hat ein Jesuit«, schlussfolgerte Richard.
Raleigh schüttelte den Kopf: »Der Dummkopf hat sich die Karte von einem einfachen Seemann abnehmen lassen, der keine Ahnung hatte, was er in seinen Händen hielt. Der Mann hat versucht, die Karte zu verkaufen, was ihm angeblich auch gelungen ist. Seither gilt die Karte als verschwunden. Aber ich bin davon überzeugt, dass die Kirche alles daransetzt, sie wiederzubeschaffen. Der Goldschatz soll von einem gigantischen Ausmaß sein.«
Richard betrachtete stirnrunzelnd das eingerollte Schriftstück in Raleighs Hand.
»Als ich an die Karte kam, studierte ich sie so eingehend, bis jede Linie auf dem Papier in meinem Kopf eine Spur zurückgelassen hatte wie in frisch gefallenem Schnee.«
Richard hätte gern erwidert, dass Schneespuren schnell verwischt werden können, unterließ es aber.
»Während der letzten Tage habe ich die Schatzkarte aus meinem Gedächtnis noch einmal zu Papier gebracht.«
»Warum erzählt Ihr ausgerechnet mir davon?«, fragte Richard skeptisch. Raleigh hatte keine hohe Meinung von ihm. Warum sollte ausgerechnet er nun von dem Geheimnis der Karte erfahren?
»Ich bin in die Neue Welt gesegelt, weil ich den Schatz für England finden wollte. Ich war fest davon überzeugt, dass nur unsere Nation es wert war, in den Besitz eines derart gigantischen Goldschatzes zu gelangen. Ich war ein Narr!«
Raleigh schnaufte verächtlich: »Eine Nation taugt immer nur so viel wie ihr Regent. Meine Königin ist tot, und ihr Nachfolger wird mich nächste Woche hinrichten lassen. Ein feiger, unsicherer König, der sich vor den Spaniern ins Hemd macht. Ich bin ein alter Mann, und meine treusten Weggefährten leben nicht mehr. Jene, die geblieben sind, haben sich als Verräter entpuppt. Was einst Querdenker und Mitglieder der School of Night waren, sind heute Mitläufer und Feiglinge.«
Richard horchte auf. Er hatte sich immer gefragt, ob es die geheime Vereinigung wichtiger Männer wirklich gegeben hatte. Die School of Night, eine Gruppe gelehrter Männer, Mathematiker, Astronomen, Geographen, Philosophen und Dichter, die sich angeblich rund um Raleigh versammelt hatten, um über Religion und Politik zu diskutieren und die Gesellschaft neu zu ordnen. Es hieß, sie hätten den Atheismus studiert, was de facto mit Hochverrat gleichzusetzen war. Wie konnte es sein, dass Raleigh mit all diesen Männern gebrochen hatte?
»Euer Gesicht verrät Eure Gedanken«, sagte Raleigh lachend.
»Keinem von denen, die noch leben, will ich diese Karte überlassen. Sie alle würden den Schatz für politische Intrigen nutzen. Macht, Einfluss und wieder Macht. Ich habe dieses Spiel endgültig satt.«
Richard verstand immer noch nicht, welche Rolle er in dem Spiel übernehmen sollte.
»Alle wollen diesen Schatz besitzen, der ihnen Macht garantiert. Ich selbst war nicht besser. Wäre mein Wunsch nach Einfluss nicht so groß gewesen, könnte ich noch ein paar Jahre zufrieden leben. Aber die feige Entscheidung eines armseligen Königs kostet mich nun mein Leben.« Raleigh spuckte auf den sauberen Fliesenboden.
»Doch solange ich noch atmen und denken kann, will ich verhindern, dass er oder einer seiner Männer jemals die Karte besitzen wird.«
Ein spitzbübisches Lächeln, das erahnen ließ, wie gutaussehend er einst gewesen war, stahl sich auf Raleighs Gesicht.
»Ihr seid ein Trinker, der abenteuerlustig genug ist, sich auf die Suche nach dem Schatz zu machen, und solltet Ihr ihn tatsächlich finden, weiß ich mit Sicherheit, dass Ihr keinerlei politische Ambitionen hegen werdet. Im besten Fall hört Ihr mit dem Saufen auf und kehrt zu Euerm früheren Leben zurück, im schlimmsten Fall gebt Ihr einen Teil des Goldes für Schnaps aus und schickt den Rest an Eure Familie.«
»Habt Ihr eine Idee, um wie viel Gold es sich handelt?«, fragte Richard vorsichtig.
Raleigh schüttelte den Kopf.
»Ich weiß nur, dass es ein riesiges Vermögen sein muss. Wenn Ihr den Schatz findet, werdet Ihr Julia zu einer reichen Frau machen und Euren Kindern und Enkelkindern ein gutes, sorgenfreies Leben ermöglichen.«
Raleighs Augen waren vom Alter trüb, aber sie strahlten immer noch Willensstärke aus.
»Ich will, dass Ihr in die Neue Welt segelt und dafür sorgt, dass weder Spanien noch die Niederlande, England oder gar die katholische Kirche in den Besitz des Goldes kommen. Und ich will, dass Ihr den Diener meiner Tochter mitnehmt: Tom Reasley!«
»Warum das denn?«, fragte Richard entsetzt.
»Um sicherzugehen, dass Ihr lossegelt und die Karte nicht bei der ersten Gelegenheit verkauft«, entgegnete Raleigh.
Richard schluckte hart. War er wirklich so leicht zu durchschauen? Seine Hände hatten aufgehört zu zittern, es hatte wohl keinen Sinn, zu protestieren. Er nahm den Bogen Papier entgegen und rollte ihn auf. Als Kind hatte er gelernt, wie man Karten las. Danach hatte er dieses Wissen selten angewendet. Aber er konnte dem Geflecht aus Linien und Symbolen das Bild einer Landschaft entnehmen. Richard erkannte Berge, Flüsse, Wälder und kleine Siedlungen, auch wenn er keinerlei Ahnung hatte, wo auf der Welt sich diese Landschaft befand.
»Die Karte hilft Euch erst weiter, wenn Ihr nach Altamira de Càceres gekommen seid«, erklärte Raleigh. »Die Eingeborenen nennen die Stadt Barinas, ein Wort, das für einen heftigen Wind während der Regenzeit steht.«
Richard hatte beide Namen noch nie zuvor gehört. Er kannte einige Städte auf dem Kontinent wie Paris, Antwerpen oder Barcelona vom Hörensagen beziehungsweise aus dem Lateinunterricht, der allerdings viele Jahre zurücklag. Selbst war er noch nie weiter als bis nach Stirling gereist, wo seine Mutter vor einigen Jahren verstorben war. Richard hatte noch nie ein großes Schiff betreten, und er hatte den Großteil seines Lebens in London verbracht. Dort hatte er, nachdem er das bescheidene Erbe seines Vaters für dessen Beisetzung ausgegeben hatte, zuerst als Händler, dann als Koch, als Gehilfe eines Schmieds, als Schreiber und schließlich, mit seiner Eheschließung, als Besitzer eines kleinen Wollladens gearbeitet. Wie sollte er bis ans andere Ende der Welt gelangen und diese Stadt, die den Namen eines Windes trug, finden?
Aber für Raleigh, einen Mann, der viele Jahre seines Lebens auf See gewesen war, schien diese Reise eine Kleinigkeit zu sein.
»Was bedeuten all die kleinen roten Kreuze auf der Karte?«, wollte Richard wissen.
»Sie zeigen Euch gefährliche Stellen an, denen Ihr ausweichen solltet. Wasserfälle, steile Klippen, Felsvorsprünge, tiefe Gräben …«
»Die Karte ist von den Kreuzen übersät. Kann es sein, dass Ihr zu viele davon eingetragen habt?«, fragte Richard.
»Unsinn«, winkte Raleigh ab. »Ich habe mich auf die wichtigsten beschränkt.«
»Wie beruhigend«, meinte Richard, begann die Kreuze abzuzählen und hörte wieder damit auf, als er die Zahl dreißig erreicht hatte.
»Nutzt die wochenlange Überfahrt auf See und erlernt die spanische Sprache«, riet Raleigh. »Im südlichen Teil der Neuen Welt haben sich viele Spanier niedergelassen. Die Einheimischen haben in den letzten hundert Jahren die Sprache ihrer Eroberer übernommen.«
Richard wollte nicht Spanisch lernen, behielt es aber für sich. Er war sich nicht einmal sicher, ob er sich auf diese waghalsige Suche begeben wollte. Andererseits konnte er auf diese Weise vielleicht seiner Vergangenheit entfliehen. Er brauchte Geld, denn die Gläubiger saßen ihm im Nacken. Mit etwas Glück könnte diese Karte ihm einen Weg in ein besseres Leben zeigen.
»Wie viele Menschen wissen von der Existenz der Karte?«, fragte er.
»Mindestens zwei. Der Jesuit und jene Person, an die der Seemann die Karte verkauft hat.«
»Und was ist mit dem Seemann?«
»Wenn die Nachrichten meines Informanten stimmen, dann ist er tot.«
Richard unterließ es, nach dem Informanten zu fragen. Raleigh saß nicht grundlos im Gefängnis, er hatte zeit seines Lebens an den Fäden der Macht gezogen. Jetzt hatte er sich darin verstrickt. Stattdessen stellte Richard eine Frage, von der er die Antwort zu kennen glaubte: »Starb er eines natürlichen Todes?«
Raleigh schüttelte den Kopf: »Und ich fürchte, er ist nicht der Einzige, der sein Leben lassen musste, weil er im Besitz der Karte war. Wie gesagt, alle wollen den Schatz finden, und es muss Euch klar sein, dass die Suche gefährlich wird. Irgendjemand hält das Original in den Händen, und wer weiß, vielleicht gibt es mittlerweile Abschriften. Wer also am schnellsten ist, gewinnt. Wie bei einem Hunderennen.«
Tierrennen, bei denen man auf den Sieger setzen konnte, waren ein Gebiet, auf dem Richard sich auskannte. Was ihm nicht gefiel, war, dass er nun einer der Hunde sein sollte.
»Weiß Julia von unserem Gespräch?«
Raleigh schüttelte entschieden den Kopf: »Nein, und sie darf auch nie davon erfahren. Es wäre zu gefährlich.«
Richard lachte: »Wie stellt Ihr Euch das vor. Was soll ich Julia erzählen? Sie wird glauben, ich will sie verlassen.«
»Nicht, wenn Ihr Tom mitnehmt. Es wird Euch etwas einfallen. Lasst Eure Fantasie spielen.«
Richard war anderer Meinung. Er kannte Julia und wusste, dass er ihr nicht so leicht eine Lügengeschichte auftischen konnte. Er hoffte auf Toms Einfallsreichtum.
Der Rotwein funkelte verlockend in der Kristallflasche, und Richard warf alle guten Vorsätze über Bord. Den tadelnden Blick Raleighs ignorierend, schenkte er unaufgefordert das leere Weinglas bis zum Rand voll, prostete dem alten Mann zu und trank es in einem Zug leer. Augenblicklich fühlte er sich besser, sein Zittern verschwand und die Selbstzweifel verflogen. Es konnte doch wirklich nicht so schwer sein, einen Schatz zu finden.
»Erzählt mir in Ruhe, wie ich es anstellen soll, in die Neue Welt zu kommen«, sagte er und zog seinen Mantel aus. Dann lehnte er sich entspannt zurück. Er wollte die Nacht dazu nutzen, um alles zu erfahren, was Raleigh bereit war zu erzählen.
Gran Canaria,
Oktober 1618
Janas Füße sanken knöcheltief im feinen weißen Sand ein. In jeder Hand trug sie einen ihrer Lederschuhe, gleichzeitig hielt sie den Rock ihres leichten Sommerkleides hoch, um nicht zu stolpern. Die Luft roch frisch und schmeckte nach Salz. Lachend lief sie auf die türkisblauen Wellen zu, auf denen winzige weiße Schaumkrönchen tanzten. Im regelmäßigen, sanften Rhythmus drängten sie rauschend an den Strand.
Jana drehte sich um. Conrad war nur eine Armeslänge hinter ihr. Gleich würde er sie eingeholt haben. Als sie einen weiteren Sprung nach vorne machte, spürte sie, wie seine Hand sich um ihren Oberarm legte. Augenblicklich geriet Jana ins Stolpern, ihre Schuhe fielen in den Sand, und kurz darauf landete sie ebenfalls auf dem weichen Untergrund. Sie zog Conrad mit sich.
Der Aufprall war sanft, wie der Kuss, der folgte. Jana wehrte sich nicht dagegen. Ganz im Gegenteil. Seine Lippen waren weich und salzig wie das Meer. Mit jeder Faser ihres Körpers drängte sie sich ihm entgegen. Bereitwillig ließ sie ihn das Oberteil ihres Kleides aufschnüren und seufzte zufrieden, als sie seine heiße Haut spürte. Ihre Körper bewegten sich im Rhythmus, der dem des Meeres glich. Aber Jana hörte weder das Rauschen der Brandung noch die Schreie der Möwen, die über ihnen kreisten.
Sie sah die weißen, majestätisch dahingleitenden Tiere erst, als Conrad etwas später neben ihr in einen zufriedenen Halbschlaf sank. Sie selbst blinzelte in den wolkenlosen, tiefblauen Himmel und beobachtete die Vögel. In den letzten Wochen und Monaten hatte sie immer wieder Möwen gesehen, wie sie am Hafen neben den Fischerbooten hockten und gierig auf Abfälle warteten. Dann erschienen sie ihr plump, ungeschickt, viel zu groß und schwer, um mühelos über ihrem Kopf zu segeln. Dasselbe galt für ihre Schreie. An Land klangen sie in Janas Ohren schrill und unmelodisch. Sobald die Tiere aber in der Luft segelten, konnte sie sich keine verheißungsvolleren Laute vorstellen. Jana verband die Schreie der Möwen mit Meer, Freiheit und Abenteuer. Begriffe, die für gewöhnlich den Männern dieser Welt vorbehalten waren, aber Jana hatte in den letzten Monaten dafür gekämpft, auch ein Stückchen davon abzubekommen. In Conrad hatte sie einen Mann gefunden, der ihre unkonventionelle, ja skandalöse Art zu leben guthieß und sie unterstützte.
Sie hätte die Tiere noch Stunden beobachten können, aber der etwas kühler werdende Wind trieb ihr eine feine Gänsehaut über Arme und Rücken. Langsam suchte Jana ihre Kleidungsstücke wieder zusammen und zog sich an. Bevor sie ihr Oberteil zuschnürte, hielt sie für einen Moment das goldene Amulett ihres Vaters fest. Es wog schwer in ihrer Hand. War wirklich erst ein halbes Jahr vergangen, seit er es ihr nach Prag geschickt hatte? Jana konnte es kaum glauben. Ihr Leben hatte sich seither grundlegend verändert. Sie hatte sich von ihrem Verlobten Tomek getrennt und ihre Familie sowie eine Apotheke, die eines Tages ihr gehört hätte, zurückgelassen. Sie hatte sich von ihrem besten Freund Bedrich verabschiedet und mit ihm ihre Vergangenheit endgültig hinter sich gelassen. Anschließend war sie an Conrads Seite quer durch Europa gereist, um das Geheimnis eines Buches zu enträtseln, das eng mit dem goldenen Amulett verbunden war. Als Jana ihre Reise begonnen hatte, hatte sie nicht geahnt, dass auch bestimmte Kreise innerhalb der Kirche das Buch besitzen wollten und dafür zu töten bereit waren. Man hatte Jana und Conrad einen gedungenen Mörder hinterhergeschickt. Jana erschauderte immer noch, wenn sie an das entstellte Gesicht ihres Entführers dachte. Aber all das lag nun hinter ihr, und schlussendlich hatten Jana und Conrad das Buch behalten und auch das Geheimnis enträtselt. Nur zu gut konnte Jana sich an Conrads Enttäuschung erinnern, als sich herausgestellt hatte, dass das Buch keine wissenschaftlichen Fragen beantwortete, keine neuen Erkenntnisse oder wichtiges Wissen barg, sondern zu einem der größten und wertvollsten Schätze der Welt führte, zu »El Dorado«, wie die Spanier ihn nannten. Conrad Pfeiffer war Arzt, ein Mann, dessen Religion die Wissenschaft war, der an die Logik und die Vernunft glaubte und davon überzeugt war, die Phänomene dieser Welt allein mit dem Verstand lösen zu können. Gold interessierte ihn nicht.
So als könnte er ihre Gedanken hören, blinzelte Conrad und richtete sich auf.
»Schade«, meinte er mit einem schiefen Lächeln. Dabei fiel ihm eine Strähne seiner rotblonden Haare ins Gesicht und bedeckte seine türkisblauen Augen. Auf seinen Wangen bildeten sich Grübchen und verliehen ihm ein jungenhaftes Aussehen.
»Was ist schade?«, wollte Jana wissen.
»Dass du dich schon wieder angezogen hast.«
Jana schüttelte lächelnd den Kopf und warf Conrad seine Hosen zu.
»Zieh dich lieber auch an, bevor jemand kommt und uns bei unserem unsittlichen Tun erwischt.«
»Wenn du mich endlich heiraten würdest, wäre es ganz und gar nicht unsittlich, sondern die Erfüllung unserer ehelichen Pflichten«, sagte Conrad. Er zog Jana erneut zu sich und beugte sich über sie. Jana schloss für einen Moment die Augen, dass ihre langen Wimpern ihre sonnengebräunten Wangen berührten.
Conrad küsste beide, ehe sie sie wieder öffnen konnte.
»Warum bleiben wir nicht einfach hier? Die Insel ist ein kleines Paradies. Die Winter sind milde und die Sommer warm. Es gibt Wasser und Früchte im Überfluss. Die Menschen sind freundlich, und du kannst jeden Tag frischen Fisch essen.« In Conrads Blick lag so viel Zärtlichkeit, dass es Jana schwerfiel, sich aus seiner Umarmung zu lösen. Dennoch richtete sie sich auf und schüttelte ihr Haar zurecht. Seit Tagen fürchtete sie, dass Conrad ihr diese Frage stellen könnte. Seine anfängliche Begeisterung über die bevorstehende Reise war längst abgeflaut. Reichtum war für Conrad kein erstrebenswertes Ziel. Solange er genug Geld zum Leben hatte, war er zufrieden.
Als die Santa Lucia, das Schiff, mit dem sie aus Lissabon gestartet waren, auf Gran Canaria angelegt hatte, war er fast erleichtert gewesen, und mit jedem Tag, den sie nun hier verbrachten, schien sein Wunsch nach der Reise in die Neue Welt kleiner zu werden. Jana hatte ihn beobachtet, wie er zwei Kinder einer altkanarischen Guanchen-Familie behandelt hatte. Selten zuvor hatte er bei seiner Arbeit so zufrieden und glücklich gewirkt.
»Ich hoffe, du machst bloß einen Scherz!«, sagte Jana ernst. Für sie war diese Reise noch lange nicht zu Ende. Jana war fest entschlossen, den Schatz zu finden. In den letzten Monaten hatte sie zum ersten Mal im Leben erfahren, was Freiheit bedeutete. Als Frau war ihr diese bis jetzt von der Gesellschaft verweigert worden. Man hatte von ihr erwartet, dass sie heiratete, Kinder zur Welt brachte und einem Ehemann gehorsam war. Mutig hatte sie sich allen Zwängen widersetzt, und Conrad, der Wissenschaftler, der an die Vernunft im Menschen glaubte, hatte sie nach anfänglichem Zweifel schließlich darin bestärkt.
Nun seufzte er schwer. Eine heftige Welle schwappte bis zu ihnen und erfasste seinen Schuh. Rasch sprang er auf und fischte danach, ehe der Schuh in den Wellen verschwinden konnte. Als er zurückkam, nahm er seine Hose, schüttelte sie aus und schlüpfte hinein. Der Wind wurde stärker und rauschte durch die riesigen Lorbeerbüsche und hohen Palmen hinter ihnen. Als Conrad wieder angezogen war, ergriff er mit einer Hand Janas Kinn, mit der anderen ihre Hände und zwang sie, ihn anzusehen.
»Ich habe meinen größten Schatz bereits gefunden«, sagte er ernst und leise. Aber laut genug, dass seine Stimme vom Wind nicht verschluckt wurde.
»Ich brauche weder Gold noch Edelsteine. Wenn du nicht hier bleiben willst, können wir nach Bologna oder Genua gehen. Ich kann als Arzt arbeiten und einen Lehrstuhl an einer Universität annehmen. Niemand kennt uns dort, und keiner weiß, dass wir die Karte besitzen. Du kannst eine kleine Apotheke eröffnen, und wir werden viele glückliche Kinder in die Welt setzen.«
Bei seinen letzten Worten bildeten sich winzige Lachfältchen rund um seine Augen. Jana wurde heiß, sie wich seinem Blick aus. Eine eigene Apotheke, Kinder, Familie, ein Mann, der sie liebte. All das waren Dinge, die sie sich als kleines Mädchen gewünscht hatte, und sie war sicher, dass sie es eines Tages wieder haben wollte. Aber nicht jetzt. Nicht, solange sie nur die Hälfte des Geheimnisses rund um die Schatzkarte ihres Vaters gelöst hatte. Sie konnte unmöglich irgendwo ein ruhiges Leben führen, während die Schatzkarte in einer Truhe lag und darauf wartete, entdeckt zu werden. Entschieden schüttelte sie den Kopf.
»Mein Vater hat wegen der Karte sterben müssen, und wir zwei haben ebenfalls unsere Leben aufs Spiel gesetzt, um in ihren Besitz zu gelangen. Wir wissen nicht, was wir an dem Ort El Dorado finden werden. Vielleicht ist es Gold, vielleicht ist es etwas anderes, das so wertvoll ist, dass es geschützt werden muss. Denk an das Gift, das die Muskeln lähmt. Noch vor wenigen Wochen hättest du alles dafür gegeben, die Rezeptur zu erfahren.«
Als Conrad nichts erwiderte, fuhr Jana fort: »Das Einzige, was wir mit Sicherheit wissen, ist, dass es Menschen gibt, die bereit sind, dafür zu töten. Wer garantiert uns, dass der Mönch mit dem hässlichen Gesicht aus der Geheimen Bruderschaft nicht immer noch hinter uns her ist? Er würde uns finden, ganz egal wo du einen Lehrauftrag annimmst.«
Conrads Gesicht wurde ernst. Die Erinnerungen an Janas Entführung in Lissabon waren noch frisch. In diesem Punkt hatte sie recht. Die Kirche bestand nicht nur aus mildtätigen Nonnen und Mönchen. Es gab auch Männer, die nach Macht, Einfluss und Geld gierten. Sie hatte ihr Netz über ganz Europa gespannt, und wenn sie jemanden finden wollte, dann würde es ihr gelingen. Solange Jana im Besitz der Karte war, würde man nach ihr suchen.
»Lass uns das Stück Papier verbrennen, dann sind wir es los und können von vorne anfangen.«
»Du willst die Karte verbrennen?«, fragte Jana fassungslos. »Nach all dem, was wir durchgemacht haben?«
»Wer weiß, was wir noch durchmachen müssen«, meinte Conrad.
»Seit wann fürchtest du dich vor einer Reise?«
»Es ist nicht die Angst vor einer wochenlangen, ungewissen Reise übers Meer mit einem Haufen stinkender, ungewaschener und ungebildeter Männer, viel zu wenig Essen und der Gefahr zu verdursten«, Conrad machte eine Pause. »Ich sehe einfach keinen Sinn in dem Ganzen. Warum sollen wir uns ungewissen Gefahren aussetzen, wenn wir in einer großen Universitätsstadt ein unbeschwertes und ausgefülltes Leben führen können? Wir können der Wissenschaft dort dienen, indem wir forschen und arbeiten. Die verdammte Karte bringt uns nur Ärger ein. Und du hast mir immer noch nicht die Frage beantwortet, wann du mich heiraten willst.«
Seine letzten Worte klangen trotzig, wie die eines kleinen Kindes. Die Mannschaft auf dem Schiff glaubte ohnehin, dass Jana und Conrad längst ein Ehepaar waren, denn der Kapitän hätte sicher keine unverheiratete Frau mit auf die Reise genommen. Warum dann also noch warten?
Auch jetzt ließ Jana Conrads Frage unbeantwortet. Sie stand schweigend vor ihm und starrte auf das offene Meer. Die Wellen kamen immer näher zu ihnen. Bei der nächsten würden ihre Füße nass werden. Jana blieb dennoch stehen und bewegte sich nicht. Nach einer schier endlosen Pause sagte sie: »Ich will wissen, was sich in El Dorado verbirgt. Was ist so wertvoll, dass dafür getötet wird?«
»Das wissen wir doch längst«, schnaufte Conrad verächtlich. »Gold. Es ist Gold und sonst nichts!«
»Und wenn es doch etwas anderes ist?«
Genervt verdrehte Conrad die Augen.
»Wenn du mich zwingst, mit dir nach Bologna zu gehen, und wir nicht wenigstens versuchen, den Ort zu finden, werde ich mein ganzes Leben unzufrieden sein und irgendwann vor Neugier platzen.«
Jana sah, dass Conrad weitere Argumente vorbringen wollte. Er biss sich auf die Lippen, fuhr sich durchs Haar und meinte schließlich verärgert: »Ich könnte es mir nie verzeihen, wenn du platzt.«
Jana fiel ihm um den Hals und küsste ihn auf die Nasenspitze. Sie kannte ihn gut genug, um zu wissen, wie schwer es ihm fiel, nachzugeben: »Du wirst die Entscheidung nicht bereuen. Sobald Don Miguel Valdiva seine Geschäfte erledigt hat, gehen wir wieder an Bord.«
»Ich hoffe, dass wir nicht mehr lange auf die Handelsschiffe aus Afrika warten müssen, denen Valdiva etwas abkaufen will. Denn je länger sich unsere Abfahrt hinauszögert, umso gefährlicher wird die Überfahrt werden. Wir haben bereits September«, meinte Conrad.
Jana machte eine beschwichtigende Handbewegung: »Ach was, Columbus ist ebenfalls im September von hier gestartet. Er hat in der großen Werft eines seiner Schiffe reparieren lassen. Die Pinta.«
»Woher weißt du das?«, fragte Conrad.
»Ich habe mich mit Valdiva unterhalten. Er hat mir versichert, dass die erwarteten Schiffe noch diese Woche eintreffen werden. Der Kapitän eines Handelsschiffs ist sein Schwager, und der will rasch weiter durch die Straße von Gibraltar segeln, um noch vor dem Winter wieder zu Hause zu sein, seine Frau erwartet ihr erstes Kind.«
Conrad neigte den Kopf zur Seite. »Hat der Spanier dir verraten, was sein Schwager Wertvolles transportiert?«
Jana schluckte hart, ehe sie sprach. Sie wusste, dass ihre Antwort Conrad nicht gefallen würde. Deshalb hatte sie es ihm bisher verschwiegen. Nun wurden ihre Worte beinahe vom Rauschen der nächsten Welle verschluckt, so leise sprach sie. Aber Conrad verstand sie trotzdem und wurde blass vor Entsetzen.
»Sklaven.«
Bereits am nächsten Morgen tauchten am Horizont zwei Handelsschiffe aus Nordafrika auf. Schon von weitem war zu erkennen, dass es sich um zwei schwere Galeonen handelte, die tief im Wasser lagen. Sie segelten hintereinander und steuerten direkt auf die Bucht Bahia de Gando zu. Jana und Conrad beobachteten ihr Eintreffen.
Sie saßen etwas abseits der Werft, auf einem langen Brett, das man auf zwei Holzblöcke gelegt hatte und das den Arbeitern während ihrer kurzen Pausen als Bank diente. Von hinten drang der scharfe Geruch heißen Pechs zu ihnen, das in einem der riesigen Öfen kochte. Die Arbeiter versuchten damit die Plankennähte der Schiffe möglichst wasserundurchlässig zu machen, dennoch musste während jeder großen Schiffsreise auf hoher See noch nachgebessert werden.
Jana hatte ihr Frühstück, bestehend aus getrocknetem Fisch und Brot, bereits aufgegessen, Conrad kaute immer noch lustlos an seiner salzigen Sardine.
»Die Schiffe sehen kleiner aus als die Santa Lucia«, bemerkte Jana.
Conrad schluckte einen Bissen seines Fischs und blinzelte aufs Meer. Die beiden Handelsschiffe verfügten über drei Masten, genau wie die riesige portugiesische Noa, mit der sie unterwegs waren, doch der Rumpf der Galeonen war deutlich schlanker und die Gesamtlänge der Schiffe kürzer.
»Einen schönen guten Morgen«, sagte eine tiefe Stimme hinter ihnen. Mario Servante, der Schiffslotse, war zu ihnen getreten. Es war schwer, das Alter dieses kleinen, drahtigen Mannes zu schätzen. Die Jahre auf dem Meer hatten die Haut seines Gesichts wie Leder gegerbt, deshalb war nicht klar, ob die Falten eine Erscheinung des Alters oder ein Resultat von Wind, Sonne und Regen waren. Der spanische Lotse mit deutschen Wurzeln war mit Abstand der gebildetste Mann an Bord der Santa Lucia. Rangmäßig unterstand er dem Steuermann, dem direkten Vertrauten des Kapitäns, dennoch war er der Einzige auf der Santa Lucia, der fundierte Kenntnisse in Astronomie und Mathematik besaß. Er musste die Breitengrade messen und den Kurs des Schiffes immer wieder aufs Neue berechnen.
Servante war einer der wenigen Männer an Bord, der sich mit Jana und Conrad abgab. Alle anderen behandelten sie wie lästigen Ballast, der im Weg herumstand. Der Lotse schien die Gespräche mit Conrad, einem Mann der Wissenschaft, zu genießen. Die meisten Männer auf dem Schiff waren einfache Matrosen, die weder lesen noch schreiben konnten und ihr ganzes Leben auf dem Meer verbracht hatten. Viele von ihnen waren schon im frühen Kindesalter zum ersten Mal zur See gefahren. Das entbehrungsreiche Leben auf dem Meer, die ständige Gefahr und die Naturgewalten, denen sie Tag für Tag ausgesetzt waren, hatten sie zu rauen, wortkargen Männern gemacht. Ganz anders Servante. Er ließ keine Gelegenheit aus, sich mit Jana und Conrad zu unterhalten. Manchmal fand Jana seine Neugier unangenehm und sein Interesse aufdringlich. Sie begann schon zu fürchten, er könnte etwas von der Schatzkarte ahnen.
Auch jetzt trat er eine Spur zu nah zu ihr und sagte: »Wenn alles nach Plan läuft, werden wir in den nächsten Tagen unsere Reise fortsetzen können.« Servante segelte bereits zum fünften Mal in die Neue Welt. Obwohl er ganz fürchterliche Geschichten erzählen konnte, von Matrosen, die im Sturm über Bord gespült wurden und ertranken, von Männern, die verdursteten, und von Piraten, die brutal ganze Mannschaften hinrichteten, wirkte er ganz erpicht auf die Überfahrt. Jana war sich nicht sicher, ob Servantes Geschichten alle stimmten oder ob er damit bloß Eindruck schinden und Angst einflößen wollte.
»Ihr scheint Euch auf die Fahrt zu freuen«, sagte Jana.
Servante wandte sich ihr zu, er stand nun eindeutig zu nah bei ihr. Er grinste: »Ich freue mich, weil es meine letzte Fahrt sein wird.«
»Ihr habt vor, in Amerika zu bleiben?«
Servante schüttelte den Kopf: »Nein, ich bleibe auf einer der wundervollen Inseln in der Karibik. Goldene Sandstrände, keine Winter mit Schnee und Eis, sondern immer Wärme und Sonnenschein. Früchte, von denen selbst die Menschen hier auf Gran Canaria bloß träumen können, und Frauen mit schwarzem, seidenem Haar, bronzefarbener Haut und Rundungen, wie jeder Mann sie sich erträumt.« Bei der letzten Bemerkung starrte er einen Augenblick zu lang auf Janas Busen, und sie errötete. Unangenehm berührt trat sie zu Conrad, der scheinbar nichts von der Unterhaltung mitbekam. Er blickte aufs Meer hinaus und kaute immer noch an dem Fisch, der in seinem Mund mehr statt weniger zu werden schien.
»Das klingt sehr vielversprechend«, sagte Jana leise.
»Ich nehme an, Ihr wollt nicht auf Trinidad bleiben, sondern werdet weiter zum Festland reisen und dort Euer Glück versuchen?« Der Lotse sah Jana fragend an.
Sie nickte bloß.
»Es gibt tausend Möglichkeiten, in Amerika reich zu werden. Europäer besitzen Silberminen, Zuckerrohrplantagen, Bergwerke …«
»Ich will nicht reich werden«, murmelte Conrad und überraschte Jana mit diesem Beleg, dass er dem Gespräch doch zugehört hatte.
Servante lachte, er hielt Conrads Bemerkung für einen Scherz.
»Die meisten Menschen, die ich bisher kennengelernt habe, sind nach Amerika gereist, weil sie sich Reichtum erhofften.«
»Wir segeln nach Amerika, weil mein Onkel dort eine Silbermine besitzt. Er braucht unsere Hilfe«, log Jana, ohne mit der Wimper zu zucken. Sie wollte Servantes Neugier ein für alle Mal beenden. Aber der Lotse fragte weiter: »Wo befindet sich die Mine?«
»In der Nähe von Barinas!« Wenn die Situation es erforderte, konnte Jana eine hervorragende Lügnerin sein. Nun drehte Conrad sich zu ihr um und sah sie belustigt an. Servante bemerkte es nicht und glaubte Janas Geschichte.
»Barinas«, wiederholte er. Vor seinem inneren Auge schien eine Landkarte aufzutauchen. »Wir landen auf Trinidad, danach habt Ihr noch eine weite Reise vor Euch.«
»Wie viele Menschen können auf der Santa Lucia transportiert werden?«, fragte Conrad. Jana war sich sicher, dass er versuchte, das Interesse des Lotsen in eine andere Richtung zu lenken.
Seine Rechnung ging auf. Servante antwortete wichtig: »Eine Nao wie die Santa Lucia ist in etwa 27 Meter lang und 9 Meter breit. Für gewöhnlich haben darauf vierzig Seeleute Platz.«
»Was meint Ihr mit ›gewöhnlich‹?«, hakte Conrad nach.
»Diesmal werden es nur dreißig Seeleute sein, zwei Passagiere.« Er sah zuerst zu Jana, dann zu Conrad und ergänzte: »Und zwanzig Sklaven.«
»Das sind zwölf Menschen mehr als sonst«, schoss es aus Conrad heraus.
»Statt der Menschen transportieren wir sonst Vieh«, erwiderte Servante vorsichtig.
»Vieh, das Ihr in die Neue Welt bringt, oder Vieh, das während der Überfahrt gegessen wird?«
»Beides«, antwortete Servante ehrlich.
»Aber wie kann ein Schiff der Größe der Santa Lucia mit nur dreißig Seemännern gesteuert werden? Noch dazu, wenn deutlich weniger Lebensmittel, dafür aber mehr Esser an Bord sind?«, fragte Conrad.
Der Lotse zuckte mit den Schultern. »Kapitän Valdiva will sich eben ein gutes Geschäft nicht entgehen lassen. Billige Arbeitskräfte sind in der Neuen Welt rar. Die Konquistadoren haben in den letzten hundertfünfzig Jahren einen Großteil der Ureinwohner ausgerottet, und wen sie nicht erschlagen haben, den haben die Pocken erwischt. Jetzt fehlen den reichen Plantagenbesitzern die Männer, die ihnen das Zuckerrohr schneiden. Deshalb holen sie Schwarze aus Afrika. Mittlerweile ist ein guter Sklave so wertvoll wie ein Pferd.«
Jana gefiel der Vergleich nicht, behielt ihre Meinung aber für sich.
»Den Silberminenbesitzern geht es genauso. Die brauchen auch starke Männer, die ihnen die Edelmetalle aus den Bergen klopfen. Ihr könntet Euren Onkel überraschen und ihm einen kräftigen Sklaven mitbringen.«
»Einen Menschen als Geschenk?«, fragte Conrad entsetzt. Es fiel ihm sichtlich schwer, seine Meinung für sich zu behalten.
»Ihr werdet doch nicht glauben, dass der Onkel Eurer Frau ohne Sklaven arbeitet?« Servante zog misstrauisch die Augenbrauen hoch.
»Das hoffe ich sehr«, murmelte Conrad.
»Macht Euch doch nicht lächerlich. Schon die Römer haben Schwarze aus Afrika geholt und sie versklavt. Das ist das Natürlichste der Welt.«
»Das sehe ich anders«, erwiderte Conrad und setzte zu einem Vortrag über die Würde des Menschen an, an der Servante aber nicht interessiert war. Er unterbrach Conrad mitten im Satz und wandte sich Jana zu: »Sobald die Schiffe da sind, solltet Ihr zur Anlegestelle kommen. Der Verkauf hat große Ähnlichkeit mit einem Jahrmarkt und ist sehenswert. Vielleicht findet Ihr einen preiswerten Schwarzen und könnt den Kapitän dazu überreden, ihn gegen ein entsprechendes Entgelt mitzunehmen. Auch wenn Euer Mann anderer Meinung ist, Euer Onkel wird es Euch danken.«
»Wenn mein Onkel einen neuen Sklaven benötigen würde, dann hätte er uns davon geschrieben«, sagte Jana rasch, bevor Conrad noch einmal seine Meinung zum Thema Sklaverei kundtun konnte.
»Wie Ihr meint. Auf alle Fälle könntet Ihr Rodriguez unterstützen.« Nun sprach er wieder mit Conrad. »Als Schiffsarzt muss er die Sklaven untersuchen. Wenn Ihr ihm dabei helft, dann geht es schneller.«
Conrad verzog sein Gesicht zu einer Grimasse und brachte damit zum Ausdruck, was er von dessen Fähigkeiten hielt. Dabei war die Anwesenheit eines Schiffsarztes bei einer derart langen Reise beinahe so wichtig wie die des Kapitäns. Conrad und Rodriguez waren sich bereits auf der Fahrt von Lissabon auf die Insel in die Haare geraten. Einer der Matrosen hatte sich den Finger gequetscht, worauf Rodriguez ihn amputieren wollte. Conrad hatte sich ungefragt eingemischt und darauf bestanden, dass die Fleischwunde versorgt und der Finger geschient wurde. Der Matrose hatte nun immer noch zehn Finger, worüber er sehr dankbar war.
»Ich denke, Rodriguez sollte die Männer lieber allein untersuchen. Es wird noch genug Situationen geben, in denen ich mit ihm streiten werde.«
Jana seufzte. Sie fürchtete, dass Conrad recht hatte, und war froh, dass er sich diesmal nicht einmischen wollte.
Die Kanarischen Inseln dienten fast allen Schiffen, die nach Amerika unterwegs waren, als letzter Anlaufpunkt zum Auffüllen der Vorräte. Viele Kapitäne wählten die Bucht von San Sebastian auf der Grafeninsel La Gomera als Ankerplatz. Andere, wie Valdiva, entschieden sich für Gran Canaria. Erstaunlicherweise verfügte keine der Inseln über einen besonders großen Hafen. Im Vergleich zu Lissabon war Las Palmas mit seinen rund fünftausend Einwohnern ein winziges Dorf. Im Hafen gab es eine Werft, einige Fischhändler, Tavernen und ein prächtiges Verwaltungsgebäude mit kleinen Balkons aus schwarzem Gusseisen. Hier trieb ein Beamter des Gouverneurs die Zölle und Abgaben für die spanische Krone ein. Um der Insel gesicherte Einnahmen zu garantieren, hatte Felipe II. bereits 1576 ein königliches Dekret erlassen, das den Sklavenhandel mit Amerika erlaubte. Aus diesem Grund landeten regelmäßig Lieferungen aus Afrika in Las Palmas. Im Moment lagen vier große Schiffe im Hafen. Also gingen die beiden Handelsschiffe aus Afrika außerhalb der Bucht vor Anker.
Jana hatte Conrad überredet, sie zum Hafen zu begleiten. Vielleicht hatten die Schiffe aus Afrika neben den Sklaven auch andere Waren an Bord, die sie zum Verkauf anboten.
Die beiden waren nicht die Einzigen, die die Neuankömmlinge erwarteten. Die Neuigkeit über die eingetroffenen Schiffe hatte sich wie ein Lauffeuer über Gran Canaria und die Nachbarinseln verbreitet. Hafenarbeiter und Bewohner aus dem Inneren der Insel sowie Plantagenbesitzer und reiche Adelige von den Nachbarinseln waren gekommen, um dem Spektakel beizuwohnen. Servante hatte erzählt, dass jeder Sklavenmarkt den Bewohnern der Inseln eine willkommene Abwechslung im anstrengenden und tristen Arbeitsalltag war. Der Verkauf von Menschen war besser als jedes Schauspiel und unterhaltsamer als Hahnen- oder Hundekämpfe. Außerdem war es der letzte Markt vor dem nahenden Winter. Setzten erst die Herbststürme ein, segelte kein vernünftiger Kapitän mehr Richtung Amerika.
Nun drängten sich Schaulustige und potenzielle Käufer durch die engen Straßen von Triana, dem Arbeits- und Wohnviertel von Las Palmas, Richtung Hafen. Die Alten und Gebrechlichen saßen bei offenen Fenstern und reckten die Hälse, um ebenfalls nichts zu verpassen. Für ein paar Stunden schienen alle, die es sich leisten konnten, ihre Arbeit niederzulegen.
Jana und Conrad hatten sich einen Platz etwas abseits vom Kai gesucht. Von hier aus hatten sie einen freien Blick auf die zwei Handelsschiffe. Nachdem die Anker gesetzt waren, wurden kleine, flache Ruderboote zu Wasser gelassen. In den Booten befanden sich Männer. Einige davon ruderten. Wegen des zunehmenden Windes kamen die Ruderboote nur langsam voran und schaukelten wie Nussschalen auf den immer höher werdenden Wellen. Als die Boote endlich nahe genug waren, sah Jana, dass die Insassen im ersten Boot ordentlich gekleidet waren. Vermutlich handelte es sich um den Kapitän, den Steuermann und vielleicht auch den Lotsen der Schiffe. Sie trugen feine Kniebundhosen, dunkle Jacken und weiße Spitzkrägen sowie vornehme Hüte mit bunten Federn. In den Booten dahinter hockten einfache Matrosen und dunkelhäutige Gefangene, die meisten von ihnen waren nackt.
Endlich legte das erste Ruderboot an. Ein Hafenarbeiter half beim Befestigen der Taue. Geschickt stiegen die vornehm Gekleideten aus. Ganz offensichtlich genossen sie den Empfang, der ihnen bereitet wurde. Sie spazierten durch die Menschenmenge, als wären sie Könige oder Herzoge. Einige Schaulustige jubelten ihnen zu. Danach folgte das Boot mit den ersten Gefangenen. Ein untersetzter Seemann mit schmutzigem Hemd und ausgetretenen Stiefeln trieb die Schwarzen mit einem Stock aus dem Ruderboot. Er hatte kaum noch Haare auf dem Kopf und hinkte beim Gehen. Brutal schlug er mit einer Peitsche auf die Unglücklichen ein.
Nie zuvor hatte Jana Menschen gesehen, deren Gesichter dunkel wie die Nacht waren. Entsetzt stellte sie fest, dass die Gefangenen mit schweren Fußketten aneinandergefesselt waren. Ein junger Bursche, er konnte nicht älter als fünfzehn sein, geriet ins Straucheln und stürzte ins Wasser. Dabei zog er zwei weitere Männer mit sich. Augenblicklich sprang der Aufseher zu ihm, zerrte ihn hoch und schlug mit einem dicken Stock zuerst auf den nackten Rücken des Jungen, dann auf seinen Kopf. Der Hinkende schimpfte auf Portugiesisch. Jana fragte sich, warum der Junge nicht seine Hände über seinen Kopf legte, um die Heftigkeit der Schläge abzufangen. Doch sofort erkannte sie den Grund dafür. Seine Hände waren fest am Rücken zusammengebunden. Der Junge drohte erneut zusammenzusacken, da lehnte der Gefangene hinter ihm sich schützend vor ihn und nahm statt seiner die Schläge in Kauf. Der Mann wirkte kräftig, hatte auffallend breite Schultern und ausgeprägte Muskeln. Die Schläge schienen an ihm abzuprallen, auch wenn seine Haut aufplatzte und Blut über seine Schultern floss. Die Entfernung war zu groß, so dass Jana sein Gesicht nicht genau sehen konnte, aber sie hätte schwören können, dass es keinen Schmerz, sondern pure Verachtung für seinen Peiniger zeigte.
Während Conrad sich angewidert zur Seite drehte, konnte Jana ihren Blick nicht abwenden, sie war fasziniert von der aufrechten Körperhaltung des breitschultrigen Gefangenen. Der Mann schien über einen Stolz zu verfügen, den keine Peitsche der Welt brechen konnte. Woher nahm er die Kraft?
Nun wurden die Sklaven mit Stockhieben über den Kai zu einem freien Platz am Hafen getrieben, die Menge tobte und jubelte. Es war, als würde man preisgekrönte Stiere, gebändigte Löwen oder Bären über einen Jahrmarkt hetzen. Kinder liefen neben dem Menschenzug her, lachten und applaudierten. Jana zog Conrad mit sich, der ihr nur widerwillig folgte.
Vor dem Verwaltungsgebäude der spanischen Krone hatte man einen Tisch, mehrere Stühle und ein kleines Podest aufgestellt. Nachdem der reichste Kaufmann der Insel, der gleichzeitig der spanische Gouverneur war, die beiden Kapitäne der Sklavenschiffe mit Erfrischungen begrüßt hatte, nahmen die Männer auf den Stühlen Platz. Die Familie Peraza, die Herzöge von La Gomera, hätte nicht feierlicher empfangen werden können.
Unterdessen führten die Matrosen die Gefangenen auf den freien Platz und ließen sie in ordentlichen Reihen aufstellen. Die potenziellen Käufer konnten nun von einem Sklaven zum nächsten gehen und sich von der Qualität der menschlichen Ware überzeugen, bevor die Männer einzeln auf das Podest gestellt und zum Kauf angeboten wurden.
Durch das Drängen der Menge waren Jana und Conrad ganz vorne gelandet.
»Ich habe genug gesehen«, sagte Conrad angewidert und wandte sich zum Gehen. Da drängte sich Kapitän Valdiva an ihm vorbei. Der Mann war beinahe so breit wie hoch und trug wie immer einen auffallenden Hut mit bunten Federn. Jana vermutete, dass er damit größer wirken wollte, als er tatsächlich war. Er trat als einer der Ersten zu den Gefangenen und schritt die Reihe der Gefesselten mit prüfendem Blick ab. Vor einem der Männer blieb er stehen, drehte sich mit suchendem Blick um und rief: »Rodriguez?«
Aber der Schiffsarzt antwortete nicht. Da erblickte der Kapitän Conrad und winkte ihn ungeduldig zu sich.
»Pfeiffer, Ihr seid Arzt. Ich brauche Eure Hilfe. Untersucht die Zähne des Sklaven, ich will nur erstklassige Ware kaufen«, sagte er und zwang den Mann vor sich, den Mund zu öffnen.
Conrad rührte sich nicht vom Fleck, sein Gesichtsausdruck war finster.
»Worauf wartet Ihr, Pfeiffer?«, fragte der Kapitän ungeduldig.
»Ich bin Arzt. Ich behandle Menschen, wenn sie krank sind«, zischte Conrad zwischen zusammengebissenen Zähnen. Jana war sich sicher, dass der Kapitän ihn nicht verstehen konnte, und das war gut, denn sie wollte nicht, dass Conrad bereits vor der Abreise Schwierigkeiten mit Valdiva bekam. Gerade als sie ihn darauf aufmerksam machen wollte, wurde Conrad unsanft zur Seite gedrängt. Es war der Schiffsarzt Doktor Rodriguez, der ihm einen Stoß versetzt hatte. Rodriguez war ebenso groß wie Conrad, aber deutlich kräftiger. Mit seinem glänzenden schwarzen Haar, dem sauber gestutzten Bart und den auffallend breiten Schultern war er ein gutaussehender Mann.
Er bedachte Conrad mit einem mitleidigen Blick und meinte abfällig: »So leicht besaitet wie Ihr seid, solltet Ihr lieber gehen. Sobald wir die zwanzig kräftigsten Männer ausgesucht haben, werden wir sie brandmarken.« Er zeigte mit dem beringten Zeigefinger seiner rechten Hand zu einer Feuerstelle, wo ein Schmied mehrere Eisenstangen bereithielt. An deren Enden waren unterschiedliche Zeichen befestigt.
»Ich nehme an, Euer empfindlicher Magen verträgt den Geruch von verbranntem Menschenfleisch nicht, und wir wollen doch nicht, dass Euch schlecht wird. Vor allem nicht heute, wo ich so viel zu tun habe und mich nicht um Euch kümmern kann.«
»Bevor ich mich von Euch behandeln lasse, bitte ich den Schiffsjungen um Hilfe. Er hat mehr Ahnung von Medizin als Ihr.«
Rodriguez’ Gesicht verfinsterte sich, und Jana schloss für einen Moment die Augen. Sie ahnte, was jetzt kommen würde. Warum konnte Conrad nicht einfach seinen Mund halten, sich umdrehen und gehen? Hatte er den Schiffsarzt nicht schon genug gedemütigt, indem er den Finger des Matrosen gerettet hatte? Aber Conrad setzte noch eins drauf und fuhr fort: »Und was die Gefangenen anbelangt: Ich werde mich hinterher um die sinnlosen Verbrennungen kümmern, die Ihr den Männern zufügt. Denn solltet Ihr die Verletzungen nicht versorgen, werden die Gefangenen an den Folgen der eitrigen Wunden elend zu Grunde gehen, und Kapitän Valdiva landet mit toten Sklaven in Trinidad.«
»Das werdet Ihr unterlassen«, zischte Rodriguez voller Zorn. »Ihr seid lediglich ein Passagier auf der Santa Lucia. Wenn Ihr mir noch einmal ins Handwerk pfuscht, werdet Ihr es bereuen. Ich lasse mich von Euch nicht zum Narren machen.«
»Das brauche ich nicht, denn Ihr …« Weiter kam Conrad nicht, denn Jana versetzte ihm nun einen so heftigen Stoß in die Rippen, dass er zusammenzuckte und sie verärgert anstarrte.
»Was …?«, fragte er.
Aber Jana schüttelte bloß den Kopf.