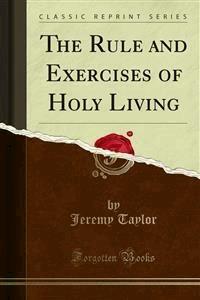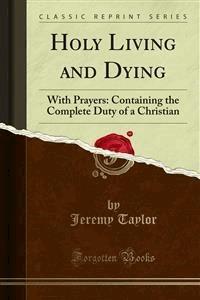11,99 €
Mehr erfahren.
Die Evolution hat uns kein leichtes Erbe auferlegt: Unser Körper befindet sich noch auf Steinzeit-Niveau und ist an die »moderne« Welt nicht angepasst. Die Folge sind Zivilisationskrankheiten wie Rückenschmerzen, Autoimmunkrankheiten, Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und vieles mehr. Beispielsweise ist die Bauchspeicheldrüse darauf gepolt, dass wir wie unsere Ahnen täglich 40 km lange Märsche zurücklegen und selten mal eine Beere naschen. Unsere zuckerlastige Ernährung und mangelnde Bewegung führen darum langfristig zu Diabetes Typ II. Dieses Buch erklärt auf ebenso spannende wie einleuchtende Weise die Ursachen und Zusammenhänge sämtlicher Volkskrankheiten. Dazu stellt es neueste Forschungsergebnisse aus der Evolutionsmedizin vor, die unglaubliche Chancen und Therapiemöglichkeiten bietet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 445
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Jeremy Taylor
Der Fluch unserer Gene
Warum Volkskrankheiten entstehen und wie die Evolutionsmedizin hilft
Aus dem Englischen
von Christine Ammann und Tobias Rothenbücher
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte dieses E-Book Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung dieses E-Books verweisen.
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel »Body by Darwin. How Evolution Shapes Our Health and Transforms Medicine« bei University of Chicago Press.
1. Auflage
Deutsche Erstausgabe
© 2015 der deutschsprachigen Ausgabe Riemann Verlag, München
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright © Jeremy Taylor 2015
Lektorat: Ralf Lay, Mönchengladbach
Satz: EDV-Fotosatz Huber/Verlagsservice G. Pfeifer, Germering
ISBN 978-3-641-17397-5
www.riemann-verlag.de
Inhalt
Einleitung
Abwesende Freunde
Wie die Hygienetheorie Allergien und Autoimmunerkrankungen erklärt
Eine tolle Romanze
Wie die Evolutionstheorie Unfruchtbarkeit und Schwangerschaftserkrankungen erklärt
Die Kehrseite des aufrechten Gangs
Der Zusammenhang zwischen Zweifüßigkeit und orthopädischen Beschwerden
Hoffnungsfrohe Monster
Warum Heilung bei Krebs nahezu ausgeschlossen ist
Verstopfte Leitungen
Warum uns die evolutionäre Entwicklung der Koronararterien anfällig für Herzinfarkte macht
Mit sechsundsechzig Jahren … und dann?
Wie die Evolutionsbiologie der dahinsiechenden Alzheimer-Forschung neues Leben einhaucht
Dank
Literatur
Register
Einleitung
Warum können wir nicht ewig leben? Warum schaffen wir es nicht, alle Krankheiten endgültig zu besiegen? Das sind die Fragen, die junge Leute in populären Wissenschafts-Blogs, in Studentenforen oder in Zeitungskolumnen wie »Fragen Sie einen Wissenschaftler« häufig stellen. Aber das macht die Fragen nicht weniger interessant. Die Lebenserwartung steigt heute in allen Ländern weltweit und liegt in einigen schon bei über achtzig Jahren. Der Unterschied zwischen der Lebenserwartung der Jäger und Sammler und derjenigen der modernen westlichen Bevölkerung ist, wie eine aktuelle Studie zeigt, inzwischen größer als der zwischen Jägern und Sammlern und wild lebenden Schimpansen. Und die gewaltige Steigerung der Lebenserwartung gelang uns allein in den letzten vier Generationen – von grob geschätzt 8000 Generationen, seit die Menschheit auf der Erde weilt. Man muss sich nur die unglaublichen Fortschritte anschauen, die Chirurgie, Pharmakologie, Gesundheitswesen, Immunologie und Transplantationschirurgie im vergangenen Jahrhundert gemacht haben, um zu begreifen, dass die Geschichte der modernen Medizin eine Riesenerfolgsstory ist.
Doch solche Statistiken können leicht darüber hinwegtäuschen, dass manche Erkrankungen besorgniserregend zunehmen – und die Situation hier erstaunlicherweise eher schlechter als besser wird. Das menschliche Krankheitsmuster, die »Krankheitslandschaft«, hat sich inzwischen vollkommen verändert. Den scheinbar naiven Fragen der jungen Leute können wir ganz leicht noch ein paar hinzufügen: Warum leiden so viele von uns an Autoimmunerkrankungen wie rheumatoider Arthritis, multipler Sklerose, Typ-1-Diabetes oder chronischer Darmentzündung? Warum sind so viele Menschen von allergischen Erkrankungen wie Ekzemen oder Asthma betroffen? Warum haben Herzleiden heute geradezu epidemische Ausmaße angenommen? Warum leiden Frauen an Unfruchtbarkeit oder schwerer Gestose? Warum leiden wir an Rückenschmerzen, Zwerchfellbrüchen, verrutschten Wirbeln und defekten Hüftgelenken? Warum gibt es so viele geistige und seelische Erkrankungen? Und warum gleiten so viele von uns im Spätherbst ihres Lebens in die geistige Dämmerwelt der Alzheimer-Krankheit ab?
Die Medizin neigt dazu, den menschlichen Körper als eine raffiniert konstruierte Maschine zu betrachten, die höchstens ein wenig störanfällig ist. Die Maschine muss laufend gewartet werden, weil sie manchmal nicht rundläuft oder fehlerhaft wird. Sie muss dann repariert werden wie ein Rennwagenmotor, bei dem ein erfahrenes Mechanikerteam dafür sorgt, dass er stets wie eine Katze schnurrt. Jeder Medizinstudent lernt, dass es sein Job ist, die Maschine wieder hinzukriegen und möglichst lange am Laufen zu halten. Aber der menschliche Körper ist keine Maschine. Er ist ein Bündel lebender Baustoffe, das wie alles irdische Leben als Produkt der Evolution durch natürliche Selektion entstanden ist. Und es gibt beträchtliche Unterschiede zwischen Maschinen, architektonischen oder technischen Gebilden und dem menschlichen Körper.
Wenn wir einen Architekten oder Techniker mit der Planung eines – sagen wir – Bürohochhauses beauftragen, will er als Erstes wissen: »Wie lautet mein genauer Auftrag?« Wir erläutern dann vermutlich, dass wir eine bestimmte Höhe wünschen, die Solaranlage bestimmte energetische Anforderung erfüllen, der Aufzug vor der Fassade liegen, das Gebäude zur Umgebung passen und außerdem 200 Jahre halten soll und so weiter. Das Ergebnis ist ein Bauplan, an den sich alle halten müssen. Bei unvorhergesehenen Problemen wirft der Architekt einen Blick auf den Plan und bringt hier und da einige Korrekturen an.
Der Auftrag an die Evolution sieht hingegen vollkommen anders aus. In der Welt der Architektur und Technologie werden Ihnen die Konstruktionskriterien für den menschlichen Körper niemals begegnen. Die Evolution »interessiert« sich nicht für Gesundheit oder Glück oder ein langes Leben. Um es mit Darwin zu sagen: Sie interessiert sich nur für die maximal angepasste Reproduktionsfähigkeit eines Individuums. Und somit nur für Veränderungen, die es einem Organismus ermöglichen, sich an Umweltveränderungen anzupassen und zu vermehren. Das heißt umgekehrt auch, dass genetische Veränderungen zu einem größeren Fortpflanzungserfolg führen und sich die veränderten Gene in einer Bevölkerung voraussichtlich stärker verbreiten. Gene können also unsterblich sein, aber beim Körper war davon nie die Rede. Die Evolution entscheidet sich bei einem Individuum nur dann für Eigenschaften, die ihm das Leben jenseits des Fortpflanzungsalters ermöglichen, wenn sich dadurch die Überlebenschance von Genen verbessert, die an Töchter und Söhne, enge Verwandte und Enkel weitergegeben werden. Die Evolution ist zudem, anders als jeder renommierte Architekt, blind und ahnungslos. Sie besitzt keinen Plan, sie kann nicht in die Zukunft schauen und vorausschauend planen, und sie verfügt über keinen Verstand, mit dem sie Probleme »erkennen« und darauf optimal reagieren könnte. Die Evolution muss zu jedem Zeitpunkt in der Evolutionsgeschichte eines Organismus mit dem klarkommen, was gerade da ist. Sie kann Bauplan und Konstruktion nicht neu aufdröseln und von vorn anfangen, wenn von irgendwoher ein neuer Selektionsdruck auftaucht, der nach baulichen und funktionalen Veränderungen verlangt, damit bestimmte Individuen einer Art überleben können.
Der Vergleich mit Technik oder Maschinen führt also gründlich in die Irre und hilft uns nicht weiter, wenn wir verstehen wollen, warum wir so anfällig für Krankheit und Verschleiß sind. Vier Pioniere der Evolutionsmedizin, Randolph Nesse, Stephen Stearns, Diddahally Govindaraju und Peter Ellison, haben daher kürzlich versucht, ein für alle Mal mit dem Technikvergleich aufzuräumen. Er ist nämlich nicht nur vollkommen unnütz, um zu begreifen, was im menschlichen Körper schiefläuft, sondern in der medizinischen Fachwelt auch nach wie vor stark verankert. Weil die Evolution, so erläutern die Forscher, die Fortpflanzung und nicht die Gesundheit maximieren will, ist jeder Organismus ein Konglomerat aus Kompromissen und folglich das Ergebnis unvermeidlicher Zugeständnisse und Zwänge. Und weil die biologische Evolution zweitens so viel langsamer verläuft als der kulturelle Wandel, werden viele Krankheiten dadurch verursacht, dass unser Körper nicht zur modernen Umwelt passt. Hinzu kommt, dass sich Krankheitserreger viel schneller weiterentwickeln als wir und unser Leben ohne Infektionen überhaupt nicht vorstellbar ist. Und schließlich, so die Forscher, ist die Vorstellung falsch, viele menschliche Krankheiten würden durch die Vererbung einiger weniger defekter Gene hervorgerufen. Normalerweise interagieren mehrere Genvarianten miteinander und mit der Umwelt und lassen so eine Erkrankung entstehen. Krankheit und Verschleiß werden darum immer Teil unseres Lebens sein und lassen sich kaum vermeiden.
Die Evolutionsmedizin lässt den menschlichen Körper in einem völlig neuen Licht erscheinen und kommt häufig zu Erkenntnissen, die der gängigen Vorstellung von Krankheit zuwiderlaufen. Ein einfaches und alltägliches Beispiel dafür ist das Fieber bei Infektionen. Wenn wir an Grippe erkranken, bekommen wir Fieber, fühlen uns matt und haben wenig Lust, unseren Alltag zu meistern. Häufig greifen wir und unsere Ärzte dann zu fiebersenkenden Mitteln. Doch da Krankheitserreger eine Temperatur bevorzugen, die unterhalb unserer Körpertemperatur liegt, ist Fieber nützlich: Es ist ein raffiniertes, evolutionär bewährtes Mittel, um den menschlichen Körper für eindringende Mikroorganismen in eine möglichst feindliche Umgebung zu verwandeln.
Peter Gluckman von der Universität Auckland führt noch ein komplexeres Beispiel an: Die Evolution, so sagt er, kann auch erklären, warum Brust- und Eierstockkrebs seit Jahrzehnten zunehmen und Brustkrebs bei Frauen in entwickelten Ländern heute eine der fünf häufigsten Todesursachen ist. Vieles deutet darauf hin, so Gluckman, dass man vor Brustkrebs besser geschützt ist, wenn die erste Menstruation spät kommt und das erste Baby früh, wenn relativ viele Schwangerschaften mit langer Stillzeit darauf folgen und die Menopause anschließend früh einsetzt. All das traf auf Frauen der Altsteinzeit typischerweise zu. Doch für die moderne Frau gilt genau das Gegenteil. Ihre Menstruation setzt früher ein, zwischen Menarche und erster Schwangerschaft liegt ein langer Zeitraum – das heißt viele Menstruationszyklen –, sie hat wenige Kinder und stillt nur kurz. Heute haben Frauen während ihrer fruchtbaren Jahre ungefähr 500 Eisprünge, und durch mechanische Verletzungen des Eierstockepithels und die lokal stark schwankenden Sexualhormone erhöht sich, so nimmt man an, das Eierstockkrebsrisiko. Das erklärt möglicherweise auch, so Gluckman, warum die Einnahme oraler empfängnisverhütender Mittel, die die Zahl der Menstruationszyklen einer Frau verringern, das Risiko offenbar senken. Das Brustkrebsrisiko hingegen ist, so Gluckman, erhöht, weil das duktale Brustgewebe bei Frauen, die nicht gebären, unreif bleibt – es reift erst mit der ersten Schwangerschaft. Außerdem werden die Brustepithelzellen ständig regeneriert, weil Östrogen und Gestagen fortlaufend zirkulieren und es kein Ausbleiben der Regelblutung durch mehrfache Schwangerschaften gibt. Und durch das fehlende oder kurze Stillen werden Präkrebszellen nicht mit der Muttermilch ausgespült, so Gluckman.
Die dramatischen Veränderungen im Fortpflanzungsverhalten – durch Verhütungsmittel und Hormonersatztherapie, Kinderlosigkeit oder weniger Kinder, kurze Stillzeiten, frühere Menarche und spätere Menopause – führen also dazu, dass der weibliche Körper und die Fortpflanzungsbiologie nicht mehr zueinanderpassen. Frauen sind länger fruchtbar und erleben viele Menstruationszyklen mit wild schwankenden Hormonzuständen. Doch wie können wir das Vorhandensein der vermutlich krebsauslösenden Gene BRAC1 und BRAC2 erklären? Bestimmte Varianten dieser Gene verlieren ihre Fähigkeit, die Tumorentwicklung in den Brustepithelzellen zu unterdrücken. Gluckman verweist darauf, dass Brustkrebs zwar meistens im fortgeschrittenen Alter auftritt, es aber auch eine erhebliche Zahl jüngerer Frauen gibt, die an Brustkrebs erkranken. Man sollte daher annehmen, dass die Genvarianten, die das Brustkrebsrisiko stark erhöhen, evolutionär aussortiert wurden und ihre Häufigkeit in der heutigen Bevölkerung sinkt. Das trifft aber nicht zu. Und das lege nahe, so Gluckman, dass die Gene im jungen Alter eine nützliche Wirkung haben, die ihre verheerende Wirkung im fortgeschrittenen Alter wieder wettmacht. Dieses Phänomen nennt sich »antagonistische Pleiotropie« und taucht in evolutionären Modellen menschlicher Erkrankungen häufig auf. Eine aktuelle Studie zeigt denn auch, dass Trägerinnen von BRAC1-Mutationen signifikant fruchtbarer sind und ihre Sterblichkeit nach der Menopause signifikant höher ist. Möglicherweise hat die Evolution hier eine höhere Fruchtbarkeit im jüngeren, reproduktiven Alter gegen ein höheres Sterberisiko durch Brustkrebs in späteren Jahren eingetauscht.
Angesichts des erfreulich erfolgreichen und unglaublich nützlichen Erklärungsansatzes, den der Evolutionsgedanke bietet, müsste die Evolution, so sollte man meinen, in der medizinischen Landschaft heute eine große Rolle spielen, was sie aber nicht tut. Konnte sich der Gedanke in der Medizin nicht durchsetzen, oder hat er inzwischen wieder an Gunst verloren? Wie Peter Gluckman erklärt, hatten die Vordenker der Evolution zu Beginn des 19. Jahrhunderts sogar einen medizinischen Hintergrund, aber im medizinischen Lehrplan kam die Evolution nur in liberaleren Teilen Europas vor und war ansonsten aufgrund religiöser Vorstellungen verpönt. Gegen Ende des Jahrhunderts musste sie sich dann gegen neu aufkommende Wissenschaften wie die Physiologie behaupten, wobei selbst eingefleischte Darwinisten wie Thomas Huxley damals meinten, die Evolution habe zum Arbeitsgebiet der Ärzte nichts beizutragen. In die Medizin hielten stattdessen Physiologie, Histologie und viele andere -ologien oder auch die Biochemie Einzug, die ohne jeden Rückgriff auf die Evolution auskamen. Die Evolution hatte endgültig ausgedient.
Ein weiteres Problem ist, dass viele Ärzte dem Evolutionsgedanken offen feindlich gegenüberstehen – und immer standen. Wenn man an irgendeiner Universität die Kreationisten finden wolle, scherzt der Philosoph Michael Ruse, so solle man am besten geradewegs zur medizinischen oder veterinärmedizinischen Fakultät gehen! Viele Ärzte halten die Erkenntnisse der Evolutionsmedizin zudem in der Praxis für irrelevant, weil sie in ihrem Alltag ja vor schwer kranken Patienten ständen, die jetzt und hier eine Behandlung oder Operation bräuchten. Die Ärzte leben in der greifbaren Welt des menschlichen Leidens und nicht in den fernen Welten der Evolutionsmechanismen.
Hinzu kommt, dass die Evolutionstheorie und ihre Sprache, wenn man sie auf die Biologie und das Verhalten des Menschen anwendet, unserem Verständnis von Moral und Ethik oder den Gefühlshaltungen, die unsere Menschlichkeit ausmachen, großenteils zu widersprechen scheinen. Ich erinnere mich an eine besonders unangenehme Begegnung mit einer Frau auf einer Party. Ich erzählte in einer Runde von einigen Studien, die herausgefunden hatten, dass Mütter ihre Söhne in guten Zeiten mit nahrhafterer Brustmilch stillen als ihre Töchter – und umgekehrt, wenn die Zeiten schlecht sind. Man sehe hier einen evolutionären Mechanismus am Werk, der die elterliche Investition in Söhne bei schlechten Bedingungen begrenzt, weil diese möglicherweise am unteren sozialen Ende aufwachsen, daher unattraktive Partner wären und so die Chance auf Enkel minderten. Meine Zuhörerin schnaubte verärgert und stapfte auf der Suche nach einer angenehmeren Unterhaltung davon, aber nicht ohne mir noch über die Schulter zuzuzischen: »Du solltest mal Ordnung schaffen: in deinen Fakten und in deinem Kopf!« Jede normale Frau, so meinte sie, müsse es ja wohl verwerflich und sexistisch finden, wenn eine Mutter ihrem Kind absichtlich Brustmilch vorenthalten würde. Sie machte den Fehler, nicht zwischen einer bewussten Entscheidung gegen das Kind – die etwa im ländlichen Indien und anderswo verstörend viele weibliche Babys sterben lässt – und einem unbewussten physiologischen Mechanismus der Evolution zu unterscheiden, der die Überlebenschancen der väterlichen Gene bei Söhnen oder Töchtern erhöht. Bei Letzterem handelt es sich um eine Reaktion auf Umweltbedingungen, durch die die kindliche Ernährung über die Mutterbrust entsprechend kanalisiert wird und die ohne jedes bewusste Denken abläuft.
Die Sprache der Evolutionstheoretiker ist häufig so leidenschaftslos, dass sie beinah abstoßend klingt. So kann es verstören, wenn man hört, dass sich das zahlenmäßige Geschlechterverhältnis je nach Umweltbedingungen umkehren kann oder sich das nächtliche Aufwachen und Saugbedürfnis von Babys vermutlich evolutionär entwickelt hat, damit die Mutter keinen Eisprung hat, nicht erneut schwanger wird und Konkurrenz von Geschwisterseite ausgeschaltet wird. Oder es kann verstören, wenn man erfährt, dass das rosarote Bild, das wir uns vom verliebten, kinderzeugenden Paar oder der schwangeren Frau oder der stillenden Mutter machen, in Wahrheit einem evolutionären Kriegsschauplatz gleicht, auf dem männliche, weibliche und fetale genetische Interessen aufeinanderstoßen.
Doch wie dem auch sei, ein Jahrhundert später ist die Evolution wiederaufgetaucht. Das Werk Why We Get Sick. The New Science of Darwinian Medicine (deutsch: Warum wir krank werden. Die Antworten der Evolutionstheorie) von Randolph M. Nesse und George C. Williamsaus dem Jahr 1994 gab die Initialzündung, und darauf folgten wichtige Beiträge von Peter Gluckman, Wenda Trevathan, Stephen Stearns, Paul Ewald und vielen anderen. All diese Autoren haben sich intensiv und sehr spezifisch mit den Konzepten der Evolutionsmedizin beschäftigt. Dennoch möchte ich einen etwas anderen Weg einschlagen. Dazu inspiriert hat mich ein wichtiger Punkt, den einer der Väter der Evolutionsmedizin, Randolph (Randy) Nesse, mehrfach hervorgehoben hat.
Nesse hat wiederholt betont, dass der Wert der Evolutionsmedizin darin liege, dass sie direkt zu Veränderungen in der täglichen medizinischen Praxis oder sogar zu neuen Therapien führen kann. Doch aus einer grundsätzlicheren Warte aus betrachtet, so Nesse, bestehe ihr Wert darin zu erklären, warum die Dinge so sind, wie sie sind. In diesem Sinne sei die Evolution für die Medizin das, was die Physik für die Technik ist. So lautet der berühmteste Aphorismus von Randy Nesse: »Medizin ohne Evolution ist wie Technik ohne Physik.« Man kann kein Raumschiff Rosetta bauen und 500 Millionen Kilometer weit ins Weltall schicken, wo es dann auf Komet 67P trifft und erfolgreich die mit Versuchsgeräten vollgestopfte Philae-Landeeinheit absetzt, wenn man nichts über Physik und speziell die Newton’schen Gesetze und das elektromagnetische Spektrum weiß. Und ebenso wenig kann man zu den Wurzeln des hochspeziellen menschlichen Immunsystems vordringen und wirklich effektive Behandlungen für Allergien und Autoimmunerkrankungen entwickeln, wenn man nicht weiß, wie und warum sich das Immunsystem entwickelt hat. Und darum müsse die Evolutionsbiologie, so Nesse, Grundlage und Eckpfeiler von Medizin und Biologie sein.
Ich kenne Randy Nesse seit über einem Vierteljahrhundert und habe ihn stets für seine Ausdauer, Energie und Geradlinigkeit bewundert, wenn es darum geht, die Evolution erneut in die überfüllten Studienpläne der medizinischen Hochschulen zu integrieren. Und aktuell sieht es so aus, als wende sich das Blatt zu seinen Gunsten. Mit diesem Buch möchte ich Nesses Vorstellung, dass die Evolution die »Physik« der Medizin sei, anschaulich machen und untermauern. Ich habe keine umfassende Anleitung geschrieben, wie die Evolution ganz allgemein medizinische Probleme lösen kann, und auch kein Handbuch »Heile dich selbst« auf Grundlage der Evolution. Ich beschreibe vielmehr den evolutionären und weit zurückreichenden Hintergrund, der hinter einigen Erkrankungen steckt, und versuche vor allem zu erklären, warum es solche Erkrankungen gibt: warum die Dinge also so sind, wie sie sind. Ich wünsche mir, dass Sie der Evolution nach Lektüre dieses Buches mit neuer Achtung begegnen, denn sie ist die Hauptursache für Bau und Funktionsweise des menschlichen Körpers – auch wenn sie manchmal dazu führt, dass unser Körper versagt und wir die Arztpraxis aufsuchen müssen.
In den folgenden Kapiteln möchte ich die grundlegenden evolutionären Faktoren, die hinter verschiedenen Erkrankungsprozessen stehen, umfassend erläutern, aber auch mit einigen Mythen aufräumen – etwa in Hinblick auf den Zusammenhang zwischen aufrechtem Gang und Verschleißerscheinungen an Wirbelsäule, Füßen und Gelenken. Außerdem möchte ich zeigen, dass die Betrachtung einer Krankheit unter evolutionären Gesichtspunkten schon heute zu hochinteressanten Therapieansätzen führt: etwa bei Blindheit, Herzleiden, Autoimmunität, Fortpflanzungsstörungen, Krebs oder Alzheimer. Aber wieso sollten Herzleiden, Krebs oder Demenz eine evolutionäre Anpassung sein?, werden Sie nun vielleicht fragen. Das sind sie natürlich nicht. Was ich zeigen möchte, ist, dass der Evolutionsgedanke ein Ansatz sein kann, der zu grundsätzlichen Fragen und zu einer neuen Sicht von Krankheit und damit vielleicht auch zu neuen Antworten führt.
Wenn wir beispielsweise verstopfte Koronararterien auf einem Röntgenbild sehen, kann sich schnell der Verdacht aufdrängen, ob solche engen, schnell verlegten Gefäße nicht ein evolutionärer Ausrutscher sind. Doch wir vergessen dabei, dass das Herz die kräftigste und dichteste Muskelmasse unseres gesamten Körpers ist und daher einen ungeheuren Sauerstoff- und Nährstoffhunger hat. Und wenn die Herzmuskeln dichter werden, werden sie leider undurchlässiger für die Blutversorgung. Im Folgenden werden wir darum sehen, dass wir Herzleiden besser gerecht werden, wenn wir die Koronararterien als die evolutionäre Antwort verstehen, um den zunehmend kräftigeren, dichteren Herzmuskel der aktiven Wirbeltiere, etwa unseren, besser mit sauerstoffreichem Blut zu versorgen. Und ganz ähnlich hat die evolutionäre Aufgabe, den aufrechten Gang mit der Geburt immer größerer Babys in Einklang zu bringen, zu Kompromissen beim Bau von weiblicher Wirbelsäule und weiblichem Becken geführt.
Die Welt unserer Vorfahren war um einiges schmutziger als unsere Welt heute. Und da sich die Mikroorganismen in der Frühgeschichte nicht ausrotten ließen, entschied sich die Evolution für die praktische Lösung und sorgte dafür, dass der Mensch mit den Mikroben leben konnte, ohne sie ständig bekämpfen zu müssen. Um die erheblichen Nebenwirkungen zu vermeiden, die wir unserem Gewebe durch ein sinnlos und ständig randalierendes Immunsystem zufügen würden, überließ die Evolution die Steuerung unseres Immunsystems den Mikroben, die in uns lebten, sodass wir sie schließlich tolerierten. Die Evolution konnte ja nicht ahnen, dass wir einmal in einer Welt leben würden, in der Hygiene, Antibiotika und Chemikalien 99,9 Prozent aller Haushaltskeime töten und die mikrobiotische Besiedelung in uns so ausdünnen würden, dass unser Immunsystem nicht mehr richtig reifen oder reguliert werden kann und Allergien und Autoimmunerkrankungen daher auf dramatische Weise zunehmen. Es handelt sich um eine evolutionäre Fehlanpassung, die im 21. Jahrhundert zu neuen Erkrankungen von epidemischen Ausmaßen führt.
Das stärkste Argument für einen evolutionären Ansatz in der Medizin sind die Antibiotikaresistenzen, die sich derzeit rasant ausbreiten. Evolutionsbewusste Biologen warnen uns schon seit Jahrzehnten davor, denn sie wissen, dass sich Bakterien im Gegensatz zu uns, die wir Jahrzehnte dafür brauchen, im Stunden- oder Minutentakt vermehren und sich in halsbrecherischer Geschwindigkeit weiterentwickeln können. Doch wir waren auf diesem Ohr taub und ließen es zu, dass Antibiotika – dank einer fruchtbaren, ausgefeilten Antibiotikaforschung – über Jahrzehnte mutwillig im Übermaß verschrieben und, was die Sache noch schlimmer macht, zentnerweise als wachstumsfördernde Mittel an Tiere verfüttert wurden. Nun könnte es eher früher als später so weit sein, dass wir zahllosen multiresistenten Keimen und hochpathogenen Mikroorganismen hilflos ausgeliefert sind. Führende Mediziner prognostizieren heute, dass wir vorübergehend zu den Krankenstationen der fünfziger Jahre zurückkehren werden – mit weit auseinanderstehenden Betten, Legionen von karbolschwingenden Schwestern und aufgerissenen Fenstern, um frische Luft hereinzulassen –, indes die Regierungen versuchen werden, die widerstrebenden Pharmaunternehmen mit großzügigen Steuererleichterungen dazu zu bewegen, den Kampf gegen die Keime in uns aufzunehmen. Und ganz ähnlich begreifen viele Onkologen nicht, dass sich Krebszellen wie Bakterien verhalten und sich blitzschnell verändern, wenn sie mit Chemotherapien überschüttet werden. Bei zahlreichen Krebsarten hat sich die Überlebensrate zwar allmählich verbessert, doch in vielen Fällen verhindern entstehende Tumorresistenzen den Erfolg.
Was die menschliche Fortpflanzung betrifft, lässt sich die sehr geringe Fruchtbarkeit im Vergleich zu anderen Tieren und die sehr hohe Rate an Fehlgeburten und Schwangerschaftserkrankungen wie Gestose kaum erklären, wenn man nicht die Evolutionstheorie heranzieht und berücksichtigt, dass die Interessen von mütterlichen und väterlichen Genen konkurrieren und die Evolution die mütterlichen Investitionen in den Nachwuchs besonders absichern will.
Ein Aspekt bei der Beschreibung des menschlichen Körpers und seiner Krankheitsanfälligkeit unter evolutionären Gesichtspunkten hat mich allerdings immer gestört, und ich möchte darum näher darauf eingehen. Meiner Meinung nach dient dieser vor allem dazu, vom Beitrag der Evolution für die Entwicklung der Menschheit – und des Lebens im Allgemeinen – abzulenken, und ist großenteils durch den Kampf entstanden, den Darwinisten und Anhänger von Kreationismus und Intelligent Design nun schon seit langer Zeit um Herzen und Köpfe der Menschen führen. Die Kreationisten gehen von der Grundannahme aus, Gott habe den Menschen nach seinem Ebenbild erschaffen, doch die Darwinisten widersprechen ihnen mit dem Argument, im menschliche Körper gäbe es zahlreiche Fehlkonstruktionen, die ein göttlicher Chefkonstrukteur niemals zugelassen hätte. Die vielen Mängel seien ein Beweis für die Evolution und widerlegten die göttliche Schöpfung.
Meine Version eines uralten bekannten Witzes bringt den Kampf zwischen Anhängern der Evolutionstheorie und Kreationisten auf den Punkt:
Die Jahrestagung des amerikanischen Ärzteverbandes findet diesmal in Chattanooga, Tennessee, statt – tief im Bible Belt und in einer der gläubigsten Städte Amerikas. Im Foyer sitzen einige Ärzte entspannt beim Drink, man unterhält sich über das einzigartige Design des menschlichen Körpers. Da einige der Ärzte tief religiös sind, andere aber Atheisten, entwickelt sich ein Streitgespräch darüber, wer den Körper erschaffen hat: Gott oder die Evolution.
»Nichts spricht mehr für die göttliche Hand«, meldet sich der Orthopäde zu Wort, »als das menschliche Knie. Es ist das komplexeste Gelenk des menschlichen Körpers. Dort treffen die drei langen Beinknochen – Schienbein, Oberschenkelbein und Wadenbein – mit ihren sorgfältig ausgeführten Gelenkflächen unter dem Schutz der Kniescheibe aufeinander. Jede Menge Bänder und Sehnen halten sie zusammen, und noch dazu sorgen Stoßdämpfer aus Knorpel und flüssigkeitsgefüllte Beutel dafür, dass sich das Knie reibungslos bewegt. Einfach ein Wunder!«
»Alles schön und gut«, sagt da der Neurowissenschaftler. »Aber du musst dir mal das menschliche Gehirn anschauen. Wenn du die verblüffende Komplexität des Gehirns siehst, wirst du Gottes Kunstfertigkeit erst richtig zu schätzen lernen. Stell dir mal vor: 86 Milliarden Neuronen tauschen mit Geschwindigkeiten bis 400 Stundenkilometer Nervenimpulse über ein riesiges Netzwerk mit 125 Billionen Synapsen aus. Ich arbeite gerade an einer Computerkartierung der Gehirnaktivitäten, und nur für die Messwerte eines Jahres werden wir schätzungsweise 300 Milliarden Gigabyte Speicherplatz brauchen.«
»Da kenne ich mich ja nicht so genau aus«, bemerkt da der Urologe. »Aber unter der Gürtellinie, wo ich normalerweise arbeite, sehen die Dinge irgendwie anders aus. Überall fehlerhafte Leitungen. Was ist beispielsweise mit dem Samenleiter? Er muss vom Hoden zum Penis eine lächerlich lange Strecke zurücklegen, nur weil er sich erst nach oben und dann um den Harnleiter winden muss. Und auch die Prostatadrüse legt sich wie ein Schraubstock um die Harnröhre, wenn diese die Blase verlässt. Und darum können Millionen Männer im mittleren Alter nicht richtig pinkeln! Was für ein Gestümper! Für mich spricht das alles für die Evolution! Und wo wir schon bei der Urogenitalregion sind, welcher göttliche Schöpfer wäre denn so blöd, eine Abwasserleitung mitten durch den Fortpflanzungsbereich zu legen? Das ist wirklich ein Wunder. Ein Wunder, dass die schlechte Konstruktion überhaupt funktioniert!«
In der Literatur zur Evolution finden sich noch viele Beispiele dieser Art: Der Rachen wird gleichzeitig zur Atmung und Nahrungsaufnahme genutzt, was die Erstickungsgefahr erhöht. Der Appendix ist ein verkümmertes Organ, das aber noch immer vorhanden ist: Er macht uns anfällig für »Blinddarmentzündungen«, und ohne die moderne Medizin sind unsere Vorfahren sogar daran gestorben. Wir leiden zudem schnell an verstopften Nebenhöhlen, weil sich unser Gesicht verflacht hat und wir aufrecht gehen. Und auch der Stimmnerv bei anderen Tieren ist ein beliebtes Argument der Evolutionsanhänger. Der Nerv verbindet den Kehlkopf mit dem Gehirn und verläuft dabei um den Aortenbogen. Je länger der Hals, desto länger muss der Nerv sein, und bei Giraffen ist er gar über sechs Meter lang. Ein göttlicher Perfektionist hätte den Nerv doch wohl getrennt und umgelegt?
Die Anhänger der Evolutionstheorie argumentieren also mit einer schlechten Bauweise. Doch das ist problematisch, weil die Evolution so als glückloser Stümper erscheint – und ihr Ergebnis als Pfusch am Bau. Als halte sie nur plumpe Lösungen bereit, denen die Einfachheit und Eleganz eines guten Bauplans fehlen und die den fantastischen, überkomplizierten und sinnlos komplexen Maschinen eines Rube Goldberg oder Heath Robinson ähneln würden – je nachdem, auf welche Seite des Atlantiks Sie schauen. So kritisieren etwa Randolph Nesse und einer der berühmtesten Evolutionsvertreter, Richard Dawkins, einträchtig den Bau des menschlichen Auges, weil die inverse Netzhaut das Licht erst durch ein Wirrwarr aus Zellen schicke, bevor es auf die Fotorezeptoren trifft, und der Schaltweg für die optischen Signale unnötig lange an der Netzhautoberfläche herumtrödele, ehe er durch den blinden Fleck den Weg ins Gehirn findet. Welch eine chaotische Lösung!
Doch die eigentliche Tragödie all der »Pfusch am Bau«-Metaphern – die großenteils einer verdrehten Logik entstammen, die die Kreationisten widerlegen will – liegt für mich darin, dass sie der Evolution insgesamt einen Bärendienst erweisen. Anstatt auf das Außergewöhnliche der evolutionären Konstruktionslösungen zu verweisen, malen sie ein Bild der Evolution als angeberischer Tüftler und versäumen es oft, uns daran zu erinnern, wie hervorragend die Lösungen eigentlich funktionieren. Allerdings sind die Lösungen der Evolution durch einen Prozess aus Mutation und Selektion entstanden, der im Blindflug, ohne Kenntnis der Zukunft agieren musste. Sie wirken daher notwendigerweise etwas eigenwillig und auf einen Technikpuristen möglicherweise exzentrisch. Schließlich kann die Evolution gar keinen menschlichen Körper geschaffen haben, der bloß ein Sammelsurium aus fantasievollen, aber ineffizienten Tüfteleien ist. Hätte die Evolution dauernd nur herumgepfuscht, wäre unsere Spezies angesichts des pausenlosen evolutionären Wettrüstens längst ausgestorben. So gesehen, erinnert der evolutionäre menschliche Körperbau vor allem an den einfallsreichen Angus MacGyver aus der gleichnamigen Fernsehserie, der im Kampf um Leben und Tod geniale Lösungen aus Alltagsgegenständen wie Klebeband und Büroklammern bastelt, und keineswegs an den unfähigen und anatomisch unbeleckten Dr. Nick aus den Simpsons, der bei seiner berühmten Transplantation, wenig witzig, Arm und Bein vertauscht hat.
Es ist, meine ich, sehr schade, dass sich die Anhänger der Evolution in eine Ecke manövriert haben, in der sie beständig das Negative hervorheben müssen, um uns davon zu überzeugen, dass die Evolution und nicht Gott den menschlichen Körper geschaffen habe. Nehmen wir beispielsweise den Bau des Auges. Hätten manche Evolutionsanhänger nur ein wenig tiefer gegraben, dann hätten sie hochplausible Gründe dafür finden können, warum die inverse Netzhaut, die auf den ersten Blick mangelhaft scheint, genauso gut eine wunderbare, effiziente Anpassungsleistung sein kann, um in großem Umfang optische Signale zu verarbeiten. Ich wünsche mir, dass wir das Argument der Konstruktionsmängel ein für alle Mal auf den Müllhaufen der Geschichte werfen. Denn in dem Bereich, der uns hier interessiert – die Evolutionsmedizin –, schadet das Argument mehr, als dass es nützt. Der evolutionäre Bauplan unseres Körpers ist überwiegend genial und keineswegs ungeeignet. Doch er ist das Ergebnis von Kompromissen, die die Evolution machen musste – und vieler antagonistischer Pleiotropien nach dem Motto »Lebe jetzt und zahle später«: Die Evolution hat sich wie gesagt für Mechanismen entschieden, durch die junge Menschen im fortpflanzungsfähigen Alter überleben, obwohl die Mechanismen im Alter zulasten der Gesundheit gehen – was wir dann als Krankheit interpretieren.
Und im Zentrum all dieser Krankheitsbereiche stehen zahllose Menschen, die ihrem Leiden nicht entkommen können. Ich möchte sie im Folgenden ebenfalls zu Wort kommen lassen, damit wir nicht vergessen, dass sich hinter der abstrakten Evolutionstheorie Menschen aus Fleisch und Blut verbergen: Menschen, deren Leben durch Krankheit und Immobilität beeinträchtigt ist, Menschen, die ganz real leiden und das mit unglaublicher Tapferkeit ertragen, und Menschen, die unbeirrt für jene sorgen, die von dem Leiden betroffen sind. Viele derer, mit denen ich gesprochen habe, stellen sich mutig als Versuchsperson zur Verfügung, damit die Wissenschaft für ihre Erkrankung neue, bahnbrechende Therapien auf der Basis der Evolution entwickeln kann. Ihnen allen möchte ich für ihre großzügige Unterstützung danken.
Abwesende Freunde
Wie die Hygienetheorie Allergien und Autoimmunerkrankungen erklärt
Familie Johnson wäre in den neunziger Jahren beinah auseinandergerissen worden, weil ihr Sohn Lawrence ein zunehmend gewalttätiges, selbstzerstörerisches und unkontrollierbares Verhalten zeigte. Lawrence war stark verhaltensgestört und konnte hocherregt sein. Dann schlug er sich ins Gesicht, haute den Kopf gegen die Wand, wollte sich die Augen ausstechen und biss sich in den Arm, bis es blutete. Schon mit Alter von zweieinhalb Jahren wurde bei ihm Autismus diagnostiziert, und als er älter wurde, wurde alles nur noch schlimmer. Wenn er eine Straße überqueren wollte und die Ampel nicht grün wurde, wenn sein innerer Zeitplan es ihm sagte, explodierte er vor Wut. In belebten Räumen wie Restaurants oder Kinos hielt er es nicht eine Minute aus, und häufig musste man ihn mit Gewalt davon abhalten, sich selbst zu verletzen. Die Ärzte versuchten es unter anderem mit Antidepressiva, Antikonvulsiva, Antipsychotika und Lithium, aber alles ohne Erfolg.
Seine Eltern waren mit ihrer Weisheit am Ende. Doch weil der Vater von Lawrence, Stewart Johnson, ein aktiver, zupackender und lösungsorientierter Mann ist, setzte er sich intensiv mit den Ursachen der Erkrankung seines Sohns auseinander und las alles über Autismus, was er finden konnte. Und schon bald hatte er eine erste Idee. »Uns fiel auf, dass sich seine Krankheit in nichts auflöste, wenn er Fieber hatte. Das war jedes Mal so, ohne Ausnahme. Sobald er wegen einer Erkältung, Grippe oder Nebenhöhlenvereiterung erhöhte Temperatur hatte und Fieber bekam, hörte er auf, sich zu schlagen, wurde ruhig und war wie ausgewechselt. Wir sprachen dann mit anderen Eltern autistischer Kinder darüber, und alle berichteten dasselbe.«
War das unangemessene Verhalten ihres Sohnes vielleicht einfach gedämpft, weil er krank und lethargisch war? Einige Wissenschaftler vermuten, dass das Fieber die Erregungsleitung der Nervenzellen im Gehirn verändert, andere führen Veränderungen im Immunsystem ins Feld. Genaues weiß keiner. Doch alle, die eine Zeitlang mit Lawrence leben mussten oder ihn betreuten, sagten dasselbe: »Wir sind froh, wenn er krank ist, dann ist das Leben einfach wunderbar!« Wenn das Fieber zurückging, kehrte sein furchterregendes Verhalten allerdings zurück. Im Jahr 2005, Lawrence war inzwischen fünfzehn, mussten sich Stewart Johnson und seine Frau eingestehen, dass es so nicht mehr weitergehen konnte. Während Laurence in einem speziellen Sommercamp war, stellten sie schweren Herzens einen Antrag auf lebenslange Betreuung für ihren Sohn. »Lawrence sollte gehen, und jemand anders sollte sich um das Problem kümmern. Wir wollten nicht, dass er unsere Familie zerstört.«
Doch genau in dem Moment, als Lawrence’ triste Zukunft beschlossene Sache war, erhielten seine Eltern einen Anruf vom Sommercamp. Sie befürchteten schon das Schlimmste. »Doch sie sagten: ›Wir wissen nicht, was los ist, aber Lawrence verhält sich völlig normal. Es geht ihm gut, er flippt nicht aus, schlägt sich nicht, wirft nicht mit Essen um sich, nimmt an allen Aktivitäten teil und kommuniziert.‹«
Stewart Johnson fuhr zu dem Camp und traf dort einen vollkommen ruhigen Sohn an, der mit anderen Jugendlichen Spaß hatte und sich freute, ihn zu sehen. Sie setzten sich ins Auto, fuhren die zwei Stunden bis nach Hause, und plötzlich sagte Lawrence, er wolle irgendwo essen gehen. Er war seit zwei oder drei Jahren in keinem Restaurant mehr gewesen. »Und jetzt wollte er in ein lautes, überfülltes Lokal, um das wir seit Jahren einen Riesenbogen machten. Sonst konnte er nie anstehen, aber jetzt wartete er eine Dreiviertelstunde, dann wurden wir endlich bedient, aßen, und es wurde ein wundervoller Abend.
Stewart Johnson fuhr die Familie nach Hause, sein Kopf schwirrte. Als er Lawrence später half, sich bettfertig zu machen, sah er, dass sein Sohn an den Beinen, von der Hüfte bis zu den Knöcheln, mit Sandflohbissen übersät war. In Amerika ist der Sandfloh, ein Parasit, im Sommer weit verbreitet, und Lawrence hatte sich die Bisse im hohen Gras des Sommercamps zugezogen. Doch welche Verbindung konnte zwischen den Sandflohbissen und dem völligen Abklingen der Autismussymptome bei Lawrence bestehen?
Stewart Johnson konsultierte die einschlägige Literatur und erfuhr, dass Sandflöhe eine sehr starke Immunabwehr hervorrufen. Die Sandflöhe bohren sich in die Haut des Wirts und sondern zur Verdauung von Wirtsgewebe Speichel ab. Dann lassen sie sich abfallen und hinterlassen eine Stelle mit hartem Narbengewebe, die tagelang juckt, bis die Immunreaktion schließlich nachlässt. Zehn Tage lang, solange Lawrence’ Immunsystem die Sandflohbisse und nicht ihn selbst bekämpfte, hatte die Familie eine wunderbare Zeit, doch als die Bisse abklangen und das Jucken aufhörte, verhielt sich Lawrence wieder so gewalttätig und selbstzerstörerisch wie zuvor.
»Ich habe sofort gesagt: ›Das ist es. Das sieht man doch. Das könnte die Lösung sein. Die Symptome, die mein Sohn zeigt, sind zumindest teilweise eine abnormale Immunreaktion.‹«
Stewart Johnson wusste, dass der Arzt seines Sohns, der Autismusexperte Eric Hollander vom Albert Einstein College of Medicine in New York, in seinen Arbeiten zeigen konnte, dass die Verwandten ersten Grades von autistischen Kindern neunmal häufiger an Autoimmunerkrankungen litten als Verwandte gesunder Kinder. Und Lawrence leidet an einer Erdnussallergie, sein Vater an Myasthenia gravis, einer Autoimmunstörung, die zu Müdigkeit und Muskelschwäche führt, und seine Mutter an Asthma. Die Krankengeschichte seiner Familie passte zu den Forschungen, die einen Zusammenhang zwischen Autismus, Autoimmunität und Allergien herstellen. Schon 1971 hatten Forscher von der Johns Hopkins University über eine Familie berichtet, bei deren jüngstem Sohn eine multiple Autismuserkrankung diagnostiziert wurde: Morbus Addison, eine Autoimmunerkrankung der Nebennieren, und Candidose, eine opportunistische Infektion mit dem Hefepilz Candida albicans. Sein älterer Bruder litt an Hypoparathyreoidismus, der durch das Autoimmunsystem hervorgerufen werden kann, Candidose und Typ-1-Diabetes, und der nächstältere wiederum an Hypoparathyreoidismus, Morbus Addison, Candidose und Alopecia totalis, einer Autoimmunerkrankung, bei der sämtliche Kopfhaare ausfallen. Der älteste Sohn war dagegen wie seine Eltern symptomfrei. Die Autoren kamen zu dem Schluss, dass man zwar die traumatische familiäre Krankheitsgeschichte als Autismusursache nicht ausschließen könne, die Ursache aber ebenso eine »Beeinträchtigung des Autoimmunsystems durch Autoantikörper [sein könne], die auf das zentrale Nervensystem einwirken«.
Im Jahr 2003 berichtete Thayne Sweeton von der Indiana School of Medicine darüber, dass Autoimmunerkrankungen in Familien mit autistischen Kindern prozentual sogar häufiger seien als bei Angehörigen von Kindern mit Autoimmunkrankheiten. Zu den Erkrankungen gehörten dabei Schilddrüsenunterfunktion, Hashimoto-Thyreoiditis, bei der die Schilddrüse von Autoantikörpern und Immunzellen angegriffen wird, sowie rheumatisches Fieber. Wie Sweeton weiter schrieb, lasse das verstärkte Auftreten von Autoimmunerkrankungen bei Großmüttern, Onkeln, Müttern und Brüdern autistischer Kinder vermuten, »dass die Anfälligkeit für Autoimmunkrankheiten in Familien mit Autisten von der Mutter an den Sohn weitergegeben wird«. Und Sweeton nahm auch an, dass für einige biochemische Anomalien bei Autisten – wie hoher Harnsäurespiegel und Eisenmangelanämie, die auch bei Autoimmunstörungen auftreten – eine Autoimmunität oder chronische Aktivierung des Immunsystems verantwortlich sein könne. Studien an dänischen Kindern, die zwischen 1993 und 2004 von Hjördis Atladóttir durchgeführt wurden, bestätigten Sweetons Ergebnisse: Mütter, die an Zöliakie (Glutenunverträglichkeit) litten, hatten prozentual häufiger autistische Kinder. Die Studie wies zudem einen Zusammenhang zwischen Autismus und familiärem Typ-1-Diabetes sowie Kindern nach, deren Mütter an rheumatischer Arthritis litten.
Sandflöhe, Abklingen des Autismus und Autoimmunität – das alles ließ in Stewart Johnsons kriminalistischem Kopf nur einen Schluss zu. Wenn die Ursache des Autismus bei seinem Sohn Immunstörungen – ein hyperaktives Immunsystem – waren, dann brauchte er etwas, was das Immunsystem seines Sohns dämpfte. Bei seinen Nachforschungen stieß er auf die Arbeit von Joel Weinstock, David Elliott und ihrem Team, damals noch an der University of Iowa. Die Gruppe um Weinstock berichtete über einen erfolgreichen Versuch, eine kleine Patientengruppe, die an Morbus Crohn litt, einer entzündlichen Autoimmunerkrankung des Darms, mit den Eiern des Darmparasiten Schweinepeitschenwurm zu behandeln. Die Forscher verabreichten 29 Patienten 2500 lebende Peitschenwurmeier (Trichuris suis), die sie 24 Wochen lang alle drei Wochen über einen Schlauch in den Magen der Patienten beförderten. Am Ende der Behandlungsperiode hatten 79 Prozent der Patienten eine aufsehenerregende Reaktion gezeigt: Die Peitschenwurmeier hatten den Morbus Crohn zurückgedrängt.
»Ich war beeindruckt«, sagt Johnson. »Das waren echte Wissenschaftler, die echte Studien durchführten und Erfolge nachweisen konnten, das war keine Esoterik. Bei Morbus Crohn schien es zu funktionieren, dachte ich, also liege ich wohl richtig. Ich schrieb alle Informationen, die ich hatte, zusammen, fertigte einen Miniforschungsbericht mit Literaturhinweisen an und überreichte ihn Eric Hollander.«
Hollander war beeindruckt. »Stewart ist ein intelligenter Typ, und er war der Sache wirklich intensiv und umfassend nachgegangen. Er präsentierte mir die Literatur, und wir sprachen sie durch. Die These schien mir plausibel und einen Versuch wert.«
Hollander erhielt die notwendige Erlaubnis, um die Behandlung durchzuführen, und half Johnson, die Peitschenwurmeier aus Deutschland einzuführen. Sie begannen zunächst, aus Angst vor Nebenwirkungen, mit einer niedrigen Dosis. Stewart Johnson nahm die Eier übrigens auch selbst: Er wollte seinem Sohn keine scheinbar groteske Behandlung aufzwingen, zu der er selbst nicht bereit wäre. Die ersten Ergebnisse waren äußerst enttäuschend. Während des 24-wöchigen Behandlungszeitraums war der »gute« Lawrence nur an vier nicht aufeinanderfolgenden Tagen zu sehen. Johnson rief den Hersteller an, und man sagte ihm, die Ergebnisse ließen erkennen, dass der Patient auf die Behandlung anspreche und sich bei höheren Dosierungen eine stärkere Wirkung zeigen werde. Die Männer erhöhten die Dosis auf jene, die Weinstock seinen Morbus-Crohn-Patienten verabreicht hatte – auf 2500 Eier pro Behandlung. Lawrence’ Symptome lösten sich innerhalb einer Woche in Luft auf – und sind bisher nicht wiedergekommen. Nur viermal ist der alte Lawrence kurz zurückgekehrt, als Johnson und Hollander die Behandlung versuchsweise ein paar Tage aussetzten. Solange Lawrence die Eier nimmt, so scheint es bislang, wird sein Autismus in Schach gehalten.
Stewart Johnson ist der Hygienetheorie auf die Spur gekommen. Sie sieht einen Zusammenhang zwischen den Bakterien, Pilzen und Helminthen (Wurmparasiten), die in unserem Darm, auf unserer Haut, in unseren Atemwegen und der Vagina leben, und den heutigen Autoimmunerkrankungen und Allergien. Es mehren sich die Hinweise darauf, dass uns die Gesamtheit all jener Organismen, die auf und in uns leben, »Mikrobiota« genannt, vor einer stattlichen Anzahl an Autoimmunerkrankungen schützen kann, etwa chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, Typ-1-Diabetes, rheumatoider Arthritis oder multipler Sklerose und, wie wir gesehen haben, sogar vor psychischen Erkrankungen. Manche Studien legen zudem nahe, dass sie uns vor einer ähnlich großen Zahl atopischer und allergischer Erkrankungen wie Ekzemen, Nahrungsmittel-, Pollen- und Tierallergien, Heuschnupfen, Nasenschleimhautentzündung und Asthma bewahren können. Allerdings kann man es nicht oft genug betonen: Autismus ist eine komplexe, multifaktorielle Erkrankung, und die therapeutische Anwendung der wissenschaftlichen Ergebnisse, die im Zusammenhang mit der Hygienetheorie für verschiedene Autoimmunerkrankungen und Allergien belegbar sind, steckt bislang noch in den Kinderschuhen und ist weitgehend unerprobt. So ist die Behandlung von Lawrence Johnson beispielsweise ein einmaliges Experiment und keine medikamentöse Behandlung, die in klinischen Studien umfassend getestet wurde. Dennoch sind die Forschungsergebnisse beeindruckend, und sollten sich daraus medizinische Therapien entwickeln lassen, stünden wir in einigen Jahren vor nichts weniger als einer medizinischen Revolution.
Die entscheidenden Verbesserungen bei Hygiene, sanitären Anlagen und Wasserqualität seit dem späten 19. Jahrhundert, aber auch der umfangreiche Einsatz von Antibiotika und die Durchimpfung der Bevölkerung haben die Lebensqualität und Lebenserwartung in der entwickelten Welt erheblich gesteigert. In den postindustriellen Gesellschaften sind Polio, Keuchhusten, Ruhr, Masern und andere einst häufige potenziell tödliche oder schwächende Krankheiten heute weitgehend ausgerottet, doch überraschenderweise breiten sich nun neue Autoimmunerkrankungen und Allergien epidemieartig aus. Nehmen wir beispielsweise Darmerkrankungen. Den Studien von Joel Weinstock zufolge waren chronisch entzündliche Darmerkrankungen (CED) bis zum 20. Jahrhundert weitgehend unbekannt. Von 1884 bis 1909 zählten die Krankenhäuser in London durchschnittlich höchstens zwei Fälle von Colitis ulcerosa im Jahr, und Morbus Crohn wurde 1932 überhaupt zum ersten Mal diagnostiziert. Erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts nahmen Verbreitung und Häufigkeit von CED zu. Derzeit sind in den USA 1 bis 1,7 Millionen Menschen an CED erkrankt, und in Westeuropa schätzungsweise 2,2 Millionen. Anders als angenommen, hat sich die Zahl der Morbus-Crohn-Fälle auch nicht stabilisiert, sondern nimmt in England, Frankreich und Schweden weiter zu. In Osteuropa, Asien, Afrika und Südamerika sind chronisch entzündliche Darmerkrankungen dagegen weniger häufig. In dem Maße, wie sich diese Regionen sozioökonomisch weiterentwickeln, steigen die Erkrankungszahlen allerdings auch dort. Zudem haben Kinder von Personen, die aus einem Land mit niedrigen CED-Zahlen in ein Land mit hohen CED-Zahlen umziehen, ein erhöhtes Risiko, eine chronisch entzündliche Darmerkrankung zu entwickeln.
Der Mensch erkrankt zwar schon seit Jahrhunderten an Typ-1-Diabetes, aber auch hier steigen die Fallzahlen – und zwar so schnell, dass genetische Veränderungen keine Rolle spielen können. Und der Zusammenhang zwischen Wohlstand, Hygiene, westlichem Land und zunehmenden Autoimmunerkrankungen lässt sich auch für multiple Sklerose (MS) herstellen: Südlich des Äquators tritt die Erkrankung selten auf, aber die Fälle nehmen zu, je weiter nördlich eine Region vom Äquator liegt. In den USA ist die Erkrankung nördlich von Breitengrad 37 doppelt so häufig wie südlich davon. Infektionserreger, Erbanlagen und Vitamin-D-Spiegel mögen dabei eine Rolle spielen, aber dennoch bleibt die Tatsache, dass erwachsene Migranten, die von Europa nach Südafrika auswandern, ein dreimal so hohes MS-Risiko haben wie diejenigen, die mit fünfzehn Jahren und jünger nach Südafrika einwandern. Das legt die Vermutung nahe, dass es im Aufnahmeland schützende Umweltfaktoren gibt, die nur in der Jugend wirken. Und die gegenteilige Beobachtung lässt sich unter den Kindern von Migranten machen, die aus Indien, Afrika und der Karibik, wo die Zahl der MS-Fälle gering ist, nach Großbritannien einwandern: Sie haben ein höheres MS-Risiko als ihre Eltern, aber ein ähnlich hohes wie Kinder, die in Großbritannien geboren wurden.
Wie Jorge Correale, Neurologe in Buenos Aires, verdeutlicht, nimmt MS in allen entwickelten Ländern stetig zu. In Deutschland, so Correale, haben sich die MS-Fälle von 1969 bis 1986 verdoppelt, und in Mexiko tritt MS heute sogar 29-mal so häufig auf wie noch 1970 – gleichzeitig habe sich der Lebensstandard dort stetig verbessert. Correale hat zudem ein hochinteressantes, umgekehrt proportionales Verhältnis beobachtet, das zwischen MS und der Verbreitung eines gewöhnlichen Darmparasiten, des Peitschenwurms Trichuris trichiura, besteht – der Peitschenwurm war in den südlichen USA einst weit verbreitet und tritt in Entwicklungsländern auch heute noch oft auf. Die MS-Häufigkeit, so Correale, nimmt stark ab, wenn eine kritische Schwelle erreicht ist und 10 Prozent der Bevölkerung mit dem Wurm infiziert sind. Aber auch weit verbreitete atopische Erkrankungen wie Ekzeme und Asthma sind in Entwicklungsländern relativ selten, während Infektionen mit Helminthen dort relativ hoch sind.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: