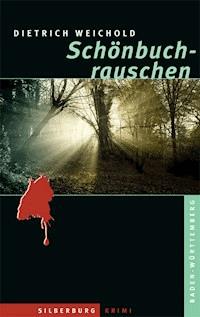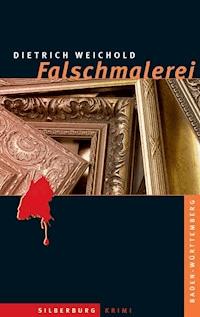Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Silberburg-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Schloss Hohenentringen, 1428. Als Georg von Ehingen hier geboren wird, ahnt niemand, dass er mit seinen Taten in die Geschichte eingehen wird. In Innsbruck, Freiburg und Rottenburg durchlebt er die harte Erziehung zum Ritter. Das hohe Ideal des Ritters als Beschützer der Christenheit im Kampf gegen die "Ungläubigen" wird von nun an zu seinem Lebensziel. Deshalb begibt er sich auf Reisen und lernt zunächst an den europäischen Höfen die Bräuche und Vergnügungen des Adels kennen, Musik, Tanz und neueste Kleidermoden, die beliebte Beizjagd mit Falken und auch die erotischen Avancen mancher Hofdamen. Doch das ist nicht seine Welt – ihn zieht es hinaus, um sich in mutigen Kämpfen zu beweisen. Bei der Verteidigung der Insel Rhodos gegen türkische Angriffe spielt Georg eine wichtige Rolle. Er unternimmt gefährliche Seefahrten und eine abenteuerliche Pilgerreise ins Heilige Land, wo er von Wegelagerern entführt wird. Seinem Lebensziel kommt er näher, als er am Kriegszug gegen Granada teilnimmt, die letzte maurische Bastion auf der iberischen Halbinsel. Der Höhepunkt von Georgs Ritterdasein ist schließlich der riskante Zweikampf um Ceuta – sein Sieg über einen heidnischen Kontrahenten entscheidet die Schlacht zugunsten von Portugal, wodurch die Stadt bis heute ein europäischer Brückenkopf an der nordafrikanischen Küste geblieben ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 661
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dietrich Weichold
Der Flug des Jagdfalken
Historischer Roman
Dietrich Weichold, geboren und aufgewachsen in Herrenberg, studierte in Tübingen Germanistik und Anglistik. Er unterrichtete Deutsch, Englisch und Spanisch an Gymnasien in Tübingen und Rottenburg und lehrte fünf Jahre an der Deutschen Schule in Madrid. Seit seiner Pensionierung hat er zahlreiche Bücher veröffentlicht, darunter mehrere Regionalkrimis. Er lebt mit seiner Frau in Ammerbuch-Entringen und hat von dort eine gute Sicht auf Schloss Hohenentringen, die Geburtsstätte des Georg von Ehingen.
1. Auflage 2017
© 2017 by Silberburg-Verlag GmbH,Schönbuchstraße 48, D-72074 Tübingen.Alle Rechte vorbehalten.Umschlaggestaltung: Anette Wenzel, Tübingen,unter Verwendung des Gemäldes»Bildnis eines Herrn Rehlinger«, 1540, voneinem unbekannten Augsburger Meister.Bild Seite 10/11: Wandgemäldeauf der Burg Hohenentringen.Lektorat: Gertrud Menczel, Böblingen.Druck: Gulde-Druck, Tübingen.Printed in Germany.
E-Book im EPUB-Format: ISBN 978-3-8425-1774-5E-Book im PDF-Format: ISBN 978-3-8425-1775-2Gedrucktes Buch: ISBN 978-3-8425-2052-3
Besuchen Sie uns im Internetund entdecken Sie die Vielfaltunseres Verlagsprogramms:www.silberburg.de
Inhalt
Vorwort
I.Hohenentringen 1434–1435
II.Innsbruck 1435–1451
III.In den österreichischen Vorlanden 1451–1452
IV.Prag 1453
V.Rhodos und Palästina 1454–1455
VI.Frankreich, Spanien, Portugal 1455–1456
VII.Ceuta 1456
VIII.Andalusien und das Emirat Granada 1457
Nachwort
1. Reise
2. Reise
Danksagung
Ich zôch mir einen valken mêre danne ein jâr.dô ich in gezamete, als ich in wolte hân,und ich im sîn gevidere mit golde wol bewant,er huop sich ûf vil hôhe und floug in anderiu lant.(Der von Kürenberg, »Falkenlied«)
Vorwort
Hoch an der Wand des Schlosses in Hohenentringen, im großen Saal des Restaurants, kann der Gast die Wappen von fünf Familien betrachten, die, wie man darunter lesen kann, 1417 mit hundert Kindern das Schloss bewohnt haben sollen. Obwohl es die fünf Familien mit ihren vielen Kindern tatsächlich gab, handelt es sich dabei um eine romantische Legende. Denn 1417 waren noch lange nicht alle dieser hundert Kinder geboren, sondern dürften erst in den nächsten fünfundzwanzig Jahren nach und nach auf die Welt gekommen sein. Die fünfte der Familien, welcher Georg von Ehingen entstammt, von dem hier erzählt werden soll, wurde zum Beispiel im Jahr 1417 erst gegründet.
Alle fünf Familien sind längst ausgestorben, vier von ihnen sind im Lauf der Geschichte völlig vergessen worden, weil sie keine interessanten Spuren in der Weltgeschichte hinterlassen haben.
Doch mit den Ehingern verhält es sich anders. Vom Leben Rudolfs von Ehingen ist sehr viel überliefert, auch von den vier Söhnen, die das Erwachsenenalter erreicht haben, vor allem von seinem Jüngsten, Georg, genannt Jörg, der 1428 auf Hohenentringen geboren wurde, 1508 in Kilchberg starb und dessen Bildnis in einem Fenster der Tübinger Stiftskirche zu bewundern ist. Nach seinen Reisen als Ritter diente er Graf Eberhard im Bart, indem er tatkräftig bei der Gründung der Universität Tübingen mitgewirkt hat.
Sein Vater, Rudolf von Ehingen (1377–1467), verbrachte seine jungen Jahre an Fürstenhöfen in Österreich und Ungarn, bei den Grafen von Zilly und König Sigismund (1368–1437). Mit vierzig Jahren war er bereits ein verdienter Beamter und Diplomat, war schon zu Wohlstand gekommen und wäre sicher auch noch länger in österreichisch-ungarischen Diensten geblieben, hätte er nicht von seinem älteren Vetter Hug ein verlockendes Angebot bekommen. Neben vier anderen Familien lebte dieser Hug mit seiner Frau auf Hohenentringen und blieb kinderlos. Da Hug vermeiden wollte, dass sein Besitz nach seinem Tod unter den anderen Familien verteilt würde, wie es dem damaligen Brauch entsprochen hätte, sondern ihn den Ehingern erhalten wollte, ließ er seinen Vetter Rudolf wissen, dass er vorhabe, ihm seinen Anteil an Hohenentringen zu überlassen, ein großes Gut, das jedes Jahr eine beträchtliche Summe einbrachte. Aber nicht einfach so! Diese Schenkung war an die Bedingung geknüpft, dass er sich dort niederlassen und heiraten würde. Hug hatte für seinen Vetter bereits drei mögliche Bräute ausgesucht, adlige Jungfrauen, alle drei Töchter eines Herrn von Waldeck, der Truchsess am Hof der Heimerdinger in Ditzingen war. Von denen hatte er sich eine auszusuchen.
Rudolf, der mit seinen fast dreißig Jahren viel von der Welt gesehen und wohl auch mit Frauen erlebt haben mochte, ging auf diesen Handel sofort ein. Er kehrte mit einem beträchtlichen Vermögen nach Württemberg zurück und heiratete Agnes von Waldeck, die nicht nur höfische Bildung hatte, sondern seinem Vermögen auch eine ansehnliche Mitgift beisteuerte. Die Hochzeit wurde 1417 gefeiert. Im selben Jahr starb Hug von Ehingen und vermachte Rudolf auch noch seine übrigen Güter.
Weiteren Zuwachs bekam Rudolfs Vermögen wenige Jahre später, als sein Onkel Wolf von Ehingen starb und ihm Hab und Gut hinterließ. (Wolf von Ehingen war ebenfalls in österreichischen Diensten zu Ehren und Reichtum gekommen. Dass er im Stephansdom in Wien begraben liegt, zeugt davon, dass er eine sehr hohe Wertschätzung genoss.)
Rudolf war aber nicht nur ein vom Glück begünstigter Erbe, sondern wusste seine Güter auch klug zu mehren. Trotzdem lebte er verhältnismäßig bescheiden und gab sein Geld häufig für wohltätige Zwecke aus. Ein Beispiel dafür ist der Bau der Pfarrkirche in Entringen. 1452 ließ er die alte Kirche, die zu klein und baufällig geworden war, abreißen und eine neue erbauen, die bis auf eine zwischenzeitliche Erneuerung des Turmhelms ihre Form bis heute bewahrt hat.
Als Ratgeber des Pfalzgrafen Ludwig, der im Uracher Schloss saß, war er ständig im ganzen Land unterwegs, bekam 1455 die Vormundschaft über den jungen Grafen Eberhard übertragen und war, bis er sich aus dem öffentlichen Leben zurückzog, um sich um sein Seelenheil zu kümmern, ein geschätzter Diener Württembergs.
Hier soll die Geschichte seines jüngsten Sohnes, Georgs von Ehingen (1428–1508), erzählt werden, der im Alter eine biografische Schrift verfasste mit dem Titel: »Reisen nach der Ritterschaft«.
»Ich Jörg von Ehingen, Ritter, bin in meiner jugend geschickt worden, als ain knab, an hoff gen Yszbruck. Da zuo mal hielte hoff da selbst ain junger fürst von Österrych, hertzog Sigmunt genant; hett ain künigin von Schotland zuo ellichem gemahel. Also ward ich geordnet, der künigin zu dienen.«
(Ich Jörg von Ehingen, Ritter, bin in meiner Jugend als Knabe an den Hof nach Innsbruck geschickt worden. Damals hielt ein junger österreichischer Fürst, Herzog Sigismund genannt, dort Hof. Er hatte eine Königin von Schottland zur Gemahlin. Und so wurde mir aufgetragen, der Königin zu dienen.)
So beginnt sein Bericht.
Seine Kindheit und Jugend sparte er aus. Da er aber zum Ritter erzogen wurde, kann man mit Sicherheit annehmen, dass er schon mit sieben Jahren nach Innsbruck geschickt wurde. Über seine ersten Lebensjahre gibt es von ihm nichts zu lesen. Aber manches lässt sich aus der Lokalität, der Kultur und den Sitten jener Zeit erschließen, sodass sich doch ein Bild von seiner Kindheit und Jugend zeichnen lässt.
I.
Hohenentringen 1434–1435
Am Berg unter Hohenentringen, der wie ein Sporn aus dem Schönbuchtrauf nach Westen ragt, wird mit Äxten und Sägen gearbeitet. Die Axtschläge hallen durch den frühen Oktobermorgen. In rhythmischem Hin und Her frisst sich eine Säge durch harte Buchenstämme. Dann und wann erschallt ein Warnruf, bevor ein Baum fällt. Mit dumpfem Aufprall trifft der Stamm den Boden, der Baum rutscht ein paar Meter den Steilhang hinab, bis sich seine Krone im Buschwerk verfängt.
Die Bauern kennen die Gefahr. Vorsichtig treten sie heran, hacken die dünnen Äste ab und ziehen sie auf die Seite, ehe sie die starke Krone zersägen.
Brennholz für die fünf Burgherren. Oben im Wald wäre das leichter zu schlagen. Doch der Berg soll gerodet werden, blank und trotzig soll er wieder aussehen wie in alten Zeiten. Brennholz schlagen und gleichzeitig die Wehrhaftigkeit des Schlosses verbessern. Die Männer sehen diese Erschwernis ihrer Arbeit nicht ein. Hohenentringen ist noch nie eingenommen worden, schon lange hat es in der näheren Umgebung keinen Krieg mehr gegeben, es scheint Frieden im Land zu herrschen, und sollten doch einmal Feinde anrücken, würden sie das Schloss niemals von unten angreifen. Dazu ist der Berg viel zu steil. Denkbar wäre ein Angriff allenfalls von den Feldern her, die auf der Höhe hinter der Burg liegen. Dort könnte man ein ganzes Heer aufstellen.
Hohenentringen ist schon lang nicht mehr die wehrhafte Burg vergangener Jahrhunderte, trotz Halsgraben und Zugbrücke. Feindlichen Kanonen, wie sie immer mehr eingesetzt werden, würde der Torturm keine Stunde standhalten. Und so hat sich, was den Menschen im Tal noch als Burg erscheinen mag, längst zu einem großen Anwesen gewandelt, das sich von einem großen Bauernhof nur dadurch unterscheidet, dass die Insassen ihre Felder nicht selbst bestellen. Das macht die Dienstbarkeit, die fronpflichtigen Bauern des Dorfs.
Als Festung ist Hohenentringen so unnütz wie die Burg Müneck über dem Nachbardorf Breitenholz, die schon lange aufgegeben wurde und als Steinbruch dient.
Warum also den Hang roden? Wenn es die Herren selbst machen müssten, würden sie es sicher bleiben lassen. Die paar Bauern, die sich am Hang abplagen müssen, sehen den einzigen Lichtblick bei ihrer Fron darin, dass sie das Holz nicht weit transportieren müssen. Es hinaufzuschaffen ist zwar eine Schinderei. Aber das sind sie gewohnt, denn die Hänge des Schönbuchs sind überall steil. Und wenn sie angewiesen werden, das Brennholz für die Burg in abgelegenen Waldstücken zu schlagen, kostet es sie oft mehrere Tage. Dann frisst schon der Weg viel kostbare Zeit, in der sie sich lieber auf ihren Feldern um ihr Auskommen kümmern würden. Dem Anschein nach tun sie nun zwar geduldig, was man ihnen befohlen hat, aber sie murren.
Der Älteste von ihnen, ein hagerer Mann Mitte dreißig, richtet sich stöhnend auf und legt einen Handrücken auf sein schmerzendes Kreuz, während er sich mit der anderen auf den Stiel seiner Axt stützt. Dabei schaut er auf das Dorf hinunter, von dem sie kurz vor Sonnenaufgang heraufgekommen sind. Der spitze Helm des Kirchturms ragt aus dem Nebel, die Häuser oberhalb der Kirche kann man erahnen, sonst liegt das ganze Tal noch unter einer dichten grauen Decke.
Er steht am Rand der gerodeten Fläche, wo sie als Erstes ein paar Haselnuss- und Holunderbüsche umgesägt haben. Auf einmal sieht er ein Kind neben sich, einen schlanken Jungen von fünf, sechs Jahren, braune Augen, honigblondes gewelltes Haar. Der Junge schaut ihm ins Gesicht, dann auf die Axt und den umgelegten Haselnussstrauch. Dann sieht er ihn wieder an, als wollte er etwas fragen und traute sich nicht.
»Was willst du?«
»Einen Stecken«, sagt der Junge und zeigt mit ausgebreiteten Armen an, wie lang er sein soll. Ohne etwas zu sagen, hackt der Bauer einen daumenstarken Haselnussstock ab und reicht ihn ihm.
»Noch einen, aber bloß so«, sagte der Junge und deutet an, dass diesmal ein zwei Spannen langes Stück genügt. Als er auch das bekommen hat, dreht er sich wortlos um und macht sich daran, den Berg hochzusteigen. Mit kaltem Blick schaut ihm der Bauer nach und ruft schließlich: »Wie heißt du?«
»Jörg.«
»Und weiter?«
»Von Ehingen.«
»Saudummes Geschwätz. Wo bist du auf die Welt gekommen?«
»Auf Hohenentringen.«
»Und wo wohnst du?«
»Auf Hohenentringen.«
»Na, also: Jörg von Entringen, würd ich sagen.«
Als der Junge außer Hörweite ist, meint einer der anderen Männer: »Hast du ein freches Maul! Hoffentlich sagt er das nicht seinem Vater.«
Gleichgültiges Achselzucken. »Glaub ich nicht. Ob er den in dem Gewusel dort oben überhaupt finden würde?«
»Wenn der überhaupt daheim ist. Er reitet doch die ganze Zeit im Land herum, sagen sie.«
»Er wär ja auch blöd, wenn er’s nicht tät. Wenn ich der Ehinger wär, würd ich auch lieber für den Pfalzgrafen von Schloss zu Schloss reiten, als dort oben im Dreck rumhocken.«
»Und der tut das nicht um Gottes Lohn. Herumreiten und dafür auch noch Geld einstreichen, das tät ich auch gern.«
Der andere brummt zustimmend. Dann arbeiten sie schweigend weiter, bis der Älteste seine Axt in einen Stamm schlägt und sie dort stecken lässt. Das Signal zum Vesper.
Fünf Bauern sitzen nebeneinander auf einem Baumstamm. Jeder isst ein großes Stück trockenes Roggenbrot und ein kleines Scheibchen Speck. Dazu trinken sie stark verwässerten Apfelmost.
»Wie viele sind’s jetzt dort oben?«, nimmt einer das Gespräch wieder auf.
»Das weiß doch niemand. Am End wissen’s die selber nicht. Wer soll das auch wissen!«
»Der Pfarrer vielleicht. Der kann sie doch in der Kirche zählen.«
»Aber die kommen doch nie alle. Die sind auch manchmal krank. Wenigstens da geht’s denen nicht besser als uns.«
»Oder liegen im Kindbett.«
»Vor zwei Jahren habe ich mit einem von den Knechten geredet, als wir den Weg zum Schloss hinauf richten mussten. Der hat was von ungefähr fünfzig Kindern gesagt. Aber ob die alle noch leben? Dort oben stirbt es sich doch genauso wie bei uns im Dorf. Ein kalter Winter, und es fehlen wieder ein paar.«
Schweigen. Jeder denkt an den vergangenen kalten, entbehrungsreichen Winter und hofft, dass der kommende milder sein möge.
»Würd’s euch dort oben gefallen?«
Die einen zucken resigniert mit den Achseln, die andern nicken.
»Schon«, sagt einer laut. »Aber nicht mit vier anderen Familien zusammen.«
Zustimmendes Nicken.
»Ich glaube, der Ehinger macht’s schon richtig, wenn er für den Pfalzgrafen in der Weltgeschichte herumreitet.«
»Ja. Aber ich möcht mal wissen, was er da so treibt.«
»Geschäfte der Herren halt.«
»Und er muss auch noch nach seinen Gütern schauen. Der hat ja noch viel mehr als das Bisschen hier.«
»Das Bisschen! Ich wollt’, ich hätt’ die Hälfte von seinem Anteil dort oben. Das wär ein schöneres Leben.«
Dann arbeiten sie weiter. Eine junge Buche um die andere fällt, Haselnuss- und Holunderbüsche werden umgesägt, bis die gerodete Fläche so groß ist, dass man sie meilenweit erkennen kann. An einem Tag werden sie nicht den ganzen Steilhang schaffen, nicht einmal in einer Woche. Aber sie beginnen am Spätvormittag damit, einen Teil des geschlagenen Holzes den Berg hochzuziehen.
»Was oben ist, ist oben. Dann sehen sie schon einmal, was wir schaffen, und wir haben drunten im Dorf Ruhe vor ihnen. Es langt ja schon, wenn man wegen den Herrschaften sonntags kaum in die Kirche passt.«
»Ja, ich würd auch mal gern vorn beim Altar stehen und nicht bloß unter der Tür.«
»Hm, die sind halt immer vorne dran, in diesem und im nächsten Leben.«
’s Jergle, wie er genannt wird, wird also kaum seinem Vater sofort über den Weg laufen. Und wenn, würde er ihm sicher nicht erzählen, was der Bauer zu ihm gesagt hat. Denn von den Gemeinen, den unfreien Bauern und Taglöhnern, soll er sich fernhalten und nur mit ihnen reden, wenn es unbedingt sein muss. Ein leicht zu befolgendes Gebot. Denn welchen Anlass sollte es für den Jungen schon geben?
Aber da ist noch etwas, weshalb er bei seinem Vater in Ungnade fallen könnte. Man hat den Kindern verboten, am Berg unterhalb der Mauern herumzuklettern. Dort fließt das Abwasser hinunter, die Brühe aus der Waschküche, die Jauche aus den Ställen und das, was aus dem Abort und den Nachtgeschirren über die Mauer geht. Manchmal steigt der Gestank bis in die Burg hinauf, besonders im Sommer, wenn die Sonne steil auf den Berg fällt.
Also: Wenn sein Vater trotz allem erfahren würde, dass er einen Gemeinen angebettelt hat, und auch noch dort unten, würde es eine Maulschelle geben, die sich gewaschen hat. ’s Jergle wird also den Ausflug für sich behalten wie so vieles, was er seinen Eltern und Geschwistern nicht mitteilen mag. Er sieht zu, dass er schnell wieder oben ist, ehe ihn jemand vermisst und nach ihm fragt.
Durch steiles Gelände hindurch, das noch nicht gerodet ist, gelangt er zu einem schmalen Weg, der ihn zu einem Zugang zum Schlosshof führt. Vorsichtig öffnet er das Törchen und horcht, ob die Luft rein ist. Er hat Glück. Niemand scheint in unmittelbarer Nähe zu sein, und die ganze Hundemeute, die im angrenzenden Zwinger gehalten wird, liegt an der Ostseite unter der Zugbrücke und wartet auf die Fütterung. Über ein paar Sandsteinstufen gelangt er auf die Höhe des Burghofs. Als er aber zwischen Waschhaus und Kräutergarten weitergehen will, sieht er Frau Agnes, seine Mutter, und zwei seiner Geschwister vor der Tür des Herrschaftsgebäudes stehen. Schnell duckt er sich hinter die niedrige Ummauerung des kleinen Kräutergartens und wartet, bis sie weg sind. Dann rennt er flugs in die Scheune und sucht sich einen Garbenstrick. Damit bindet er seine beiden Stöcke übers Kreuz zusammen. Zufrieden betrachtet er sein Werk und geht zum Scheunentor hinaus.
Nach ein paar Schritten sieht er sich plötzlich seiner Mutter gegenüber und erschrickt. Die ist doch gerade ins Haus gegangen? Sie merkt nicht, dass er erschrocken ist. Sie sieht nur, was er vor sich herträgt.
»Jergle, hast du ein Kreuz gemacht? Willsch nach Bebenhausen ins Kloster?«
»Nein. Das ist doch ein Schwert! Ich werd einmal ein Ritter.«
»Um Gottes willen, Bub!« Frau Agnes seufzt tief und bekreuzigt sich.
’s Jergle hat nun sein Haselnussschwert und fantasiert. Er hat im Laufschritt die Zugbrücke überquert, einen Ausfall gegen die Belagerer gemacht und will sogleich ihre Reihen lichten. Fest hat er das Heft in der Hand und lässt die Klinge durch die Luft sausen, dass es nur so pfeift. Er haut so stark ins Leere, dass sich sein ganzer Oberkörper jedem Schlag hinterherdreht. Seine Schwertstreiche brauchen Widerstand, fühlt er. Er sucht Gegner und findet sie in den Kardendisteln, die unweit der Burg mannshoch am Feldrain stehen. Mit wütenden Schlägen hin und her schlägt er ihnen die Köpfe ab und kann nicht genug kriegen. Wenn er nur weit genug ausholt und blitzschnelle Streiche führt, schneidet er glatt durch ihre Hälse, sodass ihre Rüstungen zerbersten und die Köpfe nur so durch die Luft fliegen. Er tobt sich aus. Erst an den Kardendisteln, dann an Brennnesseln. Mit tiefer angesetzten Hieben mäht er eine Schneise in die feindliche Schar der Brennnesselritter. Er vergisst alles um sich herum.
»Aha, der große Held«, hört er es plötzlich hinter sich spotten.
Mit noch erhobenem Haselnussschwert dreht er sich um. Sein älterer Bruder Wolf steht hinter ihm und grinst höhnisch. Die rechte Hand hat er hinter seinem Rücken versteckt.
»Was hast du da? Ein Schwertlein?«
’s Jergle nickt etwas verschämt.
»Dann kannst du ja mit mir fechten.«
Er zieht einen krummen Buchenast vor, so dick wie ein Handgelenk, dessen Ende gegabelt ist. Keine ritterliche Waffe!
»Das gilt nicht.«
»Was gilt oder nicht, isch dem Feind egal.«
Damit holt Wolf aus und schlägt nach seinem Bruder, den er um einen halben Kopf überragt. ’s Jergle hält dagegen. Er kann den ersten Schlag abwehren, obwohl ihm Wolf sein Schwert fast aus der Hand schlägt. Er weicht einen Schritt zurück und richtet dabei seine Schwertspitze mit ausgestrecktem Arm auf den Bauch seines Gegners. Der aber lacht nur.
»Stich doch zu, trau dich doch«, fordert er Jergle heraus.
’s Jergle sticht zu, aber ins Leere. Wolf hat einen Schritt zurück gemacht, erwischt mit seiner Gabel Jergles Schwert und drückt es nach unten. Dabei kommt er ihm näher, lässt den Buchenast los und packt ihn mit beiden Händen an der Schulter. Er stellt ihm ein Bein, sodass er strauchelt, und gibt ihm einen Stoß mit dem Knie, dass er rücklings im Brennnesselfeld landet.
»Zum Ritter langt’s nicht. Geh halt ins Kloster«, höhnt Wolf und geht weg.
Mühsam rappelt sich ’s Jergle auf. Sein Hals, seine Hände und Waden brennen, und mit jeder Bewegung, die er macht, kommt er noch mehr mit den beißenden Blättern in Berührung. Aber das muss er aushalten. Anders kommt er nicht hoch. Als er wieder auf den Beinen steht, sieht er Wolf gerade noch hinter einer Bodenwelle verschwinden.
Beim Träumen ertappt und mit einem Schlag hart in die Wirklichkeit zurückgeholt, fühlt er sich gedemütigt und schämt sich. Seine Haut brennt an den Handgelenken, am Hals, in den Kniekehlen, an den Waden. Er möchte zum nächsten Brunnen rennen. Aber da müsste er Wolf überholen. Er fürchtet sich vor seinem Spott und geht ihm nur langsam nach, bis er die Viehtränke passiert hat und über die Zugbrücke verschwunden ist. Dann erst rennt er an den Trog, hängt seine nackten Beine ins eiskalte Wasser, spritzt sich den Hals nass und reibt und reibt, bis das Brennen endlich nachlässt. Er friert. Am liebsten würde er jetzt zum Schloss zurückgehen und sich im großen Saal vor den Kamin setzen. Aber da müsste er sich durch die Kinderschar durchschlängeln, die im Schlosshof irgendwelche albernen Spiele spielt, er müsste an der alten Magd Stine vorbei, die im Freien auf ihrem Schemel Geflügel rupft oder Hasen das Fell abzieht, und auch Veit, den Pferdeknecht, den er eigentlich sehr mag, will er jetzt nicht sehen. Niemanden will er sehen. Er will nicht gefragt werden, warum er so nass ist.
So geht er eine Weile ziellos über den Weinbergen auf Schloss Roseck zu. Von Nordwesten bläst ihm ein starker Wind in den Rücken. Er fröstelt und läuft ein Stück, um warm zu werden. Dann kommt er zu dem kleinen Steinbruch, wo die Wengerter eine ganze Schicht Steine auf die Seite geräumt haben, um an die bröselige bunte Erde zu kommen, unter die sie den Dung für ihre Rebstöcke mengen. Dort bleibt er stehen. Er bückt sich nach einem Gesteinsbrocken, den er mit beiden Händen kaum umfassen kann, hebt ihn hoch über seinen Kopf und schleudert ihn über die Kante. Er schaut ihm nach, wie er ein Stück bergab rollt, dann gegen einen anderen Brocken stößt und liegen bleibt. Er schickt ihm weitere Brocken nach, und noch einen, und wieder einen. Er versucht, kleinere Steine mit einer Hand zu stoßen. Er freut sich jedes Mal, wenn ein Stein auf einen anderen trifft, ihn mit hellem Schlag zerspringen lässt oder selbst zerbricht. Er verliert sich in diesem Spiel, bis seine Kraft erlahmt und seine Arme zu schmerzen beginnen. Dann geht er zum Schloss zurück. Zwar ist er müde, aber er hat seine Kraft gespürt, er fühlt sich besser.
An der Stelle, wo Wolf ihn in die Brennnesseln gestoßen hat, findet er sein Haselnussschwert und hebt es auf. Einen Moment lang sieht er es an, als wollte er es wegwerfen, nimmt es aber dann mit und versteckt es in einem Holunderbusch bei der Viehtränke.
Inzwischen ist die Sonne untergegangen. Ein paar Atemzüge lang leuchtet noch ein roter Streifen über dem westlichen Horizont. Dann fallen Schloss und Umgebung ins Dunkel.
Das kahle Zimmer neben der Küche, in dem sie zu Abend essen, ist nur von zwei rußenden Pechfackeln beleuchtet. Durch die offene Tür kommt etwas Wärme von der Kochstelle herein. Wenn ’s Jergle es schafft, setzt er sich abends immer in die Nähe der Tür, am liebsten mit dem Rücken zu ihr, um sich vorm Schlafengehen noch ein wenig aufzuwärmen. Was aber auch Wolf stets versucht. Wer zuerst kommt, ergattert den wärmsten Platz, und der Verlierer versucht, möglichst nahe dabeizusitzen. Aber diesmal ist es anders. Als Wolf an den Tisch kommt und meint, den umkämpften Lieblingsplatz erobert zu haben, sieht er ’s Jergle am entgegengesetzten Ende des Tisches zwischen ihren älteren Brüdern Diepolt und Burckart sitzen. Im ersten Moment ist er überrascht. Dann begreift er die Lage.
»Wo hockst denn du heute?«
Übertriebenes Erstaunen tönt aus seiner Frage. ’s Jergle tut, als hätte er sie nicht gehört.
»Beißt es noch?«, stichelt Wolf weiter.
’s Jergle antwortet nicht. Er spürt, dass er rot wird. Aber so hell, dass es einer sehen würde, leuchten die zwei Fackeln glücklicherweise nicht.
»Was beißt?«, fragt Diepolt.
»Nichts«, antwortet Wolf und winkt ab.
Als alle neun Kinder am Tisch versammelt sind, fordert Mutter Agnes den ältesten Sohn auf, in Abwesenheit des Vaters das Tischgebet zu sprechen. Diepolt ist sich der Ehre bewusst und betet laut und inbrünstig. Gott, der Herr, möge die Mahlzeit segnen. Dann brechen alle ein Stück vom Roggenbrot ab und warten darauf, dass die Köchin die Hauptspeise aufträgt, auf die sich alle freuen. Man hat ein Schwein geschlachtet. Es gibt Kesselfleisch mit Sauerkraut.
Die große Schüssel macht die Runde, jeder schöpft seinen Teil heraus. Wolf schaut länger in die Schüssel als die anderen, ehe er mit seinem Holzlöffel zulangt.
»Jetzt mach doch«, drängt ihn Ludwig, der neben ihm sitzt.
»Warte doch. Ich muss aufpassen, dass ich unserem Ritter nicht das fetteste Stück wegnehme. Sonst wird nichts aus dem.«
Als Ludwig ihn fragend anschaut, zeigt er hämisch grinsend über den Tisch auf ’s Jergle.
Frau Agnes macht ein strenges Gesicht und gebietet Ruhe. Man isst schweigend.
Kaum hat ’s Jergle den Löffel gewischt, will er vom Tisch aufstehen.
»Halt«, sagt die Mutter. »Wir danken. Sprich das Gebet.«
Es bleibt ihm nichts übrig, als sich wieder zu setzen, gesenkten Haupts die Hände zu falten und in andächtigem Ton das Dankgebet zu sprechen. Anders duldet es die Mutter nicht. Aber seine Gedanken sind nicht dabei. Das Amen der Familienrunde ist noch nicht ganz verklungen, da springt er auf und verlässt den Tisch. Frau Agnes wirft einen fragenden Blick auf Wolf. Doch der rührt keine Miene.
In absoluter Dunkelheit findet ’s Jergle in die Bubenkammer, wo sich alle Brüder ein breites Lager teilen. Splitternackt schlafen sie auf einer dicken Lage Stroh, die von vernähten Leintüchern zusammengehalten wird.
Er legt alle Kleider ab und schlüpft im hintersten Winkel unter die Decke, obwohl es dort, direkt an der Wand, am kältesten ist. Es ist überall sehr kalt in der Kammer. Jetzt schon, im Oktober, sehen sie oft ihren Atem über sich stehen, wenn sie morgens aufwachen. Aber er weiß, dass Wolf lieber an der Türseite schläft, weil er jeden Morgen nach dem Aufwachen sofort aus der Kammer stürmt. Der Geruch von sechs nackten Leibern, ihre Ausdünstungen und der Gestank der Nachtgeschirre sind ihm zu viel.
’s Jergle legt sich auf den Rücken und schließt die Augen. Es ist absolut still um ihn herum. Er wartet gespannt, wer als Nächster in die Kammer kommt. Aber er nimmt es nicht mehr richtig wahr. Nach den Anstrengungen des Nachmittags und der üppigen Mahlzeit schläft er schnell ein. Er merkt nur noch, dass sein Nebenmann viel größer ist als er, weil die Decke so spannt. Das muss Diepolt sein, oder Burckart.
Gleichgültig. Zufrieden schläft er weiter.
Die Mägde, Knechte, Köchinnen und Küchenhilfen sind Jergle gleichgültig. Sie gehören einfach so zum Schloss wie das spärliche Mobiliar. Nur mit Veit, dem alten Pferdeknecht, verbindet ihn etwas. Sein Vater brachte Veit mit, als er sich auf dem Schloss niederließ, was dem Stallknecht unter dem Gesinde besonderes Ansehen verleiht. Nur er kann berichten, was »der Herr Rudolf« an vornehmen Höfen erlebt und geleistet hat, und er tut das auch gern, wenn man ihn darum bittet.
’s Jergle ist oft im Pferdestall. Er mag den Geruch und die Wärme der Tiere. Immer wieder geht er deshalb zu Veit und will ihm helfen, die Rösser zu striegeln und zu füttern. Das Striegeln geht noch nicht so gut, dazu ist ’s Jergle zu klein. Und die Pferde sind sehr groß. Vor allem das Lieblingsross seines Vaters, ein dunkelbrauner Kaltblutwallach mit breiter Brust, hat es ihm angetan. Er hat eine schwarze Mähne und einen zackigen weißen Fleck zwischen den Augen, weshalb er Stern genannt wird. Er ist so groß, dass ’s Jergle kaum seinen Rücken erreichen kann.
»Du musst fast noch ein bisschen wachsen«, sagt Veit gutmütig lächelnd und holt ihm einen Melkschemel aus dem Kuhstall.
’s Jergle stellt sich darauf und lehnt sich gegen die Flanke des Rosses. Er spürt seine Wärme und atmet seinen Geruch ein. Mit langen Strichen striegelt er seinen Rücken, bis Veit ihm sagt, dass es nun genug sei und er sich auch um Brust und Hinterteil kümmern solle. Auch das macht er gründlich und setzt sich schließlich nieder und poliert die großen Hufe, bis sie glänzen.
Das tut er immer wieder, und nicht nur an Vaters Lieblingsross. Nur Ausmisten mag er nicht. Eigentlich würde er auch das tun. Nur fürchtet er, dass Wolf ihn auslachen würde, falls er es sieht. Und Veit erwartet nicht einmal, dass der junge Herr eine Mistgabel in die Hand nimmt. Ausmisten ist Sache des Knechts.
’s Jergle begleitet Veit, als er die Pferde zur Tränke führt. »Das Wasser vom Brunnen im Hof tät nicht langen?«, will er wissen.
»Schon, aber wir müssten es heraufziehen. Viel z’ viel Gschäft.«
»Ist das wahr, dass es da einen Gang gibt?«
»Ja, so heißt es. In zwanzig Fuß Tiefe.«
»Lässt du mich mal hinunter?«
»Ja, wie denn?«
»Mit einem Seil.«
Veit schüttelt energisch den Kopf.
»Warum nicht? Bitte!«
»Was meinst du, was dein Vater sagen würde?«
»Der ist doch nicht da. Der ist schon wieder beim Pfalzgrafen.«
»Aber er würde es erfahren, bei den vielen Leuten hier. Meinst du, die würden alle ’s Maul halten? Nie und nimmer.«
Damit ist das Gespräch zunächst beendet. Die Pferde trinken und werden wieder in den Stall gebracht. Ehe ’s Jergle aus dem Stall geht, hat er aber noch eine Frage: »Und den anderen Gang. Gibt’s den auch?«
»Ins Dorf nunter?«
’s Jergle nickt und schickt hinterher: »Weißt du, wo der rauskommt?«
»In dem Haus hinter der Kirche, sagen sie.«
»Und den gibt’s wirklich?«
»Ich glaub’s fast nicht. Wo soll der auch anfangen?«
»Im Keller vielleicht.«
»Vielleicht. Ich glaub’s zwar nicht, aber ’s könnt schon sein. Wer weiß?«
Der letzte Satz klingt dem Jungen in den Ohren: Es könnte sein, dass es einen unterirdischen Gang ins Dorf hinab gibt. Den will er suchen, und den anderen, der in den Brunnenschacht führt, natürlich auch. Mit seinen Brüdern mag er nicht darüber sprechen. Die Gänge sollen sein Geheimnis sein. Aber er spricht darüber mit seinem Freund Hans von Gültlingen, der ungefähr sein Alter hat.
»Ich sag dir ein Geheimnis. Du darfst es aber niemand sagen. Niemand! Schwörst du mir das?«
Er erzählt ihm von dem Gang, der vom Brunnenschacht irgendwo in den Keller führt. Es gäbe ja niemanden, der einen in einem Korb den Brunnenschacht hinunterlassen würde, sodass man von dort aus in den Keller gehen könnte. Das sei ja viel zu gefährlich. Aber anders herum, durch den Keller zum Schacht, das müsste doch gehen. Und vielleicht würde man im Keller sogar zwei Eingänge finden. Hans ist Feuer und Flamme. »Und wenn wir den Gang gefunden haben, was dann?«
»Welchen?«
»Den ins Dorf.«
’s Jergle zuckt mit den Achseln.
»Dann erzählen wir’s allen«, sagt Hans in verfrühter Vorfreude.
Das genügt für den Moment.
Der Himmel ist grau verhangen. Schon am Nachmittag wird es dunkel im Schloss. Vor den Türen zum Saal, zur Küche und den Stuben der verschiedenen Familien stecken brennende Pechfackeln in den Halterungen. Hans nimmt eine Fackel an sich und die beiden schleichen die Treppe hinab. Sie hören Schritte und bleiben stehen. Aber es sind nur drei kleine Mädchen von den Hailfingern, die an ihnen vorbeigehen, als sei es selbstverständlich, dass zwei Jungen mit einer Fackel die Treppe hinuntersteigen. Die Buben wissen, dass der Keller nicht abgeschlossen ist. Warum sollte man ihn auch zusperren? Niemand steigt gern in das finstere Gewölbe hinab, weder die Herrschaften noch die Knechte. Und wenn die Mägde zum Wein- oder Mostholen hinuntergeschickt werden, bekreuzigen sie sich, singen fromme Lieder und rufen ihre Schutzheiligen an.
Die Türangeln quietschen. Sie öffnen die Tür nur so weit, dass sie gerade durchschlüpfen können. Als sie hinter ihnen ins Schloss fällt, stehen sie einen Moment regungslos da und lauschen. Nichts zu hören, gar nichts. Der Fackelschein bricht sich im Kellerhals, dahinter braune Dunkelheit. Zögernd steigen sie Stufe um Stufe hinunter. Die Treppe kommt ihnen endlos vor. Die Luft wird schlecht. Es riecht nach feuchtem Moder. Schließlich stehen sie im Gewölbe. Der Boden ist uneben. An den felsigen Stellen glitzert die Feuchtigkeit, daneben dunkle nasse Erde und Pfützen. Rechts und links von ihnen liegen große Wein- und Mostfässer in den Lagern. Wo soll hier ein Gang beginnen?
»Vielleicht dort«, flüstert ’s Jergle und zeigt auf die Stirnwand, die man gerade noch erahnen kann. Aber da ist nur eine Wand aus großen Steinquadern.
»Vielleicht hinter den Fässern.«
Hinter den Fässern ist nicht viel Platz, gerade genug, dass sie sich hintereinander durchzwängen können. Sie spüren, dass die feuchte Erde an ihren Schuhen klebt, und streifen mit ihren Kleidern die feuchte Mauer entlang, deren Kälte sie auf der Haut spüren. Bis zu den Knöcheln treten sie in Pfützen. Plötzlich quiekt es laut und plätschert. Ratten! Hans lässt vor Schreck die Fackel fallen, sie rollt unters Fasslager und erlischt. Noch für einen Moment hören sie die Ratten rascheln, quieken, plätschern. Dann ist es ebenso still wie dunkel. Sie hören nur ihren eigenen Atem.
»Und jetzt? Sollen wir schreien?«, fragt Hans.
»Nein. Das hört doch keiner. Gehen wir einfach rückwärts.«
Schritt für Schritt, zögerlich, finden sie langsam an die Stirnwand zurück, tasten sich an den Fasslagern entlang zur Treppe vor und steigen dann erleichtert hinauf.
Keiner von beiden redet von seiner Angst. Und schnell sind sie sich einig: Es muss eine zweite Suche stattfinden.
»Aber diesmal nehmen wir auch Kerzen mit.«
»Und jeder einen Knüppel«, sagt Hans entschieden.
»Einen Knüppel?«
»Ja, wegen den Ratten.«
Am nächsten Tag, wieder gegen Abend, als sie wieder damit rechnen können, dass niemand mehr in den Keller geht, steigen sie hinunter. Beherzt, sie sind ja bewaffnet, gehen sie vor bis an die Stirnwand des Gewölbes und drücken sich tastend hinter den Fässern an der Wand entlang bis zur Treppe. Gespannt tasten sie die Wand ab. Die Mauersteine fühlen sich alle gleich an, einer neben dem andern, es gibt keine Vertiefung, keine Nische. Aber als sie schon fast wieder an der Treppe sind, wird der Boden uneben. Es ist, als durchquerten sie einen flachen Graben von etwa zwei Schritt Breite. Der Abstand zwischen Fasslager und Wand ist aber so gering, dass sie den Boden an dieser Stelle nicht ausleuchten können.
»Von der anderen Seite.«
»Das ist das dritte Fass von vorn.«
Im Gang zwischen den Fassreihen gehen sie auf die Knie und halten ihre Fackel unter das dritte Fass.
»Schau mal. Lauter Brocken.«
Ihre Fackel wirft ein schwaches Licht in eine runde Senke, die in der Mitte mehr als einen Fuß tief ist. Sie sehen nicht gut. Die Fackel blendet sie. Um besser sehen zu können, zünden sie eine dicke Kerze an und versuchen, sie mit einem ihrer Knüppel voranzuschieben.
»Pass auf, dass sie nicht kippt.«
»Zünd die andere auch noch an.«
Deutlich erkennen sie, dass die Senke mit großen Feldsteinen angefüllt ist. Überall sonst besteht der Boden aus gestampftem Lehm oder natürlichen Steinplatten.
»Verstopft. Aber hier ging es hinein.« Darin sind sie sich einig.
»Schade. Den gibt’s nicht mehr.«
Mit dem Knüppel löschen sie die Kerzen und verlassen den Keller, einerseits enttäuscht, andererseits aber auch stolz, weil sie doch etwas herausgefunden haben.
»Aber der andere, der könnt im Torturm anfangen. Und der ist vielleicht noch offen«, sagt ’s Jergle.
Ein paar Tage später eröffnet er seinem Vater, dass er in den Torturm steigen will, der südlich an die Zugbrücke anschließt.
»Warum?«
»Wir suchen den Gang ins Dorf.«
»Und du glaubst, dass es den gibt?«
»Vielleicht.«
Herr Rudolf überlegt nicht lang. Zwar glaubt er nicht, dass es diesen Gang gibt. Er kennt schließlich die unzähligen Legenden, die von solchen Gängen erzählt werden, und weiß, dass man noch nie einen gefunden hat. Aber es gefällt ihm, dass Georg, sein Lieblingssohn, der ihm ähnelt wie kein anderer, dass dieser Junge mit seinen sechs Jahren einen solchen Gang finden will, dass er mutig genug ist, um in diesen Turm zu steigen, den seines Wissens in den letzten Jahrzehnten niemand betreten hat.
»Du ganz allein?«
»Nein. Mit’m Hans.«
»Da kann es Ratten geben.«
»Weiß ich.«
»Und Eulen, vielleicht auch Elstern und Krähen.«
»Macht nix.«
»Veit soll auf euch aufpassen.«
»Wir wollen aber alleine …«
»Schon gut. Er passt draußen auf und holt euch raus, falls ihr nicht wiederkommt.«
Veit ist zu dieser Aufgabe gerne bereit.
»’s könnt schon sein, dass es den Gang tatsächlich gibt«, sagt er in bedächtiger Einfalt.
Ohne Veits Hilfe könnten sie den Turm nicht aufschließen. Das Schloss ist eingerostet, und es kostet ein paar Hammerschläge und viel Petroleum, bis sich das Schloss bewegen lässt. Die Tür liegt fünf Stufen über dem Niveau der Zugbrücke. Das Stockwerk darüber ist ein runder Raum mit Balkenboden. Von den Schießscharten aus könnte man mit Bogen und Armbrust feindlichen Angreifern gut zusetzen. Aber es hat nie Angreifer gegeben und gibt auch jetzt keine.
Die beiden Buben steigen gerade so weit hoch, dass sie einen Blick hineinwerfen können. Es riecht scharf nach Vogelkot. Sie schrecken zwei große Vögel auf, die so schnell durch die Schießscharten ins Freie flattern, dass sie sie nicht einmal erkennen können.
»Jetzt gehen wir hinunter«, ruft ’s Jergle Veit zu.
»Ist gut. Ich warte.«
Der runden Mauer entlang führen schmale Steinstufen in die Tiefe hinab. Die Lichtstrahlen, die durch die Schießscharten hereinfallen, beleuchten nur die obere Hälfte des ersten Kellergeschosses. Wer auf den schmalen Stufen ausrutschen oder das Gleichgewicht verlieren würde, würde meterweit hinunterfallen und sich die Knochen brechen. ’s Jergle und Hans drücken sich an die Mauer und steigen hinab, indem sie vorsichtig einen Fuß vor den andern setzen. Was sie vorfinden, ist ein leerer dunkler Raum mit einem weißen Niederschlag an den Wänden. An zwei Stellen sind Eisenringe in die Mauer eingelassen, an denen noch ein paar Kettenglieder hängen.
»Da ist mal einer gelegen und verschmachtet«, bemerkt ’s Jergle. Das klingt sachlich. Dass es ihm graust wie noch nie, weiß er zu verbergen. Hans geht es wohl ebenso. Er sagt kein Wort, aber die Flamme seiner Fackel lässt erkennen, dass ihm die Hände zittern. Doch umkehren geht nicht. Jeder hält den andern für mutiger, als er selbst ist, beißt die Zähne zusammen und schließt sich dem Freund an. Sie stützen einander wie zwei Garben, die man schief aneinandergelehnt hat.
Sie müssen noch weiter hinunter, wenn sie den Anfang eines unterirdischen Gangs finden wollen. Sie steigen weiter hinab, jeder im Schutz des anderen.
Die untere Treppe ist noch schmäler. Und es ist noch dunkler als im ersten Kellergeschoss. Feuchter wird es, die Stufen immer glitschiger. Sie beleuchten jede mit ihren Fackeln, ehe sie sich ihr anvertrauen. Dreißig Stufen zählen sie, bis sie auf gestampftem Boden stehen.
Kein Loch ist im Boden, keine Lücke in der Mauer, es gibt keine Tür, keine Öffnung. Das sehen sie auf den ersten Blick.
»Wieder nix.«
»Au, guck«, sagt Hans mit Schrecken in der Stimme und zeigt auf eine flache Nische.
Von einem Eisenring in der Wand hängt eine Kette bis zum Boden. Sie endet in einer Armfessel, in der ein knöcherner Arm mit Knochenhand und ein paar Stoff- und Lederfetzen stecken. Sie halten die Luft an und starren auf den grausigen Fund. Eine Weile stehen sie stumm da.
Dann dreht sich ’s Jergle wortlos um und steigt vorsichtig wieder hinauf. Hans folgt ihm. Sie sind froh, als sich die Tür zum Torturm wieder hinter ihnen schließt.
»Lang seid ihr nicht drin gewesen«, sagt Veit etwas verwundert.
»Da war ja auch nichts.«
»Das hätte mich auch gewundert.«
Aber der grausige Fund regt ihre Fantasie an, und sie reden, wenn sie unter sich sind, ständig davon. Wer war das? Was hat der getan? Wer hat ihn dort so elend verrecken lassen? Diese Fragen lassen ihnen keine Ruhe.
Am nächsten Sonntag sitzt ’s Jergle beim Essen neben seinem Vater. Nach dem Dankgebet wird er von ihm angesprochen.
»Wart ihr jetzt schon unten im Turm?«
’s Jergle nickt. Die Brüder horchen auf.
»Und?«
»Nichts.«
»Gar nichts? Jetzt erzähl doch.«
»Kein Gang, nirgends.«
Rudolf wundert sich über die Einsilbigkeit seines Jüngsten.
»Dann war die ganze Anstrengung umsonst?«
’s Jergle nickt. Die Brüder verstehen nicht genau, worum es geht. Aber mindestens Diepolt und Burckart kennen die Legende von dem unterirdischen Gang ins Dorf. Allerdings haben sie nie danach gesucht. Ihr herablassendes Grinsen steckt auch Wolf an.
»Unser mutiger Ritter ist wegen nichts und wieder nichts im Torturm drunten gewesen?«, höhnt er.
»Und du, du hättest dich gar nicht dort hinunter getraut. Du hättest die Hose verschissen.« Dem Jergle reicht es mit den Bosheiten des Bruders.
Wolf lacht nur albern.
»Und im Keller unten waren wir auch und wissen jetzt, wo der Gang zum Brunnen war. Unter dem dritten Fass nämlich, ganz nahe bei der Treppe.«
Vater Rudolf horcht auf.
»Aber man sieht doch gar nichts.«
»Doch. Unter dem dritten Fass war ein Loch im Boden. Da haben sie einfach Steine hineingeschmissen.«
»Das ist ja vielleicht ein wichtiger Fund. Deswegen würd ich nicht im Keller rumkriechen«, sagt Wolf hämisch.
»Und außerdem haben wir noch etwas gefunden«, behauptet sich ’s Jergle darauf, »im Torturm.«
»Ja, Rattenscheiße.«
»Nein. Ein Verlies.«
Jetzt genießt ’s Jergle volle Aufmerksamkeit von allen Seiten.
»Im mittleren Stock Eisenringe in der Wand und unten im Dunklen eine Leiche.«
»Das glaubst du doch selber nicht.«
»Doch. Eine Knochenhand und ein Arm. Dort unten ist einer elend verreckt.«
»Glaubt Ihr das, Vater?«, fragt Wolf.
Rudolf macht ein ernstes Gesicht und nickt.
’s Jergle ergreift die Gelegenheit, alle seine Fragen loszuwerden.
»Vater, wer war das? Wer hat den dort eingesperrt?«
»Ich weiß es nicht. Das muss lange her sein. Es war sicher ein Feind, der gefangen genommen wurde.«
»Aber du hast doch gesagt, dass Hohenentringen nie angegriffen worden ist?«
»Schon. Aber Feinde hat es trotzdem gegeben, oder Verbrecher, Mörder, Diebe, Wegelagerer.«
’s Jergle starrt vor sich hin. Er sieht immer noch den Eisenring mit der Knochenhand vor sich.
»Und die hat man einfach in den Turm geschmissen?«
Rudolf nickt nur.
»War es dort unten immer so dunkel?«
Rudolf nickt wieder.
»Und hat man denen etwas zu essen gebracht, und Wasser?«
»Nein. Das glaube ich nicht.«
»Dann ist der verhungert und verdurstet?«
Nachdenkliches Schweigen. Den einen und andern verschüttelt es. Und dann fragt ’s Jergle nach dem, was ihn am meisten umtreibt: »Warum sind nur noch ein paar Knochen da?«
Rudolf sagt nur ein einziges Wort: »Ratten.«
Alle erschaudern und sind still.
Am Spätvormittag sitzt ein halbes Dutzend Kinder über seine Wachstäfelchen gebeugt um den großen Tisch herum. Die Tür zur Küche steht offen, ein bisschen Wärme kommt herein und bringt Bratenduft mit. Agnes von Waldeck unterrichtet die Kinder, die lesen und schreiben lernen wollen, und beaufsichtigt gleichzeitig die Köchin und die Mägde. Ein ganzes Ferkel wird am Spieß über der Feuerstelle gedreht, und Frau Agnes wirft immer wieder einen Blick durch die Tür.
»Langsam weiterdrehen, immer langsam weiterdrehen«, weist sie mehrmals das Küchenmädchen an, das auf einem Schemel am Feuer sitzt. Dann wendet sie sich wieder den Kindern zu. Sie trägt eine Ohrenhaube und ein langes graues Kleid. Es ist sehr weit, kann aber ihren Zustand nicht verhüllen. Sie ist hochschwanger. Unter ihren vollen Brüsten wölbt sich ihr Bauch. Immer wieder zuckt es schmerzhaft in ihrem Gesicht, und sie fasst mit beiden Händen an ihren Leib, als müsste sie ihn zusammenhalten. Die Kinder am Tisch sehen es wohl, aber reagieren nicht darauf. Sie sind es gewohnt. Jedes von ihnen hat seine Mutter schon mehrmals in diesem Zustand erlebt.
Und Frau Agnes beherrscht sich und leitet die Kinder geduldig an, so wie sie es gewohnt sind. »Drück nicht so auf. Du kratzt ja das ganze Wachs aus dem Rahmen«, sagt sie zu Hans, der neben seinem Freund Jergle sitzt. Dem zarten Mädchen gegenüber lautet ihre Anweisung: »Ein bisschen mehr musst du schon aufdrücken, sonst kann das niemand lesen.« Und dem jüngsten Kind, das erst seit Kurzem zum Lernen kommt, muss sie noch zeigen, wie es den Griffel halten soll.
’s Jergle hingegen kann schon ganz gut lesen und schreiben. Er ist am längsten dabei. Er hat schon alle Buchstaben gelernt, als seine älteren Geschwister noch hier saßen, und darf manchmal schon etwas abschreiben, während seine Mutter den anderen die Buchstaben erklärt.
»Das ist ein H wie Hailfingen und Hohenentringen. Himmel, Heiland und Herrgott schreibt man auch so«, erklärt sie, oder »G wie Gott oder Gültlingen. J wie Jörg, aber auch wie Jesus oder Jerusalem. S wie Schloss, T wie Turm und Thomas, A wie Anfang oder Adam.«
Für jeden Buchstaben gibt es ein Merkwort oder mehrere, Bezeichnungen für etwas, das die Kinder gut kennen, oder Wörter, die sie beim Gebet hören oder wenn Frau Agnes ihnen in der Kirche die Bilder erklärt. Auch den Namen der vielen Heiligen werden die Buchstaben zugeordnet: Agnes, Barbara, Benedikt, Christophorus, David, Daniel, Elisabeth, Erhard, Florian usw. Zu jedem Buchstaben sagt sie ihnen wenigstens einen Namen.
Hans kann sich das nicht alles merken. Immer holt er sich beim Jergle Hilfe. Manchmal schämt er sich ein bisschen, dass er nicht so gut mitkommt, und hilft sich mit der Bemerkung: »Deine Mutter weiß das ja alles. Meine nicht.«
Seine Mutter, die Gültlingerin, kann zwar ein bisschen lesen, aber schreiben hat sie nie gelernt – wie die meisten Schlossbewohner. Wo die Eltern kaum lesen können, sind die Kinder auch nicht sehr eifrig bei der Sache. Die meisten von ihnen finden oft eine Ausrede, damit sie wegbleiben können, und merken dann, wenn sie im Winter aus lauter Langeweile wieder mitmachen wollen, dass sie etwas versäumt haben und die andern schon wieder viel Neues können. Das ist beschämend. Es liegt ihnen einfach nicht, sagen sie sich, und finden sich trotzig damit ab, vielleicht erst später einmal richtig lesen zu lernen, wenn sie es wirklich brauchen sollten, wenn sie Güter geerbt hätten, so Gott will. Wozu denn sonst? Die spärlichen Kenntnisse ihrer Eltern reichen auch nur dazu, die Schrift auf den Grabplatten an der Kirche zu entziffern, und das mit Mühe. Das ist kein großer Gewinn, warum sollte einen das also interessieren? Und Bücher gibt es nur im Kloster, und das Latein der Bibel würden sie ohnehin nicht verstehen. Auch schreiben müssen sie nicht unbedingt können, wie sie meinen. Wozu auch? Das Geschriebene ist nicht ihre Welt, sondern Sache der Mönche, der Berufsschreiber und Notare auf den Schlössern. Und sollten sie doch einmal eine Urkunde verstehen oder gar selbst aufsetzen müssen, dann hätten sie bestimmt einen Vertrauten, meinen sie, der ihnen die Angelegenheit verständlich macht und den Streit an ihrer statt ausficht oder schlichtet. So einen wie den Ehinger, den Herrn Rudolf, der aber so hoch über ihnen steht, dass sie nicht im Entferntesten daran denken können, ihm gleichzukommen.
Genau darin unterscheidet sich die Familie der Ehinger von den anderen. Diepolt und Burckart, Jergles älteste Brüder, waren eifrige Schüler ihrer Mutter und lernten gut. Diepolt kann jetzt schon, mit nur sechzehn Jahren, seinen Vater bei der Verwaltung der Güter unterstützen und begleitet ihn oft auf seinen Ritten. Burckart wird mit ihm gleichziehen, wenn er ein paar Jahre älter ist.
Und ’s Jergle will unbedingt so wie sein Vater werden und lernt mit großem Fleiß. An manchen Regentagen, wenn der Wind durch die Fenster hereinpfeift, sitzt er mit seinem Wachstäfelchen am Tisch, solange das Licht reicht, und ritzt einen Buchstaben nach dem anderen ins Wachs. Immer wieder bittet er seine Mutter, ihm etwas vorzuschreiben, was er laut vorlesen und abschreiben kann.
»Gut, Bub, aus dir wird mal was«, bestärkt Frau Agnes seinen Eifer, auch weil sie weiß, dass sie damit ihren Gatten hoch erfreut, ist doch ’s Jergle, der ihm so ähnlich sieht, sein Lieblingssohn, »ein richtiger Ehinger«, wie er zu sagen pflegt.
Wolf, nur zwei Jahre älter als ’s Jergle, sieht es mit Eifersucht. Auch er wird immer noch von seiner Mutter unterrichtet. Aber der Erfolg stellt sich bei ihm nicht so leicht ein wie bei seinem jüngeren Bruder. Und selbst wenn er so mühelos lernen würde wie ’s Jergle – er sieht seinem Vater einfach nicht so ähnlich. So bleibt ihm nur der Neid. »Dich sollen sie möglichst bald ins Kloster schicken. Dann sind wir dich los«, hat er schon zu seinem kleinen Bruder gesagt und ihn heimlich beschimpft als »Mammasuggele«. Und manchmal stellt er ihm nach, sobald er ihn nur zum Tor hinausgehen sieht.
Wenn ’s Jergle aber am Tisch sitzt, seinen Freund neben sich hat, immer noch etwas dazulernen kann und dafür gelobt wird, kann er seinen groben Bruder vergessen. Und besonders freut er sich aufs Lesen und Schreiben, weil ihm die Burgl gegenübersitzt, Notburga von Gültlingen, die Schwester seines Freundes, ein Jahr jünger als er und das schönste Mädchen im Schloss. Auch wenn er sie zwei oder drei Tage nicht gesehen hat, braucht er nur die Augen zu schließen, um ihr Gesicht zu sehen: die mandelförmigen dunklen Augen mit den langen Wimpern, die hohe Stirn, die fein geschnittene, gerade Nase, die roten Lippen und das Kinn mit dem Grübchen. Das ist sein Geheimnis, davon sagt er keinem was, nicht einmal Hans.
Während seine Mutter unter der Tür zur Küche steht und dafür sorgt, dass der Haferbrei rechtzeitig aufgesetzt wird, schaut er ganz versonnen zu, wie Burgl zaghaft Lettern ins Wachs ritzt. Mit ihrer zarten Hand umklammert sie den Griffel so stark, dass ihre Fingerspitzen weiß werden, und nach jedem geraden Strich, der ihr gelungen ist, atmet sie hörbar auf. Schließlich hat sie ein ganzes Wort geschrieben, lehnt sich zurück und betrachtet ihr Werk. Ein zufriedenes Lächeln spielt um ihre Mundwinkel, ihre Augen lachen. Plötzlich schaut sie auf und sieht dem Jergle direkt ins Gesicht. Schnell blickt er auf seine Wachstafel nieder, setzt den Griffel an und schreibt das letzte Wort des angefangenen Satzes. »Jesus hat uns geliebt«, steht auf seinem Täfelchen.
Reglos sitzt er da und schaut sie an. Ihre dunklen Augen erinnern ihn an die Frau auf der Wandmalerei im Saal, an die Fürstin oder Königin mit der Bänderhaube und dem Falken, deren geheimnisvolles Gesicht er so schön findet. Als er seine Mutter fragte, wer die Frau sei, sagte sie nur, das sei irgendeine stolze Frau. So stolz wie die dürfe man nicht sein. Das sei eine Sünde. Das hat er nicht verstanden und bestaunt das Bild immer wieder, aber nur, wenn es seine Mutter nicht sieht. Burgls Gesicht ist ebenso schön wie das der hohen Frau, und wie er so vor sich hin träumt, verschwimmen ihm die beiden Gesichter in eins. Er ist ganz benommen. Da gibt ihm Hans kichernd einen leichten Stoß mit dem Ellbogen. Sofort versucht er wieder, sich auf sein Wachstäfelchen zu konzentrieren, und beginnt einen neuen Satz.
Doch er kann es nicht lassen, noch einmal hinüberzuspicken. Er lässt das Kinn auf der Brust und schielt zu Burgl hinüber – und wird ertappt. Auch sie hat den Kopf gesenkt, ihre Locken hängen leicht in die Stirn, und darunter hervor blitzen ihre Augen. Sie lächelt breit, weil sie ihn überrascht hat. Doch auch sie hält den Blickkontakt nicht aus. Schnell senkt sie die Lider, kann aber ein leise gluckerndes Kichern nicht unterdrücken. Was niemand bemerkt – außer Hans. Diesmal stößt er mit seinem Knie gegen Jergles Oberschenkel.
»Was willsch?«, fragt ’s Jergle und gibt sich gereizt, als wüsste er nicht genau, worum es geht.
»Nachher«, flüstert Hans.
Und da ist auch Frau Agnes schon wieder am Tisch und zeigt ihnen, wie man Gott Vater und Heiliger Geist schreibt. Dann geht sie um den Tisch herum und schaut sich an, was jedes Kind geschrieben hat. Sie lobt und tadelt, und am Ende kommt sie zu ihrem Sohn und liest, was auf seinem Täfelchen steht.
»Ja, geliebt hat Jesus Christus uns auch. Aber schau mal, ich habe »erlöst« vorgeschrieben. Das hättest du schreiben sollen.«
Nun kichert Hans, und Frau Agnes schaut stirnrunzelnd auf ihn hinunter, ohne etwas zu sagen.
Nach dem Unterricht rennen Hans und ’s Jergle die Treppe hinunter und auf den Schlosshof hinaus.
»Warum hat die Burgl auf einmal gekichert?«
»Weiß ich doch nicht«, sagt ’s Jergle, aber er wird rot dabei.
»Aha, du bist in sie verliebt. Du bist in die Burgl verliebt. Ich weiß es. Ich hab’s gemerkt.«
»Blödsinn. Ich bin nicht verliebt, und schon gar nicht in die.«
»Und warum schaust du sie dann immer an?«
»Ich schau sie nicht immer an.«
»Doch. Tust du.«
»Na, du musst es ja wissen.«
»Ich weiß es auch.«
Und weil ’s Jergle nicht weiterweiß, fängt er mit Hans zu raufen an. Sie fassen einander an den Schultern. Jeder will den andern niederringen, was aber keinem gelingt. Unter dem Gegacker aufgescheuchter Hühner geht es hin und her. Am Ende stehen sie atemlos mit roten Backen an der westlichen Mauer und schauen ins Land hinaus.
»Du hast es gut. Deine Mutter kann alles«, sagt Hans wieder einmal.
»Schon.«
’s Jergle weiß nicht, was sonst er darauf antworten soll, und eine Weile sagt keiner etwas.
»Warum heißen die anderen Frauen sie die Truchsessin?«
»Weiß nicht. Vielleicht, weil mein Großvater Truchsess ist.«
»Was ist das?«
»Weiß ich auch nicht genau. Der ist bei einem Grafen oder Herzog in einem Schloss. Das ist viel größer und schöner als das hier. Und dort macht er alles.«
»Warst du schon einmal dort?«
’s Jergle schüttelt den Kopf. »Viel zu weit. Da kommt man an einem Tag nicht hin.«
»Und was macht der dort? Kocht er und schlachtet er?«
»Nein, der ist doch kein Koch. Aber er sagt denen, was sie tun müssen.«
»Ach so. So wie deine Mutter. Die weiß ja auch immer, wie man alles machen muss.«
»Wer sagt das?«
»Meine Mutter und die Hailfingerinnen. Die sagen doch dauernd, sie müssen die Ehingerin etwas fragen. Und die sind auch ganz froh, dass deine Mutter uns Lesen und Schreiben beibringen kann. Das könnten die nicht. Ich sag ja, du hast’s gut.«
Darauf erwidert ’s Jergle nichts. Er wird abgelenkt vom Schrei eines Bussards, der sich im warmen Aufwind über ihnen hochschraubt.
»Da, ein Bussard«, sagt er freudig erregt.
»Hab ich schon oft gesehen«, antwortet Hans gelangweilt.
»Ich finde Bussarde schön. Du nicht?«
Hans zuckt gleichgültig mit den Achseln.
»Ich wollt, ich könnt so fliegen«, schwärmt ’s Jergle mit unverminderter Begeisterung.
»Und dann?«
»Dann würd ich fortfliegen.«
Es ist schon wieder so weit. Vater Rudolf hält sich auf dem Schloss auf und nimmt mit den Seinen die Mahlzeiten im großen Saal ein. ’s Jergle weiß, was das bedeutet. Die Schreikammer, die gegenüber der Stube liegt, in der die Ehinger gewöhnlich essen, ist aufgeschlossen worden. Die Mägde haben sie ausgefegt und die Dielen feucht gewischt. Das große Bett hat ein frisches Leintuch bekommen. In der Küche liegt ein großer Vorrat an Reisig und Buchenholz für ein großes Feuer, das man über Stunden, vielleicht eine Nacht und einen Tag lang oder noch länger in Gang halten muss. Töpfe für heißes Wasser werden geputzt, die größten Schüsseln bereitgestellt, alles unter der Aufsicht der Hebamme, die man herbeigerufen hat.
Hans merkt beim Spiel im Schlosshof, dass ’s Jergle etwas bedrückt.
»Was ist mit dir? Was hast du?«, fragt er den Freund.
»Meine Mutter kommt wieder in die Schreikammer.«
»Meine auch bald wieder«, antwortet Hans mit ernstem Gesicht, als redete er von der Eiseskälte, die jeden Winter unabwendbar das Leben im Schloss lähmt.
Die Buben wissen, was es geschlagen hat, wenn die Hebamme vom Dorf heraufkommt und sie dann aus dem Bereich um die Küche herum verbannt werden. Die Hebamme ist eine hagere Frau mit ernstem Gesicht, die nur mit Frauen und Mägden zu sprechen scheint, die nach ihren Anweisungen in unruhiger Hast die Vorbereitungen treffen. Und sie spricht die Litanei vor, mit der die heilige Margarete und die heilige Dorothea um Hilfe bei der Entbindung gebeten werden.
Seit ’s Jergle denken kann, ist kein Jahr ohne drei oder vier Geburten vergangen. Jedes Mal sind die kleineren Kinder aus dem Schloss verbannt worden und haben in der Scheune schlafen müssen. Da ist etwas vorgegangen, was sie nicht sehen sollten und ihnen doch Angst machte. Und keine Mutter hat ihnen jemals erklärt, warum so viel Aufregung herrschte, warum sie die Schmerzensschreie der Gebärenden hören mussten und warum oft der Priester geholt werden musste, wenn das Neugeborene tot zur Welt kam. Am allerschlimmsten ist der Morgen gewesen, an dem nach dem Schreien Todesstille ins Schloss einkehrte, weil eine werdende Mutter die Geburt nicht überlebt hatte.
Jetzt sitzen Hans und Jergle wieder einmal vor der Scheune, und es graut ihnen davor, dass bald die Schreie aus der Kammer dringen und sogar im Schlosshof zu hören sein werden, den ganzen Tag und die halbe Nacht. Sie haben sie nie ertragen können, sie haben sie nie hören wollen, sind weggelaufen, aber doch wieder zurückgekommen, in der Hoffnung, dass die Schreie verstummt wären. Aber oft waren sie nicht verstummt, manchmal nach einem ganzen Tag und noch länger nicht. Beide, ’s Jergle und der Hans, plagen schlimme Erinnerungen an solche Tage und Nächte. Und dabei haben sie immer gewusst, dass dieses angsteinflößende Geschehen auch mit ihnen selbst etwas zu tun hatte. Es war qualvoll, von den Frauen ausgesperrt zu werden und doch hören zu müssen, dass die eigene Mutter, die sich noch am Tag zuvor liebevoll um sie gekümmert hatte, um ihr Leben und das eines Geschwisterchens kämpfte.
In einer solchen Nacht vor knapp einem Jahr, als eine der Hailfingerinnen ein Kind zur Welt brachte, haben sie nicht einschlafen können und sind ins Treppenhaus geschlichen, um heimlich zu lauschen. Die Dielen haben unter hastigen Schritten geknarrt, selbst die gedämpften Anweisungen, die sie nicht verstehen konnten, haben sie spüren lassen, dass es um Leben und Tod ging. Und dann haben die Frauen auf einmal angefangen, laut und schrill zu singen: »O Kind, ob lebend oder tot, komm heraus, denn Christus ruft dich ans Licht.«
Dieses klagende Geschrei hat sie furchtbar erschreckt. Es ist nicht auszuhalten gewesen, und sie sind ohne Rücksicht auf den Lärm schnell die Treppe hinuntergerannt und haben sich im hintersten Winkel der Scheune versteckt.
Hans schaut ’s Jergle nachdenklich an.
»Ihr seid schon neun. Zu was braucht ihr noch ein Geschwister?«
»Ich weiß nicht. Ich brauch keins mehr. Wenn das Letzte nicht tot auf die Welt gekommen wär, dann wären wir sogar schon zehn. Mir tät’s langen.«
»Mir auch. Sieben Geschwister reichen mir haufeng’nug. Und wir wären ja auch schon zehn. Aber eins war gleich tot, und die Zwillinge letztes Jahr, die sind nicht mal einen Monat alt geworden.« Schweigend starrt er eine Weile ins Leere. »Warum kriegen die Frauen so viele Kinder, wenn sie doch dabei sterben können? Wollen die das?«
’s Jergle zuckt mit den Achseln.
»Weiß nicht. Ist halt so.«
Sie hoffen, dass die Frauen am nächsten Morgen die Weiberzeche feiern, indem sie leicht angeheitert bei Brot, Käse und Wein in der Küche sitzen und für die Wöchnerin eine stärkende Brühe kochen. So wie vor zwei Jahren, als Stine nach einer anstrengenden Nacht so viel getrunken hatte, dass sie am Küchentisch einschlief und den ganzen Tag nicht mehr aufwachte. Hoffentlich wird es wieder so.
Hans kritzelt mit einem Stück Holz etwas in den Dreck, was wie ein dicker Bauch und zwei Brüste aussieht. Zum Jergle sagt er: »Deine Mutter ist aber gar nicht so dick. Meinst du wirklich, dass …«
»Ich weiß es von meinem Vater. Er hat uns erklärt, warum wir gerade nicht in der Stube essen. Deshalb ist er ja auch da und ist nicht zum Pfalzgrafen nach Urach geritten.«
»Meine Mutter sieht aber dicker aus als deine«, bemerkt Hans, der immer noch auf sein Gekritzel schaut.
»Kann schon sein. Ist auch gleichgültig. Wenn nur schon alles vorbei wäre.«
So schnell ist es aber nicht vorbei. Kurz vor Sonnenuntergang treibt der Nordwestwind dunkle Wolken daher und es beginnt zu schneien. Eine Magd kommt aus dem Schloss, hinter ihr eine ganze Kinderschar. Die Jüngsten sind drei, die Ältesten acht oder neun. Sie sollen alle in der Scheune schlafen. Die Magd gibt ihnen Decken und Schaffelle. »Rutscht zusammen, dann friert ihr nicht«, sagt sie zu ihnen, als sei es in der Scheune viel kälter als im Schloss.
’s Jergle und Hans ergattern eine große Wolldecke und ein Schaffell.
»Wir bleiben in der Nähe vom Tor«, schlägt ’s Jergle vor. Hans stimmt zu.
Kaum haben sie sich eingerichtet, wird es dunkel. In der Scheune wird geflüstert, eines der jüngsten Kinder weint vor Angst und wird von einem älteren Geschwister getröstet, es wird auch gekichert. Mit der Zeit wird es immer ruhiger. Am Ende ist es ganz still.
Hans kann trotzdem nicht einschlafen. Leise steht er auf und geht ans Scheunentor. Durch eine Ritze sieht er hinaus. Hinter den Fenstern des Schlosses flackert ein schwacher Schein. Er lauscht, hört aber nichts. Der Schnee schluckt alle Geräusche. Er tastet sich zum Jergle zurück und schlüpft unter die Wolldecke.
»Und? Hast du was gehört?«
»Nein. Es ist ganz still.«
Sie versuchen zu schlafen. Rücken an Rücken liegen sie mit angezogenen Beinen in ihrem Lager, fühlen sich weit von den anderen entfernt und sind froh aneinander.
’s Jergle fährt auf. Er hat etwas gehört. Der Schein einer Fackel dringt durch eine Ritze im Scheunentor. Jetzt hört er es wieder. Jemand muss im Pferdestall sein. Ein Pferd schnaubt laut, leises Wiehern. Schnell steht er auf und schlüpft aus dem Tor. Zwei Knechte stehen mit Fackeln im Schnee, der ihnen inzwischen bis über die Knöchel reicht.
Veit führt zwei gesattelte Pferde aus dem Stall. ’s Jergle springt zu ihm hin.
»Veit, was ist los? Warum die Pferde?«
»Ich soll den Priester holen.«
»Meine Mutter?«
»Ich weiß nicht.«
»Was ist mit meiner Mutter?«