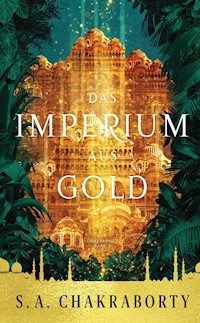12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Panini
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Daevabad
- Sprache: Deutsch
Neue Geschichten aus Daevabad – der sagenumwobenen Welt der Dschinns, in der Prinzen ihre Macht hinterfragen und mächtige Dämonen sowohl Segen als auch Fluch bedeuten können. Eine Anwärterin auf den Königsthron trifft auf einen Hofstaat, dessen tödliche Geschichte ein nahezu unüberwindliches Hindernis darstellt. Die Wege eines gefangenen Prinzen aus einer gefallenen Dynastie und einer jungen Frau, die ihrer Heimat entrissen wurde, kreuzen sich in einem verzauberten Garten. Ein Spähtrupp stößt in einem verfluchten Winterwald auf ein Geheimnis, das die Welt in ihren Grundfesten erschüttern könnte. Die preisgekrönte Daevabad-Trilogie der Bestsellerautorin S. A. Chakraborty wird mit dieser neuen mystisch-magischen Geschichtensammlung erweitert und feiert ein Wiedersehen mit altbekannten und auch völlig neuen Charakteren aus der faszinierenden Welt der Dschinns.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 443
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
AUSSERDEM BEI PANINI ERHÄLTLICH
VON SHANNON CHAKRABORTY
DIE ABENTEUER DER PIRATIN AMINA AL-SIRAFI
ISBN 978-3-8332-4396-7
DIE DAEVABAD-REIHE
Band 1: DIE STADT AUS MESSING
ISBN 978-3-8332-4099-7
Band 2: DAS KÖNIGREICH AUS KUPFER
ISBN 978-3-8332-4177-2
Band 3: DAS IMPERIUM AUS GOLD
ISBN 978-3-8332-4273-1
Band 4: DER FLUSS AUS SILBER
ISBN 978-3-8332-4330-1
Nähere Infos und weitere phantastische Bände unter:
paninishop.de/phantastik/
S. A. Chakraborty
Geschichten aus Daevabad
Ins Deutsche übertragen von Kerstin Fricke
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Copyright © 2023 by Shannon Chakraborty. All rights reserved.
Titel der Englischen Originalausgabe: »The River of Silver« by S. A. Chakraborty, published 2022 by Harper Voyager an imprint of HarperCollins Publishers LLC, New York, USA.
Designed by Paula Russell Szafranski
Interior ornaments © Fine Art Studio / Shutterstock.com
Deutsche Ausgabe 2023 Panini Verlags GmbH, Schloßstr. 76, 70176 Stuttgart.
Alle Rechte vorbehalten.
Geschäftsführer: Hermann Paul
Head of Editorial: Jo Löffler
Head of Marketing: Holger Wiest (E-Mail: [email protected])
Presse & PR: Steffen Volkmer
Übersetzung: Kerstin Fricke
Lektorat: Mona Gabriel
Umschlaggestaltung: tab indivisuell, Stuttgart
Satz und E-Book: Greiner & Reichel, Köln
YDCHAK004E
ISBN 978-3-7569-9991-0
Gedruckte Ausgabe:
1. Auflage, Juni2023, ISBN 978-3-8332-4330-1
Findet uns im Netz:
www.paninicomics.de
PaniniComicsDE
INHALT
Anmerkung der Autorin
Manizheh
Duriya
Hatset
Muntadhir
Jamshid
Dara
Jamshid
Ali
Der Kundschafter
Nahri
Ali
Zaynab
Muntadhir
Alternativer Epilog zu »Das Imperium aus Gold«
Nahri
Dank
Auszug aus »Die Abenteuer von Amina Al-Sirafi«
Über die Autorin
Für meine Leserinnen und Leser. Ohne euch wäre das alles nicht möglich gewesen.
ANMERKUNG DER AUTORIN
Obwohl es über zehn Jahre her ist, erinnere ich mich noch genau an den Tag, an dem ich das, woraus einmal Die Stadt aus Messing werden sollte, in Brooklyn erstmals meiner Schreibgruppe vorstellte. Ich war neu in der Gruppe, hatte gerade erst mit dem Schreiben angefangen und noch nie zuvor auf der Couch einer mir fremden Person gesessen, um etwas vorzustellen, das mir sehr am Herzen lag. Und so berichtete ich von der Art Manuskript, von der ich dachte, dass epische Fantasy so aussehen müsse: eines, das wenigstens ein Dutzend verschiedene Figuren und ihre Perspektiven enthält, mehrere Reisen kreuz und quer durchs Land sowie zahllose verschiedene Städte, Dörfer und ausgedehnte magische Gebiete, für die ich seitenweise detaillierte Hintergründe, Zusammenfassungen der Geschichte und umfangreiche Beschreibungen parat hatte.
Damit stieß ich auf einiges an Ablehnung.
Es gibt bestimmte epische Fantasygeschichten, für die derartige Erkundungen erforderlich sind, sagten sie, aber im Grunde genommen sollte es bei Die Stadt aus Messing doch um Nahris und Alis Lebenswege gehen. Um eine junge Frau, die aus allem, was sie kennt, herausgerissen wird und sich gezwungen sieht, ihr Leben wieder und wieder neu aufzubauen – und bei diesem Überlebenskampf eine grimmige Kraft in sich entdeckt, für ihr Volk und ihr Glück zu kämpfen. Es geht um einen jungen Mann, der sich darum bemüht, seinen Glauben und seine Vorstellungen von Gerechtigkeit mit der Realität der Unterdrückung in der Stadt, die er liebt, in Einklang zu bringen – und dabei wird er das Ende der Herrschaft seiner Familie herbeiführen. Ich wollte diese beiden Personen in einer vollständig ausgeformten Welt inmitten von diversen Freunden und Familienmitgliedern darstellen. Dabei sollten die Personen, die sie lieben oder hassen, jeweils ihre eigenen Geschichten, Eigenheiten und Absichten haben. Trotzdem beschloss ich schon sehr früh, dass sich diese spezielle Geschichte auf Nahri und Ali und später auch auf Dara konzentrieren sollte.
Allerdings waren mir auch meine Nebenfiguren ans Herz gewachsen, und ich glaubte fest daran, dass man beim Schreiben organisch vorgehen und seine Geschichten wachsen und atmen lassen muss. Daher unternahm ich im Verlauf der Arbeit an der Trilogie mehrere parallele Missionen mit namenlosen Kundschaftern und beschrieb Muntadhirs und Jamshids Beziehung in ihren eigenen Worten, sah Zaynab als Anführerin der Rebellen aufsteigen und erkundete Daras Jugend in einem viel früheren Daevabad. Ich habe Szenen geschrieben, die mein Verständnis der Bücher vertieften, selbst wenn ich daraus nur eine Zeile oder ein Gefühl übernahm. Sie waren meine Art der Forschungsnotizen, wenngleich ich nie vorhatte, sie zu veröffentlichen.
Dann kam die Pandemie. Ohne zu genau auf meine persönlichen Erfahrungen einer Krise einzugehen, die noch lange nicht vorbei ist, belassen wir es einfach dabei, dass ich in den ersten Monaten rein gar nichts schreiben konnte. Die Welt stand in Flammen, meine Familie brauchte mich, und ich sollte auch noch kreativ werden? In dem verzweifelten Versuch, wenigstens irgendwelche Worte aufzuschreiben, kehrte ich zu meinen alten Szenen aus Daevabad zurück. Die Arbeit an etwas Vertrautem, das bereits in Teilen stand, noch dazu in einer Welt, die ich liebte und in- und auswendig kannte, erwies sich als sehr viel weniger furchterregend, als vor den leeren Seiten eines neuen Projekts zu sitzen. Nach und nach kehrten die Worte zu mir zurück, daher ging ich weiter und malte mir das Leben meiner Figuren nach dem Ende von Das Imperium aus Gold aus und lange vor den Ereignissen, mit denen Die Stadt aus Messing anfängt.
Einige dieser Geschichten können Sie jetzt lesen. Sie sind in chronologischer Reihenfolge angeordnet und verfügen jeweils über eine kurze Einleitung, die sie im Kontext der Trilogie einordnet. Ich hoffe sehr, dass Ihnen diese kurze Rückkehr nach Daevabad ebenso viel Spaß macht, wie sie mir bereitet hat, und ich werde Ihnen auf ewig dankbar dafür sein, dass Sie meinen Büchern eine Chance gegeben haben.
Mögen die Feuer hell für Sie brennen!
Shannon Chakraborty
MANIZHEH
Diese Szene spielt einige Jahrzehnte vor den Ereignissen aus Die Stadt aus Messing und enthält Spoiler für die ersten beiden Romane.
Ihr Sohn war wunderbar.
Manizheh fuhr Jamshids winzige Ohren nach, betrachtete voller Wonne sein perfektes kleines Gesicht. Obwohl er gerade mal eine knappe Woche alt war, schimmerte in seinen schwarzen Augen bereits ein feuriger Dunst. Sein kleiner Körper war warm und weich und lag sicher und geschützt in ihren Armen. Dennoch drückte Manizheh ihn fester an sich, als sie das Zelt verließ. Es war zwar Frühling, doch er hatte gerade erst angefangen. Daher erwiesen sich die Vormittage in Zariaspa oftmals als recht frisch.
Das Tal, das sich vor ihr ausbreitete, leuchtete im frühen Morgenlicht, und hier und da blitzte rosa- und lilafarbener Klee zwischen den langen Grashalmen auf. Vorsichtig trat sie über herumliegende Steine und zerbrochene Ziegel hinweg. Kaveh und sie hatten ihr Zelt in einer der vielen vergessenen Menschenruinen aufgebaut, die man hier überall in der Landschaft fand, wenngleich von diesen Hinterlassenschaften kaum mehr als einige Bogen und eine gedrungene, mit Diamantenmuster verzierte Säule übrig geblieben waren, sodass man sie kaum noch vom felsigen Hang unterscheiden konnte. Doch im Gehen fragte sich Manizheh, was sich hier wohl einst befunden haben mochte. War dies ein Schloss gewesen, das Heim von Königen, in dem andere nervöse frischgebackene Eltern lebten und sich Sorgen wegen der Welt machten, in die sie ein Kind von edlem Blut gesetzt hatten?
Abermals blickte Manizheh auf ihren Sohn hinab. Ihren Jamshid. Das war ein königlicher Name, der wie so viele ihrer Namen schon vor langer Zeit von den Menschen entliehen worden war – was die meisten Daeva niemals zugegeben hätten. Doch Manizheh war als Nahid ausgebildet worden und hatte Dinge gelernt, die anderen verboten waren. Jamshid war der Name einer Legende und eines Königs. Ein optimistischer Name, der aus dem letzten Funken Hoffnung in ihrer Seele stammte.
»Dieser Platz ist mir der liebste auf der Welt«, sagte sie leise, während Jamshids Augenlider flatterten, da sich das Baby satt getrunken hatte und müde war. Sie legte sich seinen Kopf auf die Schulter und atmete den süßen Duft seiner Haut ein. »Du wirst hier so viele Abenteuer erleben. Dein Baba wird dir ein Pony schenken und dann kannst du alles nach Lust und Laune erkunden. Und ich möchte, dass du alles erkundest, mein Schatz«, flüsterte sie. »Ich möchte, dass du erkundest, dass du träumst und dich an einem Ort verlierst, an dem niemand über dich wacht. An dem dich niemand einsperrt.«
An dem Ghassan dir nicht wehtut. Weil er nie von dir erfahren wird.
Denn wenn es eines gab, dessen sie sich in Bezug auf die Zukunft ihres Kindes sicher war, dann dass Ghassan niemals von Jamshids Existenz erfahren durfte. Allein bei diesem Gedanken wurde Manizheh ganz flau vor Angst, dabei war sie keine Frau, die sich leicht fürchtete. Ghassan würde Kaveh töten, daran bestand für sie kein Zweifel, und zwar auf die langsamste und grausamste Art und Weise, die ihm einfiel. Er würde Rustam bestrafen und das brechen, was vom traumatisierten Geist ihres Bruders noch übrig war.
Und Jamshid … Ihr Verstand wollte sich gar nicht erst ausmalen, was Ghassan ihm antun würde. Wenn Jamshid Glück hatte, würde sich Ghassan damit zufriedengeben, ihn dasselbe grässliche Schicksal durchleiden zu lassen, dem sie und Rustam unterworfen gewesen waren: Ein Leben als Sklaven in der Krankenstube des Palastes, das sie tagtäglich daran erinnerte, dass man ihre Familie längst ausgelöscht hätte, wenn ihr Nahid-Blut sie nicht so überaus nützlich machen würde.
Allerdings bezweifelte sie, dass ihr Sohn solches Glück haben würde. Manizheh hatte mit angesehen, wie die Jahre Ghassan härter machten, bis er zu einem Spiegelbild seines tyrannischen Vaters geworden war. Vielleicht war Manizheh eine stolze Närrin gewesen, weil sie Ghassan das verwehrte, was er sich am sehnlichsten wünschte. Möglicherweise wäre es besser gewesen, ihre Familien und Stämme zu vereinen, sich bei einer königlichen Hochzeit ein Lächeln abzuringen und in seinem Bett im Dunkeln die Augen zuzukneifen. Dann würde ihr Volk jetzt eventuell aufatmen und ihr Bruder nicht ständig zusammenzucken, nur weil irgendjemand eine Tür etwas zu laut schloss. War das denn nicht die beste Wahl für so viele Frauen, und mehr, als sie sich erhoffen konnten?
Dennoch hatte sich Manizheh dagegen entschieden. Stattdessen hatte sie Ghassan auf die intimste Weise betrogen, die ihr nur möglich war, und Manizheh wusste ganz genau, dass Kaveh und sie teuer dafür bezahlen würden, falls sie jemals aufflogen.
Sie drückte einen Kuss auf den weichen Haarflaum, der von Jamshids Kopf abstand. »Ich werde zu dir zurückkehren, mein Kleiner, das verspreche ich dir. Und wenn ich das tue … dann hoffe ich, dass du mir vergeben kannst.«
Jamshid regte sich im Schlaf und gab ein leises Geräusch von sich, bei dem sich Manizhehs Brust vor Trauer zusammenschnürte. Sie schloss die Augen und versuchte, sich jede Einzelheit dieses Augenblicks einzuprägen. Sein Gewicht in ihren Armen und seinen süßen Duft. Die Brise, die säuselnd durch das Gras wehte, und die kühle Luft. Sie wollte sich daran erinnern, wie es war, ihren Sohn in den Armen zu halten, bevor sie ihm das alles nehmen musste.
»Manu?«
Beim Klang von Kavehs zögerlicher Stimme erstarrte Manizheh und ihre Gefühle waren erneut im freien Fall. Kaveh. Ihr Partner und Mitverschwörer, seitdem sie sich als Kinder hinausgeschlichen hatten, um Pferde zu stehlen und durch das Land zu streifen. Ihr engster Freund und später ihr Liebhaber, als ihre Neugier und ihre Teenagersehnsüchte in zaghafte Berührungen und gestohlene Momente übergingen.
Eine weitere Person, die sie verlieren würde. Manizheh hatte ihren Besuch in Zariaspa bereits um drei Monate überzogen und Ghassans Briefe, in denen er ihre Rückkehr anordnete, geflissentlich ignoriert. Es hätte sie überrascht, wenn der König nicht längst in Erwägung zog, sie von Soldaten nach Hause holen zu lassen. Eines stand fest: Sie würde Daevabad nie wieder verlassen dürfen. Jedenfalls nicht, solange Ghassan an der Macht war.
Der Ring, rief sie sich in Erinnerung. Solange du den Ring hast, gibt es noch Hoffnung. Doch ihr Kindheitstraum, den schlafenden Afshin-Krieger aus dem Sklavenring zu befreien, den sie und Rustam vor so langer Zeit gefunden hatten, erschien ihr heute als genau das: als ein Traum.
Kaveh sprach weiter. »Ich habe alles vorbereitet, worum du gebeten hast. Bist du … Geht es dir gut?«
Manizheh wollte lachen. Sie wollte weinen. Nein, es ging ihr nicht gut. Sie drückte das Baby fester an sich. Es kam ihr schlichtweg unmöglich vor, es loszulassen. Sie wollte den Schöpfer anschreien. Sie wollte in Kavehs Armen zusammenbrechen. Zur Abwechslung sehnte sie sich danach, dass ihr einmal jemand sagte, alles würde wieder gut werden. Sie wollte nicht länger die Banu Nahida sein, die Göttin, der keine Schwäche gestattet wurde.
Aber ihrer Rolle konnte sie nun mal nicht entkommen. Selbst für Kaveh war sie immer zuallererst seine Nahid und erst danach seine Geliebte und seine Freundin, und sie würde seinen Glauben daran jetzt nicht erschüttern. Daher sorgte sie dafür, dass ihre Stimme ruhig klang und ihre Augen trocken waren, als sie sich zu ihm umdrehte.
Ihm stand der Schmerz ins Gesicht geschrieben. »Du siehst wunderschön aus mit ihm in den Armen«, flüsterte Kaveh, in dessen Stimme Ehrfurcht und Schmerz mitschwangen. Er trat näher und betrachtete ihren schlafenden Sohn. »Bist du dir auch wirklich sicher?«
Manizheh strich Jamshid über den Rücken. »Das ist die einzige Möglichkeit, um zu verbergen, wer er wirklich ist. Wenn wir das jetzt nicht tun, wird er ansonsten seine Ammen heilen und dafür sorgen, dass sich seine aufgeschürften Knie im Handumdrehen schließen.«
Kaveh warf ihr einen unsicheren Blick zu. »Und falls er diese Fähigkeiten eines Tages brauchen sollte?«
Das war eine gerechtfertigte Frage. In ihren Armen sah Jamshid so winzig und zerbrechlich aus. Es gab so viele Krankheiten und Flüche, die ihn befallen konnten. Er konnte vom Pferd fallen und sich das Genick brechen. Oder er trank aus einem der vielen mit Eisen vergifteten Flüsse, die durch die dichten Wälder Zariaspas strömten.
Allerdings waren all diese Risiken weitaus weniger schlimm als das, was ihm drohte, wenn er als Nahid erkannt wurde.
Es ist schon erstaunlich, dass man den Tod einem Leben in Daevabad vorziehen konnte.
»Ich weiß nicht, was wir sonst tun sollen, Kaveh«, gab sie zu, während sie zusammen zurück ins Zelt gingen. Der Feueraltar schwelte in der Ostecke. »Ich hoffe sehr, dass ich eines Tages in der Lage sein werde, das Mal zu entfernen, aber dieser Tag ist noch lange nicht angebrochen. Offen gesagt ist diese Magie derart alt und unerforscht, dass ich nicht einmal genau sagen kann, ob sie funktionieren wird.«
»Woher werden wir wissen, ob es geklappt hat?«
Manizheh blickte auf ihren Sohn hinab und fuhr ihm mit einem Finger über das winzige, zusammengezogene Gesicht. Sie versuchte sich auszumalen, wie er mit drei Monaten aussehen würde. Oder wenn er drei Jahre alt war. Oder dreizehn. Weiter mochte sie gar nicht denken. Sie wollte nicht wirklich wahrhaben, dass sie ihn nicht aufwachsen sehen würde.
»Wenn es funktioniert, werde ich nicht in der Lage sein, seinen Schmerz zu lindern«, erklärte sie. »Und dann wird er anfangen zu schreien.«
* * *
Drei Wochen, nachdem sie ihr Baby zum letzten Mal in den Armen gehalten hatte, stand Manizheh im Thronsaal in Daevabad.
»Denn es war nun einmal so …«, beendete sie ihre erfundene Erklärung und rang nach einer Ausrede dafür, dass sie über mehrere Monate in Zariaspa aufgehalten worden war. »Meine Experimente waren zu jener Zeit viel zu aussichtsreich, als dass ich sie aufgeben konnte. Ich musste bleiben und sie zu Ende bringen.«
Einen sehr langen, angespannten Moment war es derart still im Raum, dass man eine Stecknadel hätte fallen hören können. Dann richtete sich Ghassan mit wutentbrannter Miene auf seinem Thron auf.
»Eure Experimente?«, wiederholte er. »Ihr seid in Zariaspa geblieben und habt meine Bitten und Boten ignoriert, um Eure Experimente fortzusetzen? Meine Frau, Eure Königin, ist aufgrund Eurer Experimente tot?«
Saffiyeh war nie meine Königin. Aber Manizheh wagte es nicht, das laut auszusprechen. Stattdessen zwang sie sich, ruhig stehen zu bleiben und das Schwanken zu unterdrücken. Ihre Beine und ihr Rücken schmerzten von dem langen Ritt, ihre Brüste waren geschwollen, weil der Milchfluss einfach nicht aufhören wollte, und der leichteste Druck der Wickel und Kohlblätter, die sie sich unter das Gewand gestopft hatte, um ihren Zustand zu verbergen, tat derart weh, dass ihr die Tränen kamen.
Doch sie gab sich die größte Mühe, all das zu ignorieren, und antwortete: »Ich habe Eure Nachrichten nicht rechtzeitig erhalten.« Manizheh war zu geschwächt und innerlich zu zerbrochen, als dass ihre Worte aufrichtig klingen konnten; sie hörte selbst, wie ungemein gefühllos sich ihre Erwiderung anhörte. »Andernfalls wäre ich früher zurückgekehrt.«
Ghassan starrte sie an, und man sah ihm an, dass er sich verraten fühlte. In seiner Miene stand aufrichtige Trauer, eine Emotion, die Manizheh seit sehr langer Zeit nicht mehr bei ihm bemerkt hatte. Mit jedem Jahrzehnt als Tyrann von Daevabad zeigte er weniger Gefühle, und es war, als würde ihm die Herrschaft über die Stadt jegliche Wärme aus dem Herzen entziehen.
Sie empfand keinerlei Mitleid mit ihm. Ghassan hatte sie ergreifen lassen – nun, selbstverständlich nicht im wörtlichen Sinne, denn selbst der König scheute davor zurück, andere dazu zu zwingen, sie anzufassen. Jedenfalls war sie von Soldaten umringt worden, die sie zwangen, vom Pferd zu steigen, kaum dass sie am Daeva-Tor eingetroffen war. Daraufhin lief sie zu Fuß durch das gesamte Viertel ihres Stammes zum Palast. Manizheh hatte dies getan und versucht, dabei den Kopf hoch erhoben zu halten und die Tatsache zu verbergen, dass sie nach Atem rang, weil sich die Straße die Hügel von Daevabad hinaufschlängelte. Ihr Volk hatte all das mit angesehen, mit verängstigten Gesichtern aus Fenstern und Türspalten gelugt, und Manizheh konnte nicht zulassen, dass Daeva sie straucheln sahen. Sie war ihre Banu Nahida, ihr Licht. Das war ihre Pflicht.
Als sie am Palast eintraf, den ihre Ahnen einst erbaut hatten und dessen Steine für sie sangen, war sie vollkommen am Ende. Ihre Kleidung war verschmutzt, ihr Kleid zerrissen und mit Schlamm bedeckt. Ihr Tschador war ihr auf die Schultern gerutscht und enthüllte ihr zerzaustes Haar und ihre mit Asche beschmierte Stirn. So war sie in den Thronsaal geführt worden, den heiligen Ort, an dem sich früher der Nahid-Rat zusammengefunden hatte.
Sie fragte sich, was ihre Vorfahren wohl denken würden, wenn sie sie jetzt so sehen könnten, wie sie unordentlich und schmutzig vor dem ihrer Familie geraubten Thron stand und man von ihr erwartete, dass sie sich vor den Nachfahren der Dschinn, die ihre Ahnen abgeschlachtet hatten, in den Staub warf.
Es wäre sehr weise, sich zu entschuldigen. Genau das erwartete Ghassan von ihr, wie Manizheh nur zu gut wusste. Sie hatte ihn gedemütigt. Der Hof von Daevabad war grausam und selbst seine Herrscher blieben nicht vor dem Klatsch der Höflinge verschont. Manizheh hatte dafür gesorgt, dass er schwach wirkte. War der furchterregende König von Daevabad wirklich derart mächtig, wenn ihm seine eigene Nahid trotzen konnte? Wenn diese Missachtung sogar den Tod seiner Frau zur Folge hatte? Manizheh bedauerte aufrichtig, dass Saffiyeh gestorben war. Ihr hatte sie nie feindselig gegenübergestanden, sondern vielmehr gehofft, Ghassan würde nach seiner Hochzeit sein Verlangen nach ihr aufgeben. Es hätte Manizheh rein gar nichts außer ein wenig Stolz gekostet, sich bei ihm zu entschuldigen, und eine gute Heilerin, die den unnötigen Verlust eines Lebens bereute, hätte das vermutlich auch getan.
Aber Manizheh hielt Ghassans Blick stand und war sich deutlich bewusst, dass der gesamte Hof sie anstarrte. Sein Qaid Wajed, ebenfalls ein Geziri-Dschinn. Sein Ayaanle-Großwesir. Obwohl Ghassan großspurig behauptete, die Beziehungen zwischen den Daeva und den Dschinn-Stämmen verbessern zu wollen, befand sich unter all jenen, die Manizheh nun beäugten, kein einziger Daeva. Zudem wirkten diese Dschinn auch gar nicht, als würden sie trauern. Sie kamen ihr eher begierig vor. Hungrig. Alle schienen zu frohlocken, dass eine hochnäsige »Feueranbeterin« an ihren Platz verwiesen wurde.
Wir sind besser als ihr. Ich bin besser als ihr. Nicht zum ersten Mal war Manizheh versucht, dem in ihr tobenden Zorn nachzugeben. Wahrscheinlich wäre sie in der Lage gewesen, der Hälfte der Männer, die sie gerade höhnisch angrinsten, die Knochen zu brechen, um dann die Decke einstürzen zu lassen, damit alle darunter begraben wurden.
Doch sie war in der Unterzahl und wusste zudem genau, dass jeder Daeva in der Stadt für eine solche Tat mit dem Tod büßen müsste. Zuerst würde man sie mit den Waffen jedes noch lebenden Mannes attackieren, um danach Rustam und im Anschluss Nisreen, ihre treueste Freundin und Assistentin, hinzurichten. Die Priester im Tempel und die Kinder in der Schule wären die Nächsten. Das Blut der Unschuldigen würde ihr Viertel schwarz färben.
Daher senkte Manizheh den Blick. Aber sie entschuldigte sich nicht. »Sind wir hier fertig?«, fragte sie stattdessen eisig.
Ghassans Wut war nicht zu überhören. »Nein. Aber Ihr werdet zweifellos in der Krankenstube von all den anderen Patienten gebraucht, die Ihr im Stich gelassen habt. Hinfort mit Euch.«
Hinfort mit Euch. Der erniedrigende Befehl hallte in ihr wider. Manizheh drehte auf dem Absatz um.
Ghassan war jedoch noch nicht fertig. »Ihr werdet diesen Palast nie wieder verlassen«, erklärte er ihrem Rücken. »Wir wünschen nicht, dass Euch etwas zustößt.«
Ihre Hände brannten vor Magie. Nur ein Fingerschnippen. Würde es ausreichen, um seine Schädelknochen zu zertrümmern?
Sie straffte die Schultern und entspannte die Hände. »Verstehe.«
Klatsch hallte über die Köpfe hinweg, als sie sich einen Weg durch die Menge zur Tür bahnte. Die metallfarbenen Augen der Dschinn musterten sie feindselig und vorwurfsvoll. Sie hörte, wie sie als herzlose Hexe bezeichnet wurde. Als eifersüchtig und grausam. Als eingebildet. Als Schlampe.
Als Feueranbeterin.
Manizheh hielt den Kopf hoch erhoben und trat durch die Tür.
Außerhalb des Thronsaals wurde es allerdings nicht einfacher. Mitten am Tag wimmelte es im Palast von Sekretären und Ministern, Adligen und Gelehrten. Ihr schmutziger Tschador hing noch immer auf ihren Schultern, daher erkannte man Manizheh auf den ersten Blick, und sie mochte sich gar nicht ausmalen, wie schlimm sie aussehen musste, während sie schmutzig und ohne Eskorte durch den Palast marschierte, nachdem sie von ihrem rechtmäßigen, gläubigen König gemaßregelt worden war. Der Lärm im Korridor erstarb und alle blieben stehen und starrten sie an.
Zwei Daeva auf der anderen Seite des Flurs kamen mit besorgten Mienen auf sie zu. Manizheh sah ihnen in die Augen und schüttelte leicht den Kopf. Die beiden konnten ihr nicht helfen und sie wollte keinen aus ihrem Stamm in noch größere Gefahr bringen. Stattdessen stellte sie sich dem Geflüster allein. Sie sei eiskalt, zischten die Leute. Sie sei böse. Sie hätte Saffiyeh, die Gütigste aller Königinnen, im Grunde genommen ermordet, nur um in Ghassans Bett zurückkehren zu können.
Das Brennen ging auf ihre Arme und ihren Hals über. Vor Manizhehs Augen verschwamm alles. Sie konnte jeden Stein spüren, jeden Tropfen Nahid-Blut, der an diesem Ort vergossen worden war. Wussten die anderen überhaupt, wie viel sie und ihr Volk geopfert hatten, damit die Dschinn jetzt hier stehen und über sie urteilen konnten?
Natürlich nicht.
Da sie sich bewusst war, dass die Palastmagie ihren Zorn einfach übernehmen und daraus etwas erschaffen würde, das sie bereuen würde, wenn sie sich nicht rasch wieder beruhigte, hielt Manizheh schwer atmend auf den ersten Eingang zum Garten zu, an dem sie vorbeikam. Sie schien den Wachmann zu erschrecken, der bei ihrem Anblick zusammenzuckte, sich jedoch rechtzeitig erholte, um die Tür zuzuknallen und zu verriegeln, kaum dass Manizheh hinausgegangen war.
Manizheh sackte mit dem Rücken gegen die Steinmauer und schlug die Hände vors Gesicht. Ihr tat der ganze Körper weh. Auch ihre Seele schmerzte. Sie fühlte sich leer und ausgebrannt, als sei nichts als eine Hülle mehr übrig. Alles, was sie in der Finsternis ihrer Gedanken sehen konnte, waren Jamshid und Kaveh, so wie sie die beiden verlassen hatte: Der Mann, den sie liebte, hielt ihr gemeinsames verbotenes Kind in den Armen und stand inmitten von Ruinen und Frühlingsblumen. Sie hörte noch immer Jamshids Weinen, als sie ihm das Mal auf die Schulter tätowiert und ihm so sein Erbe genommen hatte. Dieses Geräusch hallte seit ihrer Abreise in ihren Ohren wider. Hicksende Schreie und gedämpftes Schluchzen, wieder und immer wieder.
Auf einmal erstarrte Manizheh. Das war nicht etwa die Erinnerung an Jamshids Weinen, das sie da hörte. Vielmehr weinte dort in dem üppigen Grün ein anderes Kind.
Sie zögerte. Dies war die verwilderte Ecke des Gartens, die seit Jahrhunderten sich selbst überlassen blieb und nun praktisch einem wilden Dschungel glich. Die hoch aufragenden Bäume waren höher als die Palastmauern, Dornenranken überwucherten die Wege, und das Unterholz war derart dicht, dass sich auf dem Waldboden eine Schicht aus verrottendem Laub und Moos gebildet hatte, auf der man leicht ausrutschen konnte. Hier floss der Kanal, der durch den Palast verlief, nahezu lautlos und so unergründlich tief, dass jedes Jahr mindestens eine Person im dunklen Wasser ihr Leben ließ. Da dies Daevabad war, erwies sich nicht allein die Natur als gefährlich. Die Palastmagie, die durch ihre Venen rann, hatte sich inmitten der schweigenden Bäume schon immer am gnadenlosesten erwiesen. Es war, als sei etwas Uraltes und Verletztes unter dem Boden vergraben, das sich vom Blut und Leid der Jahrtausende ernährte.
Dementsprechend machte jeder, der nur etwas Verstand besaß, einen großen Bogen um diesen Teil des Gartens. In diesen Wäldern geschahen Dinge, die die Dschinn schlichtweg nicht verstanden. Eine zuvor dürre Katze war als Tiger mit gläsernen Zähnen und Schlangenschwanz wiederaufgetaucht. Die Schatten lösten sich angeblich vom Boden und verschluckten alle unaufmerksamen Wanderer. Um dieses Gebiet rankte sich eine Mischung aus Gerüchten und echter Magie, wobei sich die Grenze zwischen den Geschichten, die man erzählte, um Kinder in Angst und Schrecken zu versetzen, und den Dienern, die tatsächlich verschwanden, schwer bestimmen ließ.
Diese Geschichten hatten Manizheh jedoch niemals Angst eingejagt. Bis jetzt. Gut, sie war eine Nahid und die Magie des Palastes hatte ihr nie geschadet. Aber sie konnte sich nicht vorstellen, was ein Kind hierhergelockt haben sollte, und einen Augenblick lang fragte sie sich, ob dieses Geräusch nur ein Trick war, eine grausame, persönliche Peinigung.
Doch das tränenreiche Schluchzen hörte nicht auf, mochte es nun echt sein oder ein Trick. Zunehmend besorgt folgte sie dem Geräusch und rechnete schon beinahe damit, einen monströs großen Vogel vorzufinden, der diese Schreie ausstieß.
Allerdings stand sie kurz darauf nicht etwa vor einem Vogel. Vielmehr hielt sich unter einer gewaltigen Zeder, deren Wurzeln derart verworren waren, dass man schon sehr klein sein musste, um sich darunterzwängen zu können, ein Junge auf. Er lag zusammengekrümmt auf dem moosbedeckten Boden und drückte sich die Knie an die Brust, während sein ganzer Körper von Schluchzern geschüttelt wurde. Seine feine Kleidung fiel selbst in diesem schwachen Licht auf. An den Stellen, an denen seine Baumwoll-Dishdasha nicht mit Blättern oder Erde beschmutzt war, schimmerte sie so weiß, dass sie förmlich glänzte. Die Schärpe um seine Taille war aus Seide; Bronze und Indigo bildeten ein Muster auf kupferfarbenem Grund. Goldene Ringe an seinen Unterarmen und Ohren, Perlen um seinen Hals. So etwas trugen kleine Jungen, die draußen spielten, üblicherweise nicht – ganz gewiss nicht ihr Sohn, den man in selbst gesponnene Wolle und geflickte Mützen kleiden würde, während er die kalten Winter in Zariaspa ertrug.
Andererseits war der kleine Junge vor ihr auch nicht so wie die meisten anderen. Dies war der nächste Dschinn-König.
Allerdings verhielt er sich äußerst töricht. Denn man sah auf den ersten Blick, dass der junge Muntadhir al Qahtani allein und unbewaffnet war und somit gleich zwei Fehler auf einmal begangen hatte. Sie konnte sich nicht vorstellen, was den verhätschelten kleinen Prinzen dazu bewogen hatte, sich weinend im Dschungel zu verkriechen.
Kannst du das wirklich nicht? Schließlich war Manizheh selbst ein Königskind gewesen und hatte früh lernen müssen, ihre Gefühle zu verbergen. Im Palast waren Emotionen Schwächen, die andere ausnutzten, um einem zu schaden. Außerdem war Muntadhir nicht nur der Sohn des Königs, sondern entstammte auch einer Familie von Kriegern und einem Volk, das sich für seine Zähigkeit pries. Er war ganz gewiss alt genug, um zu wissen, was ihn erwartete, wenn er an einem Ort trauerte, an dem man ihn sehen konnte.
Allerdings würde er auch ganz gewiss von einer Schattenkreatur gefressen, wenn er sich noch lange hier draußen aufhielt, und auch das würde man den Nahid-Geschwistern ankreiden, daher trat Manizheh vor. »Friede sei mit dir, kleiner Prinz.«
Muntadhir schrak zusammen und hob ruckartig den Kopf. Er hatte gerade mal die feuchten Augen auf sie gerichtet, da riss er sie vor lauter Furcht auch schon weit auf. Rasch sprang er auf die Beine und wich zurück, bis er sich gegen den Baumstamm presste.
Manizheh hob die Hände. »Ich will dir nichts tun«, versicherte sie ihm sanft. »Aber das hier ist kein sicherer Ort.«
Der Prinz blinzelte nur. Er war ein wunderschönes Kind mit großen, leuchtenden grauen Augen und langen dunklen Wimpern. Ein Hauch von Rost schimmerte in seinen schwarzen Locken, die ihm in perfekten Wellen bis fast auf die Schultern fielen. Aus der Nähe konnte Manizheh erkennen, dass winzige Amulette aus sandgestrahltem Glas an seiner Kleidung angebracht waren. Eine Kette aus ähnlichen Materialien hing um seinen Hals, wobei die hellen Glasperlen hier mit welchen aus Holz und Muscheln vermischt waren und einen Anhänger aus gehämmertem Kupfer umgaben. Dieser Anhänger war vermutlich gefüllt mit heiligen Versen, die man auf winzige Papierstreifen geschrieben hatte. Ein ländlicher Aberglaube, um den jungen Adligen vor allerlei Bösem zu schützen. Seine Mutter stammte aus einer kleinen Küstensiedlung, und wenngleich Manizheh Saffiyeh als scheu und ruhig empfunden hatte, so musste sie doch zugeben, dass sie ihren Sohn mit allem, was ihr zur Verfügung stand, zu beschützen versucht hatte.
Nun war sie tot. Muntadhir stand wie erstarrt da, als sei er ein Kaninchen im Angesicht eines Falken.
Manizheh kniete sich hin, um weniger bedrohlich zu wirken. Auch wenn die Dschinn das anders sahen, hätte sie doch nie einem Kind etwas zuleide getan. »Das mit deiner Mutter tut mir sehr leid, mein Kleiner.«
»Warum habt Ihr sie dann getötet?«, fuhr Muntadhir sie an. Er wischte sich die laufende Nase am Ärmel ab und fing erneut an zu weinen. »Sie hat Euch nie irgendwas getan. Sie war gut und freundlich … Sie war meine Amma«, stieß er schluchzend hervor. »Ich brauche sie.«
»Das weiß ich und es tut mir schrecklich leid. Ich habe meine Mutter ebenfalls verloren, als ich noch sehr jung war.«
Wobei verloren eine auf schreckliche Weise zutreffende Bezeichnung war, denn Manizhehs Mutter gehörte zu den vielen Daeva, die unter der brutalen Regentschaft von Khader, Ghassans Vater, einfach verschwunden waren. »Und ich weiß, dass es dir jetzt unmöglich vorkommt, aber du wirst diesen Verlust überleben. Sie hätte sich gewünscht, dass du das schaffst. Hier gibt es viele, die dich lieben, und sie werden sich um dich kümmern.« Der letzte Teil fühlte sich für sie wie eine Lüge an oder jedenfalls nicht wie die ganze Wahrheit. Die traurige Tatsache war, dass man sich durchaus um den mutterlosen jungen Prinzen scharen würde, allerdings aus vielerlei ganz eigennützigen Gründen.
Muntadhir starrte sie einfach nur an und wirkte vollkommen verloren. »Warum habt Ihr sie umgebracht?«, flüsterte er noch einmal.
»Das habe ich nicht getan«, erwiderte Manizheh und achtete darauf, dass ihre Stimme sanft, aber entschieden klang. »Deine Amma war sehr krank. Die Nachricht deines Vaters traf nicht rechtzeitig bei mir ein, aber ich hatte ganz gewiss nicht die Absicht, ihr zu schaden. So etwas würde ich niemals tun.«
Muntadhir trat etwas näher an sie heran. Dabei umklammerte er einen der dick mit Moos bewachsenen Äste, die zwischen ihnen herabhingen, und das so fest, dass seine Fingerknöchel weiß hervortraten. »Sie haben gesagt, dass Ihr so etwas sagen würdet. Sie haben gesagt, dass Ihr mich anlügen werdet. Dass die Daeva nichts anderes tun, als zu lügen. Sie haben gesagt, du hättest sie getötet, damit du meinen Vater heiraten kannst.«
Es war eine Sache, derart bigotte Worte aus dem Mund erwachsener Höflinge zu hören, aber eine ganz andere und viel schlimmere, wenn sie von einem trauernden Kind ausgesprochen wurden. Manizheh verschlug es die Sprache, als sie den anklagenden Blick des Jungen auf sich spürte. Muntadhir stand nun aufrecht vor ihr und war durch und durch der zukünftige Emir.
»Ich werde eines Tages dafür sorgen, dass du stirbst.« Der Qahtani-Prinz zitterte, als er das sagte, doch er tat es trotz allem, als würde er eine neue Fähigkeit ausprobieren, die es noch zu meistern galt. Bevor sie auch nur etwas erwidern konnte, war er schon tiefer in den Wald hinein geflüchtet.
Manizheh sah ihm hinterher. Muntadhir wirkte vor dem nebelumwölkten dunklen Unterholz so klein. Einen flüchtigen Moment lang wünschte sie sich, der Prinz würde vom Dschungel verschluckt werden. Dass die Natur sich um die Gefahr kümmerte, von der sie wusste, dass sie nur weiter schwären und wachsen würde.
Genau aus diesem Grund hast du Jamshid zurückgelassen. Es mochte ihr das Herz gebrochen haben, ihren Sohn aufzugeben, aber so musste er wenigstens nicht an diesem grässlichen Ort aufwachsen.
Sie zwang sich weiterzugehen, war aber schon bald erschöpft, da ihr die feuchte Hitze die letzte Kraft nahm, die ihr noch geblieben war. Ihre Beine zitterten und dazwischen machte sich eine neue Feuchtigkeit bemerkbar. Obwohl Jamshids Geburt Wochen her war, blutete sie hin und wieder noch. Manizheh hatte keine Ahnung, ob das normal war, und sie wusste auch nicht, ob der Körper einer Nahid anders auf eine Geburt reagierte. Als sie alt genug gewesen war, um derartige Fragen zu stellen, hatte es keine Nahid-Frauen mehr gegeben, die sie ihr beantworten konnten.
Ihr Schmerz war jedoch nicht von Bedeutung. Denn je näher sie der Krankenstube kam, desto offensichtlicher wurde, dass ein anderer Nahid sie brauchte.
Wenn die Magie des Palastes Manizheh vereinnahmt hatte, dann war der überwucherte Dschungel Rustams Reich. Ihr kleiner Bruder war nie ein so guter Heiler gewesen wie sie – eigentlich konnte es niemand mit ihren Heilkräften aufnehmen –, aber in Bezug auf Pflanzen war er ein wahrer Gelehrter, und der Garten war so auf ihn eingestimmt wie ein loyaler, liebevoller Hund auf sein Herrchen.
Nun schien er jedoch wild geworden zu sein. Neue Efeuranken und gewaltige trompetenartige Blüten breiteten sich überall aus, und das helle Grün frischen Wachstums ließ sich nicht übersehen. Schon lange bevor er zu sehen war, konnte Manizheh Rustams geliebten Orangenhain riechen – der viel zu süße Duft von überreifen Zitrusfrüchten und Verwesung hing in der Luft.
Ihr stockte der Atem, als sie um die Wegbiegung kam. Der Garten der Krankenstube sah aus, als seien ihm ein Dutzend Wachstumstränke verabreicht worden. Hüfthohe Silberminzbüsche hatten nun die Größe von Bäumen und standen neben Rosen mit tellergroßen Blüten, deren Dornen als Dolche dienen konnten. Rustams Obstgarten, seine Freude und sein ganzer Stolz, war völlig außer Rand und Band und kauerte wie eine wartende Spinne über dem restlichen Garten. Die Explosion an Früchten musste selbst die Freiwilligen, die sonst alle überschüssigen Exemplare für die Vorratskammern des Tempels einsammelten, überfordert haben, da unzählige Orangen faulend auf dem Boden lagen.
Manizheh bahnte sich einen Weg zwischen dem Unkraut hindurch, so schnell sie konnte – was aufgrund ihres Zustands einige Zeit dauerte. Ihr Kopf dröhnte und eine Ascheschicht bedeckte ihre Haut. Ihren Tschador hatte sie inzwischen verloren, er war irgendwo an einem Baum hängen geblieben, und ihr schmutziges Haar fiel ihr auf die Schultern. Als sie den Pavillon gerade erreicht hatte, schoss ein stechender Schmerz durch ihr Becken. Sie krümmte sich und unterdrückte einen Schrei.
»Meine Dame!«
Manizheh blickte auf und sah, wie Nisreen die medizinischen Instrumente fallen ließ, die sie gerade in der Sonne zum Trocknen auslegen wollte, um sogleich zu Manizheh zu eilen.
»Banu Nahida …« Nisreen stockte und blickte mit besorgten Augen auf Manizheh herab, wobei man ihr das Entsetzen deutlich anmerkte.
Manizheh biss die Zähne zusammen, als der Schmerz abermals durch ihren Unterleib tobte. Atmen. Einfach atmen. »Wo ist Rustam?«, stieß sie mühsam hervor.
»Er ist mitten in einer Behandlung. Er hatte bereits damit angefangen, als wir von Eurer Rückkehr erfuhren.«
»Geht es ihm gut?«
Nisreen machte den Mund auf und klappte ihn wieder zu, während sie sichtlich nach einer Antwort rang. »Er ist am Leben.«
Das war nicht beruhigend. Manizheh wusste, dass er noch lebte. Ghassan konnte es nicht riskieren, seinen einzigen Nahid umzubringen, solange sie noch nicht wieder zurück war. Allerdings gab es sehr viele andere Dinge, die er Rustam antun konnte.
»Ihr braucht Hilfe, werte Dame«, beharrte Nisreen. »Ich bringe Euch in den Hammam.«
Manizheh presste sich die Faust fester gegen den Bauch. Im Augenblick war sie sich nicht sicher, ob sie es bis zum Hammam schaffen würde, geschweige denn, ob sie sich dort reinigen konnte, ohne in Ohnmacht zu fallen. Außerdem würde man ihrem Körper sofort ansehen, was passiert war, sobald sie sich entkleidete.
Sie sah Nisreen in die Augen, ihrer Assistentin, der Frau, die Manizheh am ehesten als ihre Freundin bezeichnet hätte. Wichtiger vielleicht noch: der Frau, die lieber in den Tod gehen würde, bevor sie eine Nahid verriet. Daher zögerte Manizheh nur einen Moment, bevor sie Nisreens ausgestreckten Arm nahm und sich schwer darauf stützte.
»Mich darf sonst niemand sehen«, raunte Manizheh ihr zu. »Sobald wir den Hammam erreichen, musst du dafür sorgen, dass niemand dort ist. Und du musst die Tür hinter uns verriegeln.«
»Ich soll die Tür verriegeln?«
»Ja. Ich brauche deine Hilfe, meine Liebe. Aber noch viel wichtiger ist dein Schweigen.«
* * *
Im Bad verlor Manizheh zwar nicht das Bewusstsein, war jedoch so benommen, dass sie trotzdem kaum etwas mitbekam. Die Zeit verschwamm in einer verworrenen Mischung aus Dampf und heißem Wasser, dem Geruch von Rosenseife und altem Blut. Nisreen ging sanft und ruhig zu Werke. Nachdem sie Manizheh die staubige Kleidung abgenommen hatte, war sie kurz ins Zögern geraten, nur um dann so verlässlich wie immer vorzugehen. Während sie gebadet und abgeschrubbt wurde und sich das Wasser zu einem hässlichen Grau verfärbte, weinte Manizheh möglicherweise, und die Tränen rannen ihr mit dem Seifenschaum über die Wangen. Sie war sich nicht sicher und es war ihr auch egal.
Sobald sie jedoch in ihrem vertrauten Bett lag, schlief sie sofort ein und fiel in einen langen, traumlosen Schlaf. Als sie wieder erwachte, war es dunkel im Zimmer, abgesehen vom schwachen Leuchten ihres Feueraltars und einer kleinen Öllampe neben dem Bett.
Sie war nicht allein. Ihre Nahid-Sinne bemerkten den Herzschlag und das Atmen einer anderen Person ebenso mühelos, wie sie sie bei besserem Licht gesehen hätte. Desorientiert wollte sich Manizheh aufsetzen, was aber neuen Schmerz in ihrem Bauch hervorrief.
»Es ist alles in Ordnung«, versicherte ihr eine leise Stimme. »Ich bin es bloß.«
»Rustam?« Manizheh blinzelte. Ihr Bruder erschien in Form verschwommener Bruchstücke vor ihr – die schwarzen Augen, die sie gemeinsam hatten, und das helle Weiß seines Schleiers.
»Im Augenblick eher der Baga Nahid.« Rustam legte ihr ein weiteres Kissen unter den Kopf und hielt ihr einen Becher mit einem übel riechenden Gebräu an die Lippen. »Trink das.«
Manizheh gehorchte. Wenn einem Rustam e-Nahid persönlich einen Trank braute, dann nahm man ihn ohne Widerrede zu sich. Die Erleichterung überkam sie derart schnell, dass es Manizheh die Kehle zuschnürte. Die Schmerzen, die Schwellungen am ganzen Körper und ihre dröhnenden Kopfschmerzen ließen sogleich nach.
»Der Schöpfer segne dich«, krächzte sie heiser.
»Du solltest etwas essen«, sagte er. »Und trink auch ein bisschen Wasser.«
Sie nahm den neuen Becher entgegen, den er ihr reichte, schüttelte allerdings den Kopf, als er ihr einen kleinen Teller mit geschnittenem Obst und Brot anbot. »Ich habe keinen Hunger.«
»Du musst etwas essen, Manu. Dein Körper ist schwach.« Rustam wollte ihre Hand nehmen.
Aber Manizheh zog sie weg, bevor er sie berühren konnte. »Ich sagte doch schon, dass ich keinen Hunger habe.«
Kurz schwiegen sie sich an. Sie konnte ihn noch immer nicht gut erkennen. Er senkte wie immer den Kopf. Rustam sah anderen nur noch selten in die Augen, und wenn er es tat, fiel es ihm schwer, den Blickkontakt zu halten.
Erneut ergriff er das Wort. »Ich mag vielleicht nicht deine Talente besitzen, Schwester, aber ich bin ebenso ein Nahid wie du. Ich muss deine Hand nicht berühren, um zu wissen, was passiert ist.«
Wieder kamen ihr die Tränen. Vor Jamshids Geburt hatte Manizheh viele Jahre nicht geweint. »Es ist gar nichts passiert. Mir geht es gut. Ich habe nur eine harte Reise hinter mir.«
»Manizheh …«
»Es war eine harte Reise«, wiederholte sie energisch. »Hast du das verstanden? Es gibt nichts, worüber wir reden müssen. Nichts, was du wissen solltest. Für etwas, das du nicht weißt, kann man dich nicht bestrafen.«
»Wir wissen beide, dass das nicht stimmt.« Rustam schnippte mit den Fingern, und die Öllampe brannte heller und ließ wilde Schatten durch den Raum tanzen. »Trag diese Last nicht allein. Das kannst du nicht. Nicht diesmal.«
»Es gibt nichts zu erzählen.«
»Und ob es das gibt! Du kannst nicht ein Jahr lang verschwinden und dann wiederauftauchen, nachdem du ein …«
Der ganze Raum bebte. Eine Hitzewoge traf sie, und die Flammen des Feueraltars loderten auf, versengten die Decke und ließen Rustams Zaubertrick wie den eines Kindes aussehen.
»Wenn du diesen Satz beendest, wird er der letzte sein, den du jemals sagst«, warnte sie ihn. »Hast du das verstanden?«
Rustam nahm ihr den leeren Becher aus der Hand und zitterte sichtlich. Seine Hände bebten immer, wenn er Angst hatte, ein Leiden, das er nicht kontrollieren konnte und das im Laufe der Jahre immer schlimmer wurde. In Ghassans Gegenwart konnte er kein Objekt festhalten, ohne dass es klapperte, und wenn sie an öffentlichen Veranstaltungen teilnehmen mussten, umwickelten Manizheh und er seine Handgelenke mit verknoteten Lumpen, an denen er sich festklammern konnte, um halbwegs ruhig zu wirken.
Doch jetzt hatte Manizheh ihn zum Zittern gebracht. Ihr war keine andere Wahl geblieben, denn er war töricht genug, solche Worte offen auszusprechen, obwohl Ghassan überall Augen und Ohren versteckte. Reue überkam sie.
»Bitte entschuldige, Rustam. Ich muss einfach nur …«
»Ich habe verstanden«, fiel er ihr ins Wort. »Dass du mich bedrohst, ist mir Antwort genug.« Er öffnete und schloss die Fäuste und presste die Hände auf die Knie, während er versuchte, wieder die Kontrolle zu gewinnen. »Ich hasse das«, flüsterte er. »Ich hasse sie. Dass ich dich nicht einmal fragen kann, ob …«
»Ich weiß.« Sie nahm seine Hand. »Darf ich dich etwas fragen?«
»Natürlich.«
»Würdest du das, was ich dir nicht erzählen kann, in deine Gebete einschließen?«
Abermals sah Rustam ihr in die Augen. »Ich werde es jeden Tag tun, Schwester.«
Er blickte sie so ernst an, dass Manizheh sich noch schlimmer fühlte. Sie wollte es ihm erzählen. Sie wollte sich mit ihm unter ihre Decke kuscheln, so wie sie es als Kinder getan hatten, und mit ihm weinen. Sie wollte, dass ihr ein anderer Nahid sagte, alles würde wieder gut werden. Dass Ghassan fallen würde und sie ihren Sohn wiedersehen konnte. Dass sie den von ihr gewirkten Zauber rückgängig machen und nach Daevabad zurückkehren würde, damit sie zusammen regieren konnten, so wie es ihrer Familie gebührte.
Aber ihr kleiner Bruder sah schrecklich aus. Rustam zitterte noch immer und seine blasse Haut hatte eine kränkliche gelbe Farbe angenommen. Die Ringe unter seinen Augen traten so deutlich hervor, als sei er geschlagen worden, und er hatte Gewicht verloren. Mehr konnte sie von seinem Gesicht nicht erkennen. Rustam nahm den Schleier so selten ab, dass sie ihn manchmal daran erinnern musste, wenn sie allein waren, und Manizheh wusste auch, dass er dies nicht allein aus Frömmigkeit tat. Er hatte sich nach innen gewandt, um in Daevabad zu überleben, sich hinter jede Mauer zurückgezogen, die er errichten konnte, um tief in seinem Inneren einen Ort zu errichten, wo er vor allen sicher war.
Allein daran sah sie, was ihr Bruder in dem Jahr ihrer Abwesenheit hatte durchmachen müssen. Es würde keine anderen Hinweise geben. Die gab es nie. Rustams Knochen heilten, wenn Ghassans Schergen sie brachen, ebenso die Wunden der Peitschen und die Verbrennungen durch Säure. Ghassan legte nie Hand an Manizheh und das musste er auch gar nicht. Er hatte schon vor langer Zeit gelernt, dass er nur ihren Bruder schlagen musste, damit sie sich ihm im Handumdrehen unterwarf. Doch nicht alle unsichtbaren Male stammten von Ghassan. Die an Rustams Handgelenken erzählten eine ganz andere Geschichte. Rustam hatte mehr als einmal versucht, sich das Leben zu nehmen, doch so etwas ließ sich für einen Nahid nur sehr schwer bewerkstelligen. Sein letzter Versuch – mithilfe von Gift – war Jahre her, und damals hatte Manizheh ihn wieder zurückgeholt. Er hatte sie angefleht, ihn sterben zu lassen, und sie war auf die Knie gefallen und hatte ihn angefleht, bei ihr zu bleiben.
Das war das letzte Mal, dass sie vor Jamshids Geburt geweint hatte.
Sie würde sich nicht länger auf Rustam stützen. Stattdessen bemühte sich Manizheh um eine energischere Miene. »Könntest du mir aus der Küche einen Ingwertee bringen lassen?«, bat sie ihren Bruder. »Damit kann ich meinen Magen bestimmt weit genug beruhigen, um ein paar Bissen herunterzubekommen.«
Er sah sie erleichtert an. Ah, ja, sie kannte den Blick eines Heilers, der sich über eine machbare Aufgabe freute. »Selbstverständlich.« Rustam stand auf und fummelte in den Taschen seiner Robe herum. »Ich habe dir etwas mitgebracht. Ich weiß, dass du ihn lieber verstecken möchtest, aber ich dachte … Ich dachte, er spendet dir vielleicht etwas Trost.« Er legte ihr ein kleines, hartes Objekt in die Hand und schloss ihre Finger darum, bevor er einen Schritt zurücktrat. »Mögen die Feuer hell für dich brennen, Manu.«
Manizhehs Brustkorb zog sich zusammen. Sie wusste ganz genau, was sie da in der Hand hielt. »Für dich auch, geliebter Bruder.«
Er verbeugte sich und eilte hinaus. Manizheh lehnte sich im Bett zurück und krümmte sich. Erst als sie hörte, wie die Tür ins Schloss fiel, befahl sie den Flammen, sich zurückzuziehen, sodass der Raum erneut in Dunkelheit getaucht war.
Danach steckte sie sich den uralten Ring, den Rustam ihr gegeben hatte, an den Finger. Das Band war arg in Mitleidenschaft gezogen worden. Manizheh kannte jede einzelne Delle und Schramme, denn es gab kein Objekt, dem sie mehr Aufmerksamkeit geschenkt hatte als diesem Ring, der die einzige Hoffnung ihres Volkes auf Erlösung darstellte.
»Bitte komm zurück«, flüsterte sie. »Bitte rette uns.«
DURIYA
Diese Szene spielt etwa ein Jahr nach der vorherigen und enthält Spoiler für alle drei Bücher.
Mit spitzen Fingern hob die die Dschinn-Frau eine der frisch gewaschenen Bandagen hoch, als würde sie eine Spinne halten, und verzog das Gesicht. »Soll das ein Witz sein?«
Duriya beäugte den Verband, der ihrer Meinung nach durchaus brauchbar aussah. Sie hatte ihn in so heißem Wasser geschrubbt, dass ihre Hände ganz rissig waren, und anschließend in der Sonne trocknen lassen.
»Ich kann Euch nicht folgen, Herrin«, erwiderte sie und gab sich die größte Mühe, möglichst eingeschüchtert zu wirken. So etwas tat sie nur sehr ungern, doch sie hatte schon vor langer Zeit gelernt, dass sie in Gegenwart dieser Dämonen auf ihren Ton achten musste. Es gab wenig, was ein Dschinn mehr genoss als die Möglichkeit, einen »Schlammblütigen« zu maßregeln.
»Sie sind immer noch feucht. Kennst du denn nicht einmal den Unterschied zwischen trockenem und feuchtem Stoff? Wenn ich sie so weglege, fangen sie an zu schimmeln. Entweder erklärst du Banu Manizheh, warum ihre Vorräte Schimmel ansetzen, oder du wäschst sie noch mal.«
Die Frau warf den Lappen nach Duriya. Duriya fing ihn auf und starrte die Wäsche, die sie eben hereingeholt hatte, verzweifelt an. Eigentlich hatte dies der letzte Korb für heute sein sollen, bevor sie nach Hause gehen durfte.
»Vielleicht hätte ich sie etwas länger in der Sonne trocknen lassen sollen«, gab Duriya geknickt zu. »Ich habe sie wirklich eben erst von der Leine genommen. Sie waren noch gar nicht …«
Mit einem schnellen Tritt kippte die Dschinn-Frau den Korb um, sodass sich die Bandagen überall auf dem Boden der Krankenstube verteilten. Allerdings war der Fußboden hier alles andere als schmutzig – nichts in der Krankenstube oder an den furchterregenden Bewohnern war schmutzig. Die kleine Armee aus Shafit-Dienern, zu der Duriya gehörte, verbrachte Tag und Nacht damit, die Böden zu wischen, die Wäsche zu waschen und Flecken zu beseitigen. Die magischen Patienten darin – und erst recht die Knochenbrecher mit den ebenholzfarbenen Augen, die sie behandelten – durften auf gar keinen Fall auch nur einen Moment lang unhygienischen Bedingungen ausgesetzt werden.
Ich wüsste zu gern, ob sie auch nur ahnen, dass die Dienstboten, bei denen sie sich darauf verlassen, dass sie ihre Räume derart gründlich putzen, bei jedem Regen im Shafit-Viertel durch Abwasser waten müssen. Und ich wüsste gern, ob sie das überhaupt schert. Nichts davon war von Belang. Die Regeln der Krankenstube waren unumstößlich.
Duriya senkte den Kopf. »Ja, Herrin.« Dann sammelte sie die Wäsche wieder ein und ging.
Es war ein unfassbar schöner Tag mit strahlend blauem Himmel und in den Bäumen zwitscherten juwelenfarbene Vögel ihre verträumten Lieder. Aber Duriya zog ihren Schal enger ums Gesicht, als sie den Flügel, in dem sich die Krankenstube befand, verließ und über die abgelegenen Wege in Richtung Kanal marschierte. Es war klug, keinerlei Aufmerksamkeit zu erregen, wenn man allein im Palast herumlief, denn nur sehr wenige Dschinn kamen einer Shafit-Dienstbotin zu Hilfe. Das war eine der Gefahren, die die Arbeit hier mit sich brachte, ein Handel, den man für das verhältnismäßig gute Gehalt einer Position im Palast notgedrungen einging.
Die Risiken, die Duriya zu befürchten hatte, wurden immer zahlreicher. Bei ihrer ersten Stelle im Palast hatte sie Königin Saffiyeh und ihrem kleinen Sohn, dem Erben des Dschinn-Throns, gedient. Die Königin war eine Frau der leisen Töne und gütig gewesen, eine der wenigen Dschinn, die sich die Mühe machten, sich die Namen ihrer Shafit-Diener zu merken und sich um ihr Wohlergehen zu sorgen. Dort hatte sich Duriya sicher gefühlt; niemand rührte ein Dienstmädchen an, das die Farben der Königin trug.
Doch nun war die Königin tot, und Duriya bezweifelte, dass ihre neuen Nahid-Herren ihr Gesicht inmitten der anderen Shafit-Waschfrauen überhaupt bemerkt hatten oder sich um ihre Sicherheit sorgten. Oder gar um ihr Leben. Shafit wurden vor vielen Dingen gewarnt, wenn man sie nach Daevabad schleifte, doch diese Warnung war die wichtigste: Nimm dich vor den schwarzäugigen Dschinn in Acht, die sich Daeva nennen.
Über diese Daeva kursierten grausame Geschichten. Angeblich lebten sie abseits der anderen Dschinn und beteten Flammen an anstelle von Gott. Duriya war gewarnt worden, niemals einem Daeva in die Augen zu sehen, niemals in ihrer Gegenwart zu sprechen, wenn sie nicht dazu aufgefordert worden war, und niemals, auf gar keinen Fall einen Daeva zu berühren – Shafit hatten schon für weitaus weniger eine Hand verloren. Zudem waren ihre neuen Nahid-Herren nicht nur Daeva, sondern deren Anführer. Die Letzten einer uralten Dynastie, die den Gerüchten zufolge Krieg geführt hatte, um die Shafit auszurotten. Eine Armee aus mit Magie aufgerüsteten Kriegern, die sechzig Pfeile gleichzeitig abschießen und ganze Städte auslöschen konnte, hatte sie dabei unterstützt.
Duriya war sich nicht sicher, ob sie die Gerüchte glauben sollte, schließlich war dies eine Stadt der Lügen. Aber die ständige Anwesenheit bewaffneter Soldaten in der Krankenstube – Soldaten, die beide Nahid-Geschwister mit feindseligen Blicken bedachten, während sie ihre Patienten behandelten – reichte bereits aus, dass sie sich fragte, ob es nicht Zeit sei, sich eine andere Stelle zu suchen.
Der Platz am Ufer des Kanals, wo sie immer die Wäsche wuschen, war leer. Duriya tauchte den Korb ins Wasser und machte sich dann daran, die nassen Bandagen an einer Schnur aufzuhängen, die an einer sonnigen Stelle zwischen den Bäumen aufgespannt war. Trotz ihrer zur Schau gestellten Unterwürfigkeit hatte sie nicht die Absicht, diese verdammten Lappen ein zweites Mal zu schrubben. Vielleicht konnten schimmlige Bandagen ja das garstige Gemüt der Dschinn verbessern.
Sie arbeitete schnell. Der Kanal war eine finstere Erinnerung daran, wie gefangen sie sich in Daevabad fühlte, und sie hielt sich hier nur sehr ungern auf. Als Duriya anfing, im Palast zu arbeiten, hätte sie beim Anblick des tosenden dunklen Wassers, das durch den Garten floss, beinahe geweint. Im Shafit-Viertel gab es weder Flüsse noch Bäche, doch hier bot sich ihr zumindest eine Gelegenheit.
Denn im Gegensatz zu dem, was sie die meisten glauben ließ, war Duriya nicht erst in Daevabad und durch die Dschinn mit Magie in Kontakt gekommen.
Dies war schon viel früher passiert, am Ufer des Nils, als ein einsames Mädchen dort einen höchst ungewöhnlichen Freund fürs Leben fand. Daher war Duriya bei der ersten Gelegenheit, die sich ihr bot, zum Kanal gerannt. Sie hatte diesen Freund auf die einzige Weise gerufen, die sie kannte und die sie bislang nie im Stich gelassen hatte: indem sie sich in den Finger biss, bis er blutete, und die Hand sodann ins kalte Wasser tauchte.
»Sobek!«, hatte sie gefleht. »Bitte … bitte erhört mich, alter Freund! Ich brauche Euch!«
Falls Sobek in der Lage war, in diesen fremden Gewässern ihren Ruf wahrzunehmen, so war er ihm nicht gefolgt. Ebenso wenig war er die anderen Male erschienen, als sie versucht hatte, ihn herbeizubeschwören. Möglicherweise konnte er es nicht. Er war schließlich der Gott des Nils und sie befand sich sehr weit von Ägypten entfernt. Das alles hinderte sie jedoch nicht daran, sich eine solche Rettung in ihren Träumen weiterhin zu ersehnen. In diesen Träumen nahm der See die satte braune Farbe des Nils zu Flutzeiten an und überschwemmte die Dschinn-Stadt. In diesen Träumen stand sie an Sobeks Seite, während er den Kopfgeldjäger in Stücke riss, der sie gefangen genommen hatte und dessen Blut nun die Krokodilzähne befleckte.
»Gibt es Dschinn, die sich in Tiere verwandeln können?«, hatte Duriya Schwester Fatumai einmal gefragt. Sie und ihr Vater waren Hui Fatumai in ihrer ersten Woche in dieser Stadt begegnet, nachdem der Kopfgeldjäger sie entführt und im Shafit-Viertel abgesetzt hatte. Die in Daevabad gebürtige Frau organisierte die Shafit und hatte es sich zur Aufgabe gemacht, Neuankömmlingen bei der Eingewöhnung zu helfen. Darüber hinaus hatte Schwester Fatumai ihnen das Leben in der magischen Stadt erklärt und sie zu der kleinen ägyptischen Gemeinde gebracht, die die beiden bei sich aufnahm.
In Bezug auf Sobek und allgemeine Fragen über magische Kreaturen war Schwester Fatumai hingegen wenig hilfreich gewesen.