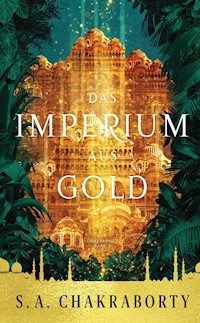Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Panini
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Daevabad
- Sprache: Deutsch
Band 1 der Daevabad-Trilogie. Nahri hat nie an die Magie geglaubt. Sie besitzt zwar gewisse Kräfte und gilt auf den Straßen Kairos im 18. Jahrhundert als äußerst talentierte Frau, doch sie weiß es besser. Denn sie schlägt sich nur mit billigen Tricks und Handlesen durch. Als Nahri jedoch versehentlich Dara beschwört, einen ebenso gerissenen wie unheimlichen Dschinnkrieger, sieht sie sich gezwungen, ihre Ansichten zu ändern. Denn Dara erzählt ihr von heißen, windgepeitschten Sanddünen, in denen es von Feuerkreaturen wimmelt, von Flüssen, in denen mythische Wesen schlafen, von einstmals großartigen Metropolen, von Bergen, in denen die kreisenden Raubvögel mehr sind, als sie scheinen und er erzählt von der legendären Stadt aus Messing - eine Stadt, die eine unwiderstehliche Anziehungskraft auf Nahri ausübt. Doch ihr Eintreffen in dieser sagenumwobenen Welt könnte einen seit Jahrhunderten schwärenden Krieg neu entfachen. Denn in Nahri schlummern Kräfte, die so unbändig wie brutal sind ... und nun erweckt wurden. Epische Fantasy überbordend gefüllt mit schillernder Magie, mächtigen Intrigen, unvergesslichen Charakteren und großartigem World-Building.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 886
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
S. A. Chakraborty
Die Daevabad-Trilogie Bd. 1
Ins Deutsche übertragen von Kerstin Fricke
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Copyright © 2017 by Shannon Chakraborty. All rights reserved.
Titel der Englischen Originalausgabe: »The City of Brass« by S. A. Chakraborty, published 2017 by Harper Voyager an imprint of HarperCollins Publishers LLC, New York, USA.
Designed by Paula Russell Szafranski
Maps by Virginia Norey
Deutsche Ausgabe 2021 Panini Verlags GmbH, Schlossstr. 76, 70 176 Stuttgart.
Alle Rechte vorbehalten.
Geschäftsführer: Hermann Paul
Head of Editorial: Jo Löffler
Head of Marketing: Holger Wiest (E-Mail: [email protected])
Presse & PR: Steffen Volkmer
Übersetzung: Kerstin Fricke
Lektorat: Mona Gabriel
Umschlaggestaltung: tab indivisuell, Stuttgart
Satz und E-Book: Greiner & Reichel, Köln
YDCHAK001E
ISBN 978-3-7367-9861-8
Gedruckte Ausgabe:
1. Auflage, September 2021,
ISBN 978-3-8332-4099-7
Findet uns im Netz:
www.paninicomics.de
PaniniComicsDE
Für Alia, das Licht meines Lebens
ÜBERSICHT DER CHARAKTERE
DIE KÖNIGSFAMILIE
Daevabad wird momentan von der Qahtani-Familie regiert, den Nachfahren von Zaydi al Qahtani, dem Geziri-Krieger, der vor Jahrhunderten eine Rebellion anführte, den Nahid-Rat stürzte und für die Gleichberechtigung der Shafit sorgte.
GHASSAN AL QAHTANI, König über das magische Reich und Verteidiger des Glaubens
MUNTADHIR, Ghassans ältester Sohn von seiner ersten Frau, einer Geziri, und designierter Thronfolger
HATSET, Ghassans zweite Frau und Königin, eine Ayaanle, die aus einer mächtigen Familie in Ta Ntry stammt
ZAYNAB, Ghassans und Hatsets Tochter, Prinzessin von Daevabad ALIZAYD, der jüngste Sohn des Königs
Ihr Hofstaat und die Königsgarde
WAJED, Qaid und Heerführer der Dschinn-Armee
ABU NUWAS, ein Geziri-Offizier
KAVEH E-PRAMUKH, der Daeva-Großwesir
JAMSHID, sein Sohn und Emir Muntadhirs engster Vertrauter
DIE HÖCHSTEN UND GESEGNETEN NAHID
Die Nahid waren ursprünglichen Herrscher über Daevabad und Nachfahren Anahids und eine Familie außergewöhnlicher Heiler, die dem Daeva-Stamm angehörte.
ANAHID, Suleimans Auserwählte und die Gründerin von Daevabad
RUSTAM, einer der letzten Nahid-Heiler und ein erfahrener Botaniker
MANIZHEH, Rustams Schwester und eine der mächtigsten Nahid-Heilerinnen seit Jahrhunderten
NAHRI, ein Mädchen, das nichts über seine Eltern weiß und als Kleinkind im Menschenland Ägypten ausgesetzt wurde
Ihre Unterstützer
DARAYAVAHOUSH, der letzte Nachkomme der Afshin, einer Daeva-Familie der Militärkaste
KARTIR, ein Daeva-Hohepriester
NISREEN, Manizhehs und Rustams ehemalige Assistentin und Nahris Mentorin
DIE SHAFIT
Personen, in deren Adern ebenso Menschen- wie Dschinn-Blut fließt, was sie dazu zwingt, in Daevabad zu bleiben, wo sie kaum Rechte haben.
SCHEICH ANAS, Anführer der Tanzeem und Alis Mentor
SCHWESTER FATUMAI, Tanzeem-Anführerin, die für das Waisenhaus und die wohltätigen Einrichtungen der Gruppe zuständig ist
DIE IFRIT
Daeva, die sich vor Tausenden von Jahren weigerten, sich Suleiman zu unterwerfen, und daraufhin verflucht wurden; Erzfeinde der Nahid.
AESHMA, ihr Anführer
VIZARESH, der Ifrit, der in Kairo auf Nahri aufmerksam wurde
QANDISHA, die Ifrit, mit der Dara eine schreckliche Vergangenheit verbindet
1
NAHRI
Er war leicht zu erkennen.
Nahri lächelte hinter ihrem Schleier und beobachtete, wie sich die beiden Männer im Näherkommen zankten. Der Jüngere sah sich nervös in der Gasse um, während der Ältere – ihr Kunde – trotz der kühlen Morgenluft schwitzte. Abgesehen von den Männern war die Gasse leer; der Ruf zum Fadschr-Gebet war bereits ertönt, und jeder Gläubige – nicht, dass es in ihrer Gegend viele davon gab – saß bereits in der kleinen Moschee am Ende der Straße.
Sie unterdrückte ein Gähnen. Nahri konnte auf das Morgengebet gut verzichten, aber ihr Kunde hatte die frühe Stunde gewählt und gut für die Diskretion bezahlt. Sie musterte die Männer, die auf sie zukamen, und bemerkte den hellen Teint und den Schnitt ihrer teuren Mäntel. Türken, vermutete sie. Der Ältere mochte sogar ein Basha sein, einer der wenigen, die nicht vor der Invasion der Franzosen aus Kairo geflohen waren. Sie verschränkte die Arme über ihrer schwarzen Abaya und betrachtete die beiden interessiert. Sie hatte sonst kaum türkische Kunden, denn die meisten von ihnen waren ziemlich aufgeblasen. Wenn die Franzosen und Türken sich nicht gerade um Ägypten stritten, schienen sie sich nur darin einig zu sein, dass die Ägypter nicht in der Lage waren, sich selbst zu regieren. Gott bewahre! Es war ja nicht so, als wären die Ägypter die Erben einer großen Zivilisation, deren mächtige Monumente das Land noch immer zierten. Oh nein. Sie waren Bauern; abergläubische Narren, die zu viele Bohnen fraßen.
Tja, diese abergläubische Närrin wird dich gleich ordentlich übers Ohr hauen, also beleidige mich ruhig, so viel du willst. Nahri sah den Männern lächelnd entgegen.
Sie begrüßte sie herzlich und bat sie in ihren kleinen Stand, wo sie dem Älteren einen bitteren Tee aus zerstoßenen Bockshornkleesamen und grob gehackter Minze servierte. Er trank ihn rasch, aber Nahri nahm sich beim Lesen der Blätter Zeit, murmelte und sang in ihrer Muttersprache, die die beiden gewiss nicht verstehen würden und deren Namen sie nicht einmal kannte. Je länger sie brauchte, desto verzweifelter würde er sein – und umso gutgläubiger.
Es war heiß in ihrem Stand; die Luft fing sich in den dunklen Schals, die sie über die Wände gehängt hatte, um die Privatsphäre ihrer Kunden zu schützen, und war dick von dem Duft des verbrannten Zedernholzes, des Schweißes und des billigen gelben Wachses, das sie als Weihrauch ausgab. Nervös knetete ihr Kunde den Saum seines Mantels, während ihm der Schweiß über das gerötete Gesicht und in den bestickten Kragen rann.
Der jüngere Mann verzog das Gesicht. »Das ist töricht, Bruder«, flüsterte er auf Türkisch. »Der Arzt hat doch gesagt, dass mit dir alles in Ordnung ist.«
Nahri verbarg ihr triumphierendes Lächeln. Es waren tatsächlich Türken. Sie rechneten nicht damit, dass sie sie verstand – wahrscheinlich gingen sie davon aus, dass eine ägyptische Straßenheilerin kaum anständiges Arabisch sprach –, aber Nahri beherrschte Türkisch so gut wie ihre Muttersprache. Ebenso Arabisch und Hebräisch, das Persisch der Akademiker, das gebildete Venezianisch und das an der Küste gesprochene Suaheli. In ihren etwa zwanzig Lebensjahren war es noch nicht vorgekommen, dass sie eine Sprache nicht auf Anhieb verstanden hatte.
Aber das mussten die Türken nicht wissen, daher ignorierte sie sie und tat so, als würde sie die Teeblätter in der Tasse des Bashas begutachten. Schließlich seufzte sie, wobei der gazeartige Schleier gegen ihre Lippen flatterte, was die Blicke der beiden Männer anzog, und ließ die Tasse zu Boden fallen.
Sie zerbrach wie erwartet, und der Basha keuchte auf. »Beim Allmächtigen! Ist es so schlimm?«
Nahri blickte zu dem Mann auf und blinzelte träge mit den von langen Wimpern umrahmten schwarzen Augen. Er war ganz blass geworden, und sie hielt inne und lauschte seinem Herzschlag. Er war aufgrund der Angst schnell und unregelmäßig, aber sie konnte spüren, wie gesundes Blut durch seinen Körper gepumpt wurde. Auch in seinem Atem war keine Krankheit zu spüren, und in seinen dunklen Augen lag unverkennbar ein Strahlen. Trotz der grauen Haare in seinem Bart – die das Henna nur schlecht kaschierte – und seinem rundlichen Bauch litt er an nichts anderem als einem Überschuss an Wohlstand.
Zumindest in der Hinsicht konnte sie ihm helfen.
»Es tut mir sehr leid, Herr.« Nahri schob den kleinen Stoffbeutel zurück und schätzte mit flinken Fingern rasch ab, wie viele Dirham er enthielt. »Bitte nehmt Euer Geld zurück.«
Dem Basha fielen beinahe die Augen aus dem Kopf. »Was?«, rief er. »Warum?«
Sie senkte den Blick. »Es gibt Dinge, die ich nicht zu tun vermag«, murmelte sie.
»Oh Gott … Hast du das gehört, Arslan?« Der Basha drehte sich mit Tränen in den Augen zu seinem Bruder um. »Und du hast mich für verrückt gehalten!«, beschuldigte er ihn mit erstickter Stimme. »Jetzt muss ich sterben!« Er schlug die Hände vor das Gesicht und weinte; derweil zählte Nahri die Goldringe an seinen Fingern. »Ich hatte mich so auf meine Hochzeit gefreut …«
Arslan warf ihr einen gereizten Blick zu, bevor er sich an den Basha wandte. »Jetzt reiß dich zusammen, Cemal«, zischte er auf Türkisch.
Der Basha wischte sich die Augen und sah sie an. »Es muss doch etwas geben, das du tun kannst. Ich habe Gerüchte gehört … Die Leute sagen, du hättest einen verkrüppelten Jungen nur durch einen Blick wieder zum Laufen gebracht. Da musst du doch auch mir helfen können.«
Nahri lehnte sich zurück und ließ sich ihr Entzücken nicht anmerken. Sie hatte keine Ahnung, von welchem Krüppel er sprach, doch bei Gott, das konnte ihren Ruf nur weiter steigern.
»Oh, Herr, es betrübt mich sehr, Euch diese Kunde zu überbringen.« Sie legte sich eine Hand aufs Herz. »Und der Gedanke, dass Eure teure Braut um dieses Vergnügen gebracht wird …«
Seine Schultern bebten, als er bitterlich schluchzte. Sie wartete, bis seine Hysterie weiter zugenommen hatte, und nutzte die Gelegenheit, um die dicken goldenen Bänder an seinen Handgelenken und seinem Hals zu schätzen. Ein schöner, wundervoll geschliffener Granat prangte vorn an seinem Turban.
Endlich fuhr sie fort. »Es könnte da etwas geben, aber … nein.« Sie schüttelte den Kopf. »Es würde nicht funktionieren.«
»Was?«, rief er und umklammerte die Kante des kleinen Tisches. »Bitte, ich würde alles tun!«
»Es wäre sehr schwierig.«
Arslan seufzte. »Und vermutlich auch teuer.«
Ach, jetzt sprichst du also Arabisch? Nahri schenkte ihm ein liebreizendes Lächeln und wusste genau, dass ihr Schleier durchsichtig genug war, um ihre Züge erkennen zu lassen. »Ich kann Euch versichern, dass all meine Preise sehr fair sind.«
»Sei still, Bruder«, fauchte der Basha und starrte den anderen Mann an. Dann wandte er sich mit gefasster Miene an Nahri. »Sag es mir.«
»Es gibt keine Garantie«, warnte sie ihn.
»Ich muss es versuchen.«
»Ihr seid ein tapferer Mann«, erwiderte sie mit bewusst zittriger Stimme. »Ich gehe davon aus, dass Euer Leiden von einem bösen Auge hervorgerufen wurde. Jemand ist neidisch auf Euch, Herr. Aber wer wäre das nicht? Ein Mann mit Eurem Wohlstand und Aussehen kann nur Neid hervorrufen. Möglicherweise jemand aus Eurem näheren Umfeld …« Ihr Blick zu Arslan war kurz, reichte jedoch aus, um ihn erröten zu lassen. »Ihr müsst Euer Heim von jeglicher Dunkelheit befreien, die das böse Auge hineingebracht hat.«
»Wie?«, verlangte der Basha mit leiser, begieriger Stimme zu erfahren.
»Zuerst müsst Ihr mir versprechen, meine Anweisungen genau zu befolgen.«
»Selbstverständlich!«
Sie beugte sich konzentriert vor. »Kauft eine Mischung aus einem Teil Ambra und zwei Teilen Zedernöl, und zwar eine gute Menge. Am besten bei Yaqub, ein Stück die Gasse entlang. Er hat die beste Ware.«
»Yaqub?«
»Aywa. Ja. Lasst Euch auch etwas pulverisierte Limettenschale und Walnussöl geben.«
Arslan starrte seinen Bruder fassungslos an, doch in den Augen des Bashas schimmerte Hoffnung. »Und dann?«
»Da wird es kompliziert, aber, Herr …« Nahri berührte seine Hand, und er erschauerte. »Ihr müsst meine Anweisungen genau befolgen.«
»Ja. Das schwöre ich beim Allbarmherzigen.«
»Euer Haus muss gereinigt werden, und das geht nur, wenn es verlassen ist. Eure ganze Familie muss gehen, die Tiere, die Diener, einfach alle. Sieben Tage lang darf sich keine lebendige Seele im Haus aufhalten.«
»Sieben Tage!«, rief er aus und senkte sofort die Stimme, als sie ihn missbilligend anschaute. »Wo sollen wir denn hingehen?«
»In die Oase von Fayyoum.« Arslan lachte auf, aber Nahri sprach weiter. »Geht zu Sonnenuntergang mit Eurem jüngsten Sohn zur zweitkleinsten Quelle.« Sie blieb ganz ernst. »Sammelt etwas Wasser in einem Korb, wie sie ihn dort aus den Weiden flechten, sagt den Thronvers dabei dreimal auf und nutzt das Wasser für Eure Waschungen. Bestreicht Eure Türen mit Amber und Öl, bevor Ihr geht, und bei Eurer Rückkehr wird das Übel verflogen sein.«
»Fayyoum?«, fiel Arslan ihr ins Wort. »Mein Gott, Mädchen, selbst du musst wissen, dass Krieg ist. Glaubst du, Napoleon lässt uns für eine sinnlose Reise durch die Wüste aus Kairo?«
»Sei still!« Der Basha schlug auf den Tisch und wandte sich wieder Nahri zu. »Aber dieses Unterfangen wird sehr schwer.«
Nahri breitete die Hände aus. »Gott ist gnädig.«
»Ja, natürlich. Dann also auf nach Fayyoum.« Er wirkte entschlossen. »Und danach ist mein Herz geheilt?«
Sie stutzte. Er machte sich Sorgen um sein Herz? »So Gott will, Herr. Sorgt dafür, dass Eure neue Frau die pulverisierte Limettenschale und das Öl während des nächsten Monats in Euren Abendtee mischt.« Das half zwar nicht bei Herzproblemen, aber immerhin konnte sich seine Braut dann vielleicht seines frischen Atems erfreuen. Nahri ließ seine Hand los.
Der Basha blinzelte, als wäre er von einem Zauber befreit worden. »Ich … vielen Dank, meine Liebe! Danke!« Er schob ihr den kleinen Beutel voller Geldmünzen wieder zu und zog sich einen schweren Goldring vom kleinen Finger, den er ihr ebenfalls reichte. »Möge Gott dich segnen.«
»Möge Eure Ehe fruchtbar sein.«
Er erhob sich mühsam. »Eins muss ich dich noch fragen, Kind: Woher stammt deine Familie? Du hast einen Kairoer Akzent, aber da ist etwas in deinen Augen …« Er verstummte.
Nahri presste die Lippen aufeinander. Sie hasste es, wenn sich jemand nach ihrer Herkunft erkundigte. Sie entsprach zwar nicht der Vorstellung einer wunderschönen Frau – die vielen Jahre auf der Straße hatten sie viel schmutziger und dünner werden lassen, als es den meisten Männern lieb war –, aber ihre strahlenden Augen und ihr markantes Gesicht zog so manchen zweiten Blick an. Und erst bei diesem zweiten Blick bemerkte man den Ansatz mitternachtsdunklen Haars und die ungewöhnlich schwarzen Augen – unnatürlichdunkle Augen, hatte sie schon häufig gehört, die zu Nachfragen anregten.
»Ich bin so ägyptisch wie der Nil«, versicherte sie ihm.
»Natürlich.« Er berührte seine Stirn. »In Frieden.« Schon war er hinausgegangen.
Arslan verweilte noch einen Augenblick. Nahri spürte seinen prüfenden Blick, als sie ihre Bezahlung an sich nahm. »Dir ist doch bewusst, dass du soeben ein Verbrechen begangen hast?«, fragte er mit schneidender Stimme.
»Wie bitte?«
Er trat näher an sie heran. »Ein Verbrechen, du Närrin. Hexerei gilt laut osmanischem Recht als Verbrechen.«
Nahri konnte einfach nicht anders; Arslan war nur der Letzte einer langen Reihe von aufgeblasenen türkischen Wichtigtuern, mit denen sie es in Kairo unter osmanischer Herrschaft zu tun bekommen hatte. »Na, dann kann ich mich wohl glücklich schätzen, dass jetzt die Franzosen das Sagen haben.«
Das war ein Fehler. Sein Gesicht lief sofort rot an. Er hob eine Hand, und Nahri zuckte zusammen und legte die Finger reflexartig fester um den Ring des Bashas. Eine scharfe Kante bohrte sich in ihre Handfläche.
Doch er schlug sie nicht. Stattdessen spuckte er ihr vor die Füße. »Gott ist mein Zeuge, du diebische Hexe … Wenn wir die Franzosen aus Ägypten vertrieben haben, ist Abschaum wie du als Nächstes dran.« Mit einem letzten hasserfüllten Blick stürmte er hinaus.
Sie holte zitternd Luft und sah den Brüdern hinterher, die sich im Licht der frühen Morgensonne streitend auf den Weg zu Yaqubs Apotheke machten. Aber es war nicht seine Drohung, die sie derart aus der Fassung gebracht hatte, sondern das Rasseln, das sie bei seinem Schrei gehört hatte, und der Geruch von eisenhaltigem Blut in der Luft. Eine kranke Lunge, Tuberkulose, vielleicht sogar ein Krebsgeschwür. Noch war es ihm nicht anzusehen, doch das würde nicht mehr lange dauern.
Arslan hatte sie zu Recht in Verdacht, denn mit seinem Bruder war alles in Ordnung. Allerdings würde er es nicht mehr erleben, dass sein Volk ihr Land eroberte.
Sie löste die geballte Faust. Der Schnitt in ihrer Handfläche heilte bereits; eine Linie aus neuer brauner Haut bildete sich unter dem Blut. Nachdem sie sie eine Weile angestarrt hatte, seufzte sie und ging zurück in ihren Stand.
Nahri löste ihren verknoteten Kopfputz und knüllte ihn zusammen. DuNärrin.Duweißtdoch,dassdubeisolchenMännernnichtsodieFassungverlierendarfst.Sie brauchte nicht noch mehr Feinde, erst recht keine, die wahrscheinlich Wachen um das Haus des Bashas postieren würden, während er in Fayyoum weilte. Was er heute bezahlt hatte, war ein Almosen im Vergleich zu dem, was sie aus seiner leeren Villa stehlen konnte. Sie hatte ohnehin nicht vor, viel mitzunehmen – sie zog ihre Masche schon lange genug durch, um sich nicht dazu verleiten zu lassen. Aber einige fehlende Schmuckstücke konnten auch einer vergesslichen Gattin oder einem langfingrigen Diener zugeschrieben werden. Tand, der dem Basha nichts bedeutete, der jedoch Nahris Monatsmiete bezahlen konnte, den würde sie einstecken.
Leise fluchend rollte sie ihre Schlafmatte zusammen und löste einige Steine aus dem Boden. Sie ließ die Münzen und den Ring des Bashas in das flache Loch fallen und starrte ihre mageren Ersparnisse mit gerunzelter Stirn an.
Das ist nicht genug. Es wird nie genug sein. Sie setzte die Steine wieder ein und berechnete, wie viel sie brauchte, um die Miete und die Bestechungsgelder für diesen Monat zu bezahlen, die überhöhten Kosten für ihren Beruf, der ihr zunehmend zuwider war. Die Zahl wurde ständig größer und stand ihren Träumen von Istanbul und Lehrern, von einem angesehenen Beruf und wirklichem Heilen statt diesem »magischen« Unsinn im Weg.
Aber in dieser Hinsicht waren ihr momentan die Hände gebunden, und Nahri hatte nicht vor, das Geldverdienen zu unterbrechen, um ihr Schicksal zu beklagen. Sie stand auf, wickelte sich ein zerknittertes Kopftuch um ihre zerzausten Locken und sammelte die Amulette ein, die sie für die Barzani-Frauen gemacht hatte, und den Umschlag für den Schlachter. Sie würde später noch einmal wiederkommen müssen, um alles für das Zâr vorzubereiten, aber vorerst hatte sie jemand weit Wichtigeres aufzusuchen.
* * *
Yaqubs Apotheke befand sich am Ende der Gasse zwischen einem zerfallenden Obststand und einer Brotbäckerei. Keiner wusste, was den ältlichen jüdischen Apotheker dazu bewogen hatte, in diesem heruntergekommenen Viertel ein Geschäft zu eröffnen. Die meisten Menschen, die hier lebten, waren verzweifelt: Prostituierte und Süchtige. Yaqub war vor einigen Jahren still und leise hergezogen und hatte sich mit seiner Familie in den oberen Stockwerken des saubersten Gebäudes eingerichtet. Die Nachbarn zerrissen sich die Mäuler und verbreiteten Gerüchte über Spielschulden und Trunkenheit oder noch finsterere Schauermärchen, dass sein Sohn einen Moslem getötet habe, dass Yaqub den halb toten Süchtigen in dieser Gasse Blut und Körpersäfte abzapfe. Nahri hielt das alles für Unsinn, wagte es aber nicht, ihn danach zu fragen. Sie wollte nichts über seine Herkunft wissen, dafür fragte er sie nicht, warum eine ehemalige Taschendiebin Krankheiten besser diagnostizieren konnte als der Leibarzt des Sultans. Ihre seltsame Partnerschaft beruhte darauf, dass sie diese beiden Themen niemals ansprachen.
Sie betrat die Apotheke und machte einen schnellen Schritt zur Seite, um die ramponierte Glocke, die Kunden ankündigte, zu umgehen. Yaqubs Laden war vollgestopft mit Vorräten, unglaublich chaotisch, und stellte eindeutig ihren Lieblingsort auf der Welt dar. Nicht zueinanderpassende Holzregale voller verstaubter Glasbehälter, winziger Weidenkörbe und zerbröselnder Keramiktöpfe standen an allen Wänden. An langen Seilen hingen getrocknete Kräuter, Tierteile und Dinge von der Decke, die sie nicht identifizieren konnte, und Lehmamphoren nahmen den restlichen kargen Platz am Boden ein. Yaqub kannte seinen Warenbestand so gut wie die Linien in seiner Hand, und wenn sie seinen Geschichten von uralten Magi oder den heißen Gewürzländern der Hind lauschte, wurde sie in Welten versetzt, die sie sich kaum ausmalen konnte.
Der Apotheker beugte sich über seine Werkbank und vermengte etwas, das einen stechenden, unangenehmen Geruch abgab. Sie lächelte beim Anblick des alten Mannes mit seinen noch älteren Instrumenten. Sein Mörser sah aus, als stammte er aus der Zeit der Regentschaft von Salah ad-Din. »Sabah el-hayr«, grüßte sie.
Yaqub zuckte mit leisem Schrei zusammen und blickte auf, wobei er sich die Stirn an einem Knoblauchzopf stieß. Er drückte ihn weg und murmelte: »Sabah el-noor. Musst du immer so lautlos reinkommen? Du hast mich beinahe zu Tode erschreckt.«
Nahri grinste. »Ich überrasche dich eben gern.«
Er schnaubte. »Du wolltest wohl sagen, dass du dich gern an mich anschleichst. Du wirst dem Teufel von Tag zu Tag ähnlicher.«
»Das ist nicht gerade eine freundliche Art, jemanden zu begrüßen, der dir heute Morgen schon ein kleines Vermögen eingebracht hat.« Sie stützte sich mit den Händen auf seine Werkbank.
»Wenn zwei sich streitende hochrangige Osmanen bei Tagesanbruch an meine Tür klopfen und meine Frau beinahe einen Herzinfarkt bekommt, erwartest du noch Dankbarkeit von mir?«
»Kauf ihr mit dem Geld eben ein schönes Schmuckstück.«
Yaqub schüttelte den Kopf. »Und Amber! Du kannst von Glück reden, dass ich noch genug auf Lager hatte! Konntest du ihn etwa nicht dazu überreden, seine Tür mit geschmolzenem Gold zu bestreichen?«
Sie zuckte mit den Achseln, griff nach einem der Gefäße, die neben ihm standen, und schnupperte daran. »Sie sahen so aus, als könnten sie es sich leisten.«
»Der Jüngere hatte einiges über dich zu sagen.«
»Man kann nicht jedem gefallen.« Sie schnappte sich den nächsten Topf und sah zu, wie er einige Kerzennüsse in seinen Mörser gab.
Seufzend legte er den Stößel hin und streckte eine Hand nach dem Krug aus, den sie ihm widerstrebend zurückgab. »Was machst du da?«
»Das hier?« Er widmete sich abermals den Nüssen. »Einen Umschlag für die Frau des Schusters. Ihr ist schwindlig.«
Nahri sah ihm einen Augenblick lang zu. »Das wird ihr nicht helfen.«
»Ach nein? Verrat mir doch noch mal, bei wem du deine medizinische Ausbildung genossen hast.«
Nahri grinste; Yaqub konnte es nicht leiden, wenn sie das tat. Sie wandte sich den Regalen zu und suchte nach einem bestimmten Gefäß. Im Laden herrschte das reinste Chaos aus unbeschrifteten Krügen und Vorräten, die ständig von allein die Plätze zu tauschen schienen. »Sie ist schwanger«, rief sie Yaqub über die Schulter zu und nahm eine Flasche mit Pfefferminzöl heraus, nachdem sie eine Spinne davon weggeschnippt hatte.
»Schwanger? Ihr Mann hat nichts gesagt.«
Nahri schob ihm die Flasche zu und legte ein Stück Ingwer daneben. »Es ist noch sehr früh. Wahrscheinlich wissen sie es noch gar nicht.«
Er warf ihr einen durchdringenden Blick zu. »Aber du schon?«
»Beim Barmherzigen, du etwa nicht? Sie übergibt sich so laut, dass sogar Shaitan davon wach wird, möge er verflucht sein. Sie haben schon sechs Kinder. Man sollte doch annehmen, dass sie die Anzeichen inzwischen erkennen.« Lächelnd versuchte sie, ihn zu besänftigen. »Bereite daraus einen Tee zu.«
»Ich habe sie nicht gehört.«
»Ach, Großväterchen, du hörst mich auch nicht reinkommen. Vielleicht liegt das einfach an deinen Ohren.«
Yaqub schob den Mörser mit verärgertem Brummen von sich weg und wandte sich der hintersten Ecke zu, in der er seinen Verdienst aufbewahrte. »Ich wünschte, du würdest aufhören, Musa bin Maimon zu spielen, und dir einen Mann suchen. Du bist noch nicht zu alt, weißt du?« Er zog seine Truhe heraus, deren Scharniere quietschten, als er den verbeulten Deckel öffnete.
Nahri musste lachen. »Wenn du jemanden findest, der jemanden wie mich heiraten würde, wären sämtliche Heiratsvermittler Kairos auf einen Schlag arbeitslos.« Sie kramte in dem Sammelsurium aus Büchern, Quittungen und Fläschchen auf dem Tisch herum und suchte nach der kleinen Emailledose, in der Yaqub Sesambonbons für seine Enkel aufbewahrte, und entdeckte sie endlich unter einem staubigen Kassenbuch. »Außerdem«, fuhr sie fort und nahm sich zwei Bonbons, »mag ich unsere Partnerschaft.«
Er reichte ihr einen kleinen Beutel. Sie merkte am Gewicht, dass es mehr als ihr üblicher Anteil war, und wollte schon protestieren, doch er kam ihr zuvor. »Halt dich von solchen Männern fern, Nahri. Sie sind gefährlich.«
»Warum? Die Franzosen haben doch jetzt das Sagen.« Sie kaute auf den Bonbons herum, und auf einmal war ihre Neugier geweckt. »Stimmt es, dass franzosische Frauen nackt auf der Straße herumlaufen?«
Der Apotheker schüttelte den Kopf, war jedoch an ihre Unanständigkeit gewöhnt. »Französisch, Kind, nicht franzosisch. Und Gott bewahre, wo hast du denn das schon wieder gehört?«
»Abu Talha sagt, ihr Anführer hätte Ziegenfüße.«
»Abu Talha sollte sich ans Schusterhandwerk halten … Aber wechsle jetzt nicht das Thema.« Er wirkte leicht verzweifelt. »Ich versuche, dich zu warnen.«
»Mich zu warnen? Warum? Ich habe doch noch nie mit einem Franzosen geredet.« Was nicht ihre Schuld war. Sie hatte versucht, den wenigen französischen Soldaten, die ihr über den Weg gelaufen waren, Amulette zu verkaufen, doch sie waren vor ihr zurückgewichen wie vor einer Schlange und hatten in ihrer Sprache herablassende Bemerkungen über ihre Kleidung gemacht.
Er sah ihr in die Augen. »Du bist jung«, sagte er leise. »Du hast keine Erfahrung mit den Dingen, die Menschen wie uns in einem Krieg zustoßen. Menschen, die anders sind. Daher solltest du dich besser unauffällig verhalten. Oder gleich gehen. Was ist aus deinen großen Plänen mit Istanbul geworden?«
Nachdem sie an diesem Morgen ihre Ersparnisse gezählt hatte, bekam sie schon bei der Erwähnung dieser Stadt schlechte Laune. »Ich dachte, du hättest mich töricht geschimpft«, erwiderte sie. »Hast du nicht gesagt, kein Arzt würde sich einen weiblichen Lehrling nehmen?«
»Du könntest als Hebamme arbeiten«, schlug er vor. »Du hast schon mehrfach Kinder auf die Welt gebracht. Geh in den Osten, weg von diesem Krieg. Vielleicht nach Beirut.«
»Das hört sich fast so an, als wolltest du mich loswerden.«
Er berührte ihre Hand und musterte sie besorgt aus seinen braunen Augen. »Ich möchte, dass du in Sicherheit bist. Du hast keine Familie, keinen Mann, der für dich eintritt, dich beschützt, der …«
Sie wollte das nicht hören. »Ich kann auf mich aufpassen.«
»… der dir davon abrät, gefährliche Dinge zu tun«, beendete er seinen Satz und warf ihr einen vielsagenden Blick zu. »… wie ein Zâr-Ritual zu leiten.«
Ah. Nahri zuckte zusammen. »Ich hatte gehofft, dass du nichts davon erfährst.«
»Dann bist du eine noch größere Närrin«, warf er ihr an den Kopf. »Du solltest dich nicht mit dieser südländischen Magie einlassen.« Er deutete hinter sie. »Gib mir eine Dose.«
Sie nahm eine aus dem Regal und warf sie ihm mit etwas mehr Schwung zu, als notwendig war. »Da ist überhaupt nichts ›Magisches‹ dran«, widersprach sie. »Es ist ganz harmlos.«
»Harmlos!« Yaqub schnaufte und schaufelte den Tee in die Dose. »Ich habe Gerüchte über diese Rituale gehört … Blutopfer, Dschinn-Exorzismus …«
»Es geht eigentlich gar nicht ums Austreiben«, korrigierte Nahri ihn leichthin. »Man versucht eher, Frieden zu schließen.«
Er starrte sie verzweifelt an. »Mit einem Dschinn solltest du dich gar nicht erst abgeben.« Kopfschüttelnd verschloss er die Dose und verrieb warmes Wachs an den Rändern. »Du spielst mit Dingen, von denen du nichts verstehst, Nahri. Das sind nicht deine Traditionen. Wenn du dich nicht vorsiehst, schnappt dir ein Dämon noch die Seele weg.«
Nahri war auf seltsame Weise gerührt von seiner Sorge – vor allem, wenn sie bedachte, dass er sie noch vor wenigen Jahren als niederträchtige Betrügerin abgetan hatte. »Großväterchen«, sie versuchte, respektvoller zu klingen. »Du musst dir keine Sorgen machen. Dabei ist wirklich keine Magie im Spiel, das kannst du mir glauben.« Da er noch immer skeptisch wirkte, beschloss sie, ehrlich zu sein. »Es ist im Grunde genommen Mumpitz. Es gibt keine Magie, keinen Dschinn, keine Geister, die uns fressen wollen. Ich mache meine Tricks schon lange genug, um zu wissen, dass nichts davon wirklich existiert.«
Er hielt inne. »Die Dinge, die du in meiner Gegenwart getan hast …«
»Vielleicht bin ich einfach eine bessere Betrügerin als die anderen«, fiel sie ihm ins Wort und hoffte, die Angst zu besänftigen, die sie in seinem Gesicht sah. Schließlich wollte sie ihren einzigen Freund nicht beunruhigen, nur, weil sie einige seltsame Fähigkeiten besaß.
Yaqub schüttelte den Kopf. »Trotzdem gibt es Dschinn. Und Dämonen. Das sagen sogar die Gelehrten.«
»Dann irren sich die Gelehrten eben. Bisher hatte es noch kein Geist auf mich abgesehen.«
»Das ist sehr arrogant, Nahri, vielleicht sogar blasphemisch.« Er wirkte bestürzt. »Nur eine Närrin würde so etwas sagen.«
Sie reckte trotzig das Kinn in die Luft. »Sie existieren nicht.«
Er seufzte. »Ich habe es wenigstens versucht.« Dann schob er die Dose zu ihr herüber. »Kannst du das unterwegs beim Schuster abgeben?«
Nahri richtete sich auf. »Machst du morgen Inventur?« Sie mochte zwar arrogant sein, ließ sich jedoch keine Gelegenheit entgehen, mehr über die Apotheke in Erfahrung zu bringen. Yaqubs Wissen hatte ihre Instinkte in Bezug auf das Heilen drastisch verbessert.
»Ja, aber komm früh. Es gibt viel zu tun.«
Sie nickte. »So Gott will.«
»Und jetzt geh dir einen Kebab kaufen.« Er deutete auf die Geldbörse. »Du bist ja nur Haut und Knochen. Die Dschinn werden kaum satt werden, wenn sie dich holen kommen.«
* * *
Als Nahri das Viertel erreichte, in dem das Zâr-Ritual stattfinden sollte, stand die Sonne bereits hinter der hoch aufragenden Landschaft aus steinernen Minaretten und Lehmziegelbauten, um in der fernen Wüste unterzugehen. Die tiefe Stimme eines Muezzins rief zum Maghrib-Gebet. Sie verharrte und war ob des schwindenden Lichts kurz desorientiert. Dieses Viertel lag im Süden von Kairo zwischen den Überresten des uralten Fustat und den Muqattam-Hügeln, und sie kannte sich hier nicht besonders gut aus.
Nahri rückte das verärgerte Huhn unter ihrem Arm zurecht und drängte sich an einem dünnen Mann vorbei, der ein Brett mit Broten auf dem Kopf balancierte, um direkt im Anschluss nur knapp einer Kollision mit einer Bande kichernder Kinder zu entgehen. Dann bahnte sie sich den Weg durch einen wachsenden Haufen an Schuhen vor einer bereits gut gefüllten Moschee. Hier herrschte reges Treiben; die französische Invasion hatte der Woge an Menschen vom Land, die nach Kairo strebten, nicht Einhalt gebieten können. Die neuen Migranten besaßen meist kaum mehr als die Kleidung, die sie am Leib trugen, und die Traditionen ihrer Ahnen; Traditionen, die von den gereizten Imamen der Stadt oftmals als Perversionen bezeichnet wurden.
Ein Zâr zählte eindeutig dazu. Wie Magie war auch der Glaube an Besessenheit in Kairo weitverbreitet und schuld an allem Möglichen, von der Fehlgeburt einer jungen Braut bis zur lebenslangen Demenz einer alten Frau. Zâr-Rituale wurden abgehalten, um den Geist zu besänftigen und die betroffene Frau zu heilen. Zwar glaubte Nahri nicht an Besessenheit, doch der Korb voller Münzen und die freie Mahlzeit für die Kodia, die Frau, die die Zeremonie leitete, waren nun mal nicht zu verachten. Daher hatte sie zuerst einige belauscht und dann beschlossen, eine eigene verkürzte Version davon abzuhalten.
Am heutigen Abend sollte die dritte stattfinden. Sie hatte sich in der vergangenen Woche mit einer Tante aus der Familie des betroffenen Mädchens getroffen und vereinbart, dass die Zeremonie auf einem verlassenen Hof in der Nähe ihres Hauses abgehalten werden sollte. Bei ihrer Ankunft warteten ihre Musikerinnen Shams und Rana bereits auf sie.
Nahri begrüßte sie herzlich. Der Hof war gefegt worden, und ein schmaler, mit einem weißen Tuch bedeckter Tisch stand in der Mitte. Zwei Kupferteller voller Mandeln, Orangen und Datteln befanden sich an beiden Tischenden. Eine recht große Gruppe hatte sich auch schon versammelt, die aus den weiblichen Mitgliedern der Familie der Betroffenen sowie etwa einem Dutzend neugieriger Nachbarn bestand. Sie wirkten zwar alle arm, dennoch würde es keiner wagen, mit leeren Händen bei einem Zâr aufzutauchen. Das gehörte sich einfach nicht.
Dann rief Nahri zwei kleine Mädchen zu sich, die noch jung genug waren, um das Ganze schrecklich aufregend zu finden. Die beiden kamen begierig angerannt. Nahri kniete sich hin und drückte der Älteren der beiden das Huhn, das sie hergetragen hatte, in die Arme.
»Hältst du das bitte für mich fest?« Das Mädchen nickte und schien sich sehr wichtig zu fühlen.
Der Jüngeren reichte sie den Korb. Es war ein niedliches Mädchen mit großen dunklen Augen und lockigem Haar, das zu unordentlichen Zöpfen gebunden war. Keiner würde ihm widerstehen können. Nahri zwinkerte ihm zu. »Du sorgst dafür, dass jeder etwas in den Korb tut.« Sie zog an einem der Zöpfe der Kleinen und scheuchte die Mädchen fort, bevor sie sich dem zuwandte, was sie hierhergeführt hatte.
Das betroffene Mädchen hieß Baseema. Sie sah aus wie zwölf und trug ein langes weißes Kleid. Nahri beobachtete, wie eine ältere Frau versuchte, dem Mädchen einen weißen Schal um das Haar zu binden. Das Mädchen hatte die Augen weit aufgerissen, wehrte sich und schlug mit den Händen um sich. Nahri konnte sehen, dass ihre Fingerspitzen rot und wund waren, weil sie sich die Nägel abgekaut hatte. Angst und Nervosität gingen von ihr aus, und ihre Wangen waren mit Kajal verschmiert, weil sie sich erbittert die Augen gerieben hatte.
»Bitte, Liebling«, flehte die ältere Frau – ihre Mutter, die Ähnlichkeit war offensichtlich. »Wir wollen dir doch nur helfen.«
Nahri kniete sich neben die beiden und nahm Baseemas Hand. Das Mädchen wurde ganz ruhig, nur seine Augen zuckten weiter hin und her. Nahri zog Baseema sanft auf die Beine, und die Menge verstummte, als sie ihr eine Hand auf die Stirn legte.
Im Grunde genommen konnte Nahri die Art, wie sie heilte und Krankheiten aufspürte, ebenso wenig erklären wie die Funktionsweise ihrer Augen und Ohren. Ihre Fähigkeiten waren seit so langer Zeit Teil von ihr, dass sie schlichtweg aufgehört hatte, ihre Existenz infrage zu stellen. Es hatte sie als Kind Jahre – und einige sehr schmerzhafte Lektionen – gekostet, um überhaupt zu begreifen, wie sehr sie sich von den Menschen um sich herum unterschied; es war, als wäre sie die einzige Sehende in einer Welt voller Blinder. Außerdem waren ihre Begabungen so natürlich, so organisch, dass sie sie einfach nicht als außergewöhnlich ansehen konnte.
Baseema fühlte sich unausgeglichen an; ihr Geist unter Nahris Fingerspitzen war lebendig und spritzig, jedoch fehlgeleitet. Gebrochen. Sie ärgerte sich, weil ihr das Wort so schnell in den Sinn kam, aber Nahri wusste, dass sie für das Mädchen wenig mehr tun konnte, als es vorübergehend zu beruhigen.
Und dabei musste sie noch eine gute Show abliefern, damit man sie auch bezahlte. Nahri schob den Schal aus dem Gesicht des Mädchens, weil sie spürte, dass es sich gefangen fühlte. Baseema krallte eine Faust in das andere Ende des Schals und zerrte daran, während sie Nahri ins Gesicht sah.
Nahri schenkte ihr ein Lächeln. »Du kannst ihn behalten, wenn du möchtest, meine Liebe. Wir werden viel Spaß zusammen haben, das verspreche ich dir.« Sie hob die Stimme und wandte sich an die Zuschauer. »Ihr habt gut daran getan, sie zu mir zu bringen. In ihr verbirgt sich ein Geist. Ein sehr starker. Aber wir werden ihn besänftigen, nicht wahr? Führen wir eine glückliche Vereinigung der beiden herbei?« Sie zwinkerte und gab ihren Musikern ein Zeichen.
Shams schlug einen schnellen Takt auf ihrer Tabla, ihrer alten, mit Fell bespannten Trommel. Rana nahm ihre Flöte und reichte Nahri ein Tamburin – das einzige Instrument, das sie spielen konnte, ohne sich völlig zum Narren zu machen.
Nahri tippte damit gegen ihr Bein. »Ich werde zu den Geistern singen, die ich kenne«, erklärte sie über die Musik hinweg, auch wenn nur wenige Frauen aus dem Süden nicht wussten, was bei einem Zâr passierte. Baseemas Tante hob eine Feuerschale und wedelte die Rauchschwaden des duftenden Weihrauchs in die Menge. »Wenn ihr Geist sein Lied hört, wird er erweckt, und wir können fortfahren.«
Rana spielte ein Lied auf ihrer Flöte, und Nahri schlug das Tamburin, schüttelte die Schultern und ließ ihren ausgefransten Schal bei jeder Bewegung durch die Luft schwingen. Baseema folgte ihr, ohne den Blick von ihr abzuwenden.
»Oh, ihr Geiser, wir flehen euch an! Wir rufen und wir ehren euch!«, sang Nahri recht leise, damit ihre Stimme nicht brach. Richtige Kodia waren ausgebildete Sängerinnen, doch das konnte Nahri nun wirklich nicht von sich behaupten. »Ya, amir kadeem el Hindi! Oh, großer Prinz, gesell dich zu uns!« Sie fing mit dem Lied des indischen Prinzen an und ließ das des Seesultans und der Großen Qarina folgen; und die Musik änderte sich jedes Mal entsprechend. Sie hatte darauf geachtet, den Text auswendig zu lernen, kannte jedoch nicht die genaue Bedeutung, denn darüber machte sie sich keine großen Gedanken.
Baseema wurde immer lebendiger, je länger es dauerte; ihre Gliedmaßen lockerten sich, die angespannten Falten in ihrem Gesicht verschwanden. Sie wiegte sich müheloser und warf das Haar mit einem leisen, zurückhaltenden Lächeln in den Nacken. Nahri berührte sie jedes Mal, wenn sie an ihr vorbeiging, tastete nach den schummrigen Bereichen ihres Verstands und zog sie näher heran, um das ruhelose Mädchen zu beruhigen.
Es war eine gute Gruppe, die Energie ausstrahlte und mitging. Mehrere Frauen standen auf, klatschten in die Hände und schlossen sich dem Tanz an. Das geschah eigentlich immer, denn ein Zâr war ebenso eine Ausrede zum Knüpfen von Kontakten wie eine Methode, mit einem lästigen Dschinn fertigzuwerden. Baseemas Mutter sah ihrer Tochter hoffnungsvoll ins Gesicht. Die kleinen Mädchen umklammerten ihre Gaben und sprangen aufgeregt auf und ab, während das Huhn lautstark protestierte.
Auch ihre Musikerinnen erweckten den Anschein, als würden sie sich amüsieren. Shams schlug auf einmal einen schnelleren Takt auf ihrer Tabla an und Rana folgte ihrem Beispiel und spielte eine traurige, fast schon beunruhigende Melodie auf ihrer Flöte.
Nahri trommelte mit den Fingern auf das Tamburin und ließ sich von der Stimmung anstecken. Sie grinste; vielleicht wurde es Zeit, der Menge etwas anderes zu präsentieren.
Und so schloss sie die Augen und summte. Nahri kannte den Namen ihrer Muttersprache nicht, der Sprache, die sie mit ihren seit Langem toten oder vergessenen Eltern teilte. Sie war der einzige Hinweis auf ihre Herkunft, und sie wartete seit ihrer Kindheit darauf, sie wiederzuhören, belauschte Händler aus fremden Ländern und die vielsprachige Gruppe von Gelehrten, die sich immerzu vor der El-Azhar-Universität aufhielt. Da sie meinte, sie würde dem Hebräischen ähneln, hatte sie sie einmal Yaqub gegenüber erwähnt, der ihr jedoch hartnäckig widersprochen und unnötigerweise hinzugefügt hatte, dass sein Volk auch schon genug Probleme hätte, ohne dass sie dazugehörte.
Allerdings wusste sie, dass sich die Sprache ungewöhnlich und unheimlich anhörte. Perfekt für ein Zâr-Ritual. Nahri war überrascht, dass ihr das nicht schon früher eingefallen war.
Zwar hätte sie auch ihren Einkaufszettel vorsingen können, ohne dass einer ihrer Zuhörer es bemerkt hätte, doch sie hielt sich an die üblichen Zâr-Lieder und übersetzte sie aus dem Arabischen in ihre Muttersprache.
»Sah, Afshin e-Daeva«, begann sie. »O Krieger der Dschinn, wie flehen dich an! Gesell dich zu uns und beruhige die Feuer im Geist dieses Mädchens.« Sie schloss die Augen. »O Krieger, komm zu mir! Vak!«
Ein Schweißtropfen rann ihr die Schläfe herunter. Auf dem Hof wurde es unangenehm warm, und die große Gruppe und das knisternde Feuer wurden ihr fast zu viel. Sie kniff die Augen zusammen, wiegte sich zur Musik und ließ sich von ihrem hin- und herschwingenden Kopfputz Luft ins Gesicht fächeln. »Großer Wächter, komm und beschütze uns. Wache über Baseema, als ob …«
Ein leises Aufkeuchen erschreckte Nahri, und sie schlug die Augen auf. Baseema tanzte nicht mehr; sie stand wie erstarrt da und sah Nahri mit glasigen Augen an. Offensichtlich verunsichert, verpasste Shams einen Schlag auf der Tabla.
Nahri bekam Sorge, die Gunst der Zuschauer zu verlieren, schlug sich das Tamburin gegen die Hüfte und betete innerlich, dass Shams es ihr nachmachte. Sie lächelte Baseema an, griff nach der Feuerschale und hoffte darauf, dass der schwere Duft das Mädchen entspannen würde. Vielleicht wurde es Zeit, die Sache zu beenden. »O Krieger«, sang sie etwas leiser und erneut auf Arabisch. »Bist du es, der im Geist unserer sanften Baseema schläft?«
Baseema zuckte; Schweiß lief über ihr Gesicht. Aus der Nähe konnte Nahri erkennen, dass der leere Ausdruck in den Augen des Mädchens etwas gewichen war, das an Furcht erinnerte. Leicht beunruhigt nahm sie die Hand des Mädchens.
Daraufhin blinzelte Baseema, kniff die Augen zusammen und starrte Nahri mit fast schon wilder Neugier an.
WER BIST DU?
Nahri wurde kreidebleich und ließ die Hand des Mädchens los. Baseemas Lippen hatten sich nicht bewegt, und doch hatte sie die Frage so deutlich gehört, als wäre sie ihr ins Ohr geschrien worden.
Dann war der Augenblick vorbei. Baseema schüttelte den Kopf, bekam wieder glasige Augen und tanzte weiter. Erschrocken wich Nahri einige Schritte zurück. Ihr brach kalter Schweiß aus.
Auf einmal stand Rana neben ihr. »Ya, Nahri?«
»Hast du das gehört?«, flüsterte sie.
Rana sah sie fragend an. »Was denn?«
Sei keine Närrin. Nahri schüttelte den Kopf und kam sich albern vor. »Ach, nichts.« Sie hob die Stimme und wandte sich an die Zuschauer. »Gepriesen sei der Allmächtige«, verkündete sie und versuchte, ihre Stimme ruhig zu halten. »O Krieger, wir danken dir.« Sie winkte das Mädchen mit dem Huhn zu sich. »Bitte nimm unsere Opfergabe an und schließ Frieden mit der armen Baseema.« Ihre Hände zitterten. Nahri hielt das Huhn über eine gesprungene Steinschale und flüsterte ein Gebet, bevor sie ihm die Kehle durchschnitt. Blut floss in die Schale und spritzte auf ihre Füße.
Baseemas Tante nahm ihr das Huhn ab, aber Nahris Aufgabe war noch lange nicht beendet. »Tamarinde für unseren Gast«, verlangte sie. »Der Dschinn mag es sauer.« Sie zwang sich zu einem Lächeln und versuchte, sich zu entspannen.
Shams brachte ihr ein kleines, mit einem dunklen Saft gefülltes Glas. »Geht es dir gut, Kodia?«
»Gott sei gepriesen«, antwortete Nahri. »Ich bin nur müde. Könntest du mit Rana das Essen verteilen?«
»Natürlich.«
Baseema wiegte sich immer noch mit halb geschlossenen Augen und einem verträumten Lächeln im Gesicht. Nahri nahm ihre Hände und zog sie sanft zu Boden, wobei sie sich dessen bewusst war, dass alle Blicke auf ihr ruhten. »Trink, Kind«, sagte sie und reichte ihr das Glas. »Das wird den Dschinn erfreuen.«
Das Mädchen umklammerte das Glas und fast die Hälfte des Safts spritzte ihr ins Gesicht. Es zeigte auf seine Mutter und stieß ein leises, kehliges Geräusch aus.
»Ja, Habibti.« Nahri strich über Baseemas Haar und hoffte, dass sie sich beruhigte. Das Kind war noch immer unausgeglichen, doch ihr Geist schien nicht mehr ganz so panisch zu sein. Gott allein wusste, wie lange dieser Zustand andauern würde. Sie rief Baseemas Mutter zu sich und legte ihre Hände auf die ihrer Tochter.
Die ältere Frau hatte Tränen in den Augen. »Ist sie geheilt? Wird der Dschinn sie in Frieden lassen?«
Nahri zögerte. »Ich habe sie beide zufriedengestellt, aber der Dschinn ist sehr stark und vermutlich schon seit ihrer Geburt bei ihr. Für so ein zartes Wesen …« Sie drückte Baseemas Hand. »Es ist ihr wahrscheinlich leichtergefallen, sich seinen Wünschen zu unterwerfen.«
»Was hat das zu bedeuten?« Die Stimme der Frau brach.
»Der Zustand deiner Tochter liegt in Gottes Hand. Der Dschinn wird auf sie aufpassen und sie mit einem reichhaltigen inneren Leben versorgen«, log sie und hoffte, der Frau so etwas Trost zu spenden. »Sorge dafür, dass sie beide zufrieden sind. Lass sie bei dir und deinem Mann bleiben und gib ihr etwas, um ihre Hände zu beschäftigen.«
»Wird sie … wird sie jemals sprechen?«
Nahri wandte den Blick ab. »So Gott will.«
Die ältere Frau schluckte schwer und bemerkte offenbar Nahris Unbehagen. »Und der Dschinn?«
Sie versuchte, sich noch etwas einfallen zu lassen. »Gib ihr jeden Morgen Tamarindensaft zu trinken – das wird ihn erfreuen. Und lass sie am ersten Jumu’ah, dem ersten Freitag jedes Monats, im Fluss baden.«
Baseemas Mutter holte tief Luft. »Gott weiß es am besten«, sagte sie leise und eher zu sich selbst statt zu Nahri. Aber sie weinte nicht mehr. Während Nahri sie ansah, nahm die ältere Frau die Hand ihrer Tochter und schien ihren Frieden zu finden. Baseema lächelte.
Bei diesem Anblick musste Nahri unverhofft an Yaqubs Worte denken. Du hast keine Familie, keinen Mann, der für dich eintritt, dich beschützt …
Sie stand auf. »Ihr müsst mich entschuldigen.«
Als Kodia hatte sie keine andere Wahl, als zu bleiben, bis das Essen serviert wurde, zum Klatsch der Frauen höflich zu nicken und zu versuchen, der älteren Cousine aus dem Weg zu gehen, bei der sie spürte, dass sich in ihren Brüsten etwas Krankhaftes ausbreitet. Nahri hatte noch nie versucht, so etwas zu heilen, und glaubte nicht, dass dies ein guter Abend für ein solches Experiment wäre – doch sie konnte das Lächeln der Frau nur schwer ertragen.
Endlich ging die Zeremonie zu Ende. Ihr Korb war randvoll mit Kupferfils, einigen silbernen Dirham und einem einzigen Golddinar von Baseemas Familie. Andere Frauen hatten billige kleine Schmuckstücke hineingelegt, alles im Austausch gegen den Segen, den sie ihnen bringen sollte. Nahri gab Shams und Rana je zwei Dirham und ließ sie den Großteil des Schmucks behalten.
Sie befestigte eben ihren Überwurf und wich den ständigen Küssen von Baseemas Familie aus, als sie auf einmal ein leichtes Prickeln im Nacken spürte. Da sie zu viele Jahre damit verbracht hatte, andere zu verfolgen und verfolgt zu werden, um dieses Gefühl nicht zu kennen, blickte sie auf.
Baseema stand auf der anderen Seite des Hofs und starrte sie an. Sie stand ganz still und schien sich völlig unter Kontrolle zu haben. Nahri sah ihr in die Augen und war überrascht, welche Ruhe das Mädchen ausstrahlte.
In Baseemas dunklen Augen lagen Neugier und Berechnung. Doch dann, als Nahri es eben bemerkt hatte, war es auch schon wieder verschwunden. Das Mädchen legte die Hände zusammen und fing an zu tanzen, wie Nahri es ihr gezeigt hatte.
2
NAHRI
Etwas ist mit diesem Mädchen passiert.
Nahri schob die Krumen ihrer längst verspeisten Pastete herum. Seit dem Zâr waren ihre Gedanken in Aufruhr, daher hatte sie in einem Caféhaus haltgemacht, statt nach Hause zu gehen, und saß Stunden später noch immer hier. Sie schwenkte ihr Glas, und der rote Bodensatz ihres Hibiskustees tanzte über den Boden.
Es ist rein gar nichts passiert, du Idiotin. Du hast keine Stimmen gehört. Sie gähnte, stützte die Ellbogen auf den Tisch und schloss die Augen. Nach ihrem frühmorgendlichen Termin und dem langen Marsch durch die Stadt war sie erschöpft.
Ein leises Husten ließ sie aufhorchen. Als sie die Augen aufschlug, sah sie einen Mann mit einem schlaffen Bart und hoffnungsvoller Miene neben ihrem Tisch verharren.
Nahri zog ihren Dolch, bevor er auch nur einen Ton sagen konnte, und knallte den Griff auf die Tischplatte. Der Mann verschwand, und Schweigen senkte sich auf das Caféhaus herab. Irgendwo fielen Dominosteine zu Boden.
Der Besitzer starrte sie wütend an, und sie seufzte und wusste, dass man sie gleich rauswerfen würde. Er hatte sie anfangs gar nicht bedienen wollen und erklärt, keine ehrenhafte Frau würde es wagen, nachts unbegleitet auszugehen, geschweige denn ein Caféhaus voller fremder Männer zu betreten. Nachdem er wiederholt wissen wollte, ob ihre Männer wüssten, wo sie sich aufhielt, hatte der Anblick der Münzen vom Zâr ihn letztlich zum Schweigen gebracht, aber sie vermutete, dass seine Gastfreundschaft nun ein Ende haben würde.
Sie stand auf, legte ein paar Münzen auf den Tisch und ging. Die Straße war dunkel und ungewöhnlich verlassen; die von den Franzosen verhängte Ausgangssperre hatte sogar die sonst nachtaktiven Ägypter dazu bewogen, in ihren Häusern zu bleiben.
Nahri ging mit gesenktem Kopf, merkte jedoch bald, dass sie sich verlaufen hatte. Der Mond stand zwar hoch am Himmel, doch in diesem Teil der Stadt kannte sie sich nicht aus, und so lief sie zweimal durch dieselbe Gasse, um erfolglos nach der Hauptstraße zu suchen.
Müde und genervt blieb sie vor dem Eingang einer stillen Moschee stehen und überlegte, dort Unterschlupf für die Nacht zu suchen. Da fiel ihr ein Mausoleum ins Auge, das die Kuppel der Moschee überragte, und sie erstarrte. El Arafa: die Stadt der Toten.
El Arafa war ein hoch geachteter, weitläufiger Bereich voller Begräbnisstätten und Gräber und spiegelte die Kairoer Besessenheit von all dem wider, was mit Bestattungen zu tun hatte. Der Friedhof lag am Ostrand der Stadt wie ein Fortsatz voller zerbröckelnder Knochen und verrottendem Gewebe, auf dem jeder, von Kairos Gründern bis hin zu den Süchtigen, bestattet wurde. Bevor die Pest der Überbevölkerung Kairos vor wenigen Jahren ein Ende bereitet hatte, waren hier sogar Einwanderer untergekommen, die sonst nirgendwo anders hinkonnten.
Dieser Gedanke ließ sie schaudern. Nahri fühlte sich in der Gegenwart der Toten nicht so wohl, wie es die meisten Ägypter taten, und hatte erst recht nicht das Verlangen, mit einem Haufen verwesender Knochen zusammenzuwohnen. Sie empfand Leichen als abstoßend; ihr Geruch, ihr Schweigen, alles an ihnen war falsch.
Von einem der weit gereisten Händler hatte sie Geschichten von Menschen gehört, die ihre Toten verbrannten; Fremde, die sich für klug hielten, weil sie sich vor Gottes Urteil versteckten – was für Genies, dachte Nahri. In einem knisternden Feuer aufzugehen, hörte sich deutlich erfreulicher an, als unter dem heißen Sand von El Arafa begraben zu liegen.
Aber sie wusste auch, dass der Friedhof ihre beste Chance war, wieder nach Hause zu gelangen. Sie konnte der Grenze gen Norden folgen, bis sie in Viertel kam, die sie besser kannte, und er wäre ein guter Ort, um sich zu verstecken, falls sie auf französische Soldaten traf, die die Ausgangssperre durchsetzen wollten; Fremde teilten im Allgemeinen ihre Abneigung gegen die Stadt der Toten.
Am Friedhof angekommen, hielt sich Nahri auf dem äußersten Weg. Hier war es sogar noch verlassener als auf der Straße; die einzigen Hinweise auf Leben stellten der Geruch eines längst erloschenen Kochfeuers und das Kreischen kämpfender Katzen dar. Die spitzen Zinnen und glatten Kuppeln der Gräber warfen wilde Schatten auf den sandigen Boden. Die uralten Gebäude wirkten verfallen; die osmanischen Herrscher Ägyptens hatten es vorgezogen, sich in ihrem türkischen Heimatland begraben zu lassen und die Pflege des Friedhofs daher als unwichtig erachtet – eine der zahlreichen Beleidigungen, die sie Nahris Landsleuten zumuteten.
Die Temperatur schien plötzlich zu fallen, und Nahri fröstelte. Ihre abgewetzten Ledersandalen, die schon längst hätten ersetzt werden müssen, machten ein leises Geräusch auf dem weichen Boden. Abgesehen von dem Klimpern der Münzen in ihrem Korb war nichts zu hören. Da sie ohnehin schon beunruhigt war, vermied Nahri es, die Gräber zu betrachten, und dachte stattdessen über das weitaus angenehmere Thema des Einbruchs in das Haus des Bashas nach, während dieser in Fayyoum weilte. Nahri wollte verdammt sein, wenn sie sich durch diesen schwindsüchtigen kleinen Bruder von einer lukrativen Sache abhalten ließ.
Sie war noch nicht lange unterwegs, als sie hinter sich einen Lufthauch spürte, gefolgt von einer flinken Bewegung, die sie aus dem Augenwinkel wahrnahm.
Das könnte jemand sein, der ebenfalls eine Abkürzung nimmt, sagte sie sich, doch ihr Herz raste. Kairo war relativ sicher, aber Nahri wusste, dass eine junge Frau, der man des Nachts folgte, ein böses Ende nehmen konnte.
Sie behielt ihr Tempo bei, legte jedoch eine Hand an den Dolch, bevor sie abrupt abbog und sich weiter auf den Friedhof wagte. Als sie den Weg entlanghuschte, erschreckte sie einen schlafenden Hund, und duckte sich dann hinter den Eingang eines der alten Fatimid-Gräber.
Die Schritte folgten ihr. Derjenige blieb stehen. Nahri holte tief Luft, hob ihre Klinge und wappnete sich, um die Person einzuschüchtern und zu bedrohen. Sie verließ ihr Versteck.
Und erstarrte. »Baseema?«
Das Mädchen stand einige Meter entfernt, mitten auf dem Weg – ohne Kopfbedeckung und mit fleckiger, eingerissener Abaya. Sie lächelte Nahri an. Ihre Zähne glänzten im Mondlicht, als der Wind ihr das Haar aus dem Gesicht wehte.
»Sprich noch einmal«, verlangte Baseema, deren Stimme angestrengt und heiser klang, weil sie sie so wenig nutzte.
Nahri keuchte auf. Hatte sie das Mädchen tatsächlich geheilt? Wenn dem so war, warum in Gottes Namen lief es dann mitten in der Nacht auf einem Friedhof herum?
Sie ließ die Arme sinken und eilte auf Baseema zu. »Was machst du denn hier draußen, Kind? Deine Mutter macht sich bestimmt große Sorgen.«
Nach einigen Schritten stutzte sie. Obwohl es dunkel war und sich Wolken vor den Mond geschoben hatten, konnte sie seltsame Flecken auf Baseemas Händen sehen. Nahri sog die Luft ein und erhaschte den Geruch von etwas Rauchigem, Verkohltem, Falschem.
»Ist das … Blut? Beim Allermächtigsten, Baseema, was ist passiert?«
Ohne auf Nahris Fragen einzugehen, klatschte Baseema erfreut in die Hände. »Könntest du es wirklich sein?« Sie umkreiste Nahri langsam. »In etwa das richtige Alter …«, überlegte sie laut. »Und ich bilde mir ein, die Hexe in deinen Zügen zu erkennen, aber abgesehen davon wirkst du so menschlich.« Ihr Blick fiel auf das Messer in Nahris Hand. »Aber es gibt wohl nur einen Weg, das herauszufinden.«
Die Worte waren ihr kaum über die Lippen gekommen, da hatte sie Nahri auch schon mit einer unfassbar schnellen Bewegung den Dolch aus der Hand gerissen. Nahri taumelte mit einem erschreckten Schrei nach hinten, und Baseema lachte auf. »Keine Sorge, kleine Heilerin. Ich bin kein Narr und habe nicht die Absicht, dein Blut selbst zu prüfen.« Sie schwenkte den Dolch durch die Luft. »Aber ich nehme das hier besser an mich, bevor du noch auf dumme Gedanken kommst.«
Nahri hatte es die Sprache verschlagen. Sie sah Baseema jetzt mit anderen Augen. Das um sich schlagende, gepeinigte Kind war verschwunden. Abgesehen von ihren bizarren Äußerungen stand sie mit neuer Selbstsicherheit vor ihr und ließ sich den Wind durch die Haare wehen.
Baseema kniff die Augen zusammen; vielleicht spürte sie Nahris Verwirrung. »Du musst doch wissen, was ich bin. Die Marid haben dich gewiss vor uns gewarnt.«
»Die was?« Nahri hob eine Hand, um ihre Augen vor dem Sand zu schützen, den der Wind aufwirbelte. Das Wetter hatte sich verschlechtert. Hinter Baseema zogen dunkelgraue und orangefarbene Wolken über den Himmel und verdeckten die Sterne. Der Wind jaulte abermals wie der schlimmste Khamsin, dabei war die Zeit für die Frühlingssandstürme noch gar nicht gekommen.
Baseema blickte zum Himmel hinauf. Ihr kleines Gesicht wirkte alarmiert. Sie wirbelte zu Nahri herum. »Diese Menschenmagie, die du eingesetzt hast … Wen hast du gerufen?«
Magie? Nahri hob die Hände. »Ich habe keine Magie eingesetzt!«
In einem Sekundenbruchteil hatte sich Baseema bewegt. Sie drückte Nahri gegen die nächste Grabmauer und presste ihr schmerzhaft einen Ellbogen gegen die Kehle. »Für wen hast du gesungen?«
»Ich …« Nahri keuchte und war entsetzt, wie viel Kraft in den dünnen Armen des Mädchens steckte. »Einen … Krieger, glaube ich. Aber das war gar nichts. Nur ein altes Zâr-Lied.«
Baseema wich zurück, als eine heiße Brise durch die Gasse fegte und den Geruch von Feuer mit sich brachte. »Das ist nicht möglich«, flüsterte sie. »Er ist tot. Sie sind alle tot.«
»Wer ist tot?« Nahri musste schreien, um den Wind zu übertönen. »Warte, Baseema!«, rief sie, als das Mädchen in die gegenüberliegende Gasse stürmte. »Wo willst du denn hin?«
Sie hatte kaum Zeit, über eine Antwort nachzudenken. Ein Knall hallte durch die Luft, lauter noch als ein Kanonenschlag. Alles war ruhig, viel zu ruhig, und dann wurde Nahri von den Beinen gerissen und gegen eines der Gräber geschleudert.
Sie prallte hart gegen den Stein und ein greller Blitz blendete sie. Als sie zu Boden sackte, war sie zu benommen, um ihr Gesicht vor dem herabregnenden brennend heißen Sand zu schützen.
Die Welt verstummte, kehrte mit dem stetigen Schlagen ihres Herzens wieder zurück, und das Blut rauschte durch ihren Kopf. Schwarze Punkte tanzten vor ihren Augen. Sie bewegte die Finger, wackelte mit den Zehen und war erleichtert, dass noch alles dran zu sein schien. Das Pochen ihres Herzens wurde nach und nach vom Klingeln in ihren Ohren ersetzt. Zaghaft berührte sie die bereits anschwellende Beule an ihrem Hinterkopf und unterdrückte einen Schrei, als sie ein stechender Schmerz durchfuhr.
Sie versuchte, sich aus dem Sand zu befreien, der sie halb begraben hatte, und war noch immer geblendet von diesem Blitz. Nein, nicht von einem Blitz, begriff sie. Das grelle weiße Licht befand sich noch immer in der Gasse, es zog sich nur enger, verkleinerte sich, bis sie die vom Feuer versengten Gräber sehen konnte. Dann stürzte es in sich zusammen. Als würde es sich zu etwas verdichten.
Baseema war nirgends zu sehen. Panisch befreite Nahri ihre Beine. Sie hatte den Sand soeben weggeschaufelt, als sie die Stimme hörte, glockenhell und wütend wie ein Tiger, in der Sprache, auf die sie schon ihr ganzes Leben lauschte.
»Bei Suleimans Auge!«, brüllte sie. »Ich bringe denjenigen um, der mich hierhergerufen hat!«
* * *
Es gibt keine Geister, Yaqub. Keine Dschinn und keine Dämonen. Nahri musste an ihre entschiedenen Worte denken, die sie zu verspotten schienen, als sie über den Grabstein spähte, hinter den sie beim Klang der Stimme gerannt war. Die Luft roch nach Asche, aber die Helligkeit in der Gasse war schwächer geworden, fast so, als hätte die Gestalt in der Mitte sie in sich aufgesaugt. Sie sah aus wie ein Mann in einer dunklen Robe, die wie Rauch um seine Füße waberte.
Er setzte sich in Bewegung, als das letzte Licht in seinem Körper verschwand, verlor augenblicklich das Gleichgewicht und musste sich an einem vertrockneten Baumstamm festhalten. Während er sich aufrichtete, fing die Borke unter seiner Hand an zu brennen. Statt sich zurückzuziehen, lehnte er sich seufzend an den brennenden Baum und ließ die Flammen harmlos an seiner Robe lecken.
Nahri war viel zu entsetzt, um einen klaren Gedanken zu fassen oder gar zu fliehen, und rollte sich nur wieder hinter den Grabstein, während der Mann erneut nach ihr rief.
»Khayzur … Wenn das deine Vorstellung von einem Streich ist, dann schwöre ich bei meinen Ahnen, dass ich dich Feder für Feder zerfetzen werde!«
Seine bizarre Drohung hallte durch ihren Kopf, und die Worte waren bedeutungslos, die Sprache ihr jedoch so vertraut, dass sie sie fast greifen konnte.
Warum spricht eine verrückte Feuerkreatur meine Sprache?
Da sie ihre Neugier nicht bezähmen konnte, drehte sie sich um und spähte über den Grabstein.
Die Kreatur wühlte leise vor sich hin murmelnd und fluchend im Sand. Während Nahri zusah, zog der Fremde einen Krummsäbel hervor und sicherte ihn an seiner Hüfte. Direkt darauf folgten zwei Dolche und ein gigantischer Streitkolben, eine Axt, ein langer Köcher mit Pfeilen sowie ein silbrig glänzender Bogen.
Mit dem Bogen in einer Hand rappelte er sich taumelnd wieder auf, blickte durch die Gasse und suchte nach demjenigen, der – wie hatte er sich doch gleich ausgedrückt? –, der ihn »gerufen« hatte. Er schien zwar nicht viel größer als sie zu sein, aber allein die Menge an Waffen – genug, um es mit einem ganzen Trupp französischer Soldaten aufzunehmen – war gleichzeitig erschreckend und ein bisschen lächerlich. Als wäre er ein kleiner Junge, der einen mächtigen Krieger verkörpern wollte.
Ein Krieger. Oh, beim Allmächtigen …
Er suchte sie. Nahri war diejenige, die ihn gerufen hatte.
»Wo bist du?«, brüllte er und kam mit erhobenem Bogen näher. Er stand schon recht dicht vor Nahris Grabstein. »Ich vierteile dich!« Er sprach ihre Sprache mit einem gebildeten Akzent, wobei sein poetischer Tonfall nicht zu der schrecklichen Drohung passen wollte.
Nahri wollte gar nicht erst wissen, wie dieses »Vierteilen« aussehen sollte. Sie zog sich die Sandalen aus, und als er an ihrem Grabstein vorbeigegangen war, sprang sie auf und flog lautlos in die entgegengesetzte Richtung davon.
Dummerweise hatte sie ihren Korb vergessen. Bei jeder Bewegung hallte das Klimpern der Münzen durch die stille Nacht.
»Halt!«, brüllte der Mann.
Sie wurde schneller, und ihre nackten Füße donnerten über den Boden. Rasch bog sie in eine gewundene Gasse ein und gleich in die nächste, in der Hoffnung, ihn zu verwirren.
Als sie einen dunklen Eingang bemerkte, huschte sie hinein. Auf dem Friedhof war es still, weder die Geräusche eines Verfolgers noch wütende Drohungen waren zu hören. Hatte sie ihn etwa abgeschüttelt?
Sie lehnte sich an den kalten Stein, schnappte nach Luft und sehnte verzweifelt ihren Dolch herbei – nicht, dass ihre armselige Klinge ihr großen Schutz gegen den bis an die Zähne bewaffneten Mann geboten hätte, der hinter ihr her war.
Hier kann ich nicht bleiben. Aber Nahri konnte weiter nichts sehen als die Gräber vor sich und hatte keine Ahnung, wie sie zurück auf die Straße gelangen konnte. Sie mahlte mit dem Kiefer und nahm ihren ganzen Mut zusammen.
Bitte, Gott … oder wer immer zuhört, betete sie. Hol mich einfach hier raus, und ich schwöre dir, dass ich Yaqub morgen bitte, mir einen Bräutigam zu suchen. Und ich führe nie wieder ein Zâr-Ritual durch. Sie machte einen zögerlichen Schritt.
Ein Pfeil sauste durch die Luft.
Nahri kreischte auf, als er ihre Schläfe streifte. Sie taumelte vorwärts, griff sich an den Kopf und starrte ihre blutbeschmierten Finger an.
Die kalte Stimme meldete sich erneut. »Bleib auf der Stelle stehen, oder der nächste fährt dir durch die Kehle!«
Sie erstarrte und presste weiter eine Hand an die Wunde. Das Blut gerann bereits, doch sie wollte der Kreatur keinen Grund geben, ihr noch ein weiteres Loch zu verpassen.
»Dreh dich um!«
Sie schluckte ihre Angst herunter, drehte sich um, hielt die Hände ganz still und den Blick zu Boden gerichtet. »B-bitte töte mich nicht«, stammelte sie. »Ich wollte nicht …«
Der Mann – oder was immer er war – atmete laut ein; ein Geräusch, das an erlöschende Kohle erinnerte. »Du … du bist ein Mensch«, flüsterte er. »Woher beherrschst du Divasti? Wieso kannst du mich überhaupt hören?«
»Ich …« Nahri stutzte und stellte fest, dass sie nun endlich den Namen der Sprache kannte, die sie seit ihrer Kindheit beherrschte. Divasti.
»Sieh mich an.« Er kam näher, und die Luft zwischen ihnen erwärmte sich und duftete nach verbrannter Zitrone.
Ihr schlug das Herz bis zum Hals. Sie holte tief Luft und zwang sich, ihm in die Augen zu sehen.
Sein Gesicht war wie das eines Wüstennomaden bedeckt, doch selbst wenn es zu sehen gewesen wäre, bezweifelte sie, dass sie etwas anderes als seine Augen wahrgenommen hätte. Sie waren grüner als Smaragde und fast zu hell, um direkt hineinzusehen.