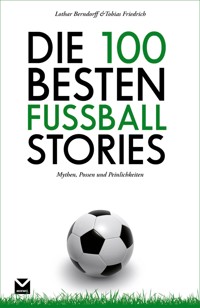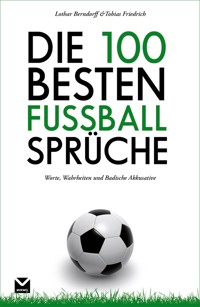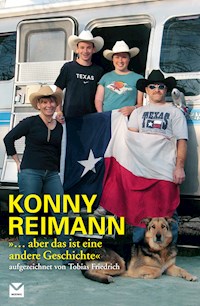10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eines des erfolgreichsten Romandebüts des vergangenen Jahres – auf der SPIEGEL-Jahresbestsellerliste
Ulm, im Mai 1932: Mit nicht viel mehr als etwas Proviant und dem kühnen Plan, nach Zypern zu paddeln, lässt Oskar Speck sein Faltboot zu Wasser. In sechs Monaten will er zurück sein. Aber alles kommt anders. Gepackt von sportlichem Ehrgeiz, begleitet von Jazzmusik und Mark Twains weisem Witz, gejagt von den Nationalsozialisten, fährt der schweigsame Einzelgänger immer weiter in die Welt. Ohne Hoffnung auf ein Wiedersehen mit Gili, die sich, wie er, den Widrigkeiten der Zeit entgegenstellen muss. Doch das Schicksal gibt Oskar eine letzte Chance.
Tobias Friedrichs literarisches Debüt basiert auf der unglaublichen, aber wahren Geschichte des Hamburgers Oskar Speck, der über sieben Jahre lang mit seinem Faltboot 50.000 Kilometer zurücklegte. So erstaunlich wie dessen Reise ist auch dieser humorvolle, dramatisch wie rasant erzählte Roman um wahre Freundschaft und Freiheitsliebe, starke Frauen und den Zufall als Wegweiser des Lebens.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 615
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Berlin, Dezember 2021
Verehrte Leserin, verehrter Leser,
als ich vor einigen Jahren auf die Geschichte von Oskar Speck stieß, erschien mir die schiere Tatsache, dass jemand in den Dreißigerjahren 50 000 Kilometer von Ulm nach Australien in einem Faltboot gepaddelt war, erstaunlich, ja nahezu unglaubwürdig. Das Bild des jungen Burschen, der am Ufer der Donau sein Boot aufbaut, um mit zehn Reichsmark in der Tasche in eine Welt aufzubrechen, von der er nichts weiß, ließ mich nicht mehr los. Und ich war überrascht, dass man über seine Fahrt, seine Abenteuer kaum etwas finden konnte.
Es brauchte kein Genie, um zu erkennen, dass hier ein Roman danach rief, geschrieben zu werden. Genauso klar war mir, dass ich, der ich noch nie einen Roman verfasst hatte, mit dieser Aufgabe restlos überfordert sein würde. Also fing ich unverzüglich an.
Im Zuge meiner Recherche lernte ich, wie Speck zahllose Gefahren überstand und ihm die unglaublichsten Dinge widerfuhren. Als er im September 1939 in Australien an Land ging, wurde er aus offensichtlichen Gründen noch am Strand festgenommen und in ein Internierungslager gebracht. Und somit verschwand Oskar Specks Geschichte in einem Krieg, dessen Gewicht sie auch in den Jahrzehnten danach unter sich begraben sollte.
Ein Zeitgenosse Specks erzählte mir einst, dass sich bereits diverse Autoren mit dem Thema beschäftigt hatten. »Doch je mehr Details sie alle über die Geschichte erfuhren, desto größer, unglaublicher und unheimlicher wurde sie.« Ich teile diese Einschätzung. Ich recherchierte im Archiv des Australian National Maritime Museum, in dem sich Specks Nachlass befindet, studierte tagelang Briefe, Tagebücher und Artikel, sprach mit seinen Freunden, Bekannten und mit seinem ehemaligen Gärtner, übernachtete in dem von ihm gebauten Haus und paddelte in einem original Dreißigerjahre-Faltboot im Sydney Harbour.
Durch meinen Roman »Der Flussregenpfeifer« erfährt die Öffentlichkeit nun also doch von Specks außergewöhnlicher Geschichte. Vielleicht ist es einer gewissen Borniertheit zu verdanken, dass ich die Arbeit daran zwischendurch nicht aufgegeben habe; oder Speck war schlicht eine Art Vorbild. Denn der kam am Ende schließlich auch an – und konnte nicht einmal schwimmen.
Herzlich
Ihr Tobias Friedrich
Ulm, im Mai 1932: Mit nicht viel mehr als etwas Proviant und dem kühnen Plan, nach Zypern zu paddeln, lässt Oskar Speck sein Faltboot zu Wasser. In sechs Monaten will er zurück sein. Aber alles kommt anders. Gepackt von sportlichem Ehrgeiz, begleitet von Jazzmusik und Mark Twains weisem Witz, gejagt von den Nationalsozialisten, die aus dem Faltbootfahrer einen deutschen Helden machen wollen, fährt der schweigsame Einzelgänger von Zypern aus immer weiter in die Welt. Ohne Hoffnung auf ein Wiedersehen mit der eigenwilligen Gili, die sich, wie er, den Widrigkeiten der Zeit entgegenstellen muss. Doch das Schicksal gibt Oskar eine letzte Chance.
»Der Flussregenpfeifer«, Tobias Friedrichs literarisches Debüt, basiert auf der unglaublichen, aber wahren Geschichte des Hamburgers Oskar Speck, der über sieben Jahre lang mit seinem Faltboot 50 000 Kilometer zurücklegte. So erstaunlich wie dessen Reise ist auch dieser humorvolle, dramatisch wie rasant erzählte Roman um wahre Freundschaft und Freiheitsliebe, starke Frauen und den Zufall als Wegweiser des Lebens.
Tobias Friedrich, 1969 in Göttingen geboren, schreibt seit den 90er-Jahren Musik für seine Bands Viktoriapark und Husten (u.a. mit Gisbert zu Knyphausen) sowie für andere Künstler. Er war Herausgeber eines Berliner Musikmagazins, arbeitet als Autor von Sachbüchern und ist Co-Veranstalter der Berliner Musik-und-Lese-Show »Ein Hit ist ein Hit«. »Der Flussregenpfeifer« ist sein literarisches Debüt, über das er sagt: »Es war mir ein Rätsel, wieso es noch kein Buch über Oskar Speck gab. Es war klar, dass ich, der ich noch nie einen Roman geschrieben hatte, mit dem Schreiben eines Romans über ihn restlos überfordert sein würde. Also fing ich unverzüglich mit der Arbeit an.«
»Tobias Friedrich nimmt uns mit auf eine wahnsinnige, tollkühne Reise. Endlich wieder ein Abenteuerroman!« Takis Würger
»Eine irrwitzige Road Novel nach einer wahren Geschichte, packend, absurd und cinematisch erzählt.« Judith Holofernes
Besuchen Sie uns auf www.cbertelsmann.de und Facebook.
C. Bertelsmann
Dieses Buch ist ein Roman.
Als literarisches Werk knüpft es in vielen Passagen an reale Geschehen und an Personen der Zeitgeschichte an. Es verbindet Anklänge an tatsächliche Vorkommnisse mit künstlerisch gestalteten, fiktiven Schilderungen und schafft so eine ästhetisch neue, künstlerisch überhöhte Wirklichkeit. Dies betrifft auch und insbesondere vermeintlich genaue Schilderungen von privaten Begebenheiten oder persönlichen Motiven und Überlegungen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2022 C. Bertelsmann
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Vignetten, Umschlag- und Vorsatzillustration:
Nadja Pia Schroeckh – Blackbooze Illustrations
c/o Kombinatrotweiss GmbH
Umschlaggestaltung: Sabine Kwauka
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-27304-0V004
www.cbertelsmann.de
INHALT
TEIL EINS
Birkenblut
Reisetage
Stäblein
Bedingungen
Kchh
Das erste Gespräch
Romer
Neweklowsky
Das zweite Gespräch
Schlamm
Loch
Nis
Els
Axios
Das dritte Gespräch ...
Fílippos
... Das dritte Gespräch
Kreuze
Das vierte Gespräch
Macedonia
Nirgendwo
Schokolade
Adieu
Das fünfte Gespräch
Schrben
Erregung
Carter
Das sechste Gespräch
Globus
Krkuk
Tuan
TEIL ZWEI
Hitler
Taman
Konfetti
Peng
Lex
Vock
Bondowoso
Houdini
Mitteilung
Patronen
TEIL DREI
Porzellan
Staub
Angst
Gestalten
Klaphake
Hut
Fünfzigtausend
Verluste
Wali
Durst
Oschkar
Enden
Lakritz
Grandezza
Insekt
Reisszwecke
Randwick
Clochard
Meer
TEIL VIER
Klein
Killcare
Sprachfehler
Pusteblume
Kupfer
Brombeernacht
Woy-Woy
Pudding
Ticken
Planken
Y
Nachbemerkung und Quellen
Dank
Für Barbara und Wolfgang Friedrich,
weil sie es, verdammt noch mal, verdient haben
Die Fliegen kommen sofort. Sie setzen sich auf Haut und Haare, Kleidung und Schuhe, sie fliegen in den Mund und surren nervtötend in den Ohren. Ohne die beiden Neuankömmlinge an seiner Seite aus den Augen zu verlieren, verscheucht der Wärter die Insekten mit monotonen Wischbewegungen. Der kleinere der Häftlinge tut es ihm gleich. Der andere lässt die Fliegen gewähren.
Sie treten einen langen Marsch durch die mit Stacheldrahtzäunen und hohen Mauern umgebene flirrende Steppe an, vorbei an Dutzenden sich gleichender, geometrisch aufgereihter Wellblechbaracken. Melde sprießt überall dort aus dem Boden, wo die Erde nicht knochentrocken ist, mit Kieseln, Schotter, Überresten von Stachelkopfgras. Die Bewohner der Baracken halten inne. Sie stieren den drei durch die Hitze schreitenden Männern aus dem Schatten der Häuser hinterher, wenden an den Beeten ihre Köpfe, Jäter, Harke und Schaufel reglos in der Hand haltend, oder treten aus Hütten hervor und wischen sich geistesabwesend ihre verschmutzten Hände an Lappen und Hosenbeinen ab, während hinter ihnen in den Fenstern weitere Gesichter auftauchen.
Das ist es also. Das Monster. Der Mann, vor dem sich Joseph Goebbels fürchtet. Der in Arabien friedliche Bauern erhängen ließ, der eine Horde Eingeborener in Indonesien ohne erkennbare Gründe der Justiz ans Messer lieferte und selbst seine eigenen Landsleute bedenkenlos in den Tod schickte. Der lebende Schlangen aß, Whiskey in Form von Pillen vertilgte und über die seltsamsten Waffen und Maschinen verfügte, die die Welt noch nicht gesehen hatte. Gleichwohl, so erzählt man sich im Lager, hatte es dieses Mysterium zu Doktorwürden gebracht, sah das britische Königreich – in diesen Zeiten! – in ihm den würdigen Träger eines Ordens Ihrer Majestät. Und nicht zuletzt ist dies jener Mann, der, so wie er jetzt stoisch und konzentriert durch das Lager schreitet, eigentlich längst tot sein sollte, aber der doch, wenn auch ausgezehrt und mitgenommen, noch immer unverkennbar lebendig ist.
Der Gefangene äußert sich zu all den Anschuldigungen und Vermutungen nicht. Er schweigt. Sieht nicht einmal den Lagerkommandanten an, als dieser ihn in seinem Büro erst ruhig und aufmerksam befragt, dann ungeduldig, am Ende fast bittend und es schließlich aufgibt. Ob ihm wenigstens der Name Makeprenz etwas sage? Ob sein Spiel als Spion nicht endlich ein Ende haben müsse, Ehre hin, Vaterland her?
Das Monster schweigt, seine Wimpern bewegen sich nicht. Erst als sie ihn abführen, hält der Gefangene im Türrahmen des Offiziersbüros inne.
»Wayang Kulit …«, flüstert er ausdruckslos, an niemanden gerichtet. Lediglich das.
Dann dreht er sich um, und als würde ihm bewusst, dass nichts auf der Welt ihn auch nur eine Handbreit von dem Pfad hat abbringen können, den sein Leben nun einmal genommen hatte, hebt er für den bereits wieder mit anderen Aufgaben beschäftigten Kommandanten kaum merklich seine Stimme.
»Kann ich meine Puppe wiederhaben?«
TEIL EINS
Hielt die Luft in meinen Lungen tagelang
Sah mich als eine unter vielen Wellen an
Als ich begriff, ich war des Meeres Untertan –
Es begann
BIRKENBLUT
Wo er mit den Leichenteilen hinwolle.
Die Räder des Eisenbahnwaggons polterten unter ihnen und ließen ihre Beine erzittern. Noch bevor Oskar antworten konnte, machte der Mann eine abfällige Geste und war im nächsten Abteil verschwunden. Als wären es junge Katzen, schob Oskar seine Rucksäcke zusammen, hockte sich in dem überfüllten Abteil neben ihnen auf den Boden und legte schützend seine Arme über sein Gepäck. Nein, Leichenteile waren das ganz sicher nicht. In der richtigen Reihenfolge zusammengesetzt, waren sie viel mehr das Einzige, was ihn und Karol am Leben erhalten würde. Hoffentlich.
In Kassel musste er umsteigen, dann ein zweites Mal in Stuttgart, bis er müde und hungrig um 14 Uhr 33 in Ulm ankam. An jeder Station hievte er seine drei Taschen aus den Gepäckablagen, zog die Kanister, die Kisten und die beiden Rucksäcke unter den Bänken hervor und zerrte alles Stück für Stück auf den Bahnsteig. Die Menschen gingen an ihm vorbei, manche starrten ihn misstrauisch, andere mitleidig an. Er hörte, wie jemand einen Witz über Gepäck machte. Gepäck, dachte Oskar und stopfte eine herausgefallene Dose Sardinen zurück in einen der Rucksäcke. Wäre ich die Figur in einem Roman, würde man wohl eher von Habseligkeiten sprechen.
Die Ulmer Innenstadt wirkte auf ihn sonderbar still und leer. Der Nachmittag war hell, klar. Einer, an dem man im Park Enten füttern, spazieren oder Eis essen gehen könnte. Oskar schwitzte unter seiner Last. Die Rucksäcke und Taschen hatte er, zwei an jeder Seite, über seine Schultern gehängt, die kleinen Kisten klemmten unter seinen Oberarmen, die Kanister baumelten an weißen, angespannten Fingern. Er kam nur in Trippelschritten voran. Das dadurch entstehende Klappern seiner Schuhe auf dem Kopfsteinpflaster hallte von den Wänden der zu beiden Seiten dicht gedrängt stehenden Fachwerkhäuser wider. Er schielte nach Händen, die Gardinen beiseiteschoben, und bemühte sich, sanfter aufzutreten und gleichzeitig größere Schritte zu machen, um die professionelle Aura eines Expeditionsleiters oder Archäologen zu erwecken, dem nur durch einen dummen Zufall sein Gepäck tragender Kuli abhandengekommen war.
Vor einem Schuhgeschäft sah er eine Tageszeitung liegen, die jemand verloren haben musste und die der Wind nachlässig durchblätterte. Oskar wartete auf den richtigen Moment, setzte einen Fuß zwischen die Seiten und beugte sich vor. Er brauchte ein paar Sekunden, bis er die Meldung gefunden hatte. Dann entdeckte er sie.
»Sieh mal einer an«, murmelte er.
»Gregor Hradetzky gewinnt Rhein-Main-Wettfahrt.«
Das sogenannte Wunderkind hatte die Konkurrenz ein weiteres Mal in die Schranken gewiesen.
»Pff.«
Oskar hob den Blick und betrachtete sein Spiegelbild in der mit Parolen beschmierten dunklen Scheibe des Ladens. Neben dem mit weißer Tünche gepinselten Wort »Itzig« sah er einen schmächtigen, krumm stehenden Kerl, bepackt wie ein Esel, der ihn skeptisch anschaute. Glatt rasiert war sein im Dunkel stehender Zwilling, die Haare zurückgekämmt über einem schlanken Gesicht, angehenden Geheimratsecken und suchenden Augen. Einzig das von seinem Vater geliehene, etwas zu große cremefarbene Hemd mit der blau aufgestickten Krone über dem Herzen strahlte so etwas wie Souveränität aus. Nach dem Hochgefühl und der Aufbruchsstimmung, die Oskar eben noch in sich gespürt hatte, fahndete er in dem Antlitz seines Doppelgängers in der Fensterscheibe vergeblich. Er seufzte und schlurfte langsam, stöhnend weiter. Im gleißenden Sonnenlicht erreichte er eine Eisenbahnbrücke und überquerte die Donau. Sein Magen knurrte, doch er verbot sich, jetzt schon eine der Dosen zu öffnen oder auch nur einen Pfennig der zehn Reichsmark anzutasten. Auf der anderen Seite kam er an einem Schild mit der Aufschrift »Jahnufer«vorbei. Nach zweihundert Metern ließ er die Taschen fallen und blieb schwer atmend neben dem sandigen Kieselweg auf einer Grasnarbe direkt neben einer Treppe stehen, deren Betonstufen zum Fluss hinunterführten. Er betrachtete die Innenseiten seiner Hände. Sie waren feucht und rosa von den in das Fleisch schneidenden Riemen.
Den Inhalt seiner Taschen, Rucksäcke und Kanister fand er genau so vor, wie er ihn am vergangenen Abend in dem Geräteschuppen in Övelgönne verstaut hatte. Er legte die Bootshaut flach auf den Boden, den Vordersteven daneben, klappte die am Dollbord befestigten Schrägstäbe nach hinten und hängte den Spant in die Bodenleisten und an den Dollbordstäben ein. Schlafwandlerisch kümmerte er sich anschließend um die vordere Trittbodenhälfte und schob den ersten Teil des Gerippes in die Haut. Nachdem er mit dem hinteren Teil ähnlich verfahren war, hob, drückte, schraubte und drehte Oskar und kümmerte sich um die Süllränder, bevor er die Trinkwassertanks prüfte und sie mit Reißverschlüssen an den Innenseiten der Segeltuchhaut befestigte.
Er versuchte sich zu beeilen, um vor Einbruch der Dunkelheit noch ein paar Kilometer zurückzulegen, als er bemerkte, dass jemand hinter ihm stand. Ein Junge mit einem Glasauge gaffte ihn vom Kieselweg aus an. Aus dem Mund des Kindes ragte der Stängel eines Lutschers, den er von rechts nach links und wieder zurück wandern ließ.
Als Letztes sicherte Oskar den Sitz mit dem Hakenwinkel. Zwanzig Minuten nachdem er mit der Montage begonnen hatte, lag vor ihm auf dem Rasen neben dem staubigen Uferweg sein einsatzbereites Faltboot, das seine Schwester vor Jahren in einem Anfall sorgloser Einfältigkeit Sonnenschein getauft hatte.
Obwohl er genau wusste, dass dies nicht der Fall war, prüfte er alles noch einmal, um zu sehen, ob er irgendetwas vergessen hatte. Er schritt das fünf Meter vierzig lange Boot ab, beugte sich hier und da über das schmale Modell 540-G und griff in den Einstieg. Plötzlich hielt er inne. Die angenietete Leiste unter dem Trittbodenbrettchen griff nicht richtig. Sein Sitz würde sich hin- und herbewegen, noch bevor er die erste Brücke passiert hätte.
Der Junge hinter ihm steckte sich einen weiteren Lutscher in den Mund. Beim Aufstehen wurde Oskar schwindelig. Seit der dünn bestrichenen Schmalzstulle, die er sich gestern Abend mit Karol geteilt hatte, hatte er nichts mehr zu sich genommen. Er rieb sich die Nase und ging auf das Kind zu.
»Ich brauch deinen Lutscher.« Er zeigte auf sein Boot. »Nehm dich dafür ’ne Runde mit: bis da vorne und wieder zurück.«
Der Junge schüttelte den Kopf und ließ den Stiel des Lutschers wandern.
»Ist ein Zweisitzer von Pionier. Ich habe es mit einem Freund umgebaut. War ziemlich aufwendig. Hab damit schon Rennen gewonnen.«
Der Kleine warf einen Blick auf das Faltboot, während sein Glasauge gleichgültig die Donau anstarrte. Dann sah er den Fremden an und verneinte stumm.
Oskar fiel Karols Trick mit den Händen ein. Vorsichtig ging er vor dem Jungen auf die Knie.
»Ich mach dir einen Vorschlag. Eine Wette. Wenn ich es schaffe, dir die Hände umzudrehen, ohne sie zu berühren, gibst du mir deinen Lutscher. Wenn ich es nicht schaffe, bekommst du von mir zehn Reichsmark.«
Oskar konnte Karols Schmirgelpapierlachen hören. Er fragte sich, ob seine Mutter und sein Vater es wohl genauso lustig fänden, dass er ihr Geld, seine gesamte Barschaft für die Reise, derart leichtfertig aufs Spiel setzte. Aber mit einem defekten Boot loszufahren kam nicht infrage. Keine halben Sachen.
Er holte zum Beweis den Schein hervor, glättete ihn auf seinem Bein, legte ihn vor die Füße des Kindes auf den Kiesweg und setzte vorsichtig die Spitze seines Schuhs darauf, damit er nicht wegflog. Der Junge zögerte. Er wendete den Lutscher in seinem Mund, schielte einäugig auf das Geld und zog etwas Rotz hoch. Dann nickte er.
»Sehr gut. Die Regeln sind ganz einfach. Alles, was du tun musst, ist, deine Hände vor mir auszustrecken.«
Das Kind gehorchte.
»Nein, nicht so. Andersrum«, korrigierte ihn Oskar.
Als der Junge die Hände wendete, steckte Oskar den Schein ein, nahm dem Kleinen den Lutscher ab und ging zurück zu seinem Boot. Nach ein paar Schritten blieb er stehen. Er betrachtete die klebrige Kugel, seufzte, zog sie vom Stiel, machte kehrt und gab sie dem Einäugigen zurück.
Vor der Sonnenschein kniend, knickte er den Stiel, zwirbelte ihn zweimal um die eigene Achse, klemmte ihn tief zwischen Leiste und Brettchen und überprüfte alles auf seine Festigkeit. Dann zog er das Faltboot die Stufen hinab ans Wasser. Er inspizierte seine Taschen und verstaute ein Gepäckstück nach dem anderen im Körper des Bootes. Das Ersatzpaddel schob er in einen eigens dafür genähten Schaft, den Feldstecher in ein mit einer Kordel verbundenes Säckchen, und nachdem er etwas Dreck von der Linse des Mikroskops für die Mineralienfunde geblasen hatte, fand er auch dafür einen Platz.
Schließlich vergewisserte er sich, dass die Schokolade, das getrocknete Dosenfleisch und die Kondensmilch auf der Zugfahrt keinen Schaden genommen hatten. Er wickelte sie in seine Ersatzkleidung – eine Hose, zwei Unterhosen, ein Hemd, zwei Paar Strümpfe, eine Jacke sowie Karols Krawatte – und stopfte alles in die Messingkanister. Zum Schluss tastete er vorsichtig nach der in einem Stoffbeutel steckenden Mauser-Pistole, schob sie tiefer in eine der Kisten und platzierte diese im Heck des Faltboots neben den leeren Stabtaschen. Er klopfte zweimal gegen die Außenhaut, blickte auf und sah den spitz zulaufenden Hals des Ulmer Münsters auf der anderen Seite des Flusses in den blauen Himmel emporragen.
Noch kann ich zurück, dachte er. Umkehren. Zum Bahnhof. Mich in den Zug setzen und eine andere Lösung finden.
Karol würde heute Abend mit Lieselotte im Hoppe sitzen und ein Glas Langsamer Selbstmord, Jungfrauenmilch fünfzehnjährig oder Rattenblutauf ihn trinken, was alles nichts anderes war als Himbeersaft mit Kümmel und einem beliebigen Schuss Alkohol. Oskar stützte die Hände in die Hüfte und betrachtete sein Boot. Die Donau dahinter floss träge und dunkel dahin.
Er holte tief Luft und stieg ein.
Der Kleine beobachtete, wie Oskar sein Paddel ins Wasser stieß. Als der Junge sich zum Gehen wandte, bemerkte er ein gefaltetes Stück Papier auf dem Rasen. Er hob es auf und öffnete es. Es war eine herausgerissene Anzeigenseite. Er überflog die Überschriften der Annoncen:
»Panther-Klopfer für jugendliche Elastizität«, »Charakterbeurteilung gegen Einzahlung von einemFranken siebzig auf ein Postscheckkonto der Luzerner Stadtbank«, »Flasche Birkenblut gegen Haarausfall, 30 Pfennige«.
Am Fuß der Seite war eine der Anzeigen mehrmals mit einem Bleistift umkreist worden:
»Arbeiten auf Zypern – Anstellung in einer Kupfermine sofort möglich – Bezahlung auskömmlich. Schreiben Sie uns oder melden Sie sich bei Interesse in unserem Büro.
Cyprus Mines Corporation in Skouriotissa.«
Der Einäugige kratzte sich im Nacken und schaute dem Mann hinterher, der sich – bereits ein ganzes Stück flussabwärts – in hoher Geschwindigkeit von ihm entfernte, den Blick fest auf die erste Biegung geheftet.
REISETAGE
Ich beginne nun mein Tagebuch. Ich verließ Hamburg am 13.5.1932 und kam am 14.5. in Ulm an. Ich machte das Boot klar und fuhr los. Erste Übernachtung im Zelt. Ich erreichte Passau am 23.5. und fühle mich jetzt völlig allein.
In der Pfandleihe, in der er seinen Feldstecher versetzte, sagte man Oskar, zwei Straßen weiter gebe es einen Krämerladen, dort werde er Kondensmilch bekommen. Sein Rücken tat ihm weh vom Paddeln und den ersten ungemütlichen Nächten auf hartem Erdboden. Sein Po war wund, und er spürte jede Sehne in seinen Waden. Auf dem Weg kam er an einem Gasthaus vorbei. Er eilte zwischen dunkler Vertäfelung zum Tresen, bestellte ein Bier und bedeutete der Wirtin, dass er Wasser lassen ginge. Auf der Toilette sah er in den Spiegel und erschrak über die Augenringe, die sich in seinem Gesicht abzuzeichnen begannen. Die Wirtin klopfte an die Tür. Er kehrte in den Gastraum zurück, sie stand bereits mit einem zu zwei Dritteln gefüllten Glas da und hielt es ihm entgegen.
»Kann ich mit einem Dresdner Schilling bezahlen?«, fragte er leise.
»Hab i’s g’wusst. Raus mit dia. Bettler und Juden ham kahn Zutritt. Raus, schleich di, Jesses-Mare.«
Wieder zurück auf dem Wasser, stellte sich Oskar vor, er sei Charlie Barr. Träumte sich in dessen Rekordfahrt über den Atlantik im Jahr 1905 und wich imaginären Brechern aus. Er setzte Segel, sah Masten vor sich aufragen und spuckte in den Wind.
Er wusste, wie man Schotterbänke umfuhr und dass hinter Brückenpfeilern durch die Teilung des Wassers bedrohliche Stromschnellen entstanden. Wie Barr es aber mit dem Drei-Mast-Schoner Atlantic von New Jersey zum Leuchtfeuer bei Lizard Point an der Küste von Cornwall in nur zwölf Tagen über ein Weltmeer geschafft hatte, war ihm, wie jedem anderen, ein Rätsel. In den Legenden über die Rekordfahrt kamen die Menschen zu den unterschiedlichsten Schlüssen. Einig war man sich über dreierlei: Barr wusste mit dem Begriff »Angst« wenig anzufangen, er verlangte von seiner Mannschaft, sich bei der Arbeit bis an den Rand der Bewusstlosigkeit zu verausgaben, und seine Detailversessenheit wurde in manchen Zirkeln als Krankheit interpretiert.
Oskar war seit Kindertagen fasziniert von den großen, legendären Pionieren der Seefahrt, und auch über das Leben des schmächtigen Schnurrbartträgers hatte er jeden verfügbaren Schnipsel gelesen. Neben Barrs nautischen Leistungen war ihm vor allem der frühe Tod des Schotten im Gedächtnis geblieben, der den Segler mit nur sechsundvierzig Jahren nach einem Herzinfarkt in den Armen seiner Frau ereilte. Inmitten seiner Träumereien von Barrs großer Liebe – wie diese wohl ausgesehen haben mochte, ob sie womöglich sogar noch lebte und zwischen den Strömungs- und Windkarten ihres Gatten ein einsames Dasein in der Nähe des Lizard Lighthouse fristete – fiel Oskar der Zweck seiner eigenen Reise ein. Er rief sich innerlich zur Räson und paddelte kräftiger.
In Linz überzeugte er den Rezeptionisten eines Hotels, kostenfrei seinen Bruder Heinrich anrufen zu dürfen, den er um eine Geldanweisung bat. Als nach zwei Wochen zwanzig Reichsmark eintrafen, kaufte er sich für die Hälfte der Summe eine Mandoline. Abends saß er in seinem Zelt, auf das ein warmer Juniregen knatterte, und versuchte, sich an die Melodien jener Lieder zu erinnern, die sie immer im Hoppe spielten. Doch so wenig er in seinem Stammlokal dazu hatte tanzen können, so wenig konnte er nun die Akkorde von Amalie geht mit’m Gummikavalierheraufbeschwören.
Also nahm er unter dem Trommeln der Tropfen Lieselottes Geschenk in die Hand, ein Büchlein mit Sprüchen ihres Lieblingsautors, das sie ihm am Bahnhof zugesteckt hatte. Es war ein kleiner, vergilbter Band, dessen Umschlag die kreidigen Umrisse von Mark Twains Konterfei auf hellblauem Untergrund zeigte. Er blätterte zu ihrer Widmung auf der leeren Seite vor den Verlagsangaben. »Vergiss nicht das Zurückkommen. Ich warte im Hoppe, deine Liesel«.
»Vielleicht bin ich am Buß- und Bettag schon wieder da«, hatte er ihr am Bahnhof, sich auf das heruntergezogene Zugfenster lehnend, gesagt. Sie hatte gelacht. »Wäre ja das erste Mal, dass du dich an der Religion orientierst.« Als er jetzt nachrechnete, kam ihm ein halbes Jahr für sein Unterfangen sehr ambitioniert vor. Aber unmöglich war es nicht.
Lieselotte. Oskars Vater, der zwei Worte vorzog, wenn drei genügten, war über sie ins Schwärmen geraten, hatte seinem Sohn eine baldige Heirat ans Herz gelegt. »Mensch, die Liesel, die ist großzügig, offenherzig ist die und freundlich. Solltest du dir sichern. Klug ist sie auch. Feste Haare, runder Busen, was willst du denn mehr?«
Oskar schnitt ein sichelförmiges Stück aus einem Apfel und erinnerte sich an das, was Lieselotte ihm im Hoppe einst offenbart hatte, an ihrem Stammplatz direkt neben der großen Fensterfront, die zur Elbe wies. »Viel zu sagen hast du ja nicht. Aber wenn du den Mund aufmachst, bin ich immer bestens amüsiert.« Als Lieselotte ihn später hinter den Bootshäusern geküsst hatte, glaubte er zunächst, sie wolle ihn hochnehmen und würde jeden Moment ihre Freundinnen herbeirufen, um sich über ihn lustig zu machen.
Doch niemand kam. Stattdessen schlich sich etwas Verklärtes in ihren Blick, und nach wenigen Augenblicken entfuhr es ihr, dass es schon unter Umständen irgendwie sein könne, dass sie ihn vielleicht liebe.
»Schatztruhe« nannte Lieselotte ihn, weil es ihr so vorkam, als würde er eigentlich irgendwo auf dem Grund des Hafens hausen, nie wirklich anwesend sein, lieber alleine für sich, die Gegenwart anderer, selbst ihre, mehr dulden als sie suchen. Zweisamkeit liege ihm im Grunde nicht. Insgeheim hoffe sie, so hatte Liesel angefügt und dabei versucht, ihrer Stimme einen heiteren Klang zu verleihen, sie würde ihn eines schönen Tages sprichwörtlich öffnen können und etwas Glänzendes, von ungeheurem Wert zutage fördern. Bis dahin müsse sie sich wohl damit zufriedengeben, eine schön anzusehende Truhe vor sich zu haben und den Glauben an deren Verheißung nicht zu verlieren. »Ich vertraue auf deine treuherzigen Augen, Oskarlein.«
Oskar wusste nicht, ob er Lieselotte liebte. Aus dem einfachen Grund, weil er mit dem Begriff Liebe nichts verband. Die Liebe war wie eine Maschine, deren Mechanik er nicht verstand, sosehr er sich auch bemühte. Er war Mitte zwanzig und ahnte, mit der richtigen Anleitung würde sich auch ihm eines Tages erschließen, was die Menschheit daran so aus der Fassung geraten ließ. Lange, so viel war ihm klar, würde er nicht mehr warten können.
Der Regen wurde schwächer. Oskar griff nach dem magnetischen Kompass und fragte sich, wie man wohl beschaffen sein müsste, aus welchem Holz geschnitzt, um ein Haudegen wie Kapitän Franz Romer oder Charlie Barr zu werden. Lag es diesen Kerlen in den Genen? Waren es Gabelungen in ihrem Leben, zufällig eingeschlagene Wege, die aus normalen Männern jene Verrückten machten, die erst Ruhe gaben, wenn sie den Naturgewalten wenigstens ein Mal auf außerordentliche Weise die Stirn geboten hatten? Eines war gewiss: Weder Barr noch Franz Romer hatten ein elektrotechnisches Büro betrieben, und keiner von beiden war mit diesem aufgrund mangelnden Geschäftssinns und einer in Schieflage geratenen nationalen Wirtschaft pleitegegangen. Alexander Mackenzie, der eine Passage vom Athabascasee in Kanada bis zum Pazifik in einem Birkenrindenkanu erkundet hatte, hatte sich nicht mit Ankerwickelei abgegeben und Teigelkamp seine Fahrten auf europäischen Gewässern nicht mit dem Verkauf neuzeitlicher Leuchtreklamen finanziert.
Oskar strich mit den Fingern über die Seekarten und den Küstenführer, schlug den Nautischen Almanach auf und blätterte durch die Navigationstafeln. Erst als er den ölig-holzigen Geruch eines der Dollbordstäbe einsog, fühlte er sich besser.
Bevor er sich schlafen legte, schlich er noch einmal nach draußen vor sein Zelt und prüfte die reparierte Traverse.
Am nächsten Tag, während er auf der grün schimmernden Donau auf die Ortschaft Grein zuhielt, dachte Oskar über zwei von Mark Twains Sprüchen nach, die er am Vorabend gelesen hatte.
Der Amerikaner war folgender Meinung:
»In zwanzig Jahren wirst du enttäuschter sein von den Dingen, die du nicht getan hast, als von denen, die du getan hast.«
Obwohl Oskar sich vorgenommen hatte, täglich nur eine der Weisheiten des Schriftstellers zu lesen, um das Vergnügen an seiner einzigen Lektüre so dünn wie möglich auf das Brot seiner Reisetage zu streichen, war er beim Blättern auf eine weitere gestoßen, die seine Aufmerksamkeit erregte:
»Das Geheimnis des Vorankommens ist das Anfangen.«
Das gefiel ihm. Er paddelte schneller und nahm sich vor, Mark Twains Erkenntnisse fortan als Leitfaden für seine Reise zu nutzen.
Er spürte, wie sich seine Muskeln an die Strapazen gewöhnten. Die ersten Stunden jedes Tages im Boot waren mühsam, doch schien sich sein Körper immer besser mit der anstrengenden Routine abzufinden und sich darauf einzustellen, und mit jedem morgendlichen Aufbruch kam er schneller in Schwung.
Er genoss, wie friedlich alles um ihn herum war. Kein Vergleich zu Hamburg, wo sie zuletzt selbst das U-Bahn-Personal mit Waffen ausgestattet hatten. Er fuhr an Klatschmohn vorbei, an Pappelalleen und Ahorn, golden schimmernden Getreidefeldern. Er paddelte an Weinbergen und Wiesen mit gelbem Kreuzkraut entlang.
Als es zu dämmern anfing, überkam Oskar ein seltsames Gefühl. Wie wenig Interesse seine Eltern und Geschwister vor seiner Abfahrt an seiner Unternehmung gezeigt hatten! Sie hatten sie weder als besonders wagemutig noch als verrückt erachtet, ihn weder dumm noch einfallsreich genannt. Sie nahmen seine Idee zur Kenntnis, hatten ihm auf Nachfrage murrend die zehn Reichsmark in die Hand gedrückt und eine gute Reise gewünscht.
Was, wenn ich einen Unfall habe, wenn ich ertrinke?
Er überlegte, wie wohl seine Beerdigung vonstattengehen würde. Trotz größter Anstrengung konnte er nur wenige Mitglieder seiner Familie am offenen Grab erkennen. Lieselotte würde da sein. Wenn sie freibekäme im Betrieb. Er hatte sie noch nie weinen sehen, und selbst auf dem Friedhof, über seinen Sarg gebeugt, hatte sie in seiner Vorstellung keine rot geränderten Augen. Auch Karol wäre dabei, natürlich, würde irgendeinen Spruch klopfen: »Stirb, solange sie noch weinen« oder etwas dergleichen. Vielleicht käme Erich vorbei, andere würden den Termin verschlafen. Er dachte nach, und als ihm nach wenigen Minuten keiner dieser anderen einfiel, verdrängte er den Gedanken wieder. Bis ihm klar wurde, dass sich niemand die Mühe machen würde und auch nicht über die Mittel verfügte, seine Leiche am Ufer der endlosen Donau suchen zu lassen, um sie anschließend nach Hamburg zu überstellen. Nicht einmal Karol. Schon gar nicht Karol. Sobald der auch nur drei Groschen in der Tasche hätte, würde sich der Schatten ihres Gläubigers, des alten von Stäblein, über ihn legen, und der herzlose Tyrann würde ihm die Kröten abnehmen. Bei dem Gedanken daran wurde Oskar schlecht.
Als er am Abend sein Zelt aufbaute, fragte er sich, wieso Karol der einzige Mensch war, den er wirklich gut kannte. Wie wenig er von dem Leben seiner Geschwister wusste. Wie wenig er im Grunde Lieselotte durchschaute. Auf einmal hasste er sich dafür, sich nicht öfter und genauer erkundigt, sie nicht nach diesem oder jenem gefragt zu haben. Er sann über seine Eltern nach und darüber, dass er einem Fremden auch über sie nichts Näheres hätte erzählen können. Weihnachten sangen sie gelangweilt Lieder; sein Vater schnitt sich ab und an im Wohnzimmer die Fußnägel; der Tonfall seiner Mutter wurde süßlich, sobald sie Wilhelm Lindemann singen hörte, was so gut wie nie vorkam. Das war’s. Schließlich versuchte Oskar, seine Konzentration wieder auf die vor ihm liegende Strecke zu lenken, und ihm wurde klar, wie wenig er auch sie studiert hatte. Zu wenig. Romer und Barr hätten es anders gemacht.
Als er fertig war, stand er vor seinem Zelt und starrte ins Leere, deprimiert darüber, wie wenig er überhaupt von der Welt wusste.
STÄBLEIN
In seinem Haus, einem Prachtbau in Rufweite der Außenalster, standen Schnaps, Kaffee, Gebäck und gutes Geschirr auf dem langen Esstisch. Rauchwolken schwebten ineinander. In aller Seelenruhe befreite Gernot von Stäblein mit seiner Zunge Essensreste aus den Zwischenräumen seiner Zähne. Seine Gäste debattierten derweil lautstark über Politik, hier und da wurde die Unterhaltung von explodierendem Gelächter oder dem Klirren von Untertassen garniert.
Konstanty registrierte, dass die meisten der acht oder neun Freunde, Geschäftspartner und Günstlinge seines Vaters den direkten Blickkontakt mit dem Industriellen mieden. Er hingegen hatte einige Mühe, seinen Erzeuger nicht andauernd anzustarren, so fasziniert war er davon, dessen Mimik zu studieren. Konstantys Freund Walter Schwencke, ein groß gewachsenes, dürres Gerippe, war auf einen Sprung vorbeigekommen, saß neben ihm am Tisch – ein wenig zusammengesunken, um nicht aufzufallen – und nippte an seinem Kaffee. Keiner von beiden wagte es, sich in die Unterhaltung einzumischen.
Die Männer sprachen über den geplanten Demonstrationszug der SA quer durch die Altonaer Altstadt. Ein älterer Herr mit weißen, wild vom Kopf abstehenden Haaren ergriff das Wort und wedelte mit krummem Zeigefinger durch seinen Pfeifenqualm.
»Das gibt Blut, Blut und noch mal Blut.«
»Sollen sie sich doch erschlagen«, fuhr ihm ein adrett frisierter Jungspund in Uniform dazwischen, ein Emporkömmling der Partei, wie Konstanty wusste.
»Wer übrig bleibt, kriegt die Stimmen der Arbeiterschaft. So sieht’s doch aus.«
Erst einmal sei er sehr gespannt, stöhnte der Alte, wie die Kommunisten auf den Aufmarsch reagieren würden.
»Da werden sie in Klein-Moskau schön blöd aus der Wäsche schauen«, murmelte jemand.
»Die Sozi und die Kozi«, sang Hans von Tschammer und Osten leise vor sich hin, ein kauziger, kleiner Militär, den Konstanty von vielen derartigen Nachmittagen im Hause seiner Eltern kannte und von dem er annahm, dass er hinter seiner freundlichen Fassade nicht arm an Abgründen war.
»Ich würde sogar mitmarschieren«, sagte der Jüngling und griente, »aber Helene will mich an dem Tag ihrer Tante vorstellen.«
»Hab gehört, die SA will Handgranaten mitnehmen.«
»Na dann …«
»Männer, lehnt euch einfach zurück und genießt die Keilerei.«
Alle redeten durcheinander, bis ein genervtes Schnaufen erklang und es still wurde am Tisch. Gernot von Stäblein hielt schützend eine Hand vor den Mund, um mit der anderen endlich den Störenfried aus seinem Mund zu ziehen.
»Keine Bange«, erklärte er träge, seinen Zahnspaltenfund auf den Boden bröselnd, »in Altona wird sich einiges ändern, meine Herren. Die Handgranatenanschläge werden die Kommis schnell vergessen. Bei dem vielen Geld, das wir in die Sanierung des Viertels stecken! Schauen wir mal, wer danach noch da wohnt.«
Nach einer respektvollen Pause setzten die Männer ihre Unterhaltung fort. Von Stäblein verschränkte die Arme, wobei er eine Hand dazu nutzte, sein Gesicht darauf abzustützen, seine Finger reichten bis zum Jochbein. Wurde ihm langweilig, musterte er die Männer der Runde, zog eine Braue hoch oder schüttelte gelassen eine neue Zigarette aus der vor ihm liegenden Packung.
Selbst durch den Tabaknebel konnte Konstanty am anderen Ende des Tisches das Rasierwasser seines Vaters riechen. Moschus, dick und süß. Angeblich, so hatte Konstanty es im Lateinunterricht gelernt, stammte der Name des Duftstoffes von dem indischen Wort für Hoden ab; eine Theorie, die seiner Ansicht nach gut zu der Tatsache passte, dass sein alter Herr mit dem Zeug seinen Altmännergeruch übertünchte.
Walter tuschelte ihm etwas zu, aber Konstanty war zu beschäftigt damit, jede Bewegung seines Vaters zu beobachten. Wie er sich jetzt auf der Lehne abstützte, einen Arm leicht inwendig gedreht, sodass ein rechter Winkel in der Beuge entstand; wie er dabei mit den Fingern der freien Hand etwas Unsichtbares zerrieb; das Kratzen seiner bis zur Schläfe rasierten Haare; die Position der fest zwischen Zeige- und Mittelfinger eingeklemmten Zigarette; er registrierte jede Regung in dem bis auf einen mathematisch exakt gestutzten Oberlippenbart glatten Gesicht und jeden Ton seiner markanten Stimme; den Bleistiftmund, der seitenlange Befehle mit einem einzigen Zucken anzuordnen vermochte. Konstanty hatte sich seit jeher gefragt, wie dieser Mann ohne Lippen es schaffte, seine Mutter zu küssen. Die Antwort, so erkannte er beim Abgleich seiner Erinnerungen mit seinen Vermutungen, war simpel: Sie küssten sich nicht. Und hatten sie je?
»Hörst du mir überhaupt zu?«, zischte Walter im Flüsterton. »Die ganze Brauerei, ich werde bald die ganze verdammte Brauerei von meinem Vadder übernehmen.«
»Aha.«
»Und ob. Und dann bring ich den Laden auf Vordermann. Werbung, Plakate, ein paar richtig irre Aktionen. Mein Alter ist da zu blöd für. Ich hab schon Ideen, aber der richtig große Knaller fehlt mir noch.«
Konstanty griff nach einer leeren Cognacflasche, schüttelte sie, damit sein Vater merkte, dass er sich um Nachschub kümmern wollte, wartete dessen affirmierenden Skalpellblick ab und bedeutete dann Walter, ihm ins Wohnzimmer zu folgen.
»Das ist ganz wunderbar«, sagte Konstanty, als sie die Schiebetür hinter sich geschlossen hatten. »Du bekommst die Brauerei, und ich habe von meinem Vater nicht einmal die Fingernägel geerbt. Stattdessen nichts als mütterliche Anatomie.«
Walter pfiff eine kleine Fanfare.
»Kerl, du hast einen messerscharfen Intellekt, goldene Haare und Wangenknochen für Filmplakate. Wenn du deinen Charme richtig einsetzt, öffnen sich dir alle Türen. Und du kannst dich ausdrücken wie kein Zweiter. Du redest wie gedruckt. Von dir geht eine magische Anziehungskraft aus. Ich würd’s nicht sagen, wenn’s nicht die Wahrheit wäre: Dir vertraut man. Dich werden sie in der Partei für die ganz großen Ansprachen engagieren, wirst schon sehen. Ich würde sofort mit dir tauschen.«
»Ach ja? Nimmst du dann auch die schmalen Schultern? Die käsig blasse Haut und die dünnen Waden?«
»Dafür hast du eine einmalige Stimme.«
Walter strahlte seinen Freund an, um seinem nicht ernst gemeinten Lob mehr Wirkung zu verleihen.
»Arschloch.« Konstanty öffnete die Glasvitrine und schob ein paar Flaschen Weinbrand beiseite. »Mach dich nur lustig über meine Stimme. Du hast gut lachen, Walter. Du hast die Pubertät mit einem warmen, nach Kontrabass klingenden Instrument verlassen.« Er zog einen Delamain aus dem Schrank und hielt ihn neben einen Camus. »Dieser entsetzlich dünne akustische Faden, an dem meine Worte hängen, ist für mich und schon gar für einen durch und durch mit Potenz gepolsterten Mann wie meinen Herrn Vater nur schwer zu ertragen.«
Walter griente und klatschte langsam Beifall.
»Die Reden der Nation, ich sage es ja.«
»Von wegen.« Konstantys Wangen glühten. »Ich versuche lediglich, meine Verachtung für die Menschheit auszudrücken. Daran ist mein Alter vermutlich auch schuld.« Kurz vor der Tür blieb er stehen. »Deine Brauerei. Viel wichtiger. Natürlich können wir die auf Vordermann bringen. Gib mir ein paar Tage, mir fällt schon was ein.«
Als sie mit dem Alkohol zurückkamen, rückte der Jungspund gerade seinen Stuhl ab, stand auf und hob erst das Kinn und dann sein Glas.
»Nun wollen wir mal angemessen anstoßen und feiern«, erklärte er mit falscher Emphase, und Konstanty wandte sich Walter zu und rollte mit den Augen. »Stahlindustrieller, Besitzer Dutzender Immobilien, Adliger, stolzer Hamburger Nationalsozialist – und nun auch noch Mitglied im Präsidium des Reichsstandes der deutschen Industrie. Gratuliere, Gernot!«
Der Weißhaarige, von Tschammer und Osten und die anderen stimmten mit ein, prosteten anerkennend dem Gastgeber zu oder bekundeten brummend ihre Ehrfurcht.
Walter verabschiedete sich kurz darauf, und Konstanty harrte mit einem Glas Cognac im Schoß dem Ende der Zusammenkunft. Dem Fortlauf der Konversation schenkte er keine Beachtung, schreckte erst wieder auf, als sein Vater kräftig seine Zigarette ausdrückte und den letzten Qualm ausstoßend in den Raum plapperte: »… nur ein paar Kontorhäuser in der Innenstadt. Und einem Kommunisten Geld wegzunehmen, ist ein schönes Oxymoron, findet ihr nicht auch?«
In die muntere Zustimmung hinein stand er auf, die Gäste gehorchten und taten es ihm gleich.
»Wo wir schon von dem Pack sprechen«, fuhr von Stäblein über dem allgemeinen Stühlerücken in süffisantem Tonfall fort, »Konstanty, was macht dein Lieblingsprojekt, der kreative Marxist?«
»Also«, Konstanty räusperte sich heiser und versuchte, beim Sprechen an Teer zu denken, »er sagt, er werde bald Arbeit finden, um die laufende Miete zahlen zu können. Aber ich werde Maßnahmen …«
»Ich habe meinem Sohn das Eintreiben von Schulden eines besonders flamboyanten linken Charakters übertragen«, schnitt ihm Gernot von Stäblein das Wort ab. »Steht gleich doppelt bei mir in der Kreide, Betrieb futsch, und seine eigene Miete kann er auch nicht begleichen. Aber ideenreich wie ein Jude. Hat seinen ehemaligen Geschäftspartner mit einem Faltboot losgeschickt«, er betonte das Substantiv, »auf dass er irgendwo im Mittelmeer das Geld beschaffe. Und dreimal dürft ihr raten, wer auf diesen Schwachsinn hereingefallen ist.«
Die Männer verharrten mitleidig blickend in ihren Positionen.
»Ich habe die Sache im Griff«, erwiderte Konstanty. »Und auch schon weitere Ideen.«
Von Stäblein bleckte die Zähne.
»Also genau das, was uns gerade noch fehlte.«
»Ich habe diesem Kretin Ärger gemacht.«
Ein blubberndes Lachen entfuhr seinem Vater.
»Wie sieht das denn aus, wenn du Ärger machst?«
Die Gäste setzten ihre Hüte auf und schlüpften in ihre Jacketts.
»Ich habe ihm gesagt, wir könnten seine Kellerwohnung jederzeit an jemand anders vermieten. Ihn rauswerfen. Das hat ihn beeindruckt.«
»Es sprach zu euch: der König des Konjunktivs. Meine Herren, es war mir ein Vergnügen, ich geleite euch noch hinaus.«
Murmelnd verließen die Männer das Esszimmer. Konstanty stützte sich mit ausgestreckten Armen und finsterer Miene auf einem Stuhl ab. Im Vorbeigehen sah ihn Gernot von Stäblein ausdruckslos an.
»Du bist nicht fest genug, Konstanty. Wenn du nicht aufpasst, landest du irgendwann mit gebrochenem Kiefer in einem Graben.« Er winkte von Tschammer und Osten zu sich. »Hans. Hans, komm doch mal, bitte. Benötigst du bei dir im Büro vielleicht …«, er zögerte, »jemanden, der dir ein bisschen zur Hand geht?«
Noch bevor Konstanty protestieren konnte, sicherte von Tschammer seine Unterstützung zu, schenkte Vater und Sohn ein aufmunterndes Lächeln und verabschiedete sich.
»Vater«, zischte Konstanty, »ich brauch den nicht. Ich habe einen perfekten Plan geschmiedet.«
»Ah, einen Plan. Ist das eine Drohung? Du weißt, ich hasse es, wenn du dich dumm anstellst.«
»Merkwürdig, ich dachte immer, du verabscheust es, wenn ich mich zu klug anstelle. Gib mir etwas Zeit, dann wirst du schon sehen.«
Gernot von Stäblein prüfte die Wetterlage jenseits der Fenster und seufzte.
»Mangels Alternative – stattgegeben.«
Er musterte seinen Sohn, dann folgte er seinen Gästen.
Konstanty schlich zurück zum Esstisch und steckte die angefangene Packung Zigaretten ein.
»›Stattgegeben‹«, flüsterte er sich selbst zu und starrte lange auf den Aschenbecher. »Von Tschammer und Osten. Wieso eigentlich nicht?« Dann rieb er mit einem Schuh Schmutz vom anderen und nickte. »Ihr werdet alle noch auf mein Klosett kommen, Wasser saufen.«
BEDINGUNGEN
Heuriger. Die Antwort sei immer Heuriger, erklärte ihm der Wirt und ließ sein Geschirrtuch auf die Schulter schlappen. »Gehst zm Heurigen, setzt di in n Heurigen und trinkst ahn Heurigen.« Er stellte das Bier vor Oskar ab und fügte hinzu: »Außer, trinkst Bier.«
Hinter der Fensterscheibe versickerte das letzte Licht eines kristallenen Sommertages in der aufkommenden Dunkelheit, und Oskar holte die Briefe hervor, die er den ganzen Tag lang zum Schutz in einem der Messingkanister aufbewahrt hatte. Er riss den ersten auf.
Er war von Lieselotte. Sie schrieb, wie sehr sie ihn vermisse, dass sie ihn liebe. »Wirklich«, schrieb sie. Zum Beweis zierten ausgemalte Herzen und Blumen den Rand des Papiers. Ansonsten erging sie sich in langatmigen Berichten über ihre Arbeit in dem Papierwarenladen in Ottensen und lästerte über ein paar merkwürdige Gestalten, die das Hoppe zusehends als Austragungsort politischer Schnauzereien kaperten.
Karols Brief war schmutzig, von blauen Schlieren überzogen. Der Umschlag roch merkwürdig.
Hamburg, 15. Juli 1932
Spargel,
ich habe hervorragende Neuigkeiten. Aber zunächst: Wie machst du dich? Bist hoffentlich noch bei Gesundheit und guten Mutes. Wie du mir empfohlen hast, schicke ich dir den Brief nach Wien.
Die erste gute Nachricht ist: Ich habe wieder Arbeit! Bei Erich. Ja, Weißdorn. Hat wohl Mitleid mit mir. Stehe jetzt jeden Tag auf dem Fischmarkt und verkaufe Reeperbahn-Gaunern und betrunkenen Seeleuten von der Unterelbe Hühneraugenmittel und Harzer Kanarienvögel. Läuft blendend. Solltest du mal eine Angorakatze oder ein Yorkshire-Fettschwanzschaf brauchen, sag Bescheid. Wer kauft so was?, hab ich Erich gefragt. Hauptsache, sie kaufen, meinte er. Ich nehme an, er stiehlt die armen Kreaturen irgendwo und besorgt sich den Rest, indem er Ewerführer oder Kaiarbeiter besticht. Soll mir alles recht sein. Jetzt, mit Gehalt, ist bald auch wieder feste Nahrung drin.
Du hast geschrieben, dass du dir Sorgen um mein Liebesleben machst. Zu Recht. Denn jetzt, wo ich nicht nur pummelig bleiben werde, sondern auch noch dieser entsetzliche Aalgeruch an mir klebt, werde ich wohl erst recht keine Frau aus der Nacht fischen. Momentan locke ich höchstens Mückenweibchen und verdorbene Kapitäne aus Finkenwerder an.
Wo wir schon davon sprechen: Lieselotte lässt ausrichten, das Geschäft, in dem sie arbeitet, ginge Krebsgang. Sie wird dir bestimmt schreiben. Also meine famose Anstellung bekommt sie nicht! Wer gibt schon derartige Pfründe auf?
Du bist zur richtigen Zeit aufgebrochen, Osse. Je näher die Wahlen kommen, desto ärger schlagen sich die Leute die Köpfe ein. Die SA ist beängstigend gut organisiert. Ganze Trupps mit Fahrrad fahrenden Nazis dringen hier jetzt in Siedlungen ein und verprügeln alle, die nicht bei drei auf dem Baum sind. Überall, wo keine KP- und SP-Genossen sind, schlagen sie zu. Feuern blaue und rote Leuchtkugeln ab und scharfe Munition.
Ein Cousin zweiten Grades hat versucht, mich für die »Eiserne Front« zu begeistern, aber ich habe ihm abgesagt. Die Braunen werden die Wahlen verlieren. Wenn ich sie vorher trete, erreiche ich nur das Gegenteil.
Genug! Kommen wir zu den famosen Entwicklungen.
Deine Fahrt wird sich bald doppelt lohnen. Stell dir vor, ausgerechnet unser Gläubiger wird uns retten! Ja, der olle von Stäblein, beziehungsweise sein Sohn. Den solltest du kennenlernen, ist echt ’ne Marke.
Ich muss dazu etwas ausholen. Die Fliegerin Elly Beinhorn wird demnächst von ihrer Weltreise nach Deutschland zurückkehren. Weißt du noch, wie ich dir im Hoppe von ihren Etappen vorgelesen habe? Es soll jetzt ein Riesenspektakel geben. Einen Empfang. Die Rede ist davon, dass sie ein höllisches Preisgeld für ihre Tour erhält. Ganz Deutschland ist kirre, richtiggehend verrückt nach ihr, die Zeitungen sind total aus dem Häuschen.
Jetzt pass auf: Gernot von Stäbleins Filius, ein nationalsozialistischer Halsabschneider wie sein ekelhafter Herr Papa, kam neulich eigens zum Fischmarkt gedackelt und meinte, er hätte eine Idee für mich, eine Möglichkeit, wie wir unsere Schulden bei ihnen auf einen Schlag begleichen könnten.
Wenn das klappt, musst du auf Zypern keinen Handschlag mehr machen!
Es soll ein Wettrennen veranstaltet werden. Eine große europäische Wettfahrt. Der Gewinner wird der Öffentlichkeit als das männliche Gegenstück zu Elly Beinhorn präsentiert! Da es keine andere Sportart gibt, die nach Abenteuer riecht und die gleichzeitig die Neugier der Menschen weckt, wäre das Faltbootfahren perfekt für ein solches Rennen geeignet, sagte von Stäbleins Sohn. Alle Welt sei derzeit auf Seen und Flüssen unterwegs.
Aber das Beste kommt erst noch: Offensichtlich hat der Mann die Kontakte seines Vaters genutzt und einen hochrangigen Nazi namens Hans von Tschammer und Osten für die Idee begeistern können. (Nein, den Namen habe ich mir nicht ausgedacht, und es ist tatsächlich nur eine Person.) Tschammer sei bereit, einen Empfang wie bei der Beinhorn zu organisieren. Außerdem ist der Völkische Beobachter als Presseorgan und ein Schirmherr mit dabei, die Brauerei Schall & Schwencke. Halt dich fest: Die stiften ein Preisgeld von zehntausend Reichsmark!
Und wer soll am Ende der große Held sein und die Kohle einsacken? Richtig: Oskar Speck. Denn natürlich ist das Ganze ein abgekartetes Spiel. Der kleine Nazi hat dafür gesorgt, dass die Strecke Ulm–Zypern auserkoren wurde. Es muss eine gewisse Anzahl an Stempeln im Pass vorgewiesen werden (bitte achte darauf, diese zu bekommen!), und dann soll offiziell der beste Mann gewinnen. Natürlich weiß niemand, dass du einen riesigen Vorsprung hast.
Den Wettaufruf, der gestern im Völkischen Beobachter erschien, lege ich meinem Brief bei. In wenigen Wochen wird Schall & Schwencke einen Zwischenstand veröffentlichen, der dich als Erstplatzierten ausweisen wird. Damit alles glaubhaft wirkt, wird dafür gesorgt sein, dass immer wieder mal ein paar Namen deiner Konkurrenten genannt werden.
Oskar hob sein Glas aus einer kleinen, kreisrunden Pfütze und bedeutete dem Kellner, dass er ein weiteres wolle. Riesenspektakel, Preisgeld, Völkischer Beobachter. Er musste an seinen Vater denken. Als er klein war, sieben oder acht Jahre alt, hatte ein Onkel bei einem der seltenen Familientreffen in großer Runde unvermittelt von ihm wissen wollen, was er später einmal werden wolle. »Besonders«, hatte Oskar wie aus der Pistole geschossen geantwortet, »ich möchte ein besonderer Mensch werden.« Noch während das Lachen der Umstehenden abebbte, hatte ihm sein Vater – ein Mann, der lebenslang als Verwaltungsarbeiter gewirkt hatte – erklärt, die Specks seien keine besonderen Menschen, noch nie gewesen und würden es auch niemals sein.
»Ein besonderer Mensch steht in der Zeitung oder auf Podesten und Bühnen, erfindet Medizin oder denkt sich komplizierte Maschinen aus. Wir Specks sind Schattengewächse, Oskar.«
Er blätterte zur nächsten Seite des Briefes.
Warte, warte, Osse, ich weiß, was du jetzt sagen wirst. Kann dich förmlich auf das Briefpapier stöhnen hören. Und du hast recht. Ich finde es genauso furchtbar. Aber ich fürchte, hier muss ich über meinen bolschewistischen Schatten springen und über deinen nicht-bolschewistischen gleich mit. Du weißt, Dinge wie Miete, Schulden oder Eigentum lehne ich ab, aber dieses Mal müssen wir wohl mitspielen.
Ich sage es dir besser gleich: Die weiteren Bedingungen werden dir noch weniger behagen, denn Stäblein 2 verlangt für sich die Hälfte des Preisgeldes. Der Mann von der Brauerei, ein Kerl namens Walter Schwencke, streicht eintausend ein. Und du behältst die restlichen vier Mille. Die Bastarde. Aber immerhin vier schöne Tausender, was? Wie ich dir immer sage, Spargel: Auch in der Hölle gibt es einen Tisch am Fenster.
Überleg doch mal, viertausend Reichsmark. Das ist kein Schmutz. Wir können diesen Sklaventreibern alles bezahlen, sind unsere Schulden los, und für dich bleibt noch ein erkleckliches Sümmchen übrig. Ich beanspruche nichts. Du weißt, ich halte mich von Geld fern, bringt nur Ärger.
Bitte sei mir nicht böse, dass ich dich wie ein Rennpferd angepriesen und mitgespielt habe. Mir blutet selbst das Herz, und eine Parteikarriere ist mir, sollte je jemand davon erfahren, wohl auch versperrt. Ich musste annehmen, ohne dich zu fragen. Ich möchte auf keinen Fall bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag diesem Aasgeier Kohle schulden.
Sieh es mal so: Du musst nicht mehr in der Mine arbeiten und kannst direkt aus Zypern mit dem Dampfer zurückkommen. Und dann überlegen wir uns, was wir Neues aufziehen.
Handschlag?
Ich muss jetzt aufhören. Die Kernseife ruft. Du glaubst gar nicht, wie sehr ich jeden Tag nach Teer, Essig und Melasse und allen erdenklichen Meerestieren stinke.
Ach, Osse, wer hat dieses Leben nur erfunden? Und wieso ist es den Schlimmsten von uns vorbehalten, die Spielregeln aufzustellen?
Lass uns das machen. Dann sehen wir weiter.
Dein »dicker« Freund Karol
PS: Was macht der geheime Blick? Hast du schon was gefunden? Ist unsere einzige Hoffnung auf Unabhängigkeit.
Oskar vergrub sein Gesicht in der letzten Seite des Briefes, drückte sie mit beiden Händen gegen Nase und Wangen und schüttelte den Kopf.
»Handschlag.«
Du gutgläubiger Idiot. Was bleibt mir denn anderes übrig?
KCHH
Hüte flogen durch die Luft, die Menschen johlten und riefen ihren Namen, als die Frau an Deck trat. Jemand hatte eine Tröte dabei, die er ausgiebig quaken ließ und die in einen Wettstreit mit einer energisch angekurbelten Drehorgel trat. Eine Traube Zeitungsreporter drängelte sich mit Fotoapparaten bewaffnet um das Ende des Fallreeps. Der Jubel schwoll ein weiteres Mal an, als sie winkte und dabei über das ganze Gesicht strahlte, sichtlich gerührt von den Tausenden, die sich ihr zu Ehren versammelt hatten. Eine Schar Möwen verharrte am makellos blauen Himmel, schien aus Respekt vor dem Anlass in der Bewegung zu verharren. Das tiefe, kilometerweit vernehmbare Tuten des Schiffshorns ließ Elly Beinhorn kurz zusammenzucken, dann stieg sie langsam, der Menge entgegen, hinab.
Gero Nadelreich widmete sich derweil, am Saum der Menschenmasse stehend, seiner Taschenuhr, hauchte den Glasbeschlag an und wischte anschließend mit seinem Taschentuch darüber. Er rümpfte die Nase über den Gestank aus salzigem Tran und beißendem Tang. Und immer ging an der Küste ein lästiger Wind. Seine Frau Bertha stand neben ihm, lehnte sich auf ihre Zehenspitzen. Doch ihr Interesse galt nicht der mit dem Dampfer Cape North aus Salvador da Bahia eingetroffenen Weltreisenden.
»Kchh. Wo ist das Kind denn jetzt schon wieder?«, rief sie stöhnend über ihre Schulter ihrem Mann zu.
Nadelreich roch die Fahne seiner Gattin. Ihre trägen Lider und das stets nach dem Vorglühen in ihrer Sprache auftauchende vokallose, akustische Signal hatten ihn bereits vor Stunden in Kenntnis gesetzt.
»Keine Sekunde kann man sie aus den Augen lassen. Ich frage mich, wie meine Schwester das ausgehalten hat. Kchh.«
»Wir haben sie schon oft aus den Augen gelassen, und sie hat nie Scherereien gemacht.«
»Also hör mal, wir waren ja mit ihr auch noch nie außerhalb von Ingolstadt. Jetzt sind wir einmal am Meer, und schon ist die Rübe ausgebüchst.«
Bertha Nadelreich drehte der Menge den Rücken zu und nahm einen Schluck aus ihrem Flachmann. Ihr Mann tat, als müsse er sich ein wenig umsehen.
»Lass ihr etwas Auslauf, Bertha. Sie hat gerade erst die Schule abgeschlossen. Ich bin ganz froh, dass sie mal ein paar Schritte ohne uns macht. Bisher hat sie die meiste Zeit in ihrem Zimmer gesessen. Immer mucksmäuschenstill. Gerade vor ein paar Tagen erst habe ich wieder das Fotoalbum aufgeschlagen auf ihrem Schreibtisch entdeckt.«
»Man möchte meinen, dass jemand nach drei Jahren den Tod seiner Eltern verwunden haben sollte, findest du nicht?«
»Sie war sechzehn, Bertha.«
»Jetzt ist sie es nicht mehr. Nachdem meine Mutter an der Spanischen Grippe gestorben ist …«
»Deine Mutter ist nicht an der Spanischen Grippe gestorben.«
»Fang nicht wieder davon an. Jedenfalls habe ich mich schnell wieder gefangen.«
»Mit Abstrichen«, murmelte Gero Nadelreich in seinen Hemdkragen und rieb sich die Hände.
»Ein Autogramm ergattern zu wollen ist zwecklos.« Gili zwängte sich zwischen zwei Hafenarbeitern aus der unruhigen Menge. »Aber ein Foto hab ich, wahrscheinlich verwackelt. Sollen wir gehen?«
»Das war’s? Deswegen sind wir so weit gefahren?« Bertha Nadelreich wischte sich ein paar Konfettischnipsel vom Kostüm. »Kchh.«
Schweigend gingen sie am Wasser entlang zurück zum Auto, der Lärm der Menschen gerann hinter ihnen zu einem Summen. Alle paar Meter blieb Gili stehen und machte eilig ein Foto von einem der vor Anker liegenden Frachtsegler oder einer Schute, und Bertha sagte auf einmal: »Wir Frauen gehören nun wirklich überall hin, aber nicht an das Steuer eines Flugzeugs in Hunderten Metern Höhe über fremden Kontinenten.«
»Unterrock-Piloten«, beeilte sich ihr Mann zu sagen, um Gili zuvorzukommen. Er zwinkerte ihr zu. Dann deutete er auf das Ende des Piers. »Da vorne haben wir geparkt. Die Kiste strahlt wie ein mächtiger Vogel, findest du nicht? Ich hoffe, die Möwen haben mir das Dach nicht verkotet.«
»Wo gehören wir denn deiner Meinung nach hin?«, fragte Gili, kniff ein Auge zusammen und spähte durch den Sucher ihrer Kamera.
»Also, man muss schon sagen, eigentlich hat sie gemogelt, die Beinhorn«, umging Bertha die Antwort. »Sie ist in Berlin gestartet und dann Richtung Osten geflogen, bis sie es nach Südamerika geschafft hat. Aber da fehlt ja die halbe Welt. Auf einem Dampfer auf dem Sonnendeck liegend, komme ich auch um den Globus.«
»Onkel Gero, kannst du ihr erklären, was mit einer offenen Klemm L 26 mit 80-PS-Argus-Motor möglich ist und was nicht?« Gili wusste es selber nicht, war aber stolz, sich die Modellbezeichnung gemerkt zu haben, die sie in einem Artikel der Bild der Woche entdeckt hatte. »Ach übrigens, ich würde gerne den Pilotenschein machen. Das Geld meiner Eltern dürfte dafür ja reichen.«
»Muckel«, seufzte ihre Tante, »diese Beinhorn hatte mehr Glück als Verstand. Das kann man nicht so mir nichts, dir nichts nachmachen.«
»Wie wär’s, wir suchen dir eine Stelle in Ingolstadt in der Fabrik? Dann verdienst du bald dein eigenes Geld.« Gero Nadelreich versuchte, aufregend zu klingen. »Ich kenne den Prokuristen.«
Sie waren bei dem schwarzen Renault Monaquatre angekommen, und Gili lehnte sich mit dem Rücken an die Hintertür, legte den Kopf auf die Dachkante, als suche sie etwas am Himmel.
»Was soll ich in der Fabrik?«, fragte sie, und dann leiser: »Denen kann ich nicht helfen.«
»Du liest doch so gern. Wir könnten uns mal beim Anzeiger erkundigen.«
Gero Nadelreich klopfte seine Taschen nach seiner Brille ab.
»Und dann?«, schaltete sich Bertha ein, die sich eine Salem angezündet hatte, die sie in eine Zigarettenspitze drückte. »Soll sie dort als Leserin anfangen?«
Ihr Mann öffnete ihr die Beifahrertür, umkurvte die Front des Fahrzeugs, setzte sich hinter das Steuer und stöhnte. »Natürlich kann sie da als Frau nicht einfach so anfangen. Aber ich glaube, Gili kann ein bisschen schreiben. Hast du mal einen ihrer Schulaufsätze gelesen? Womöglich suchen die gerade eine Sekretärin.«
Bertha holte tief Luft, und auf der Rückbank rutschte Gili so nah wie möglich an die Tür heran.
»Können wir von was anderem sprechen?«
»Muckel«, sagte Bertha, »das Beste ist, du heiratest einen gescheiten Ingolstädter Mann. Was ist mit diesem netten jungen Kerl, der dich neulich mal abgeholt hat?«
»War Gott sei Dank nur eine kurze Romanze. Aber kein Grund zum Heulen. Sein Abschiedsbrief enthielt mehr Rechtschreibfehler als Vorwürfe.« Gili sah aus dem Fenster. »Was, wenn ich überhaupt nicht in Ingolstadt bleiben will?«
»So?«, fragte Bertha spitz. »Wo willst du denn hin?«
Der Renault rumorte, als Gero Nadelreich ihn in Bewegung setzte.
»Ingolstadt hat alles zu bieten, was du dir nur wünschen kannst«, rief er über den Motorenlärm hinweg. »Außerdem haben wir deinen Eltern versprochen, dass wir für dich sorgen.«
»Red doch keinen Blödsinn«, zischte Bertha. »Als hätten Maria und Gerhard das Zugunglück geplant. Wir haben es uns versprochen, Gili.« Sie zog lang an dem Perlmutt der Zigarettenspitze. »Vorgenommen.«
Gili sah aus dem Fenster auf das Wasser. Nadelreich gab acht, nicht zu stark zu beschleunigen. Der Wagen röchelte, tuckerte langsam die Hafenstraße entlang, an deren Flanken immer noch Menschen Richtung Pier strömten.
»Wenn ich das Gaspedal nicht überstrapaziere, können wir bis Ingolstadt richtig Geld sparen. Ich habe das mal ausgerechnet. 1,5 Liter, 25 PS …«
Bertha rauchte.
»Das sind, warte mal, bei der Kilometerzahl von …«
»Ich würde gern etwas von der Welt sehen. Was erleben«, sagte Gili mehr zu sich selbst als an Onkel und Tante gerichtet.
»Bitte?«
»Flausen im Kopf«, sagte Bertha, klappte die untere Hälfte des Fensters auf und schmiss ruckartig ihren Zigarettenstummel hinaus.
Der Lärm im Wagen wuchs mit der Geschwindigkeit.
»Ingolstadt hat alles …«
»Gero, das hast du bereits gesagt.«
»Lässt du mich bitte ausreden?«
»Wenn es der Sache hilft.«
»Von dir habe ich noch keinen gescheiten Vorschlag gehört.«
»Kchh. Das war ja klar. Vergessen hast du meinen Vorschlag, wie immer.«
»Was habe ich?«
»Heiraten.«
»Bitte?«
»Sie soll heiraten.«
Etwas klapperte.
»Das ist alles, was dir dazu einfällt?«
»Es ist das Vernünftigste.«
»Sieh sie dir doch an. Dazu müsste sie erst mal …«
»Sie ist hinausgefallen.«
»Was?«
»Sie ist weg.«
Gero Nadelreich stieg in die Bremsen, und die Hintertür schlug erneut gegen den Rahmen.
»Muckel«, rief er und lief auf die ein Stück hinter dem Wagen gekrümmt am Boden liegende Gili zu, während Bertha hinter ihm herschlenderte und sich dabei am Ohrläppchen zog.
Gili öffnete die Augen, blickte den Himmel und dann ihren Onkel an, der prüfend seine Hände um ihren Kopf spreizte und nicht wusste, ob und wie er sie berühren sollte.
Sie richtete sich langsam auf, stützte sich mit einer Hand auf dem Asphalt ab und betastete die Platzwunde an ihrer Stirn. Dann blinzelte sie ihren Onkel an.
»Können wir jetzt von was anderem reden?«
DAS ERSTE GESPRÄCH
»Herr Speck? Sind Sie wach?«
Zu laut. Er brauchte einen Moment. Nickte. Hustete. Er wendete seinen Kopf dem kleinen Tischchen neben seinem Bett zu, sah den darauf liegenden zusammengefalteten Zettel.
Er ist noch da. Er ist immer noch da. Und es ist immer noch wahr.
Dann atmete er langsam aus, sank zurück und begann, mit einer Hand seine Stirn zu kneten.
»Haben Sie noch Fieber?«
Die Stimme des Mannes dröhnte.
»Ja«, antwortete er leise.
Der Fragesteller wandte sich mit einem süßlichen Grinsen der Frau zu, die er mitgebracht hatte.
»Dann solltest du besser gleich anfangen, bevor er zu müde wird. Doktor Nowack sagt, er darf derzeit höchstens eine Stunde pro Tag sprechen.«
An der Decke des Krankenzimmers drehte leise quietschend ein Ventilator seine Runden. Hinter seiner Hand hervor linste Oskar auf seinen Besuch. Neben einer Frau, die wiederholt versuchte, mit verkniffenen Lippen eine Strähne aus ihrem Gesicht zu pusten, stand an seinem Bettende ein schnell und vehement sprechender Kerl, der Oskar an jene Luftballon-Männlein erinnerte, die seine Mutter an Kindergeburtstagen immer zu knoten pflegte. Er war nicht besonders groß, hatte kräftige Unterarme und einen nahezu perfekt runden Kopf. Über einer ausgebeulten, kurzen Hose trug er ein buntes Hemd, Hosenträger und einen Hut, wie ihn die Einheimischen bevorzugten, verziert mit einem rundherum verlaufenden Schweißrand, die Silhouette eines Gebirges.
»Entschuldigen Sie, dass wir Sie hier so überfallen. Ich hoffe, Dr. Nowack hat uns angekündigt. Gunther Makeprenz mein Name. Ich bin der Präsident des Deutschen Klubs, und das hier ist Fräulein Baum.« Er legte eine Hand auf ihren Unterarm. »Sie wird das Gespräch mit Ihnen führen und alles aufschreiben, was sie ihr erzählen wollen. Ihr können Sie das alles anvertrauen. Die ganze … Diese Angelegenheit. Später können wir – wenn nötig – alles ins Reine übertragen. Aber wir dachten, vielleicht notiert sie besser erst mal alles mit Bleistift. Wie Sie sehen: Papier, Spitzer – alles vorhanden. Na, sagen Sie mal was.«
Ein Verband hüllte in dicken Bahnen Oskars Kopf ein und umschloss ein Ohr, und mehr als ein mattes »Ja« konnte er der seltsamen Emphase des Besuchers nicht entgegensetzen.
Die junge Frau löste sich sanft aus dem Griff des Präsidenten und umarmte Kladde und Lederetui. Sie sah ihn skeptisch an, als er weitersprach.
»Ganz schön irre Geschichte. Dr. Nowack hat ein bisschen berichtet. Wirklich verrückt. Er sagte, die Dinge seien wohl etwas aus dem Ruder gelaufen.« Makeprenz deutete ein Lachen an, und für einen kurzen Augenblick sah er aus wie ein glückliches Kind. »Verstehen Sie? Als ob Gregor Hradetzky einen Albtraum gehabt hätte oder so. Kennen Sie den? Der Kerl ist eine Berühmtheit. Seit Jahren spricht die ganze Welt von ihm. Hradetzky hier, Hradetzky da. Der ›König des Wassers‹. Im Klub schwärmen sie von ihm.«
Oskar sah aus dem Fenster.
»Was hat Nowack Ihnen über mich erzählt?«
Makeprenz schielte zu der jungen Frau hinüber, kratzte sich an der Backe.
»Nun ja, er sagte, es handele sich um eine ungeheuerliche Geschichte. Nowack meinte, bei dem Anschlag seien Ihre sämtlichen Aufzeichnungen abhandengekommen. Die Operation an Ihrem Ohr ist wohl erfolgreich verlaufen, aber Sie haben eine längere, wie drückte er sich aus …?«