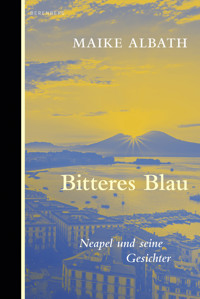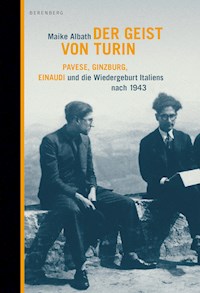
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Berenberg Verlag GmbH
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
In Mussolinis Italien, im Schatten der Fabriken von Fiat und Olivetti, begegneten sich in den dreißiger Jahren in Turin ein paar gebildete junge Leute. Sie gründeten Zeitschriften und Verlage, schrieben kritische Artikel, nahmen Verbannung und Gefängnis auf sich und fühlten sich als Avantgarde. Und das waren sie: Aus dem Kreis um Cesare Pavese, Leone und Natalia Ginzburg und dem Einaudi-Verlag kam jener Geist, der nach 1945 das Klima intellektueller Freiheit in Italien wesentlich geprägt hat. Maike Albath, die Italien kennt und liebt, beschwört in ihrem Buch die Stadt und die einmalige geistige Landschaft, in der diese stolze Episode aus Italiens jüngerer Geschichte ihren Lauf nahm. "Ein klug komponiertes Buch, das glänzende biographische Miniaturen enthält." Hans Woller, Neue Zürcher Zeitung "Ein gewagtes Unternehmen schillert hier verlockend zwischen Hommage, biographischer Skizzenfolge, lockeren Apropos und der Präsentation eines faszinierenden Kapitels europäischer Geistesgeschichte." Joseph Hanimann, Frankfurter Allgemeine Zeitung
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 261
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Piazza Vittorio und Mole Antonelliana in Turin
Maike Albath
DER GEIST VON TURIN
PAVESE, GINZBURG,EINAUDI und die Wiedergeburt Italiensnach 1943
Vorbemerkung
Hotel ROMA
AUTOS und FABRIKEN. MUSSOLINIS Aufstieg
Der EINAUDI-VERLAG. Die Anfänge
LA MOLE ANTONELLIANA, Via Biancamano
»Ich bin nur ein gewöhnlicher Student«: CESARE PAVESE
»TAUSEND LIRE IM MONAT« oder die Verbannung
KRIEGSENDE: Ripeness is all
Nach Paveses Tod. DIE DIVA GIULIO
»Mein Beruf ist das SCHREIBEN, das weiß ich genau.« NATALIA GINZBURG
Die Bücher der anderen. ITALO CALVINO
Epilog
Literatur
Vorbemerkung
Turin? Der Fußballclub mit dem schönen Namen Juventus ist manchen ein Begriff. Richtig, auch die Fiat-Werke sind ein Turiner Unternehmen. Aber sonst? Eine Industriestadt, nicht mit unserem landläufigen Italienbild zu vereinbaren. Als Knotenpunkt der geistesgeschichtlichen Entwicklung des Landes ist Turin nördlich der Alpen eher unbekannt. Dort weiß man höchstens, dass der Philosoph Friedrich Nietzsche am 3. Januar 1889 auf der Via Po seinen geistigen Zusammenbruch erlitt.
In Turin trafen in den zwanziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts die Spätausläufer der piemontesischen Aufklärung, die Arbeiterbewegung und die jüdische bürgerliche Kultur aufeinander. Lehrer und Universitätsprofessoren zeigten offen ihre antifaschistische Gesinnung, Piero Gobetti und Antonio Gramsci entwickelten neue Gesellschaftstheorien, und man richtete den Blick nach Frankreich und Amerika. Während Mussolini Italien immer stärker isolierte, experimentierten drei junge Turiner mit Zeitschriften und Büchern und gründeten 1933 den Einaudi-Verlag. Es war die Geburtsstunde einer linken elitären Kultur, die nach dem Zweiten Weltkrieg zu einer hegemonialen Macht werden sollte. Die Strahlkraft reichte weit über Italien hinaus. Es ging um die Eroberung neuer Denkräume. Selbstbewusst vertrat das Haus die wissenschaftliche und literarische Avantgarde. Einaudi war viel mehr als die Suhrkamp-Kultur in Deutschland, Einaudi bildete bis weit in die siebziger Jahre hinein den Nukleus des italienischen Geisteslebens. Neben der sagenumwobenen Fiat-Dynastie der Agnellis, die für die Stadt eine größere Bedeutung erlangte als das savoyische Königshaus, entwickelte sich in Turin unter der Hand eine weitere Dynastie: die der Einaudianer, der Kontrapunkt im christdemokratischen Italien. Der Verlag stand für eine bestimmte Kultur der Schrift. Und er stand für eine moralische Haltung.
Der Geist von Turin erzählt von der Stadt, den Gründern des Verlages und ihren wechselhaften Biographien. Es handelte sich um Freunde mit einem gemeinsamen Projekt. Dazu gehörte auch, sich zu streiten, sich zu versöhnen, sich zu verlieben und sich zu trennen. Die Genialität der frühen Phase hing mit der Verschiedenheit der Beteiligten zusammen. Der frühreife, kosmopolitische Leone Ginzburg war die intellektuelle Triebfeder des Unterfangens, Giulio Einaudi mit seinem großbürgerlichen liberalen Elternhaus besaß einen Instinkt für neue Ideen, der Schriftsteller Cesare Pavese, privat katastrophal gebeutelt, war ein pingeliger Philologe und entfaltete eine mitreißende literarische Kraft, in der sich eine ganze Generation wiedererkannte, Leones Frau Natalia Ginzburg, Proust-Übersetzerin und strenge Lektorin, schrieb große Romane wie Stimmen des Abends, Familienlexikon und Caro Michele, und Italo Calvino gab dem Verlag mit seinen eigenen Büchern und mit den »Büchern der anderen« ein unverkennbares ästhetisches Profil. Den Schriftstellern und Intellektuellen von Einaudi ging es nicht darum, Geschäfte zu machen. Sie wollten ihr Land verändern – mit Büchern. Der Geist von Turin ist der Versuch, an ein anderes Italien zu erinnern. An das stille, leise Italien, das im TV-Lärm der populistischen Bewegungen unterzugehen droht. Der Geist verfliegt nicht.
Maike Albath, Berlin im April 2021
Hotel ROMA
Es gibt ein schmales Bett, einen Nachttisch, ein schwarzes Telefon, einen roten Ledersessel im Stil der vierziger Jahre. Sachliche, schlichte Formen. An der Wand steht ein Tisch. Vor dem Tisch ein Stuhl. Das Fenster geht nach hinten hinaus. Es ist ruhig. Die Möbel seien noch dieselben wie damals, erklärt uns die Dame von der Rezeption. Natürlich habe man das Bett ausgetauscht, der Raum sei inzwischen mehrfach renoviert worden, das Badezimmer sei ganz neu. Sonst habe man alles so gelassen. Auch aus Respekt. Aber das Zimmer ist genau wie vorher Teil des Hotelbetriebes.
Das Hotel Roma liegt an der Piazza Carlo Felice direkt an der Porta Nuova, dem Hauptbahnhof von Turin. Hier trifft der Schriftsteller und Verlagslektor Cesare Pavese am 16. August 1950 aus Rom ein. Er geht nicht in die Wohnung seiner Schwester in der Via Lamarmora 35, wo er seit vielen Jahren zu Hause ist. Es gibt praktische Gründe, aber vielleicht passt die provisorische Unterkunft zu seiner Stimmung. Am 17. August schreibt er seiner Schwester einen Brief nach Santo Stefano Belbo, dem Ferienort der Familie: »Liebe Maria, den Schlüssel habe ich. Es ist soweit alles in Ordnung, nur das Licht geht nicht. Ich bin in ein Hotel gezogen, das sehr günstig ist und wo ich wunderbar schlafe. Es ist nicht nötig, dass Du schon am Montag, dem 21. zurückkommst. Bleib’ ruhig bis zum Schluss. Meine Hemden und Anzüge lasse ich hier im Hotel reinigen. Ich bin reich. Allein für eine Novelle hat man mir 30.000 Lire bezahlt. (…) Hier sind 5000 Lire für den Priester von Castellazzo, damit er seine Geschichtchen weiter predigen kann. Hoffen wir, dass wenigstens er daran glaubt. Lasst es Euch gut ergehen. Ich fühle mich so wohl wie ein Fisch im Eis. Grüße an Guglielmo, Cesare«.
Mitte August ist Turin noch wie leergefegt. Die Fiat-Werke sind den ganzen Monat geschlossen, die Schule fängt erst im Oktober wieder an, kaum ein Lebensmittelladen hat geöffnet, keine Bäckerei, nur wenige Cafés. Pavese verbringt die Tage im Hotel, schreibend und arbeitend, ruft ein, zwei Freunde an, kehrt sogar für ein paar Nächte in die Via Lamarmora zurück, schaut im Verlag vorbei, aber nicht einmal die Sekretärinnen sind schon vom Meer zurück. Am 26. August, einem Samstag, trifft er Bekannte, Journalisten einer Lokalzeitung. Der Abend endet in einer Trattoria ein paar Straßen vom Hotel entfernt, es ereignet sich nichts Spektakuläres. Wein, Nudelgerichte, Geplauder unter Bekannten. In der Nacht zum Sonntag legt Pavese eine Ausgabe seines Buches Gespräche mit Leuko auf den kleinen Tisch in seinem Hotelzimmer und schreibt hinein: »Ich verzeihe allen und bitte um Verzeihung. In Ordnung? Tratscht nicht zu viel darüber.« Er rührt achtundzwanzig Tüten Schlafpulver in ein Wasserglas, trinkt das Gemisch und streckt sich auf dem Hotelbett aus. Er muss unter Krämpfen gelitten und sich gewunden haben. Nach einer Weile fällt sein rechter Arm herunter und baumelt auf den Boden. Um neun Uhr abends findet ihn ein Zimmermädchen.
Als Cesare Pavese im Spätsommer 1950 den Freitod wählt, hatte er eigentlich alles erreicht. Mit dem Kurzroman Die einsamen Frauen, dem letzten Band seiner »Turiner Trilogie«, fühlte er sich auf dem Höhepunkt seiner literarischen Möglichkeiten angelangt. Er schaffte es sogar, stolz auf sich zu sein: »Heute entdeckt, dass Tra donne sole ein großer Roman ist«, heißt es im Vorjahr in seinem Tagebuch, und als das Buch im Juni 1950 den renommierten Premio Strega gewann, hatte er den Triumph genossen. Auch das Verlagshaus Einaudi, das er mit Giulio Einaudi führte, war längst eine Institution, mit eleganten Niederlassungen in Mailand und Rom und seinem Hauptsitz in Turin. Pavese hatte die Außenstelle in der Hauptstadt mit begründet und war 1945 Programmleiter des gesamten Hauses geworden. Jetzt, ein paar Jahre nach dem Krieg, scheint das Unternehmen auf dem Zenit angekommen. Die Bücher von Einaudi prägen die öffentlichen Diskussionen. Der Verlag wirkt wie ein Magnet auf junge Intellektuelle; man will mitmachen und dabei sein.
Nach der gerichtsmedizinischen Untersuchung bringt man Paveses Sarg in den Verlag in der Via Biancamano. Der Schriftsteller wird in seinem Arbeitszimmer aufgebahrt. Die Beerdigung findet am Dienstagnachmittag statt, um sechzehn Uhr.
AUTOS und FABRIKEN.
MUSSOLINIS Aufstieg
Der Autobus Richtung Lingotto fährt vom Bahnhof Porta Nuova ab. Vor dem Bahnhofsgebäude mit seinem großen Rundfenster setzen sich die Arkaden der Via Roma fort, und wie an fast jeder Ecke in der Innenstadt staunt man über die architektonische Geschlossenheit der Straßenzüge. Seit 1621 wachte eine Behörde über die Pläne der Architekten und achtete darauf, dass die berühmten Baumeister die Formensprache respektierten. Die savoyischen Könige wollten einen hohen Stil. Schließlich war Turin eine moderne Residenzstadt mit einem großen Verwaltungsapparat, und überall sollte es wie bei einem Fürstenpalast Kolonnaden, Säulenordnungen, Blickachsen und Gliederungen der Fassaden geben. Das konnte nicht einmal Paris bieten. Alles wurde bedacht, auch die Auflockerung der kühlen Linearität durch Kirchen, kleine Parks, Springbrunnen oder Plätze mit Reiterstandbildern. Hundert Jahre dauerte die Bauzeit, und man kann Tage damit verbringen, nach den Abstufungen zwischen der Klarheit im Stil Palladios, den kurvigen Schleifen des Barock und den strengen Proportionen des Klassizismus zu suchen. Selbst vom Bus aus verfängt sich der Blick in geschwungenen Portalen und Kapitellen. Auf der Via Nizza werden die Wohnhäuser nach und nach bescheidener. Hier baute der Ingenieur Giacomo Matté-Trucco, ein Vertreter des Rationalismus, ab 1916 im Auftrag von Giovanni Agnelli nach dem Vorbild der Ford-Niederlassung in Highland Park, Michigan, eine neue Fabrik. Sie bekam den Namen des Viertels, in dem sie lag. 1923 wurde der Lingotto eingeweiht. Das über fünfhundert Meter lange, fünfstöckige Gebäude mit den großen Fensterreihen, zwei Ecktürmen und einer Teststrecke auf dem Dach wurde zu einem Symbol für den technischen Fortschritt. Streng, klar, konzentriert, so wirkt es noch heute. Die Fabrik war für die neue Serienproduktion gedacht und funktionierte nach dem Prinzip der vertikalen Fertigung: auf jeder Etage wurde eine Etappe der Herstellung durchlaufen, vom Erdgeschoss bis zu den Fließbändern im fünften Stock und der Probefahrt ganz oben. Über dem Eingang prangt immer noch der Schriftzug »Fiat«, die Abkürzung für Fabbrica Italiana Automobili Torino, obwohl der Lingotto inzwischen ein Einkaufszentrum und ein Hotel beherbergt.
Für die Turiner stellte der Lingotto in den zwanziger Jahren die ungeheure Modernität ihrer Stadt unter Beweis. In der Autozeitschrift Motor Italia hieß es: »Am Ende der Vorortstraße, wo die letzten kleinen Fabriken und die Baustellen der neuesten Häuser liegen, erheben sich die Fiat-Werkstätten in ihrer architektonischen Folgerichtigkeit. Ein unvergleichlicher Bau in hellen Farben, der durch die Einfachheit seines Äußeren das Prinzip der Ordnung verkörpert. (…) So wie der Stil einer Kirche: diese Fabrik hat die Suche nach dem Göttlichen in einem bestimmten Moment der Geschichte vollendet. Sie ist beinahe ein Hafen, ein riesiges Arsenal mit zwei quadratischen Türmen.« Mit fast sakraler Andacht betrachtet der Journalist die Anlage. Die Fensterfronten erinnern ihn an die Augen eines riesigen Tieres: »Am Morgen, beherrscht von den Blicken großer Glasaugen, in denen sich der Gleichmut der Gerechtigkeit spiegelt, warten die Arbeiter an den zyklopischen, höhlenartigen Mauern. Sie sprechen nicht, sie bewegen sich nicht, wie es sonst bei jeder Ansammlung von Menschen der Fall ist. Sie warten. Alles wurde bereits befohlen, sie können nichts daran ändern. Sie gehorchen einem Befehl, der nicht dem menschlichen Willen entspricht, sondern einer Weisheit, die schon durch das Gesetz gebeugt wurde.«
Der Lingotto flößte Respekt ein. 18.000 Arbeiter waren in der Anlage beschäftigt. Diese Massen wirkten wie Vorboten einer neuen, moderneren Gesellschaft. Der Sozialist Piero Gobetti, einer der klügsten und interessantesten Köpfe der Turiner Linken, schrieb in seiner Zeitschrift La rivoluzione liberale kurz vor der Einweihung des Gebäudes: »Wegen der emsigen Anstrengungen einer kleinen, intelligenten Gruppe von Industriekapitänen (die Einzigen, die sich – im ökonomischen Sinne des Wortes – bürgerlich nennen dürfen) gab es bei Kriegsausbruch in Turin, zumindest anfänglich, eine tatsächlich moderne Industrie. Der Krieg brachte mehr Arbeit. Durch Giovanni Agnelli, einen einsamen Helden des modernen Kapitalismus, entstand eines der tragfähigsten Unternehmen unseres Landes: Fiat. Die Fabrik regte einen Wandel des städtischen Lebens an. (…) Während der Kriegsjahre wurde Turin zur Industriemetropole par excellence: Es handelte sich um eine aristokratische Industrie, die durch eine hervorragende Auswahl von Geist und Fähigkeiten in den Händen weniger genialer Männer lag, eine hoch spezialisierte Industrie, die zu einer unverzichtbaren Keimzelle des wirtschaftlichen Organismus wurde. Durch die Ausweitung auf das gesamte Land hätte diese Industrie der Nation den Charakter eines modernen Staates geben sollen.« Gobetti, Jahrgang 1901, wollte an das Gedankengut des Risorgimento anknüpfen und mit seinen Zeitschriften eine neue politische Klasse prägen. Immer wieder nahm er die Intellektuellen in die Pflicht, beklagte das Fehlen einer politischen Führungsschicht und stellte sich öffentlich gegen den aufkommenden Faschismus. Ihm schwebte eine liberale Revolution vor. Als Region, von der die italienische Einigung ausgegangen war, trage das Piemont eine besondere historische Verantwortung, meinte Gobetti. Dass Turin 1861 der erste Parlamentssitz und dreieinhalb Jahre lang sogar die Hauptstadt des vereinigten Königreichs Italien gewesen war, hing mit Graf Camillo Benso di Cavour (1810–1861) zusammen, Minister von Sardinien-Piemont, dem großen Architekten der Einheit. Nach der gescheiterten Revolution von 1848/49 errichtete Cavour auf der piemontesischen Verfassung ein parlamentarisches System, betrieb eine moderne Wirtschaftspolitik und säkularisierte das Königreich. Der pragmatische Piemontese favorisierte eine monarchistische Lösung und setzte sich für einen italienischen Verfassungsstaat unter der Krone der savoyischen Könige ein. Mit dem romantischen Furor der republikanisch-demokratischen Gruppierungen um Giuseppe Mazzini wollte er allerdings nichts zu tun haben. Stattdessen köderte er Napoleon III. und gewann mithilfe der französischen Armee die Doppelschlacht von Solferino und Magenta gegen die Habsburger. Gegen alle Absprachen vereinbarte Napoleon III. mit Österreich einen Vorfrieden, wodurch die geplante Aufteilung Italiens hinfällig wurde. Aber jetzt erhoben sich die Honoratioren in der Toskana, in Modena, Parma und der Emilia Romagna. Nach der Einigung von oben und dem Anschluss Mittelitaliens stach der Freiheitskämpfer Giuseppe Garibaldi im Mai 1860 mit seinem Zug der Tausend in See und eroberte Sizilien und den gesamten Süden. Nur in Rom regierte unter dem Schutz französischer Truppen weiterhin der Papst. Im Frühjahr 1861 trat das neue Parlament in Turin zusammen, und Vittorio Emanuele di Savoia nahm den Titel »König von Italien« an. Das piemontesische Statut von 1848 wurde zur Grundlage der Verfassung, Italien war vereinigt, aber es war eine Nation ohne Sprache. Wenn heute über die verspätete Einigung und die eigentümliche Spaltung zwischen Norden und Süden nachgedacht wird, gerät dies meistens vollkommen in Vergessenheit: Nur 2,5 Prozent der Bevölkerung beherrschten das Hochitalienische. Auch in den gebildeten Schichten war Italienisch keine Selbstverständlichkeit, weshalb man sich im Parlament zunächst auf Französisch verständigte. Immerhin gab es mit Dante, Petrarca, Boccaccio und Manzoni eine italienische Literatur. Bei 75 Prozent Analphabeten – im Süden des Landes waren es sogar knapp 90 Prozent, im Piemont und der Lombardei 54 Prozent – änderte das nichts an der dramatischen Lage, und bis weit ins 20. Jahrhundert hinein wurde in den Grundschulen vorwiegend Dialekt gesprochen. Gerade die piemontesischen Politiker setzten sich für Bildungsoffensiven ein. 1921 war der Analphabetismus im Piemont unter 13 Prozent gesunken, während er in Mittel- und Süditalien immer noch 50 Prozent überschritt.
Als Agnelli das Gebäude an der Via Nizza einweihte, existierte Fiat seit über zwanzig Jahren: 1899 hatte eine Gruppe autoverrückter Aristokraten und Geschäftsleute das Unternehmen gegründet. Nach einer tumulthaften Anfangsphase war der Rechtsanwalt Agnelli alleiniger Besitzer geworden. Der Erste Weltkrieg gab dem Unternehmen einen starken Impuls, den der Unternehmer klug auszunutzen wusste. La Grande Guerra, wie er in Italien genannt wird, ist die Wasserscheide in der politischen Geschichte des Landes und die Voraussetzung für den Aufstieg Mussolinis. In den fünfzehn Jahren vor dem Ersten Weltkrieg hatte der liberale Piemontese Giovanni Giolitti (1842–1928) mit seinem virtuos praktizierten trasformismo, einer Politik, bei der die oppositionellen Kräfte an der Macht beteiligt wurden, die Linie des jungen Nationalstaates bestimmt. Trotz seiner Neigung zum Klientelismus war Giolittis Innenpolitik relativ aufgeklärt. Der Ministerpräsident befürwortete einen sogenannten »organisierten« Kapitalismus, hatte durch Schulreformen und die Einführung des Wahlrechts für alle volljährigen Männer 1912 eine Demokratisierung Italiens vorangetrieben und sich um die Einbindung der moderaten katholischen und sozialistischen Kräfte bemüht. An den Rändern kam es aber bereits damals zu Radikalisierungen. Agnelli war selbstverständlich ein Anhänger Giolittis und spiegelte damit die Haltung eines Großteils der Turiner Unternehmer: Es handelte sich um eine bürgerliche Klasse mit einem starken Sinn für das Gemeinwohl, wie es sie sonst in Italien kaum gab. Sie war politisch gemäßigt, Neuerungen gegenüber aufgeschlossen, pragmatisch, legte Wert auf funktionierende Institutionen und setzte bei Auseinandersetzungen mit den Arbeitern auf den Dialog. Als die Sozialisten allerdings immer mehr Wahlkreise gewannen, fürchteten sie um ihren politischen Einfluss. Denn inzwischen hatte sich um die Turiner Innenstadt eine Art Manchester-Gürtel aus Zuliefererbetrieben gebildet. Die Bevölkerung war innerhalb von dreißig Jahren um das Vierfache auf 427.000 Einwohner angewachsen.
Mit dem Ersten Weltkrieg geriet dann auch das System des ausgleichenden trasformismo in die Krise. Bis 1915 blieb Italien neutral. Aber am 23. Mai kam es zur Kriegserklärung – gegen eine anti-interventionistische Parlamentsmehrheit. Dahinter steckte machtpolitisches Kalkül: Im Londoner Abkommen vom 26. April waren Italien neue Gebiete auf Kosten Österreichs versprochen worden. Der sonst eher für schwüle Romane bekannte Schriftsteller Gabriele D’Annunzio schwang sich zu schmissigen Reden auf, in denen er »La più grande Italia« beschwor. Ebenso lautstark meldete sich Benito Mussolini zu Wort, damals noch Chefredakteur der sozialistischen Zeitschrift Avanti!. Mussolini, 1883 in der Romagna als Sohn eines Schmieds geboren und ursprünglich Volksschullehrer von Beruf, hatte eine bewegte Jugend mit mehreren Gefängnisaufenthalten hinter sich und galt als der kommende Mann unter den Sozialisten des revolutionären Flügels. Wenn er mit seiner bulligen Gestalt, glatt rasiert und in viel zu engen Hemden ans Rednerpult trat und im Telegrammstil auf die Zuhörer einredete, begeisterte er sein Publikum. Er war keiner dieser bärtigen, gravitätischen älteren Herren aus dem Piemont, die seit Jahrzehnten die Regierungsgeschäfte führten und immer nach dem Ausgleich suchten. Politik, das hieß für Mussolini Leidenschaft und Gefühl. Nachdem er anfangs die Neutralität Italiens verfochten hatte, sagte er sich im November 1914 von dieser Haltung los und wurde zum Befürworter des Krieges. Das bedeutete einen Bruch mit den sozialistischen Positionen; seine Genossen schmissen ihn raus. Aber der ambitionierte Journalist fand sofort neue Unterstützer, die ihm innerhalb von drei Wochen die Gründung einer Tageszeitung ermöglichten: Il Popolo d’Italia. Hier betrieb Mussolini eine Kampagne für den Kriegseintritt: Audacia – Kühnheit überschrieb er einen seiner ersten Artikel, führte Georges Sorels Formel des »sozialen Krieges« ins Feld und gab sich messianisch. Sollte Italien bloß Zuschauer sein bei diesem »grandiosen Drama«? Er wetterte gegen das Parlament, wo täglich die Revolution verraten werde. In der Erfahrung der Gewalt sah er ganz im Sinne Sorels den Schlüssel für eine kollektive moralische Erneuerung.
Der ungenügend vorbereitete Waffengang mit einer schlecht ausgestatteten Armee fand mit der Schlacht bei Caporetto im Herbst 1917, als die österreichischen und deutschen Truppen bis zum Piave in Venetien vordrangen, seinen traurigen Höhepunkt. Zwar endete der Krieg mit einem knappen Sieg, aber Italien musste mit 700.000 Gefallenen, enormen Staatsschulden, Geldentwertung und Massenarbeitslosigkeit zurechtkommen. Zwischen Kriegsende und 1922 wechselten sich sechs verschiedene liberal-konservative Kabinette ab, beinahe in jedem Jahr gab es Wahlen, was das Vertrauen in die parlamentarische Regierungsform nicht gerade stärkte. Vor allem wurden Italien die versprochenen Gebiete nur zum Teil zugeschlagen: lediglich Südtirol, Trient und Triest kamen hinzu, Dalmatien und Fiume/Rijeka gingen entgegen allen Erwartungen verloren. Mussolini wusste die Lage publizistisch auszuschlachten. Er sprach im Popolo d’Italia hämisch vom »diplomatischen Caporetto« der Italiener, das dem teuer bezahlten Sieg gefolgt sei. Selbst in der bürgerlichen Presse wie dem Corriere della Sera war die Stimmung extrem aufgeladen. Man fühlte sich von den Alliierten betrogen, und der gefeierte Dichter-Soldat D’Annunzio erfand das Schlagwort des »verstümmelten Sieges«, vittoria mutilata. Ehemalige Frontkämpfer traten besonders martialisch auf und machten die Straßen unsicher. Hier sah der nach dem Krieg zunächst isolierte Mussolini seine Zukunft – die gärende Mischung aus revolutionärem Geist und aggressivem Patriotismus wollte er sich zunutze machen. Mehrfach tat er sich mit den Futuristen zu Krawallen zusammen. Außerdem zog er ehemalige arditi auf seine Seite, Soldaten der Sturmtruppe, die nach dem Desaster von Caporetto ins Leben gerufen worden war. Außerhalb der militärischen Rangordnung angesiedelt, traten die arditi in langen Mänteln, Kniebundhosen und schwarzen Hemden auf und rekrutierten sich aus der studentischen Mittelschicht. Diese Männer wurden die erste bewaffnete Streitkraft der Faschisten. »Ihr seid die bewundernswürdige, kriegerische Jugend Italiens. Eure blitzenden Messer und explodierenden Handgranaten werden Rache üben an den erbärmlichen Wichten, die der Größe unseres Landes im Wege stehen. Wir haben das Recht auf Nachfolge, denn wir haben Italien in den Krieg getrieben und nun zum Sieg geführt!«, huldigte Mussolini den arditi, die bald zu Jugendidolen avancierten.
Als offizielles Gründungsdatum der faschistischen Bewegung gilt eine Versammlung in einem Saal an der Piazza San Sepolcro in Mailand am 23. März 1919, auf der Mussolini die fasci und squadre zu offiziellen Kampftrupps bündelte, den fasci di combattimento. Der Begriff fascio, im Plural fasci, Rutenbündel, entstammte der Demokratiebewegung des Risorgimento und wurde vom Sozialismus des 19. Jahrhunderts geprägt. Aber so aktionistisch sich Mussolini gebärdete, so sehr war er im politischen Ränkespiel an den Rand gedrängt; ihm fehlte die Unterstützung durch eine große Partei. Also bemühte er sich vor allem um eines: Radau zu machen. Nur einen Monat nach der Zusammenkunft auf der Piazza San Sepolcro wurde die Redaktion des Avanti! überfallen. Mussolini verkündete: »Die erste Episode des Bürgerkriegs hat stattgefunden. Wir von den fasci haben den Angriff auf die sozialistische Zeitung nicht vorbereitet, übernehmen aber die moralische Verantwortung für den Vorfall.« Als am 20. und 21. Juli desselben Jahres ein Generalstreik ausgerufen wurde, schritten die Squadristen mit dem Einverständnis der Präfekten gegen die Arbeiter ein. Obwohl mit der gerade ins Leben gerufenen katholischen Partei Partito Popolare eine neue große Volkspartei entstanden war, schien es keine Möglichkeit zu geben, die innergesellschaftlichen Spannungen zu neutralisieren.
Nicht nur Mussolini wusste sich öffentlichkeitswirksam zu inszenieren. Im Herbst 1919 stahl dem Nachwuchsrevolutionär ausgerechnet ein Dichter die Schau: Der fronterprobte D’Annunzio, mittlerweile sechsundfünfzig Jahre alt, gebärdete sich als subversiver Patriot und eroberte mit seinen Freischärlern im Alleingang Fiume. »Der unaufhaltsame Marsch. Die Ankunft. Der Duft des Lorbeers. Das Delirium«, beschrieb er in seinem Tagebuch den Coup. Von der Bevölkerung begeistert begrüßt, wollte der Erfolgsautor durch die Annektierung zunächst nur den Rücktritt der Regierung Nitti erzwingen, die er bei jeder Gelegenheit als »Hosenscheißer« titulierte. Monatelang ging es hin und her, und das Kabinett war blamiert. Eine Räumung hätte in ganz Italien zu Unruhen führen können. Mussolini flankierte die Aktion in seiner Zeitung und griff zu immer deftigeren Formulierungen: »Francesco Saverio Nitti, oberfeiger bourbonischer Minister, wir hauen dir auf die Fresse: Es lebe das italienische Fiume« lautete eine Überschrift. Dennoch wollte sich Mussolini nicht einfach D’Annunzio unterordnen und zu ihm stoßen, denn er fürchtete um den Verlust seiner militanten Aura. Ohnehin wurde den kriegsversessenen Freischärlern in Fiume bald langweilig: Es gab ja gar keine Front. Mit ausgedehnten Festen, Ritterspielen, Kokain und freier Liebe bemühte man sich, die jungen Männer zu zerstreuen. Nittis Nachfolger Giolitti schloss im Herbst 1920 mit Jugoslawien den Rapallo-Vertrag, der Fiume den Status einer »freien Stadt« verlieh. Die meisten Gefolgsleute D’Annunzios gaben sich mit dem Kompromiss zufrieden; nur der Anführer selbst widersetzte sich, weshalb Weihnachten 1920 schließlich die italienische Flotte die dalmatinische Hafenstadt von dem selbsternannten Diktator befreien musste. D’Annunzio experimentierte in Fiume mit einem politischen Stil, von dem Mussolini später viel übernehmen sollte: Appelle vom Balkon, das Frage-Antwort-Spiel mit der Masse, die messianische Rhetorik, die Rede von den Martyrien für das Vaterland, der Einsatz von Fackeln und der römische Gruß. Den römisch-griechischen Siegesruf Eia eia alalà, ebenfalls Teil des faschistischen Repertoires und bis heute in Fußballstadien zu hören, hatte D’Annunzio schon nach der Bombardierung von Pula im August 1918 zu einem Slogan gemacht.
Der Krieg hatte Italien einen kräftigen Industrialisierungsschub versetzt. Bei Fiat war die Mitarbeiterschaft um das Zehnfache auf 40.000 angewachsen. Giovanni Agnelli, vom Präsidenten der American Federation of Labor bereits 1915 zum »Napoleon der europäischen Autoindustrie« ausgerufen, betrieb trotz der Rüstungsaufträge eine vorsichtige Expansionspolitik, weshalb sein Unternehmen relativ unbeschädigt durch die Nachkriegszeit kam. Wegen seines Engagements für die Ausstattung der Armee feierte ihn die Presse zugleich als »Retter des Vaterlandes«. Der Luftkriegsveteran D’Annunzio nannte den Fiat-Flugzeugmotor in seiner parfümierten Manier den »Motor-Gott, der uns Trient überfliegen ließ«. Agnelli stieg das nicht zu Kopf. 1866 als Sohn eines Großgrundbesitzers in Villar Perosa, in den piemontesischen Bergen unweit von Turin geboren, kultivierte er das Image eines Mannes vom Lande. Auf den ersten Blick bescheiden und einfach im Auftreten, verkörperte er einen ganz neuen Typus des Industriellen und hatte nichts mit den alten Patriarchen gemein. In seinen Methoden war er fortschrittlich und extrem modern. Von Anfang an herrschte bei Fiat eine Art Korpsgeist. Die Arbeiter wurden besser bezahlt als in jedem anderen Turiner Betrieb, hinzu kamen zahlreiche Sozialleistungen. Während man sich bis zum Kriegseintritt um die Herausbildung einer Art »Arbeiteraristokratie« bemühte und den Elitegedanken durch Weiterbildung und Aufstiegsmöglichkeiten beförderte, veränderte sich die Belegschaft ab 1916. Der Produktionsrhythmus hatte angezogen, und Agnelli musste neue Leute einstellen, darunter viele Frauen und ehemalige Bauern aus dem Umland. Die Identifikation mit dem Betrieb nahm ab; eine Politisierung setzte ein.
Wie komplex sich das Zusammenspiel von wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen gestaltete, lässt sich an den Kommentaren zu Fiat von Antonio Gramsci ablesen. Der »Machiavelli des Proletariats«, Jahrgang 1891, aus Sardinien gebürtig, ehemaliger Student der Turiner Fakultät für Jurisprudenz, eng mit Gobetti befreundet, während des Ersten Weltkriegs zum großen Intellektuellen der Sozialisten aufgestiegen und ab 1921 Führer der neuen Kommunistischen Partei, ist ebenfalls ein typischer Repräsentant des Geists von Turin. Er deutete den Zulauf zu den fasci als Verfassungskrise, machte schon 1921 auf die Korrumpierbarkeit des bürokratischen Apparats aufmerksam und ahnte als einer der ersten den »Tod des liberalen Staates« voraus. Gramsci, damals Chefredakteur der Turiner Wochenzeitschrift Ordine Nuovo, bewunderte wie Piero Gobetti die neuen Organisationsformen der Fabrikarbeiter. 1919 schrieb er: »Der Arbeiterrat in der Fabrik ist das Modell für den proletarischen Staat. (…) Sowohl im Arbeiterrat als auch im proletarischen Staat verliert der Begriff des Bürgers an Bedeutung, stattdessen gewinnt der Begriff des Genossen an Gewicht: Die Zusammenarbeit, die für eine gute und sinnvolle Produktion notwendig ist, verstärkt die Solidarität, multipliziert die emotionalen Bindungen und die Brüderlichkeit. Ein jeder ist unverzichtbar, ein jeder ist auf seinem Platz, ein jeder hat auf diesem Platz seine Funktion.« Die Fabrik schien Gramsci die Keimzelle politischer Prozesse zu sein, in denen er eine Alternative zu den bürgerlichen demokratischen Bestrebungen erkannte. Den Besitzer zählte er zu einer neuen Spezies von Königen, die durch Ausbeutung unermessliche Reichtümer anhäuften. Wenn Agnelli neue Fabriken eröffnete, dürfe er sich nicht wundern, dass seine Arbeiter Sozialisten seien. »An einem bestimmten Punkt wird die Bourgeoisie unfähig sein, die von ihr ausgelösten ökonomischen Kräfte zu beherrschen, und es wird passieren, was passieren muss.« Gramsci setzte auf die Revolution. Dass er im piemontesischen Bürgertum Verbündete gegen Mussolini hätte finden können und diese Möglichkeit nicht sah, ist genauso Teil der Tragödie des 20. Jahrhunderts wie der Umstand, dass Agnelli den Faschistenführer völlig falsch einschätzte.
Im Herbst 1919 fanden Wahlen statt. Die großen Gewinner waren die Massenparteien. Die Sozialisten erreichten im Parlament eine einfache Mehrheit; zweitstärkste Kraft wurde der neue Partito Popolare der Katholiken. Für die Faschisten war das Ergebnis enttäuschend – sie gewannen keinen einzigen Sitz. »Das Land war sozialistisch, aber der Sozialismus wusste nicht, was er mit dem Land anfangen sollte«, beurteilte der sozialistische Abgeordnete Giacomo Matteotti die Lage. Nach monatelangen Koalitionsverhandlungen mit den Sozialisten, die schließlich scheiterten, trat 1920 noch einmal der greise Giolitti auf den Plan und bildete eine Regierung, die das gesamte politische Panorama vereinte. Die Sozialisten verweigerten sich. »Es wie in Russland machen«, lautete stattdessen die Parole, in Anlehnung an die Oktoberrevolution propagierte man die Abschaffung des bürgerlichen Staates und eine Diktatur des Proletariats. Von Reformen wollte man nichts wissen. Den Sozialisten ging es ums Ganze. Gleichzeitig nahmen die Spannungen auf der Straße und in den Fabriken zu – das biennio rosso, die zwei roten Jahre 1919 und 1920 waren längst angebrochen. Seit dem Vorjahr war es im Süden wiederholt zu Landbesetzungen gekommen. In Mittelitalien gab es Volksaufstände gegen die gestiegenen Lebensmittelkosten. In Turin, Genua, Mailand und mehreren kleineren Städten wurden Fabriken besetzt. Am 1. September wandten sich die Turiner Unternehmer in einem offenen Brief an die Bürger der Stadt, wiesen darauf hin, dass die Polizei nicht rechtzeitig gegen die Besetzungen eingeschritten sei, und griffen die Gewerkschaften an: Sie betrieben eine »kriminelle Propaganda gegen die Gesetze und Institutionen, die nur an der Oberfläche wirtschaftliche Argumente ins Feld führt, während die Gewerkschaftler die Grundlagen der Unternehmen umstürzen wollen und auf eine Revolution zielen.« Die Belegschaft stellte bei den Besetzungen die Produktion nicht ein, sondern experimentierte mit Selbstverwaltung. Auf dem Höhepunkt der Erhebungen waren 600 Fabriken in der Hand von einer halben Million Arbeiter. Etliche Intellektuelle in Turin begeisterten sich für die Vorgänge, zum Beispiel der Maler und spätere Schriftsteller Carlo Levi, der zum Umfeld von Piero Gobetti gehörte und gerade erste Artikel für dessen Zeitschrift verfasste. Er schrieb am 9. September: »Endlich haben wir Helden. Die Arbeiter haben die Fabriken übernommen und halten sie in Gang – nicht alle, aber doch die kleine engagierte und mutige Minderheit, die an der Spitze steht, und sie wird die Geschichte zu neuen, vitalen Formen führen – sie sind Helden, und sie können uns geben, was uns sonst niemand geben kann. (…) Wir müssen zu ihnen halten. Uns muss schmerzen, dass wir nicht schon vorher die Vitalität der Arbeiterbewegung begriffen und dass wir uns freiwillig von dieser Bewegung ferngehalten haben, an der wir nun mit Feuereifer teilhaben möchten. Im Gegensatz zu der allgemeinen Schwäche und Müdigkeit haben wir jetzt eine Gruppe neuer Männer, die die Macht übernehmen. Die Industriellen sind tot. Sie schaffen es nicht einmal, sich zu verteidigen. (…) Ein Problem, das die Arbeiter Tag für Tag lösen, ist das ihrer Moral. Wir dürfen uns von den mitunter vulgären und brutalen Aspekten nicht irritieren lassen. Dies verleiht dem neuen Werk erst den richtigen Geschmack. Man glaube aber nicht, dass wir lächerlichen Ideologien vom besseren Menschen oder einer besseren Gesellschaft hinterhereilen. Doch wir werden besser sein, weil wir aus der allgemeinen Erstarrung, die das öffentliche Leben beherrscht hat, erwacht sind. Die Regierung war so alt, dass man sie töten musste, um das eigene Leben zu retten.« In seinem hohen Ton und der Feier der Gewalt ist Carlo Levi gar nicht so weit von Mussolini entfernt.
Agnelli ergriff eine für die damaligen Unternehmer einzigartige Initiative und bot die Umwandlung von Fiat in eine Kooperative an. Natürlich waren auch taktische Überlegungen im Spiel, und Gramsci formulierte im Ordine Nuovo gleich eine ganze Reihe von Einwänden. »Er hat den Versuch unternommen«, so Gramsci, »die Bewegung der Arbeiterräte zu entschärfen. Agnelli möchte die Interessen der Arbeiter mit denen der Großindustrie und der Kapitalisten vereinbaren.« Auf nationaler Ebene weitete sich die Sache zu einer Staatskrise aus. Am 11. September schickte Giolitti ein Telegramm an den Präfekten von Mailand: »Sie müssen den Industriellen begreiflich machen, dass die italienische Regierung, nur um den Unternehmern ein bisschen Geld zu sparen, keinen Gebrauch von den Ordnungskräften machen kann, weil dies eine Revolution auslösen würde. Der Einsatz der Ordnungskräfte wäre der Untergang der Fabriken. Ich vertraue auf eine friedliche Lösung.« Dazu kam es schließlich auch. Mit Lohnerhöhungen, bezahltem Urlaub und einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen gingen die Besetzungen zu Ende. Aber die Unternehmer, Geschäftsleute und Angestellten fühlten sich unwohl: Wie auf dem berühmten Gemälde von Pelizza da Volpedo Il quarto stato sah man sich plötzlich mit der Masse des vierten Standes konfrontiert. Nach dem roten brach jetzt das schwarze Biennium an. Die Forderungen der Sozialisten blieben so abstrakt, dass die Partei viele ihrer Anhänger enttäuschte. Gleichzeitig inszenierten nun Mussolinis squadre und fasci an vielen Orten Gegenterror, der geduldet wurde. In den Zeitungen, allesamt in der Hand von Industriellen, wurde la grande paura, die große Angst der Mittel- und Oberschicht vor einem Bürgerkrieg oder einer sozialistischen Revolution geschürt. Bei den Wahlen vom Mai 1921 standen die Faschisten auf den Regierungslisten der sogenannten »Nationalen Blöcke«, zu denen sich die Liberalen, Gemäßigten und Nationalisten zusammengeschlossen hatten. Das Bündnis bekam 275 Sitze, von denen 45 auf die Faschisten und Nationalisten entfielen, die Sozialisten erhielten 122, der Partito Popolare 107, die neu gegründeten Kommunisten 16 Sitze. Erst im Herbst wandelte Mussolini sein movimento