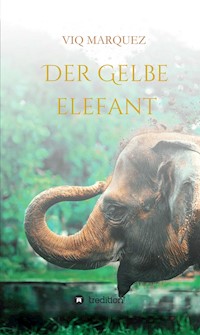
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Tanyas Leben gleicht einer stürmischen Odyssee und wird vielfach von ihrer Vergangenheit überschattet. Wieviel kann ein Mensch ertragen? Wie schafft es ein Mensch das eigene Leben wieder in positive Bahnen zu lenken? Sich von der schmerzhaften Vergangenheit endgültig zu lösen? Acht schicksalhafte Ereignisse, die Tanya in ihrem Leben maßgeblich prägten, bringen sie schließlich zu einem finalen Entscheidungspunkt und zu ihrer Begegnung mit dem gelben Elefanten. Und zu der Wahl: Aufgeben oder Aufstehen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 188
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
VIQ MARQUEZ
***
DER GELBE ELEFANT
© 2020 Copyright by VIQ MARQUEZ
© 2021 Neuauflage - Copyright by VIQ MARQUEZ
Verlag und Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Paperback: 978-3-347-24145-9
Hardcover: 978-3-347-24146-6
e-Book: 978-3-347-24147-3
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Für meinen Lieblingsmenschen
Kapitelübersicht
Episode 1 – WindGeflüster
Episode 2 – ErdRutsch
Episode 3 – RabenSchwarz
Episode 4 – WahrheitSuche
Episode 5 – FeuerBeben
Episode 6 – WasserFarben
Episode 7 – SturmTage
Episode 8 – MetaMorphose
Epilog
SchwereLosigkeit
Im Leben geht es selten um
das War, das Wollen,
das Haben, das Werden.
Sondern ganz und gar um das Sein.
Schwere ist kein geflügeltes Wort.
Schwere umgibt uns überall. Sie sickert langsam
in uns hinein, macht uns satt, schwerfällig und
starr. Solange bis wir vollständig durchdrungen
sind von ihr. Ohne es zu merken.
Eines Tages bestehen Nehmen und Geben aus
wechselseitiger Schwere.
Schwere in den Gedanken, den Beinen,
den Illusionen um uns herum. In dem Wunsch,
Sinn in unser Leben zu bringen. Etwas Besonderes
zu sein.
Auf der Suche nach Antworten.
Schwere in unseren Worten, in unseren Handlungen,
in unserem Denken. In unseren täglichen
Lügen, Manipulationen und mannigfaltigen Versuchen
der Kontrolle und Selbstaufwertung.
Schwere im Besitz, in unseren Beziehungen,
unseren Ansichten – in unseren Wünschen und
unserem fixierten Wollen.
Schwere in unserer vermeintlichen Individualität,
unserer Erziehung, unserer Gesellschaftsmoral,
unserem Wettbewerbsdenken,
unserem Glauben, unserer Unbewusstheit –
in unserem Herzen. In uns.
Schwere überall.
Wo Schwere ist, fliegen keine Schmetterlinge. Der
Inbegriff von Unschuld, Leichtigkeit und Kreativität.
Vor der Schwere zu fliehen, ist ein kurzweiliger
Akt. Erzeugt er doch wieder Schwere.
Sie hingegen zu durchdringen, in ihrem Wesen zu
begreifen, lässt Loslassen zu.
Die inneren Fenster weit zu öffnen,
eine frische Brise willkommen zu heißen,
macht uns
Frei.
Episode 1 – WindGeflüster
Ich bin in einer Familie aufgewachsen, die nie viel am Hut hatte mit Kirche oder Religiosität geschweige denn Spiritualität. Was zählte, waren Fakten, Fakten und nochmals Fakten. Von klein auf wurden wir auf mehr oder weniger subtile Art konditioniert und gemaßregelt von unseren Eltern, Großeltern, Freunden, Kindergärtnerinnen, Lehrern - sogar von Unbekannten. Menschen, die selbst auf diese Art groß geworden sind und ihr Lebtag kaum je irgendetwas in Frage gestellt hatten. Menschen, die vor sich hinlebten. Man wurde darüber belehrt, was man kann und wozu man fähig ist - und vor allem, wozu nicht. Ohne es je ausprobiert zu haben. Es regierte Gehorsamkeit gepaart mit Angst, Unterwürfigkeit und Pragmatismus. Funktionalität und Leistung wurden großgeschrieben. Die Schulen und Universitäten spuckten reihenweise Kinder aus, die es nach ihrem Abschluss meisterhaft verstanden, sich keine Fehler mehr zu erlauben, den Wettbewerb zu feiern und unnützes Wissen mit sich herumzutragen wie Lastenesel. Erwartungen zu erfüllen, darin bildete man uns aus. Nicht darin, unabhängig zu denken, zu forschen, zu hinterfragen. Natürlich war man erst dann etwas wert für die Gesellschaft, wenn man sein brav-bürgerliches Leben ohne Murren führte, den Geldbeutel des Staates stetig füllte und am Ende seiner Arbeitslast ein lachhaftes Sümmchen für die Mühen der vorangegangenen fünfundvierzig Jahre erhielt. Viele kamen gar nicht so weit und gaben den Löffel schon vorher ab. Ich persönlich habe nie verstanden, worauf wir da eigentlich hin schuften. Es war, als würden wir uns ein Stück Himmel leisten wollen, dabei aber vergessen, dass wir dann später zu alt und zu gebrechlich sind, um über die Wolken zu flitzen und häufig zu krank, um uns an dem Ausblick zu erfreuen.
Als Kind sind einem so viele Dinge der Erwachsenen suspekt: Man versteht nicht, warum sie sich gegenseitig und auch uns Kinder belügen, sich verstellen, übereinander schlecht reden. Warum sie so oft in sich hineinweinen, Dinge tun, die sie ganz und gar ablehnen, warum sie ständig dem lieben Geld hinterherlaufen oder es als Ausrede für alles Unangenehme benutzen.
Warum sie Besitztümer auftürmen, sparen wie die Irren, sich hoch verschulden. Warum sie Kinder in die Welt setzen, wenn sie selbst noch unreife Kinder sind. Warum sie alles planen müssen und ihnen Sicherheit so viel bedeutet. Warum sie in unerträglichen Situationen verharren und Beziehungen leben, die ihnen im besten Fall nichts bedeuten und im schlimmsten Fall in den Abgrund befördern.
Mir wurde von klein auf am laufenden Band eingetrichtert, dass ich zwei linke Pfoten habe, zu ungeschickt bin und einfach viel zu langsam für diese Welt. Ehe ich mich versah, wurde ich bereits von meinen Eltern etikettiert. Liebe und Vertrauen waren zwei Faktoren, die in meiner Erziehung keine große Rolle spielten. Stattdessen saß die Hand meiner Eltern sehr locker. Insbesondere die meines Vaters, wenn Mama Papa verbal unter Druck setzte und er ein Ventil brauchte. Mich.
Sie waren beide sehr überforderte Menschen, die in ihrem Leben wenig Liebe erfuhren. Diese Erkenntnis durchdrang mich ungefähr dreißig Jahre später. Leider sehr spät. Bis zu diesem Zeitpunkt allerdings hielten sie mich auf Trab. Drangsalierten mich Tag für Tag. Sticheleien, demütigende Witze auf meine Kosten, Bloßstellungen vor Dritten, Unterstellungen und messerscharfe Kritik. Keine aufmunternden Worte, keine liebevolle Geste, keine herzliche Umarmung. Nur Handgreiflichkeiten, um mich wieder auf den Weg zu bringen, einzunorden und mir das neugierige Maul zu stopfen. Sie verpassten mir auch dann Ohrfeigen, wenn ich zuviel lachte. Daraus bestand vorwiegend mein körperlicher Kontakt zu meinen Eltern! Mehr war ich für sie offenkundig nicht wert.
Was war ich bemüht, ihnen zu gefallen, angepasst zu sein und keinen Unmut zu erregen! Rückblickend lief ich durch meine Kindheit auf Alarmstufe Rot. Jede noch so winzige Änderung in der familiären Atmosphäre erspürte ich mit jeder Faser meines Körpers. Manchmal verzog ich mich rechtzeitig. Meistens jedoch nicht.
Ich war ein eher stilles, introvertiertes Kind. Zu meinen eigenen Bedürfnissen hatte ich längst den Bezug verloren. Weder wusste ich, wer ich bin, noch wer ich sein möchte. Andere Identitäten konnte ich mühelos über mich stülpen wie ein weites Kleid. Als Sechsjährige hatte ich bereits ausgezeichnet gelernt mich zu verstellen. Nach außen hin den Sonnenschein zu geben, aber sonst die Zähne zusammenzubeißen und keine Schwäche zu zeigen. In meinem Inneren zog ein Wolkenbruch nach dem anderen sein Schwert.
Man hatte mir oft genug erzählt, dass ich selbst an allem schuld sei. Doch was kann ein Kleinkind in seinem kurzen Leben schon verbrochen haben? Ich diente lediglich als Projektionsfläche für meine Familie, auf der sie sich austoben konnten. Als Individuum, als Tochter, als Geschenk wurde ich nie gesehen. Eine Wertanlage, ein funktionierender Teil der Gesellschaft, etwas dass sie nur füttern, zur Schule schicken und dem sie ein Dach über den Kopf geben müssen. Das war´s. Ein Ferkel hätte es wahrscheinlich besser getroffen. Meine Eltern haben gefühlt alles und jeden gegen mich aufgestachelt. Eine vertrauensvolle Beziehung zu meinen drei jüngeren Geschwistern gestaltete sich über viele Jahre als ein Ding der Unmöglichkeit.
Unsere Mutter zog wie ein Puppenspieler alle Fäden. Entweder verschlossen alle, Verwandte und Bekannte eingeschlossen, die Augen oder spielten einfach mit. Nie haben sie diese vorgelebten Verhaltensweisen und ungesunden Familiendynamiken hinterfragt. Lieber sollte ich mir den Zorn unserer Eltern zuziehen, als dass sie ins Kreuzfeuer gerieten. Die körperlichen Züchtigungen meiner Eltern, die beide nicht zimperlich in dieser Angelegenheit waren, summierten sich bei drei Brüdern, die ständig Blödsinn im Kopf hatten, immens. Jeden Mist, den sie verbockten, wurde mir zugeschrieben. Selbst dann, wenn ich weit weg war.
Aber nach außen hin vertraten wir natürlich die perfekte Familie: Alleinstehendes Einfamilienhaus, großer Garten, zwei PKWs, ein VW-Bus, acht Fahrräder und lachende, glückliche Gesichter. Was habe ich diese Heuchelei gehasst!
Fahrradfahren lernen zum Beispiel, war für mich kein schönes Eltern-Kind-Erlebnis. In unserer Nachbarschaft jauchzten die Kinder, wenn ihre Väter sie behutsam auf das Rad setzen und gemeinsam kleine Erfolge feierten. In dem gottverlassenen Ort, in dem ich Fahrrad fahren lernen musste, konnte man nur das Wimmern eines verängstigten Mädchens von drei Jahren vernehmen. Was vielleicht auch ein Grund war, warum meine Eltern schließlich dort wegzogen. Meine Koordination und mein Gleichgewichtsgefühl waren nicht sonderlich gut ausgebildet. Das juckte meinen Vater überhaupt nicht. Er prügelte mich auf den Drahtesel als gäbe es keinen Morgen mehr. Und wenn ich mal wieder dabei umfiel, gab es links und rechts schallende Ohrfeigen, und zwar solange bis ich wieder aufstand, in die Pedale trat und loseierte. Das wiederholte sich noch etliche Male, bis wir einmal um den Block herum waren. Dann begann es wieder von vorn. Es war ja nicht so, dass ich Stützräder gehabt oder er mein Fahrrad gehalten hätte. Nein! Sobald ich aufsaß, ließ er uns wackliges Ensemble los, um im Anschluss erneut mit grimmiger Miene und geballten Fäusten anzupreschen. An diesem Tag sah ich viele Gesichter hinter Gardinen versteckt. Eingeschritten ist niemand.
Ähnlich erging es mir beim Schwimmen. An einem frühen Maimorgen fuhr ich mit meinen Eltern nichtsahnend in einem aufblasbaren Kanu zur Mitte eines trüben Weihers. Es dämmerte gerade. Meine Eltern erklärten mir feierlich, es sei nun Zeit Schwimmen zu lernen. Ehe ich auch nur Zeit zum Reagieren hatte, landete ich unversehens mit dem Kopf voran im Wasser! Damals wusste ich noch nicht, dass andere Kinder für diesen Zweck Schwimmflügel bekamen. Mich schickten sie ohne! Nachdem ich in dem eiskalten Wasser panisch nach Luft schnappend immer wieder unterging, zogen sie mich für einen Wimpernschlag wieder aus dem Wasser und brüllten mir lauthals ins Gesicht, dass ich doch nur Arme und Beine bewegen solle. Das WIE war für sie völlig nebensächlich. Ihrer Meinung nach habe es die Natur so vorgesehen. Wenn genug Überlebenswille da ist, dann werde ich schon selbst wissen, was zu tun sei. „Das Kind muss da durch.“ Keine Ahnung, welcher Film da gerade bei ihnen ablief. Sie schoben mich mit dem Paddel immer von sich, sobald ich dem Boot auch nur zu nah kam. Vielleicht hofften sie auch, dass sich das leidige Thema mit mir damit von selbst erledigte. Schließlich entfernten sie sich mit dem Boot und ließen mich strampelnd im See zurück. Allein! Pures Entsetzen erfasste mich. Am Ufer winkten sie mir fröhlich zu, stellten den Grill auf, während ich verzweifelt darum rang, den Kopf über Wasser zu halten.
Da war ich etwa fünfeinhalb Jahre alt. Ich spürte die Eiseskälte des Wassers unwiderbrüchlich in mich eindringen, roch die kühle klare Waldluft, sah den grünen Mantel, den die Natur umlegte, den Nebel, der sich langsam von der Wasseroberfläche löste und das fröhliche Kreischen der Vögel. Als ob sich die ganze Welt an meinem Kampf ergötzt. Meine Sinne waren schmerzhaft geschärft. Um mich herum wirkte alles viel zu laut. Meine Lungen pfiffen ihr krächzendes Lied, während meine Beine und Arme taub wurden.
Schließlich verlor ich kurzzeitig die Besinnung. Ich wollte nicht mehr kämpfen. Ich war es so leid. Nach allem, was mir bisher schon von diesen Menschen widerfuhr, die sich Eltern nannten, war dies der Moment, der sich mir in Mark und Bein einbrannte. Der Moment, in dem ich auch als Kind verstand, dass das unmöglich normal sein konnte. Wer tut seinem eigenen Kind so etwas an?
Ein leises Flüstern um mich herum, riss mich schlagartig aus dem Sekundenschlaf und rettete mir wohl rückblickend betrachtet das Leben. Habe ich mir das grad eingebildet? Nach einem kurzen Blick zum Ufer sah ich, dass das Picknick in vollem Gange war. Musik hallte herüber. Niemand beachtete mich mehr. Niemand fühlte sich berufen, mir zu helfen. Niemand lachte mehr. Niemand war mehr da. Ich fühlte mich SO allein, SO hilflos, SO ohnmächtig. Ich war mir selbst überlassen. Allmählich setzte eine ungeheure Wut ein. Sie erfasste meinen ganzen Körper, bahnte sich glühend ihren Weg durch jede Faser, jede Zelle, und trieb meinen Überlebenswillen an. Arme und Beine bewegten sich plötzlich koordinierter, fraßen sich eine Schneise durch das dunkle Nass. Wie ein Hund paddelte ich verbissen um mein Leben. Das Ufer schräg vor mir rückte immer näher. Um mich herum schwirrten Libellen und Bremsen. Letztere machten sich einen Spaß daraus, mich agressiv zu traktieren. Wie meine verkorkste Familie. Das stachelte meinen flammenden Zorn nur zusätzlich an.
Ihr kriegt mich nicht klein. Euch zeig ich´ s. Die Wut half mir, über mich selbst hinauszuwachsen. Diente als Antrieb, um das hier durchzustehen und mich weiter gen Ufer zu bewegen. Japsend rettete ich mich auf den sandigen Grund, robbte erschöpft weiter und sank völlig unterkühlt und bewusstlos im Gras zusammen. Der Wind flüsterte mir erneut zu: Du bist nicht allein!
Der Himmel war an jenem Tag wolkenlos. Die Sonne schien in voller Breite, jedoch ohne spürbare Wärme. Ganz wie Zuhause. Meine Mutter zuckte mit den Achseln als wir Stunden später mit dem Auto zurück nach Hause fuhren und sagte nur herablassend:
„Du bist so ein elendiges Weichei, Tanya! Was du nur hast – schau, jetzt kannst du endlich schwimmen.“ Und mit fragendem Blick zu ihrem Mann: „Verstehst du, warum das Kind immer alles so persönlich nehmen muss?“ Ich sparte mir jegliche Antwort und verlor mich stattdessen in den vorbeifliegenden Feldern. Es gab für mich nichts mehr zu sagen. Die Uhr im Auto zeigte den 25. Mai 1985, 15:29 Uhr.
Episode 2 – ErdRutsch
Nach diesem Erlebnis, sicher auch schon davor, wünschte ich mir heiß und innig, meine Sippe würde sich einfach in Nichts auflösen… Oder wäre tot! Autounfall. Banküberfall, Einbrecher, was auch immer. Egal. Danach habe ich mich für diese Tagträume unfassbar geschämt und lautlos in mein Kissen geweint. Ich meine, wer wünscht seiner Familie so etwas. Die meiste Zeit lief ich mit diesen Schuldgefühlen und dieser inneren Zerrissenheit durch´ s Leben. Die Wut hatte seit jenem Tag am See einen beträchtlichen Teil meiner Seele okkupiert.
Aber dann wiederum stellte ich mir vor, wie ich meine Familie vor Unheil retten würde. Bildlich malte ich mir die Szenen bis ins kleinste Detail aus. Wie wir in einer dunklen Gasse überfallen werden und ICH allein mit Kung Fu Bewegungen, die sich natürlich ganz spontan einstellen, die Bösewichte in allerletzter Sekunde in die Flucht schlage. Und meinen Eltern endlich die Augen geöffnet werden. Sie mich schluchzend in den Arm nehmen, mir über den Kopf und Rücken streicheln und mein Gesicht liebkosen. Mir immer wieder sagen, wie leid ihnen all das tut.
Dass sie mich doch unsagbar liebhaben. Das ganze emotionale Auf und Ab kostete mich sehr viel Energie und Lebenskraft.
Ich habe mir so sehr gewünscht, dass wir auch im Inneren jene Familie werden würden, wie wir es im Äußeren bereits bei jeder Gelegenheit zur Schau gestellt hatten. Eine heile Familie!
VERRÜCKT! Nie hörte ich auf zu hoffen!
Die Stimme, die mir zuflüsterte, blieb bei mir. Ich fühlte mich von etwas Höherem geliebt, wenn auch nicht von meiner Familie. In dieser Zeit verbrachte ich viele Stunden beim einsamen Streunen im Wald, bei meiner Freundin oder manchmal bei meinen Großeltern. Bei Menschen, die mich überwiegend so annahmen, wie ich war. Auch das machten mir meine Eltern zum Vorwurf. Oft war ich restlos überfordert und wusste meist nicht, was ich tun musste, damit sich jeder zufrieden mit meinem Verhalten gab.
Die Schule war der einzige Bereich in meinem Leben, der eine zeitlang wirklich funktionierte und sich für mich sicher anfühlte. Über meine benoteten Leistungen baute ich mir meine Wertigkeit auf, verschenkte freigiebig Freundlichkeit, Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft an meine Klassenkameraden. Ich lief jahrelang unter dem Synonym “Everybody´s Darling“. Eine Eigenschaft, die ich später immer wieder von selbst torpedierte. Eine Lehrerin hatte mich stilles Schulmädchen irgendwann auf den Kieker, provozierte und schikanierte mich vor der gesamten Klasse. Sie wollte, dass ich mehr aus mir herauskomme, Reden schwinge und geselliger bin. Mehr Biss bekomme. Irgendeinem idiotischen Ideal entspreche. Sie wollte mir ihre Idealversion brachial überstülpen. Was vermeintlich erwachsene Menschen alles mit dir tun, im Glauben das Beste für dich zu erreichen, kannte ich schon zur Genüge. Ohne mich! Der Startschuss für jahrelanges Mobbing war gefallen. Durch Mitschüler, mit denen ich bereits drei Jahre die gleiche Klasse teilte. Menschen, die mich kannten, von denen ich bisher geschätzt wurde. Das galt plötzlich nichts mehr. Jetzt war ich die, die einfach nur ANDERS war. Introvertiert. Wenn andere Mitschüler von den sogenannten Influencern gehänselt wurden, stand ich wie eine Wand vor ihnen, ohne Rücksicht auf mich selbst. Denn ich hasste Ungerechtigkeit aus vollem Herzen.
Doch niemand stand für mich ein oder setzte diesem selbstgerechten Schwachsinn ein Ende. Zu groß war ihre Angst, selbst Opfer zu werden. Wieder fühlte ich mich ohnmächtig und machtlos. Ich versteckte mich meist auf der Schultoilette, drückte mich vor den langen Pausen im Schulhof. Fing an, Stunden zu schwänzen, in denen es besonders schlimm wurde. Zuhause setzte es dafür natürlich: eine Tracht Prügel. Es war ein Spießrutenlauf.
Ungerechtigkeit und Willkür wurden mir immer mehr zuwider. Genauso wie sogenannte Autoritätspersonen und Institutionen. Lehrer des Vertrauens gab es für mich nicht. Überhaupt hatte ich mit Vertrauen in Menschen so meine Not. Meine Probleme machte ich letztlich lange mit mir selbst aus. Von den Zuständen in meiner Familie erzählte ich niemanden etwas. Es hätte mir bei dieser vehement positiven Außenwirkung auch sowieso niemand geglaubt.
Bis ich mir beim Toben mit meiner Freundin Charlotte an einem herabhängenden Ast im Wald die Schulter verletzte. Vor ihrer Mutter sollte ich mir den engen Pullover ausziehen, damit sie die blutende Wunde ärztlich versorgen konnte. Als sie mehrere Blutergüsse sah, atmete sie scharf ein. Mit zusammengezogenen Augenbrauen hörte sie meine tapferen Ausflüchte an, kniete sich vor mich nieder und umschlang mich weinend mit ihren Armen. Stocksteif stand ich da, bis bei mir ebenfalls alle Dämme brachen und ich heulend an ihrer Schulter lehnte und mich tief in ihre Umarmung verkroch. Ich hauchte kaum hörbar in ihre Halsbeuge, ob sie denn nicht meine Mama sein könnte? Lotti´ s Mama hatte genau erkannt, was bei mir zuhause los war. Es gab von ihr nicht nur einen Versuch, das Jugendamt einzuschalten und gegen meine Eltern anonym eine Verfügung zu erlassen.
Die Mobbing-Aktionen an der Schule verliefen teilweise subtil, teilweise offen. Unbeteiligte Mitschüler wurden aktiv mit eingebunden. Die Lehrer blieben weitestgehend passiv oder kriegten es nicht mit. Zu physischer Gewalt wie in meinem Elternhaus kam es in der ersten Zeit nicht. Auch wenn ich persönlich behaupten würde, dass psychische Gewalt in jeder Form genauso schlimm, wenn nicht sogar schlimmer sein kann. Sie ist geballte Energie, die sich im Körper des Betroffenen einspeichert und tiefe körperliche als auch seelische Wunden reißt und die Zerstörung von Identität und Würde zum Ziel hat. Jeden Tag immer ein bisschen mehr. Der psychische Terror über diesen langen Zeitraum hinweg hätte mir vollkommen ausgereicht.
Den Höhepunkt der Erniedrigung und den Einsatz physischer Gewalt erreichten meine Klassenkameraden im frühen Sommer 1991 - auf einer gemeinsamen Klassenfahrt. Morgens vor der Abfahrt machten sich bei mir bereits fürchterliche Bauchweh und erhöhte Temperatur bemerkbar. Ich weinte und bettelte, zuhause bleiben zu dürfen. Meiner Mutter war das egal. Für sie war das Geld bezahlt. Also hatte ich zu fahren.
„Tanya, gib endlich Ruh. Du bist unmöglich! Immer hat man nur Scherereien mit dir.“ Ich hatte den Fehler gemacht, ihr von meinen Problemen in der Schule zu erzählen. „Kein Wunder, dass dich niemand mag. Du kannst auch einfach mal nett zu den Leuten sein. Du bist selbst schuld! Und friss dort nicht zu viel. Schau dich mal an. Du bist Schneckenfett“, zischte sie mir zum Abschied unweit des wartenden Busses zu.
Hinter mir kicherten einige Mitschülerinnen. Als meine Mutter mit ihrem roten Ford hinter der Straßenbiegung verschwand, raffte ich mich auf, um zum Bus zu gehen. Die Bauchschmerzen waren unerträglich. Jemand stellte mir ein Bein und ich fiel hart auf den Asphalt. Aua… die Zähne fest zusammengepresst, bis es schmerzte, unterdrückte ich jede weitere Gemütsregung. Das Kichern hinter mir schwoll zu einem lauten Gelächter an. Die Stimme in mir flüsterte eindringlich, ich solle auf keinen Fall in diesen Bus steigen. Lass mich in Ruh, flüsterte ich gedanklich zurück. Ich stand auf, klopfte den Gehwegstaub von meinem ausgefransten Jeansrock, betrachtete leidenschaftslos meine blutenden Knie und stieg hoch erhobenen Hauptes in den stickigen Bus. Ich vertraute nichts und niemandem mehr – auch nicht mehr meiner inneren Stimme. Mitunter hatte ich schon Befürchtungen, dass ich total am Rad drehte.
Der Bus brachte uns zu einer großen Seenlandschaft. Ein riesiges Wald- und Feuchtgebiet. Allein die flüchtigen Blicke auf das Wasser verursachten in mir aufsteigende Übelkeit. Mein Atem beschleunigte sich schlagartig. Mir wurde heiß und eiskalt. Auf meiner Stirn zogen die ersten Schweißperlen ihre Bahn. Ich bekam keine Luft mehr. Neben und vor mir saß niemand, wofür ich in diesem Moment sehr dankbar war. Neben der schnappenden Stinkkröte wollte sowieso niemand sitzen. Bis heute weiß ich nicht mal, wie sie auf die Idee kamen, das stinkend noch davor zu setzen. Wahrscheinlich klang es dann abstoßender. Immer wenn jemand furzte oder die Luft einfach nur stank, zeigten alle auf mich und riefen im Chor: „Schnappi, Schnapp, Stinkkröte ist hier und vergast die Luft. Geh in dein Loch zurück, Kröte. Wir wollen dich nicht.“ Lautlos atmete ich aus, um meinen Puls zu beruhigen und mir innerlich gut zuzureden. Das miese Gefühl aber blieb. „Na Schnappi, hier musst du dich doch pudelwohl fühlen“, dröhnte es hinter mir aus den letzten Reihen.
Es war am letzten Tag vor unserer Heimreise. Sie rissen mich gewaltsam aus dem Schlaf. Ich versuchte mich mit Händen und Füßen zu wehren. Bäumte mich auf und rang mit ihnen. Zwecklos. Es waren zu viele. Die nackte Angst stieg in mir auf. Meine Pupillen weiteten sich, als mir jemand das grelle Licht seiner Taschenlampe direkt ins Gesicht leuchtete. Sie waren zwar vermummt, die Stimmen hätte ich jedoch überall wiedererkannt. Toni, Lysanne, Sebastian und Annette und noch ein paar weitere Mitläufer. Meine größten Fans. Rasch stopften sie mir ein nasses Tuch in den Mund und banden mir die Hände hinter dem Rücken zusammen. Hatte ich kurz vorher noch geglaubt, dass sie mich scheinbar zur Abwechslung mal in Ruhe lassen würden, belehrte mich dieser nächtliche Überfall eines Besseren. Mit kurzen Shorts und einem Top bekleidet, stolperte ich barfuß und an den Händen gefesselt meinen Entführern hinterher. Über Stock und Stein ging unsere Reise ins Unbekannte. Von Erziehungsberechtigten keine Spur. Sie hatten sich die letzte Nacht so volllaufen lassen und schlummerten nun selig ihren Rausch aus. So viel zu Verantwortung. Etwas Spitzes bohrte sich mir in den rechten Fuß. Ich spürte wie die Haut meiner Fußsohle aufriss. Im nächsten Moment federte ein Zweig zurück und erwischte mich frontal. Mein Gesicht brannte wie Feuer. Was für ein Glück für mich, dass sie mir bei ihrer Verschnürungsnummer das Sichtfeld nachträglich auch mit abgedichtet hatten, sonst wäre der Zweig sprichwörtlich ins Auge gegangen.
Die hohen Bäume rauschten wild im Wind, schwangen ihre Häupter vor und zurück wie auf einem Heavy Metal Konzert. Das einsame Tönen eines Kauzes war zu hören, Knacken im Unterholz und weitere Geräusche, die ich nicht einzuordnen vermochte. Nachts wirkt alles sehr viel bedrohlicher.





























