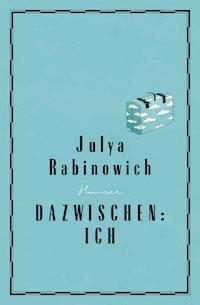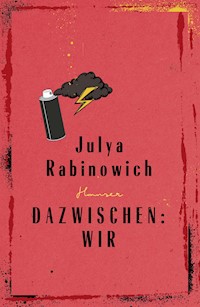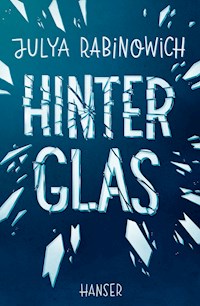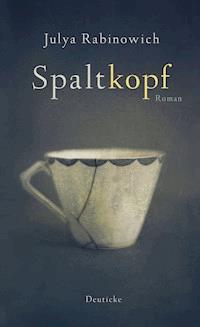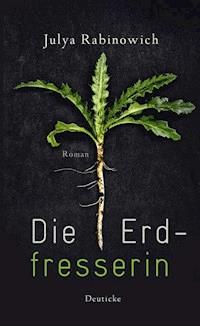Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Hochaktuell und tief bewegend: der erste Roman über die Rückkehr in die vom Krieg zerstörte Heimat. „Julya Rabinowichs Buch trifft mitten ins Herz und öffnet dort ganz neue Perspektiven.“ (Ursula Poznanski) Der Krieg ist aus und Madina wagt die Reise in ihre alte Heimat, um endlich eine Antwort auf die quälende Frage nach dem Verbleib ihres Vaters zu erhalten. Und um sich von dem Leben zu verabschieden, das sie so fluchtartig hinter sich lassen musste. Die Wunden des Krieges sind noch frisch, Madina begegnet großem Leid und Misstrauen. Und sie muss feststellen, dass nicht jede Suche wie erhofft endet. Die Suche nach ihrem Vater führt Madina letztendlich zu sich selbst. Und sie begreift, dass es an der Zeit ist, die Verantwortung für ihre Familie abzugeben und ihren eigenen Träumen zu folgen. Dies ist eine Geschichte über die Abgründe, in die ein Krieg so viele Familien stürzt, und die Geschichte einer starken jungen Frau, die über sich hinauswächst und sich selbst findet – tiefgründig und kraftvoll.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 258
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Hochaktuell und tief bewegend. Der Krieg ist aus und Madina wagt die Reise in ihre alte Heimat, um endlich eine Antwort auf die quälende Frage nach dem Verbleib ihres Vaters zu erhalten. Und um sich von dem Leben zu verabschieden, das sie so fluchtartig hinter sich lassen musste. Die Wunden des Krieges sind noch frisch, Madina begegnet großem Leid und Misstrauen. Und sie muss feststellen, dass nicht jede Suche wie erhofft endet. Die Suche nach ihrem Vater führt Madina letztendlich zu sich selbst. Und sie begreift, dass es an der Zeit ist, die Verantwortung für ihre Familie abzugeben und ihren eigenen Träumen zu folgen. Dies ist eine Geschichte über die Abgründe, in die ein Krieg so viele Familien stürzt, und die Geschichte einer starken jungen Frau, die über sich hinauswächst und sich selbst findet — tiefgründig und kraftvoll.
Julya Rabinowich
Der Geruch von Ruß und Rosen
Hanser
Für alle, die zurückblicken (müssen)
Danksagung
An die heldenhafte Mutter von Johnny für ihre Kraft und an Jackie und die zwei Ns für ihre Esels- und Engelsgeduld.
Alles hat seinen Preis.
Auch eine Rückkehr. Nein.
Vor allem eine Rückkehr.
Vielleicht habe ich ja sieben Leben, wie eine Katze. Und eine Vergangenheit, die für sieben Leben reicht. Mit all ihren schrecklichen und schönen Wundern. Blutblumen unter der Haut. Der Geruch nach Ruß, der Geschmack von Eisen. Und der Rosenduft im Garten meiner Oma. Der Mond über dem Dachgiebel unseres Hauses. Mamas Kuchen mit Zitrone. Papas Arm um meine Schultern. Das Singen meiner Tante. Das war mal alles meines.
Nicht jede Reise findet ihr Ende. Manchmal geht sie für immer weiter und weiter: für die, die verschwunden sind. Für die, die man nicht vergessen kann. Für die, die man niemals aufgeben wird zu suchen.
»Sei nicht so kryptisch«, würde Laura dazu sagen. »Glaubst du, es interessiert irgendwen, deine Rätsel zu lösen? Schieß einfach raus, was ist. Tu nicht so, als wärest du eine verdammte Sphinx.«
Und sie hätte natürlich recht.
Und ich würde sagen: »Wenn ich ein Wappentier hätte, wäre es bestimmt ein Skarabäus.«
»Ach was, ein Mistkäfer«, würde Laura jetzt sagen.
Teil 1
Aufbrüche
1
Laura wartet vor dem Haus auf mich. Dort, wo die Idioten letztes Jahr Hier wohnt Gesindel. Ausländer raus! draufgeschrieben haben, ist noch eine leichte Farbveränderung wahrzunehmen. Ein etwas gelblicheres Beige als das elegante Beige, das Susi bei der Hausrenovierung wochenlang ausgesucht hat. Es macht nichts, finde ich. Das Haus trägt jetzt eine Narbe. Warum sollte es dem Haus anders gehen als uns? Wir sind alle vernarbt aus den letzten Jahren herausgekommen. Manche ganz real auf der Haut. Andere verborgener. Omas Füße sind voller heller Streifen, wo mal die blutroten Striemen waren, die man bekommt, wenn man wochenlang mit Blasen an den Füßen wandern muss, ohne Socken, mit kaputten Schuhsohlen. Sie schämt sich. Sie trägt strahlend weiß gewaschene Strümpfe, auch im Sommer.
Ich finde Narben wichtig. Sie erinnern daran, dass man schon einmal heilen konnte. Und heilen wird. Wieder und wieder.
»Wir gehen schwimmen«, sagt Laura und pfeift nach Kassandra.
Ja, das wird mir guttun. Das Abkühlen und dann das Auf-den-heißen-Planken-Rumliegen, eine wilde Heidelbeere nach der anderen in den Mund stecken und ins Wasser schauen, auf dem Sonnenflecken tanzen.
*
Der ganze Sommer war bis jetzt verregnet und schwül. Sogar Kassandra tat sich schwer, Abkühlung zu finden, da konnte sie noch so oft in den Teich springen oder sich in der Küche auf den Kacheln platt wie ein Bettvorleger hinlegen. Die rote Zunge hing ihr aus dem Maul und reichte bis auf den Boden, sodass ich immer wieder Angst hatte draufzutreten, wenn ich Eiswürfel aus dem Eisfach holte. Und sie sabberte ärger als jeder Troll.
Zum Schwimmen sind wir meistens zu dritt unterwegs, Laura, Kassandra und ich. Rami will zwar mit, und meine Mutter hätte es ihm sogar erlaubt, aber ich habe wahrlich keine Lust, die ganze Zeit aufpassen zu müssen, um ja keinen Blödsinn zu versäumen, zu dem er so fähig ist. Und er ist zu verdammt viel Blödsinn fähig, ich würde sagen, da entfalten sich in ihm unendliche Kombimöglichkeiten. Noch heißer ist er nur noch darauf, mit Markus etwas zu unternehmen.
Markus ist noch da, aber es ist ein bisschen seltsam zwischen uns, ich habe das Gefühl, er verheimlicht etwas vor mir, wahrscheinlich eine neue Freundin, was ich völlig unnötig finde. Ja, klar gibt es mir einen Stich, wenn es wirklich offiziell so sein sollte. Aber mir ist lieber, es gibt einen Stich, und dann ist Ruhe. Es ist okay, haben wir doch gesagt, bevor er in die Stadt zog, zum Studieren. Wir sind ja nicht mehr zusammen. Wir sind Freunde. Und zu Freunden ist man doch ehrlich! Aber nichts ist einfach, wenn Liebesmüh und diese seltsame, mir zu weiten Teilen unbekannte Sache namens Sex dazwischengeraten. Nichts! Dann kannst du das übereingekommenste Übereinkommen vergessen, pronto.
»Pronto«, sagt Laura jetzt die ganze Zeit, es ist nicht rauszuklopfen aus ihr, seit wir gemeinsam in Italien gewesen sind. Ich versuche, das als nette Erinnerung unserer Reise zu betrachten und nicht als den nervtötendsten Spleen, zu dem sie derzeit fähig ist. Was nicht ist, kann natürlich noch kommen, das ist bei Laura ähnlich wie bei Rami, die Skala ist nach oben hin offen.
Über diese nach oben hin offene Skala der Nervtöterei brauche ich mir im Unterschied zu anderen, nicht ganz so klaren und eindeutigen Dingen, wie zum Beispiel dem Verbleib meines Papas, keine Sorgen zu machen. Die Sorge bleibt vermutlich für immer. Im Unterschied zu meinem Papa. Der ist leider noch immer weg. Keiner weiß, was mit ihm passiert ist.
Der Sommer geht in die Schlussphase, wie er angefangen hatte: mit quälender Ungewissheit, mit täglichen Gängen zum Briefkasten in der immer geringer werdenden Hoffnung, da drin etwas zu finden, irgendetwas. Einen Brief. Eine Todesurkunde. Einen Hinweis. Gar nicht mal so unähnlich dem vorletzten Jahr, als mein Vater und ich ständig zum Briefkasten der Flüchtlingsunterkunft rannten, in der Hoffnung auf eine Art Erlösung, auf den positiven Bescheid.
Ich weiß, dass meine Mutter jeden meiner Schritte zum Briefkasten hin und vom Briefkasten weg stillschweigend verfolgt, ihre Blicke sind mein Schatten. Das macht mich noch nervöser.
Meine Großmutter sagt nie etwas dazu, wenn sie mich zum Briefkasten schleichen sieht. Meine Großmutter ist eine Urgewalt. Meine Großmutter ist ein freundlicher Vulkan. Sie steht noch im stärksten Hurrikan firm und fest am Boden. Sie ist ein weißer Zwerg. Ein Planet, der ein Vielfaches an Gewicht trägt und um den alle anderen kreisen, weil er einfach der dichteste und komprimierteste Planet weit und breit ist und die anderen, nicht ganz so imposanten sich seiner Schwerkraft beugen müssen.
Manchmal beneide ich sie sehr darum. Dass sie einfach dasitzen und ihre Kuchen backen kann. Mit Äpfeln und Zitrone. Ein Fixstern unseres Familienuniversums, noch immer ruhig, wenn es sonst niemand mehr ist. Sie muntert meine Mutter auf, bringt Rami in den Kindergarten, lässt meiner Tante die Badewanne mit Rosenblättern ein, wenn sie müde von der Arbeit nach Hause kommt.
Meine Tante hat seit dem Sommer einen Job. Sie verdient ihr eigenes Geld! Die erste Frau in unserer Familie! In Ramis ehemaligem Kindergarten, da kocht und putzt sie.
Und dann sitzt Oma mit mir abends im Garten und frisiert meine Haare. Sie frisiert und versucht, sie zu Zöpfen zu flechten, was nicht und nicht gelingen will, weil meine Locken noch immer zu wild sind und ihre Hände nicht mehr geschickt genug. Nie würde ich jemand anderem erlauben, mich wie ein Kind zu behandeln, aber bei ihr fühlt es sich so natürlich an, so passend, dass ich es genieße und nicht dagegen ankämpfen muss.
Sie hat so vieles verloren. Ihr Haus. Ihren Garten. Ihre Ziegen. Ihre Hühner. Ihren Mann. Ihre Söhne. Man könnte sagen, ich habe vorläufig meinen Vater verloren. Aber das lässt sich so nicht aufwiegen. Das Gewicht unserer Trauer nicht. Das Gewicht unserer Verluste. Jede von uns leidet, jede für sich. Manchmal leiden wir gemeinsam. Und oft suchen wir gemeinsam Trost. Weil wir Menschen sind. Vielleicht wäre es bei Katzen anders, denke ich. Die würden einfach fallen. Auf ihre vier Pfoten. Mit ihren sieben Leben. Und dann weitermachen. Apropos weitermachen: Da bin ich eigentlich Vollprofi darin. Das ist meine Königsdisziplin. »Königinnendisziplin«, würde Laura jetzt sagen.
*
Manchmal stelle ich mir die immergleiche Frage: Wie mein neues Leben angefangen hat? Schwer zu sagen. Vielleicht war es dieser Sommerabend, an dem ich das erste Mal meine Hand auf den Arm von Markus legte unter den Lampionlichtflecken, die im Sternenhimmel so hoch über uns hingen wie bei anderen die Geigen? Und bevor mein Vater kam, um mich mit ernster Miene noch vor elf Uhr nachts wieder heimzuholen? Vielleicht, als Laura sich das erste Mal in der Schule zu mir gesetzt hat und sich nicht lustig gemacht hat über meine lustigen Deutschfehler, die alle rundum lustig fanden, bloß ich nicht? Oder später, als sie im Hinterhof von McDonald’s weinend ihr rotzverschmiertes Gesicht in meiner Jacke versteckt hat und mir erzählte, was mit ihrer Mutter passiert war. Vielleicht in diesem magischen Augenblick, als ich meinen Fuß über die Grenze dieses Landes setzte? So wie mit den roten Zauberschuhen, die man aneinanderschlägt — ein Augenblick, und es ändert sich alles. Alles. Oder war es schon, bevor wir gingen, war es bereits, als ich unser Haus in Flammen aufgehen sah? War es das Gesicht meiner Oma vor ihrem brennenden Garten? Auf alle diese Fragen gibt es nur eine Antwort:
Sei eine Katze, Madina.
*
In der Schule wird alles anders sein, wenn die Ferien vorbei sind. Die King, unsere Klassenlehrerin, hat uns abgegeben. Ich habe keine Ahnung, wer uns in unserem letzten Jahr übernehmen wird. Ich verbiete ab jetzt auch allen, sie »Krähen-King« zu nennen, wie das im vergangenen Schuljahr alle gemacht haben, auch ich. Weil sie wie ein Trauervogel in ihren strengen schwarzen Kleidern mit ihrer strengen Frisur, den dunklen Strümpfen und der langen Nase durch die Schulgänge gestelzt ist. Sie heißt jetzt aber »Super-King«. Für mich, für immer und ewig. Nie werde ich ihr vergessen, wie sie furchtlos einem ganzen Mob begegnet ist und ihn aufgehalten hat, so lange, bis die Polizei endlich gekommen ist. Ich sehe sie vor mir, wie sie zwischen Fackelschein und Blaulicht vor unserem Gartentor zu Boden geht, wie meine Tante zu ihr stürzt, wie ich schreie — aber alles das in Zeitlupe, auch der Aufschlag. In vollkommener Lautlosigkeit, als hätte man beim Filmschauen den Ton abgedreht.
Die anderen haben jetzt Ruhe vor ihr und ihrem strengen Blick, ihren fordernden Hausaufgaben. Mir wird sie fehlen. Wäre sie nicht so streng gewesen, wäre mein Deutsch jetzt ein anderes. Und mein Englisch auch. Ja, mir würde sie wirklich fehlen. Aber: Ich sehe sie nach wie vor immer wieder, Susi holt sie regelmäßig ab und bringt sie zu uns, um im Garten zu sitzen und englischen Tee zu trinken. »Frische Luft tut Ihnen gut«, sagt Susi dann, schneidet eine Rose ab und stellt sie in einem hohen Glas auf den Tisch. Diese Rose bekommt die King immer mit, wenn Johann sie nach Hause fährt. Es tut mir ein bisschen weh, sie so zu sehen, wie sie mit ihrem Rollator ganz vorsichtig zu Johanns Auto trippelt, aber andererseits bin ich froh, dass sie zu uns kommt und sichtlich Freude daran hat. Meine Oma sitzt manchmal dabei, sie liefert Honigbäckereien zum Tee, die ich als Kind so geliebt habe, lässt sich von der King die staubtrockenen Shortbreads erklären und tunkt sie neugierig in ihren Earl Grey. »Mit Milch«, darauf besteht die King.
Ihre Beine sind noch dünner, als sie schon davor gewesen sind, ihre Kleider sitzen nicht mehr so eng und exakt, als wären sie ihr auf dem Leib zusammengenäht worden. Ich habe manchmal Angst, dass sie immer leichter und leichter wird und ein plötzlicher Windstoß sie davontragen könnte wie eine Art Anti-Mary-Poppins. Ihr Blick ist aber nach wie vor wach und scharf, genau wie ihre Zunge.
Manchmal wache ich mitten in der Nacht auf, weil ich schreie. Und manchmal weiß ich nicht mehr, ob ich schreie, weil mir Erinnerungen an den Krieg hochkommen. Oder die Erinnerungen an den Mob vor unserer Tür. Weil: Ich habe verdammt lange nicht geglaubt, dass auch hier solche Sachen möglich sind. Nicht mal ansatzweise habe ich mir das vorstellen können. Nicht mal ansatzweise. Echt.
Und was ich mir auch nicht hatte vorstellen können: wie viel Hilfe wir dann von Menschen bekamen, die uns gar nicht gut kannten. Johann kannten wir nur vom Sehen. Und doch kam er vor unser Gartentor, um uns zu schützen, genauso wie die King. Und der Idiot, der den »Ausländer raus!« brüllenden Mob zu uns geführt hat, hat so richtig Angst bekommen. Aber richtig. Huper haben wir ihn genannt, weil er, bevor er ausgetickt ist, immer vor unserem Haus stehen blieb mit seinem hässlichen roten Angeberauto und elendslange hupte. Wegen Laura. Bis ich ihn vertrieb. Und er mich »Flüchtlingsgesindel« nannte. Ja, so hat das mit dem Huper angefangen. Und so hat es dann aufgehört: Der Huper ist nun klein mit Hut, mucksmäuschenstill, und wenn ich ihm im Bus begegne, sieht er weg. Ja, der fährt jetzt ab und zu auch mit dem Bus, so wie wir. Den Führerschein haben sie ihm in dieser schrecklichen Fackelnacht abgenommen. Ich gestehe, dass es eine durchaus fragwürdige Genugtuung ist, ihn im strömenden Regen an der Bushaltestelle zu sehen, mit aufgeweichter Gelfrisur und einem verbissenen Zug um die schmalen Lippen. Auch wenn mir immer noch schlecht wird, wenn ich an den hasserfüllten Blick seiner knallblauen Augen denke, die mittlerweile in dunklen Ringen liegen. »Scheiß dich nicht an«, würde Laura jetzt sagen. Ach, Laura.
*
Wenn man Tagebuch schreibt, dann ordnet man Gedanken. Wenn man in Therapie geht, ordnet man das Leben. Ich würde schlicht total verzweifeln, wenn ich Frau Wischmann nicht hätte. Sie ist meine zweite Superheldin. Gleich nach der King. Wäre die King eine machtvolle Göttin, dann wäre Frau Wischmann ihre Tochter.
*
Ich kann das nicht. Ich kann nicht so schreiben, als ob nichts passiert wäre. Es ist so viel passiert. Mit mir, mit Mama, mit Amina, mit Laura. Mit meinem Vater.
*
Manchmal ist das Leben wie eine Reihe von Berggipfeln. Immer wenn man einen geschafft hat, ist man erleichtert und stolz und glaubt, man ist jetzt endlich dort, wo man hinwollte. Und gleich darauf sieht man den noch größeren Berg dahinter. Und hinter dem den nächsten. »Das Leben kickt«, sagt Markus dazu. Und ich denk mir: Ja, und zwar mitten in die Fresse.
2
So war das auch in Venedig. Es ist noch gar nicht lange her und fühlt sich doch schon so weit weg an. Mitten in den Sommerferien. In unserem Urlaub. In Italien. Laura und ich. Das erste Mal ohne meine Eltern, das erste Mal allein in Europa unterwegs. Wieder eine ganz neue, andere Sprache, die schön klang wie eine Melodie, nur verstand ich leider nicht eine einzige Note davon.
»Scheiß dich nicht an«, hat Laura gesagt, während sie sich die Finger ableckte, die noch Flecken von der eiergelben Creme aufwiesen, die aus ihrem Gebäck hervorgeschossen kam, als sie gierig hineingebissen hatte. »Die Creme heißt Zabaione.«
»Sehr angenehm. Madina.«
Als Laura lachte, stob eine kleine Staubzuckerwolke in die Luft.
»Dolce Vita«, sagte sie. »Das süße Leben.«
Wir standen vor der kleinen Pasticceria (so sagt man hier zu Konditoreien, hatte Laura mir stolz erklärt), unsere Blusen voll mit Puderzucker, Kakaopulverränder an den Lippen, zwei ausgemachte Ferkel, die sich im venezianischen Sommer wälzten.
»Der beste Cappuccino meines Lebens«, sagte sie anschließend und wischte mit dem Ärmel über ihren Mund. Glück gehabt, die Bluse war schwarz mit braunen Hirschen drauf, passend zum Kakao.
Ich sah in die Auslage, in der ein kleines Leckereien-Universum explodierte, Erdbeertörtchen, mit Aprikosenmarmelade gefüllte Kuchenstückchen, marzipangestreifte Schnittchen, Windbeutelgebäck gefüllt mit Schoko und Vanille und mit Glasur drauf. Wir hatten schon je drei davon verspeist, und der Kaffee war hier kein Kaffee, sondern ein himmlischer Genuss. Ich trank drei schaumgekrönte Tassen hintereinander, bis mein Herz unter dem weißen Leinenkleid zu flattern begann wie ein nervöser Schmetterling.
»Noch eine Runde?«, fragte Laura. »Die Fruchtkörbchen da hinten haben wir ja noch nicht probiert.«
»Wollen wir vielleicht noch etwas Unbekanntes für morgen aufheben?«
»In Venedig gibt es genug Unbekanntes für mindestens zehn Jahre, meine Liebe!«
Die Pasticceria lag gleich neben dem Bahnhof, mitten in der Touristenhochburg, hier rasten sie alle durch das Gässchen, das von buntem Kram nur so geflutet wurde, mit ihren Rollkoffern, die so einen Höllenlärm machten wie ein nie endendes kakofonisches Konzert. Wir waren cool, wir hatten nur Rucksäcke mit.
Ich griff nach einer der bunten Masken, ich hatte so etwas noch nie gesehen.
Laura zog mich weiter. »Lass das! Diese Masken hier kommen aus China, nicht aus Venedig! Komm, komm! Woher ich das weiß? Weiß ich eben. Wir müssen unsere Fähre erwischen!«
»Welche Fähre?«
»Willst du etwa zum Lido schwimmen?!«
»Was ist ein Lido?«
»Ein Reservat für hübsche Jungs in Badeshorts.«
Was zum Teufel …
*
Dieser verdammte Lido war einfach nur ein lang gezogener Sandstrand!
Und es saßen dort nur Omas mit ihren Enkelkindern rum. Und die Enkel waren definitiv keine Jungs, die mich interessiert hätten.
Und es nervte mich, dass Laura dauernd damit angab, dass sie sich hier besser auskannte als ich. Ich würde sie so was nie so deutlich spüren lassen.
Das Meer aber war schön. Ist immer schön. Es gibt nichts Schöneres als das Meer.
*
Und die Pizza, die wir an diesem Abend gegessen haben, war leider so viel besser als die von Susi, dabei liebe ich die von Susi schon sehr. Die Tomaten schmeckten süß vor Sonne, der Basilikum haute rein wie eine grüne Faust! Und der gegrillte Fisch … und das Tiramisu … zu blöd, dass wir übermorgen schon heimfuhren.
»Denk doch nicht jetzt schon ans Heimfahren«, sagte Laura und warf mir ein rotes Kopfkissen mit Löwen drauf an den Kopf, ich wich aus, weil meine Reaktionen seit dem Krieg immer noch so scharf sind wie bei einem wilden Tier im Wald, das Kopfkissen flog an mir vorbei und stieß die Vase mit den Plastikblumen auf dem Nachttischchen um, sie fiel. Wir hielten den Atem an, aber das mit bunten Stoffen tapezierte Zimmer war so klein, dass sie schief auf dem Bett zum Liegen kam. Außerdem war auch die Vase aus Plastik, aber das merkte ich erst, als ich sie hochhob.
»Blödfrau«, sagte ich, und wir lachten, und Laura umarmte mich, auf unserer Haut noch Salz und Sand vom Meer.
Ich liebe Lauras Geruch. So riecht zu Hause. Ein Zuhause, mit dem man um die Welt fahren kann.
*
Und an unserem letzten Tag hat Laura mir eine echte venezianische Maske bei einem echten Papiermaschee-Künstler gekauft, mit dem sie echt schamlos geflirtet hat, obwohl er bestimmt über fünfundzwanzig war und damit eigentlich ein alter Macker. Ich hab sie in die Seite geboxt, weil es mir schon beinah peinlich geworden ist, und er hat es gesehen und hat gegrinst, und ich bin so rot angelaufen wie eine überreife italienische Tomate.
»Was ist?«, hat Laura gezischt.
Und er hat seine schwarzen Locken hinter das Ohr gestreift und in einem Englisch, das noch übler war als meines — und das will wirklich etwas heißen! —, gesagt: »Deine Freundin ist eifersüchtig.«
Und ich bin rausgestürmt und stand eine ganze Weile ganz allein auf dem flirrend heißen Platz auf den Marmorplatten herum, mitten in der prallen Sonne, und habe wütend in den Garten von dem Palazzo gegenüber gestiert, als ob mir von dort ein Märchenprinz entgegenkommen würde. Oder wenigstens ein Frosch. Bis Laura endlich nachgekommen ist, mit einer langnasigen Maske vor dem Gesicht.
Ich habe mich weggedreht und wollte mich nicht sofort wieder vertragen. Ja, ich darf jetzt manchmal auch zickig sein! Wenn man so oft auf Hilfe angewiesen ist, wie ich und meine Familie es mal waren, glaubt man, immer lieb sein zu müssen.
»Jetzt komm schon«, hat Laura gemault. »Ich war doch nur ganz kurz da drin!«
Ich drehte mich weg und ging noch ein Stück weiter, in den Schatten, den ein Baum spendete. Unter dem Baum stand ein kleiner Kiosk, vor dem in einem Gestell Zeitungen wie Schuppen überlappend hingen. Und Wasserflaschen am Fenster aufgereiht standen.
»Seine Locken sind sowieso nicht so toll wie deine!« Sie ging rüber zum Kiosk, immer noch mit der Maske auf. »Wasser, Wasser, wir sterben.«
Übertreiben braucht Laura auch nicht, dachte ich mir noch, genug ist eigentlich genug. Und als ich ihr das gerade sagen wollte, dass sie sich jetzt ihr Drama sparen soll, da ließ sie plötzlich die Maske von ihrem Gesicht fallen.
»Schau, Madina!« Sie hielt mir die Zeitung hin, auf der Titelseite waren Panzer und Soldaten zu sehen und Frauen, die mit Blumen in den Händen dastanden. Es kam mir irgendwie bekannt vor.
Der Verkäufer tauchte plötzlich im Fensterchen auf wie ein Springteufel aus der Kiste und schrie hinter ihr her. Weil sie die Zeitung einfach genommen hatte, ohne zu fragen.
Laura legte ihm wortlos Geld hin. Die Zeitung in ihrer Hand zitterte.
»Schau, Madina!«, wiederholte sie. »Der Krieg ist vorbei.«
Ich habe zuerst nicht verstanden, was sie meinte.
Dann ließ Laura die Zeitung fallen, sie flatterte mit ausgebreiteten Papierschwingen zu Boden, die Soldaten starrten uns von unten ernst an. Die Frauen streckten uns die bunten Blumensträuße entgegen. Sie schüttelte mich. »Dein Krieg, Madina. Euer Krieg ist vorbei!«
*
Das war nie »mein« Krieg.
*
Ich habe ihn gehasst. Er hat uns fast zertrümmert, jeden einzelnen von uns. Er hat mich und Papa in unseren Keller gezwungen, in dem die Verletzten lagen, die Papa heimlich operierte. Auf einem Küchentisch. Und ich, die ihm dabei assistieren musste. Weil meine Mutter ohnmächtig wurde, wenn sie ihm helfen sollte. Weil Rami ja nicht in den Keller gehen durfte, um uns nicht aus Versehen zu verraten. Sie hätten uns doch alle getötet, wenn es aufgeflogen wäre.
In einem Krieg kann man sich nicht raushalten, auch wenn man es noch so sehr versucht. Er deckt das ganze Land zu mit seiner Finsternis, und jeder muss selbst zusehen, wie er unter dieser schwarzen Kuppel wieder herauskommt. Und ob er überhaupt herauskommt. Manchmal vergesse ich das alles, wenn ich nur genug Laura-Lachen um mich habe. Aber es lässt sich nicht ganz vergessen. Und vielleicht will ich das auch gar nicht. Es ist mein Leben. Es war so.
*
Verdammterweise verstehe ich gar kein Italienisch und Laura nur bruchstückhaft. Wir saßen auf den Stufen, die zum Bahnhof Santa Lucia führten, vor uns der Kanal mit den Vaporetti (jaja, ich kann das jetzt auch, so angeben wie Laura), und hielten die Zeitung auf unseren Beinen, während Laura versuchte, sie zu lesen wie ein Zauberbuch voller mir unbekannter Symbole. Oder einen Orakelspruch. Oder diesen Stein von Rosetta. Weiß nicht mehr genau, was da war, aber als man den endlich entziffert hat, war es jedenfalls ein Durchbruch. Irgendwann. Nach Jahrhunderten. So viel Zeit haben wir nicht.
Ich habe überhaupt keine Geduld bei so was. Ich holte mein Handy raus und fand eher wenig dazu, aber ja, der Krieg war aus. Schrieben sie auch bei uns daheim.
Ich suchte mit zitternden Fingern in meinem Handy herum. Ich war eigentlich vorher traurig, dass unsere gemeinsame Zeit hier in Venedig zu Ende ging. Aber plötzlich konnte ich gar nicht schnell genug nach Hause kommen.
Das Klingeln hatte so eine Unendlichkeit wie das Universum. Mir schossen Tränen in die Augen, als meine Mutter abhob.
3
Der Weg zurück: ein Wirbelwind aller mir möglichen Gefühle.
Dieser Krieg hat meinen Papa gezwungen zurückzugehen. Mitten hinein in die größte Gefahr. Für seinen Bruder. Für meine Oma. Oma hat es zu uns rübergeschafft. Von Papa und meinem Onkel Miro haben wir nie wieder etwas gehört. Nie wieder.
Ich denke also gleichzeitig: Es ist gut, dass der Krieg aus ist. Vielleicht kann mein Vater endlich zurückkommen! Es ist schlecht, dass der Krieg aus ist, vielleicht wird alles noch viel schlimmer!
Den Gedanken, dass ich möglicherweise eine Antwort auf den Verbleib meines Vaters finden könnte, die ich nicht, niemals nicht, erhalten will, diesen Gedanken schiebe ich ganz schnell wieder weg. Er darf keinen Platz in meiner Welt haben.
Was man sich vorstellt, wird vielleicht wahr, sagt meine Oma. Aber die ist so abergläubig, dass sie immer dreimal über die Schulter spuckt vor allen wichtigen Treffen oder Entscheidungen, um den bösen Blick fernzuhalten. Also, sie hat jetzt ein falsches Gebiss und spuckt nicht sehr weit, der größte Teil der Spucke bleibt ziemlich oft auf ihrer runden Schulter hängen. Meistens. Und wenn sie einen gleich darauf umarmen will, wird man mit dem Gesicht voran hineingedrückt. Ich liebe meine Oma, echt, aber diese Momente liebe ich etwas weniger. Rami hat’s gut, er wird immerzu in ihren weichen Bauch gedrückt, was in diesem Fall von unschätzbarem Vorteil ist. Er wächst allerdings so unkontrolliert wie eine wilde Bohne. Bald ist er so weit, dass er es hassen wird, wenn sie ihn umarmt.
*
Als wir atemlos in den Garten stürmen, sind schon alle da versammelt: meine Mutter, Tante Amina und meine Oma, Rami, Markus und Susi. Unsere Rückkehr wird gefeiert: Der Gartentisch ist festlich gedeckt, mit der Rosentischdecke, die sich meine Oma mal gewünscht hatte, mit Susis schönstem Geschirr aus buntem Keramik, einem Blumenstrauß in der Mitte. Die Semesterferien sind noch nicht um, und Markus ist noch eine Woche da, er hat extra auf uns gewartet.
Wir haben allerdings einen Stuhl mehr als üblich dastehen. Neben Susi. Sie ist auch irgendwie nervöser, als sie sein sollte. So aufregend ist es auch wieder nicht, dass wir nach zwei Wochen Italien daheim ankommen. Ich hätte ja verstanden, wenn sie nervös ist, während wir unterwegs sind. Aber jetzt?
Meine Mutter springt so heftig auf, als sie mich näher kommen sieht, dass ihr Gartenstuhl umfällt und das geblümte Kissen wegschießt wie ein Frisbee. Und stürmt auf mich zu. Ihr Gesicht spiegelt alles wider, was ich selbst vor Kurzem empfunden habe: Angst, Hoffnung, Freude und Besorgnis, in ihren Augen stehen Tränen.
Ich lasse den Rucksack fallen und umarme sie, dabei merke ich, dass sie kleiner geworden ist, gebückter. Oder bin ich es, die gewachsen ist?
Sie drückt ihr Gesicht an meinen Hals in einer Verkehrung unserer Rollen — ich spüre sie gleich wieder, diese Schwere, die mich befällt, wenn ich hier bin. Diesen Rucksack kann ich nicht so leicht abwerfen, er sitzt fest und straff auf meinen Schultern. Er macht meine Schultern breit. Aber er zieht mich zu Boden.
Kassandra hat sich aus Ramis Armen gerissen und rast zu uns. Zwischen den Seufzern meiner Mutter ertönt ein hohes Jaulen und Singen, als sie an meinen Beinen hochspringt. Jemand hat ihr einen Blumenkranz um den Hals gehängt, der sie ein bisschen zu einem Fabelwesen macht, ihre schwarzen Ohren klappen bei jedem Hochfliegen auf und beim Abtauchen wieder zu, als ob sie mit ihrer Hilfe fliegen würde. Und ich würde sie so gerne in den Arm nehmen, aber der ist ja schon von meiner Mutter belegt, wie so oft.
Laura kniet sich hin und übernimmt die offizielle Hunde-Begrüßung, Kassandra versteckt sich zwischen ihren Beinen und wedelt wie eine Wilde. Wo Kassandra wedelt, bin ich daheim. So einfach ist das. Und dort, wo Laura ist. Man kann mehr als ein Daheim haben. Das war das Wichtigste, was ich letztes Jahr erkannt habe. Vielleicht ist das so, je weiter man sich von seiner Familie entfernt in Richtung eigenes Leben. Dann markieren andere Meilensteine neue Lebensorte, und die früheren machen Platz und verschwinden im Nebel.
Markieren und Kassandra passt sehr gut zusammen, eigentlich.
Meine Mutter lässt mich endlich los, weil auch Oma mich begrüßen will.
Meine Oma sagt: »Der Krieg ist vorbei. Vorbei. Vielleicht kommt dein Vater jetzt bald zurück«, und sie tätschelt meine Wange, nur ihre Augen bleiben dunkel umwölkt.
»Bald werden wir mehr wissen, versprochen«, sage ich.
Und sie deutet mir ganz ruhig, mich neben sie zu setzen. »Erzähle doch von deiner Reise.« Und dann lächelt sie auf diese unvergleichliche Oma-Art, wie sie schon gelächelt hat, als ich noch ganz klein war und das erste Mal bei ihr übernachten sollte, ganz allein, ohne meine Eltern, und die Dunkelheit ihres Schlafzimmers drohte über mir zusammenzuschlagen wie schwarze Tinte, und das Knarren und Knistern in der Dachkammer wurde so laut, dass ich ihr Gutenachtlied nicht mehr hören konnte.
Ihr Lächeln schneidet erleuchtete Fluchtwege in die Finsternis, egal wie alt man ist. Ihr Lächeln und der Geruch nach Rosen und süßen Äpfeln aus ihrem Garten. In dem kleinen Fensterchen unter dem hölzernen Dachgiebel riecht es nach Honigkerzen, und irgendwann zieht der Mond vorbei und der Morgenstern verkündet das Ende der Nacht. Was würde ich dafür geben, wieder dort zu sein, in ihrem Bett mit den zwei alten weichen Matratzen darauf und dem bunten Überwurf, den sie aus Resten diverser Kleider genäht hat, in dem sich ihre Geschichte spiegelt und die meines Vaters. Sogar ein Flicken aus dem Ersatz-Soldatenmantel meines Urgroßvaters war auf dieser Decke zu finden, ein abgetragenes schlammgrünes Quadrat aus festem Stoff. Er war niemals heimgekehrt, und meine Großmutter hatte begonnen, Erinnerungen an ihn in ihr Leben einzubauen. Stück um Stück.
Unsere Familie: eine lange, lange Reihe wartender Frauen. Ich weiß, dass ich jetzt auch eine von ihnen bin. Und irgendwie weiß ich auch, dass ich nicht nur zum Warten geboren bin. Ich nicht.
Meine Tante steht leicht abseits und mustert mich sehr genau, mit einer tiefen Falte zwischen ihren Augenbrauen. Ihr Gesicht hat einen Ausdruck, den ich nicht deuten kann, obwohl ich es versuche, und ich nehme mir vor, sie später darauf anzusprechen.
Aber der frühe Abend explodiert ein bisschen in alle Richtungen, Ramis Kindergartenfreund Franzi kommt ungefragt vorbei, was Rami sogar seine geliebte Kassandra völlig vergessen lässt, und Susi, die sich erstaunlich hübsch herausgeputzt hat für eine kleine familiäre Feier, sieht alle fünf Minuten auf die Uhr.
Laura verdreht die Augen. »Ich glaube, wir erleben heute noch eine kleine Überraschung«, flüstert sie mir ins Ohr.
Ich schaue verständnislos.
»Glaub mir, ich kenn das.«
Markus stößt sie in die Rippen. »Jetzt hör schon auf«, sagt er. »Auch Mütter dürfen Spaß haben.«
Laura faucht ihn an. »Pfoten weg, Alter!« Und ich bin nochmals erstaunt heute Abend, ihr Gesicht ist trotzig und trägt einen Schatten von noch etwas anderem. Anspannung.
Susi spürt das, sie kommt zu uns und legt Laura einen Arm um die Schultern. Sie riecht gut und warm nach einem blumigen Parfum, das ich noch nie an ihr gerochen habe, meist sind es luftig-leichte Düfte, die sie verwendet. Laura zuckt zusammen.
»Willst du noch was zu trinken, Schatz?«, fragt Susi, und bevor Laura etwas antworten kann, läutet unsere Türklingel Sturm.
Draußen vor dem Gartentor steht Johann, der Cafébesitzer, in einem weißen Hemd und schwenkt einen Picknickkorb in der einen und Blumen in der anderen Pranke. Sein Bart wirkt nicht so wild gesträubt wie sonst, und frisiert hat er sich auch — ein seltener Anblick.
Laura schaut und schaut und muss schließlich ein Lachen unterdrücken. »Na gut, nicht die allerübelste Wahl«, flüstert sie mir zu.
Und ich muss an diesen Abend denken, an dem Laura Geburtstag hatte und Markus mich das erste Mal umarmt hat und mein Vater an genau diesem Tor auftauchte, in weißem Hemd wie Johann jetzt eben, angespannt und unsicher, um mich wieder abzuholen.
*