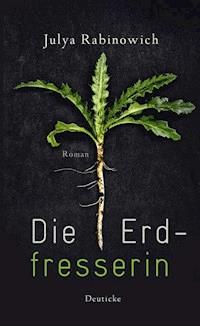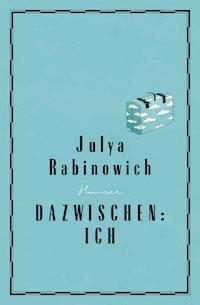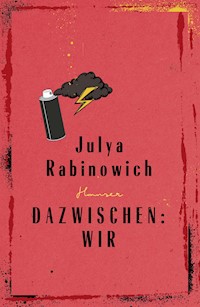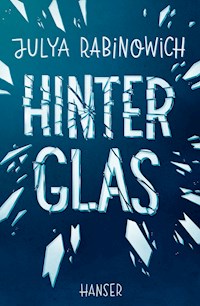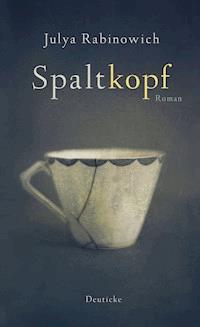Deuticke E-Book
Julya Rabinowich
Die Erdfresserin
Roman
Deuticke
ISBN 978-3-552-06200-9 Alle Rechte vorbehalten © Deuticke im Paul Zsolnay Verlag Wien 2012 Satz: Eva Kaltenbrunner-Dorfinger, Wien E-Book-Konvertierung: Beltz Bad Langensalza GmbH
Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/ZsolnayDeuticke
www.julya-rabinowich.com
Die Arbeit an diesem Roman wurde unterstützt durch das Elias-Canetti-Stipendium der Stadt Wien und das Projektstipendium des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur.
Prolog
Hinter mir scheint die untergehende Sonne durch die feingliedrigen Äste. Schnee knirscht unter den Füßen. Ein schwarzvioletter Umriss malt sich unnatürlich langgezogen auf die Schneedecke, ahmt jede meiner Bewegungen nach. Ich folge meinem Schatten, der in einem schmalen Spalt Licht in der Kälte wandert, die Wärme der Sonne am Rücken wie unzählige Männerkörper zuvor. Er hat mich noch nie in die Irre geführt. Unter mir Schnee, schmelzender Schnee und kantige Eisbruchlinien. Schwarze Spiegel neben meinen Stiefeln, die unter den Sohlen auseinanderspritzen, um sich hinter mir makellos zu schließen, bis die tiefhängenden Wolken wieder ihren Platz auf der Erde gefunden haben. Es ist gespenstisch still.
Mein Gesicht nähert sich der Oberfläche. Ich zwinkere mir zu. Dunkle Augen im dunklen Wasser. Dunkel wie Kaffee und viele durchwachte Nächte. Gezupfter hoher Brauenbogen. Der Atem rührt kleine Wellen auf, das Haar gerät in unruhige Bewegung, verwischt, setzt sich erneut zusammen. Dampf breitet sich darüber, ich verschwinde im Nebel.
Tauche endgültig hinab und trinke. Wische den Schlamm von den Lippen wie viele, viele Worte zuvor, stehe auf und gehe weiter. Stehe auf und gehe weiter. Es gibt welche, die liegen bleiben. Ich gehöre zu denen, die aufstehen und weitergehen. Es ist eine Frage der Entscheidung. Du hast es in der Hand. Bleibe liegen. Gehe weiter. Esse. Trinke. Atme. Einen Fuß vor den anderen. Und keinen Blick zurück. Den Blick zurück kann man sich erlauben, wenn man einen Ort erreicht, der nach dem Zurück liegt.
Teil I
Davor
And now, I wanna be your dog.Iggy Pop
»Erzählen Sie mir ein wenig von sich.« »Schauen Sie einfach in Ihren Unterlagen nach. Ich sehe, da liegt ein ganzer Stapel Papiere in meinem Akt.« »Das ist nicht Ihre Geschichte. Ihre Geschichte ist das, was mich interessiert.« »Was genau?« »Sie, Ihre Familie, Ihre Vergangenheit.«
1
Ich wusste so gut wie nichts mehr über Vater. Eine warme, große Brust, an der mein Hinterkopf lehnte, eine nach altem Tabak riechende Pfeife mit schwarzem Griff und gelblichem Mundstück. Elfenbein. Diese Pfeife war eines der Beweisstücke, die Mutter anführte, wenn die Rede auf Vaters Verschwinden kam. Seine Lieblingspfeife hätte er nie zurückgelassen, wenn er nicht beabsichtigt hätte, wiederzukommen.
Wenn schon nicht wegen der Kinder, dann wegen der Pfeife.
Als ich siebzehn Jahre alt wurde, kaufte ich mein erstes Päckchen Zigaretten und übergab mich heimlich im Hinterhof. Unser Haus, das größte und schönste, im Zentrum des Dorfes gelegen, ein steinernes Haus, im Gegensatz zu den kleinen schiefen Ziegelbauten rundum, gehörte nun Mutter. Wir hatten Geld. Noch.
Mein Vater war ein belesener Mann, einer, der von den Nachbarn aus Respekt gemieden wurde, ja man munkelte sogar, dass er eine Bibliothek besaß, einen eigenen Raum, der nur für Bücher verschwendet wurde. Als Kinder spielten meine Schwester und ich gerne darin, da das leere Zimmer, das an den Wänden von Regalen gesäumt wurde, die vom Boden bis zur Decke reichten, am meisten Platz für wilde Spiele bot. Man konnte sogar mit unserem Roller im Winter darin herumfahren. Die Bücher hatten einen eigenartigen Geruch, wie das ganze Zimmer, sie waren alt, meist in Stoff oder Leder gebunden, manche in einer uns unbekannten Sprache verfasst. In einer Schrift, die wir nicht entziffern konnten. Manchmal nahm ich eines der Bücher aus dem Regal, öffnete es und ärgerte meine Schwester, indem ich so tat, als könnte ich darin lesen. Lange Zeit glaubte sie mir, obwohl sie meine List hätte bemerken können. Das gesprochene Wort hatte schon damals eine größere Bedeutung für sie als das geschriebene, eine Behauptung wurde kaum auf ihren Wahrheitsgehalt geprüft. Man konnte es ihr als Dummheit auslegen, aber eigentlich weiß ich, dass sie einfach so loyal war, mir zu glauben und meine angebliche Überlegenheit zu akzeptieren, bloß, weil ich es mit Nachdruck sagte.
»Wieso kannst du das und ich nicht?«, schrie sie dann.
»Weil Papa es mir heimlich beigebracht hat«, ätzte ich.
»Warum hat er mir nichts beigebracht!«
Sie weinte und lief üblicherweise zu meiner Mutter, die mir ins Gesicht schlug, einmal, weil ich Vaters Bücher aus dem Regal genommen hatte, und dann noch einmal, weil ich log.
Mutter wischte noch in der Eiseskälte mit bloßen Händen unsere Türschwelle. Ihre Haut wurde rissig und sprang auf, kleine rote Linien in dunklem Braun. Die Fingernägel rot und die Finger. Die Türschwelle wusch sie jeden Tag, damit sie für Vater sauber und frisch blieb, damit er, wenn er zurückkehrte, ein gemütliches Zuhause vorfand, das all die Jahre nur auf seine Heimkehr gewartet hatte. Eisern.
Es war klar, dass jemand Vater ersetzen musste, aber er musste so ersetzt werden, dass man den Anschein bewahren konnte, Vater sei unersetzlich und im Übrigen sei dies auch nicht nötig.
Als ich fortging, wusch Mutter unsere Schwelle, nachdem meine Füße über sie hinweggegangen waren, ohne dass ihr Gesicht einen milderen Ausdruck angenommen hätte. Sie wartet. Ich nicht. Ich finde ihn jeden Tag und verliere ihn im Morgengrauen aufs Neue. In jedem Aspekt eines Mannes, der mir begegnet, treffe ich ihn wieder und wieder, eifrig wie eine Gottesdienerin, die in den Ikonen ihren Heiland findet, in jeder Ikone denselben. In jedem Mann finde ich den Vater und suche doch das Kind. Wenn meine Schwester und meine Mutter nur mit einem Viertel ihrer Hingabe, mit der sie auf den Vater warteten, sich meinem Sohn gewidmet hätten, hätte diese Hingabe hinreichend genügt, um uns alle glücklich zu machen. Aber einer, der da ist, ist weitaus weniger spannend als einer, der verschwand.
»Wann kommst du wieder, Mama«, hat er gesagt und geheult, bis Rotz über sein Gesicht geronnen ist, mit der Faust die Tränen im Gesicht verteilt. Trotzig vorgeschobene Unterlippe.
»Bald, Kleines«, habe ich geantwortet.
Auf der Oberlippe wuchs ihm ein dichter Schnurrbart, er hatte sich die gesamte Woche nicht rasiert, weil es ihm wieder schlecht ging. Er warf sich an mich und drückte sein feuchtes Gesicht an meinen Hals, stand zu mir hinabgebückt da und zitterte vor Weinkrämpfen. Ich umarmte ihn und hielt ihn fest. So fest ich konnte. Sogar noch ein wenig mehr, da ich fürchtete, er würde die Umarmung sonst nicht wahrnehmen können. Meine Mutter pflanzte sich in der Tür uns gegenüber auf und fixierte mich mit ihrem bitteren Blick.
Trotz ihres Alters stand sie so gerade, wie sie es in ihrer Jugend getan hatte, hager und aufrecht, mit streng nach hinten gekämmtem langen Haar, das sie jeden Morgen in einem Knoten an ihrem Hinterkopf befestigte. Trotz aller Vorwürfe, die ich im Laufe der letzten Wochen zu hören bekam, konnte ich mich, wie immer, auf ihr Wort verlassen. Sie würde sich um alle seine Angelegenheiten kümmern, um seine Arznei, die ich wöchentlich schickte, um seine Krankenschwester, die regelmäßig vorbeikam.
»Ich bin bald wieder hier«, sagte ich noch einmal überzeugend.
Pflicht, Wahl oder Wahrheit habe ich als Kind mit meiner Schwester gespielt. Ich habe keine Wahl, nur die Pflicht. Er beruhigt sich ein wenig, er lässt mich los. Mein Kleid hat vorne einen großen klebrigen Rotzfleck. Er gähnt. Das Medikament, das ich ihm in sein Essen gemischt habe, beginnt wohl zu wirken.
Seine Bewegungen verlangsamen zusehends.
»Bald«, murmelt er und lächelt sogar ein wenig. »Baaald.«
Er ist dünn, fast zu dünn, hat aber bereits ein kleines Bäuchlein angesetzt, er ist blass, Mutter ließ ihn lange nicht mehr ins Freie. Ich beginne mich langsam rückwärts den Gang hinab zu entfernen, die Tür hinter mir, mein Kind am anderen Ende. Die breiten Holzdielen knarren unter meinen Stiefeln, seine Augenlider flattern. Der dunkel gelockte Kopf hängt ihm immer weiter auf die Brust. Er winkt mir schläfrig zu, verliert das Interesse, sinkt auf unseren Holzstuhl, der im Vorzimmer steht, und legt den Kopf auf die Rückenlehne. Meine Mutter erscheint hinter ihm, dunkel gekleidet im Dunkeln, kaum zu erkennen bis auf ihr ebenso blasses Gesicht, und legt ihm ein gestricktes Tuch aus Ziegenhaar um die Schultern. Er stützt sich mit seinem ganzen Gewicht auf sie, und sie führt ihn strauchelnd in sein Zimmer.
Sie halten sich fest umschlungen und straucheln beide, sie wirken wie zwei frisch verbrüderte Saufkumpane im Morgengrauen, wie zwei schlecht eingeübte Clowns. Ich vermisse die Tröte, grün-gelb gestreift, die einen abscheulichen Ton von sich gibt, so eine habe ich ihm geschenkt, ein Souvenir von meiner ersten Reise. Das einzige Geräusch ist das Zufallen der Tür hinter mir.
Ich drehe mich um, das Gesicht Richtung Dorfstraße, und beginne zu gehen. Bevor ich die Autobushaltestelle erreiche, höre ich Schritte hinter mir. Ich weiß im Voraus, wer mir folgt. Ich verlangsame mein Tempo, ohne den Rucksack abzusetzen, und wende mich nicht um. Sie holt auf, sie geht eine Zeitlang still neben mir her. Sie trägt Schuhe, die ich aus Deutschland mitgebracht habe.
»Muss das wirklich sein?«
Ich schweige und beschleunige wieder. Sie versucht mit mir Schritt zu halten, sie ist längst nicht so sportlich wie ich, es fällt ihr schwer. Ich höre ihren Atem schneller und schneller werden, er bleibt als Nebel zwischen uns stehen. Ich lächle. Mich kostet das zügige Gehen kaum Anstrengung, ich bin eine Wandererin, während sie eine Hockerin geblieben ist.
»Muss das sein?«, wiederholt sie, nun ein wenig lauter, abgehackt, weil sie nach Luft schnappen muss.
»Schlag du mir was Besseres vor«, antworte ich gelassen.
Dieses Gespräch führen wir wieder und wieder, jedes Mal, wenn ich aufbreche, und immer, wenn ich zurückkomme, wartet sie auf ihre Entschädigungen.
»Du weißt, wie schwer er ist«, sagt sie.
Ich bleibe stehen.
Das ist neu.
»Was ist es diesmal«, sage ich, »was willst du diesmal noch mehr haben als sonst, dass du so anfängst?«
Sie weicht meinem Blick aus, Röte wandert über ihre Wangen und breitet sich bis zum Stirnansatz aus. Ich sehe in ihr glühendes Gesicht und beginne mich zu wundern.
»Du bleibst immer länger fort«, sie stottert, die Worte werden undeutlich und immer leiser.
»Jedes Mal länger …«
»War das bis jetzt ein Nachteil für dich«, sage ich. »Wer hat den Zubau bezahlt. Wer die Heizung. Die Winter waren mehr als eisig.«
Sie kämpft mit etwas, das ihr im Hals stecken bleibt, sie würgt. Ich werde geradezu neugierig, so ein Schauspiel hatten wir noch nie. Sie bleibt plötzlich stehen. Ebenso unerwartet beginnt sie zu schreien, ich habe sie seit langem nicht mehr schreien gehört, wie ungewohnt es ist. Ihre Stimme kippt und ist sofort rauh und brüchig.
»Wir hätten die verdammte Heizung nicht gebraucht!«, brüllt sie. »Wir haben den Zubau nur seinetwegen gemacht! Wenn du dein Leben versauen willst – gut, mach es, Diana! Aber lass meines in Ruhe!«
»Du hättest auch zu zweit gefroren.« Meine Stimme wird verkehrt proportional zu ihrer leiser und geschmeidiger.
»Pjotr hätte uns zu sich geholt«, bricht es aus ihr hervor, »er hätte genug Platz für uns beide, für Mutter und mich, und wir hätten das alte, riesige, unnütze Haus verkauft, das man kaum heizen kann, weil es aus Stein ist und dunkel und alt!«
Ich muss grinsen. Mein Schwesterchen hegt Brautträume, mit über fünfunddreißig Jahren, mit ihrem kantigen Gesicht, mit ihren ungelenken, großen Händen.
»Du machst uns allen das Leben zur Hölle«, stößt sie hervor.
»Ihr lebt mehr als gut von meiner Hölle«, sage ich.
»Bleib hier«, sagt sie, leise, heiser und schnell. »Bleib hier, mit deinem Sohn. Behalt das Haus. Aber lass mich gehen.«
Ich nähere mein Gesicht dem ihren, bis ihre Augen zu einem riesigen, verschreckt blinzelnden Zyklopenauge zusammenwachsen. Sie will zurückweichen, ich halte ihren Kopf fest. Mit diesen Händen habe ich bereits Männer bewusstlos geschlagen und schweres Bühnenmaterial eigenhändig durch die Kulissen geschoben, wenn ich nachts im Theater blieb, um mir neue Bilder durch den Kopf gehen zu lassen.
»Das, Schwesterchen«, hauche ich in ihr Ohr, »das solltest du Mutter sagen.«
Sie versucht sich aus meinem Klammeraffengriff zu lösen, ich lasse los, ein paar Strähnen langen, farblosen Haares bleiben in meinen Handschuhen verfangen zurück.
»Du hast uns das alles eingebrockt«, zischt sie mich an.
Ich blicke auf meine Uhr. Der Bus müsste jede Minute kommen. Ich wende mich ab. Sie bleibt stehen, sie sieht mir nach.
»Nächste Woche schicke ich das Geld«, schreie ich, als der Bus losfährt.
»Wie sind Sie hergekommen?« »Es war nicht schwer.« »Wo haben Sie die Grenze erstmals überquert?« »Zum Dorf an der Grenze ging ich eine Landstraße entlang.«
2
Zum Dorf an der Grenze gehe ich eine Landstraße entlang. Ich gehe Stunden.
Links und rechts von mir wogen riesige Flächen mit Hafer und Gras. Dunkelgrün, helles Grün, golden. Es riecht nach Kuhdung und Blumen, nach Chemie und ab und zu nach Benzin, wenn mich ein Auto überholt. Staub und Kies unter den Reifen. Manchmal nehmen mich die Leute mit, bei manchen steige ich nicht ein. Die Sonne steht hoch am Himmel. Kaum eine Wolke ist zu sehen. Der schwache Wind bringt etwas Abkühlung. Ich setze mich am Wegesrand hin, als ich meine Füße nicht mehr spüren kann. Ich habe es nicht eilig. Die Grenze am Tag zu überqueren, wäre nicht nur töricht, sondern geradezu halsbrecherisch. Wenn die Soldaten mich erwischen, bringen sie mich nicht hierher zurück, sondern viel weiter, und wenn ich Pech habe, werde ich noch früher von Anrainern entdeckt, die für gute Tipps Geschenke von der Grenzpatrouille erhalten. Die Geschenke ergeben sich aus den Habseligkeiten der Aufgegriffenen. Denen, die noch naiv genug sind, nimmt man ihr Hab und Gut als »Bestechung« ab, die nichts bewirken wird. Den anderen, die man schon kennt wie Menschen auf der Straße, die einem immer wieder über den Weg laufen, als Denkzettel.
Verzweiflung lässt sich weder in Geldbeträgen noch in Worten messen, und die nächste Begegnung mit den üblichen Verdächtigen ist vorprogrammiert. Ich kenne also sowohl das Procedere als auch diese staubige Straße bestens. Ich habe sie unzählige Male ungestraft passiert und werde es wieder tun. Ich trinke aus meiner Plastikflasche, das Wasser ist warm und abgestanden. Etwas weiter vorne gibt es einen Brunnen, an dem ich die Flasche auffüllen werde. Ich trinke in großen Schlucken.
Über meinen schweißnassen Hals und unter mein Baumwollleibchen rinnt das Wasser zwischen meine Brüste. Ich werfe mir eine Handvoll ins Gesicht und leere den letzten Rest ins Gras, lege mich zurück und spüre nach, wo sich die Erde in diesem Augenblick unter mir befindet, ob sie sich bereits weitergedreht hat, ohne mich dabei zu beachten, mächtig und mitleidlos, aber ich habe es geschafft, ich bin immer noch da.
Rücken an Rücken mit ihr.
Schon wieder in Sicherheit.
Die Kornkammer nennt man dieses Gebiet. Die Bauern sind stolz darauf, Korn für das Volk zu ernten, alles, was es braucht, um gesund und stark zu bleiben. Allerdings wird das Korn zum Schleuderpreis ins Ausland geliefert und wir finden uns an dieser Grenze wieder, um dem Korn nachzuziehen.
Das fruchtbarste Gebiet von allen ist Westeuropa, das alle ernährt. Da gibt es Korn, da gibt es Arbeit. Alle wollen wir nur einen Löffel vom Honig, ein Gläschen nur von der Milch, die in Europa fließt.
Ein Teilchen nur, ein elementares Teilchen, um zu überleben.
Das Volk ist schon lange geübt darin, auf Brot zu verzichten und zu überleben, ob in den Gebieten im Süden oder im hohen Norden, an den Küsten, an denen die verschrotteten Gerippe atomarer U-Boote liegen, große schwarze Umrisse steinzeitlicher Untiere, die verborgen in die Nacht strahlen und Wasser und Erdreich durchdringen und verändern. Die Pflanzen werden eigenartig dort und dicht und groß wie in den verwunschenen Wäldern alter Märchen. Wildwuchernd Pflanze, Tier und Mensch.
Im ganzen Land erzeugt man demnach Brot und Raketen. Das Brot geht in den Westen, die Raketen werden vorläufig dem Himmel drohend in Abschusskratern aufgestellt. Fürs Klopapier bleibt oft keine Zeit mehr.
Hygienische Notwendigkeiten trieben sogar meine Mutter aus dem Haus. Ausgerüstet mit großen Taschen und Rucksäcken mit dem Bus ins nächste Dorf.
Sie mochte es nicht, die schützenden Mauern unserer Residenz zu verlassen. Wenn sie sich nach draußen wagte, wurden ihre Bewegungen hastig und ungenau. Dinge fielen ihr aus den Händen und sie hatte es immer eilig. Vermutlich hatte sie Angst, Vater zu versäumen.
Ausflüge waren etwas Seltenes und Aufregendes und das Nachbardorf eine halbe Weltreise. Wir reisten mit dem Bus, der so oft an unseren Fenstern vorbeifuhr, aus dem manchmal fremde Leute ausstiegen und oft Nachbarn, die aus der Stadt pendelten, seltene Leckereien und wilde Geschichten im Gepäck.
Die Nasen an das staubige Glas plattgedrückt, stritten wir uns darum, wer mehr Hasen auf den Äckern erkennen würde, während der Bus über die unebene Landstraße rumpelte, Sand aufwirbelte. Die Felder trugen noch keine Früchte, sondern schienen hauptsächlich aus aufgewühlten Reihen Erde zu bestehen, die an ein Zopfmuster afrikanischer Frisuren erinnerten. Meine Mutter stand mit fest verschlossenen Lippen hinter mir und hielt uns mit ausgestrecktem Arm ans Fenster, um uns vor den Mitreisenden abzuschirmen, die vielleicht Infektionen in sich trugen.
Ihre Spannung löste sich nur wenig, als wir von einem entfernten Verwandten, den wir vielleicht zweimal zuvor gesehen hatten, an der Haltestelle in Empfang genommen wurden. Ich blickte mich gierig um: Es roch anders hier, und es sah auch anders aus, die heruntergekommenen Häuser am Hauptplatz trugen fremde Farben und andere Gesichter in ihren Fenstern.
Eine alte Frau in buntem Rock und dunkelblau aufgedunsenen Beinen sitzt auf einem Hocker auf der Straße und bietet gehäkelte Spitzendecken an. Sie lächelt mich an. Goldohrringe und Goldzähne.
Neben ihr eine Flasche Wein und ein Krug Wasser.
»Steig ein«, drängt mich der fast fremde Onkel, er schubst mich mit einer nach Mann riechenden Hand, die so anders ist als die des Vaters meiner Erinnerung, in sein rostiges Auto. Meine Schwester sitzt schon drin, artig beim Fenster, die Hände im Schoß, während ich alles angreifen, ausprobieren, kaputtmachen und erfahren muss. Meine Nägel sind nach zwei Stunden Reise bereits dunkel gefärbt.
Im Auto stinkt es nach Benzin. Ich will das Fenster hinunterkurbeln, aber meine Mutter verbietet es, aus Angst, wir könnten uns im Zug den Tod holen. Nach einer halben Stunde Fahrt auf der Landstraße wird mir übel.
Ich will anhalten, aber das geht nicht, weil wir uns beeilen müssen. Wir wissen immer noch nicht genau, wohin eigentlich, und die Neugier lenkt mich eine Zeitlang vom Brechreiz ab. Meine Mutter ist unruhig still und antwortet auf die Fragen ihres entfernten Cousins nur einsilbig. Er bricht nach mehreren Konversationsversuchen ab und fährt schweigend weiter, während Wälder an uns vorüberziehen, durchbrochen von Feldern und kleinen Siedlungen, so klein, dass sie nicht einmal aus zehn Häusern bestehen. Armselige kleine Zäune, die der kommunistischen Idee widersprechen wie das Steinhaus der Eltern. Hühner laufen vor dem Auto auseinander. Ziegen sehen uns vorwurfsvoll nach.
»Wo fahren wir hin, Mama«, frage ich.
»Einkaufen«, antwortet der Onkel, nachdem meine Mutter sich zu lange Zeit lässt und er froh ist, die Stille durchbrechen zu können.
»Was?«, hake ich nach.
»Wirst schon sehen«, sagt meine Mutter.
»Ich muss aufs Klo«, füge ich hinzu.
»Zuerst das Papier«, sagt sie.
Der Onkel sieht meine Mutter an, beschließt aber zu schweigen, wie sie vorhin geschwiegen hat. Ich muss mich auf eine unbestimmte Wartezeit gefasst machen und krampfe meinen ganzen Unterleib zusammen. Ich verschließe alle meine Lippen fest und drücke den Hintern in den durchgewetzten Sitz hinein. Nach einer Weile spüre ich meinen Bauch nicht mehr.
»Wann sind wir da?«
»Bald.«
»Bald« erweist sich als eine weitere halbe Stunde durch Wiesen und Felder, am Horizont taucht der Umriss eines Baukomplexes auf. Meterdicke Schornsteine ragen hoch. An ihren oberen Enden hängen dichte Rauchschwaden. Ich stelle mir die Pfeife meines Vaters genau so vor: riesenhaft über mir in den Himmel gebreitet mit langen Schlieren dunklen Rauchs statt Wolken. Statt die riesigen Hallen anzusteuern, biegen wir aber erneut auf einen Feldweg ab, und als ich gerade merke, dass wirklich nichts mehr geht, was Zurückhaltung anbelangt, befinden wir uns schon auf einer breiten, asphaltierten Straße.
Wir halten an und ich stürze in die Büsche, bevor meine Mutter mich greifen kann. Sie schlägt die Hände zusammen und verdreht die Augen. Als ich wieder hochkomme und mir meine tauben Füße vertreten will, sehe ich ein seltsames Panorama.
Entlang der Straßenränder stehen Zelte. Folie auf Holzstecken gespannt. Die Plastikwigwams ziehen sich über die ganze Länge der Straße, die schnurgerade zur Fabrik führt, an der wir vorübergefahren sind, und verlieren sich in der Ferne. Dutzende solcher Zelte links und rechts der Fahrbahn, mal weiß, mal blau gedeckt. Ich mache noch ein paar Schritte auf sie zu: Alle sehen absolut gleich aus. Auch der Inhalt jeden Zeltes ist ident mit dem des Nachbarn: jungfräuliches, weißes, begehrtes Klopapier. Berge aus Klopapierrollen.
Klopapierpyramiden, die eine stolze Höhe von fast zwei Metern erreichen. Sie füllen die Zelte fast vollständig aus, ordentlich aufeinandergestapelt, daneben die beflissenen Verkäufer, die uns mit Bazargesten in ihr Reich locken wollen: Kommen Sie! Kaufen Sie!
Dass der Nachbar links und der Nachbar rechts, dass die gesamte Verkaufsfläche mit demselben Produkt angefüllt ist, scheint niemanden zu stören: Zwischen den Verkaufsständen flanieren Menschen, die unter den angebotenen Waren gustieren, um das allerbeste Stück für sich zu ergattern oder den günstigsten Preis herauszuschlagen.
Das Klopapier reicht bis zum Horizont und für alle. Endlich ist die kommunistische Maxime mit den Gesetzen des Kapitalismus vereint, sozusagen die Quadratur des Kreises.
Die seit Monaten nicht bezahlten Fabrikarbeiter haben sich kurzerhand selbst versorgt und den ausstehenden Lohn in Rollen an sich genommen. Die Auslieferung der Ware, die seit Monaten ebenfalls nicht funktioniert, hat ein klaffendes Konsumloch in den Geschäften hinterlassen und Tausende Putzbedürftige hierhergelockt: Vielleicht hat nicht jeder Geld oder eine große Wohnung, ein Klo jedoch hat ein jeder. Die Lage der Fabrik hat sich herumgesprochen, und die Einkaufstour kann beginnen. Mancher Verkäufer akzeptiert auch Naturalien, ich sehe Menschen feilschen, die ihrerseits Rucksäcke dabeihaben, die mit Pilzen, Fellen, Weinflaschen beladen sind. Ein mittelalterlicher Markt.
Meine Mutter hängt den Onkel ab und geht zu den ersten Ständen hin, während ich die ganze Länge gerne laufen würde, die Straße bis zum Horizont. Sie ruft mich nach ein paar Metern wieder zurück, knapp und leise, aber ich wende und komme ihr nach, irgendetwas in ihrer Stimme klingt elend. Sie kramt in ihrem alten Samtbeutel, ihre Hände beben. Dann dreht sie sich so zum Verkäufer hin, dass außer mir und meiner Schwester niemand sieht, was sie tut, und bietet ihm auf ausgestreckter, sehr sauberer Hand einen tropfenförmigen, funkelnden Gegenstand an, und ich erkenne einen ihrer Ohrringe. Der Verkäufer nimmt ihn achtlos aus ihren Fingern und reicht uns einen großen Plastiksack. Wir fallen über unsere Rollen her und stopfen sie zuerst in die Säcke und dann ins Auto, während der Onkel am Rand der Straße sitzt, aus seiner Flasche trinkt und uns lachend dabei zusieht. Bald werden wir die Heimreise antreten, meine Mutter wird die blütenweiße Pracht besonders langsam vor dem Haus ausladen und darauf achten, dass es alle Nachbarn auch mitbekommen. Wir sind sauberer als sauber.
Ich sitze verschwitzt am Rand des Kornfelds auf der kleinen Falte Erde, die sich hin zur Landstraße schlägt, und denke an die Kürbisfelder, die auf der anderen Seite der Welt auf mich warten. Perfekt gestreifte kleine und große Sphären, die im Dämmerlicht des Morgens zwischen geringelten Strünken sattorange leuchten. Widerhaken und knallig gefärbte Blüten. Die Stacheln schwer aus der Haut zu entfernen. Die Blüten kann man vorsichtig lösen und essen, wenn der Hunger groß ist, sie schmecken leicht bitter und fühlen sich zart wie Schmetterlingsflügel am Gaumen an. Weit dahinter beginnen erst die Maisfelder, die ich noch überqueren muss, wenn es heller geworden ist.
Ich bleibe kurz stehen, stelle meinen Rucksack ab und sehe mich um. Die lichtabgewandten Kürbisflanken bleiben dunkelgrün. Sie werfen lange Schatten neben die Schatten, die meine Beine werfen.
Die Sonne geht auf und das Rot am Horizont greift auf die Erde und die Kürbisse und auf mich über. Ich kneife die Augen zusammen und sehe die Erde voller Ranken vor mir ausgebreitet, den vom Regen glattgestrichenen Feldboden, ausgetrocknete Rinnsale wie Marsflussbetten. Jeder meiner Schritte dringt in eine perfekt abgeschlossene Welt hinein und bricht sie in neue Landschaft.
»Was haben Sie in Wien gemacht?« »Verschiedenes.« »Von irgendetwas haben Sie ja leben müssen.« »Mal dieses, mal jenes.«
3
Eine Bewegung deckt meine Müdigkeit zu. Die nächste zeichnet harte Linien weich, betont die Wölbung des Mundes, ich schließe mein linkes Auge und fasse den Wimpernkranz in einen geheimnisvoll dunklen Rahmen. Die Lider flattern voller Scheu vor neuer Berührung. Als ob ich mir nicht vertrauen würde. Als wäre die Hand, die geduldig Teile der täglichen Maske auf mich aufträgt, nicht meine. Noch ist die Maske makellos, die Risse in ihr, die sich bald in kleinere und tiefere Fältchen absetzen werden, sind noch fern. Das Make-up billig und die Haut mitgenommen, der Zauber währt nicht lang.
Für die Spanne Zeit, für die er notwendig ist, wird es reichen. Zwischen meiner Nasenwurzel und den Augenwinkeln ist die Haut nun dunkel und bläulich, als hätte ein Vogel mit scharfem Schnabel fest hineingehackt. Ich kenne diesen Vogel. Er heißt Alter. Ein nebelfarbener, ein leiser Vogel ist er, der lange über seinen Opfern kreist, bevor er sie mit kaum hörbarem Flügelschlag auslöscht.
Ich verteile jugendliches Erröten großzügig über mein Gesicht. Eine angebliche Bereitschaft.
Den Mund öffne ich erwartungsvoll und mache meine Lippen feuchtglänzend. Mein Blick ist immer noch hart, es gibt nichts, was ich darüberlegen könnte, um noch weiter zu täuschen.
Die Bühne liegt im Dunkeln vor mir, ruhig, trügerisch.
Bald wird sich das Licht über mich ergießen und alle Makel wieder schonungslos an die Oberfläche zerren.
Ich räuspere mich. Ich lasse meine Stimme aus mir heraussteigen, hoch über mich hinweg, in meiner Sprache, in meinen Worten, die hier keiner versteht.
Ich versuche immer zu verstehen. Spreche mittelmäßig Deutsch, etwas Englisch, ein wenig Polnisch, Tschechisch und Serbisch, Bruchstückchen Türkisch und Arabisch. Sie haben mir Wortsplitter mitgegeben und Kleingeld, und ich habe alles genommen, was ich bekommen konnte. Mein Versteckspiel. Mein Gefundenwerden. Mein Verlorengehen.
Die Sprache ist Teil meiner Haut, Teil meiner Schritte, sie wechselt, wie meine Identität gewechselt werden muss, jeder Schauspieler muss das können, um Erfolg zu haben.
Ein Wiegenlied, für mich und für den Abend. Dieses Lied habe ich meinem Sohn wieder und wieder vorgesungen, zuerst, als er klein und müde, später, als er schon groß und krank war. Das Lied schenkt keine Ruhe, es spendet keinen Trost, aber es macht mich wieder menschlich, wenn ich das Gefühl habe, über gewisse Grenzen zu schreiten, wie über die Schwelle von meines Vaters Haus, über die Grenze meines Landes und über die nächste Grenze und noch eine.
Jede Grenze war eine Schwelle, die ich im Eiswasser gewaschen hinter mir zurückließ, ohne dass jemand einen Blick an mich, die Fortgehende, verschwendet hätte.
So unauffällig, wie ich aufgetaucht bin, bin ich weitergegangen.
Das muss man können, nicht jeder kann das. Meine Freundin Nastja zum Beispiel fiel auf, als sie über die zweite Grenze gehen wollte. Ihr gehetzter Blick fiel auf, ihre schroffen Bewegungen. Man ist ihr gefolgt, hat sie im Wald gejagt wie einen Hasen, wie ein zitterndes Tier, das sich im Dickicht duckt, gefunden, hochgezerrt, in den Wagen gesetzt, der nach Benzin und billigem Fusel roch, und sie wieder zurückgebracht, nicht ohne sie um ihr Erspartes zu bringen.
Ins sichere Drittland. Dort musste sie artig sein, dafür ließ man sie gehen.
Sei ruhig, habe ich ihr eingebläut. Sei immer langsam, bis es keinen Ausweg gibt als den, schnell zu sein. Sei still. Lächle, aber lächle nicht zu viel. Achte auf deinen Gang. Zahle niemals Geld. Naturalien kann dir keiner nehmen. Das ist ein Tischleindeckdich, das dir immer zur Verfügung steht. Lächle und gewähre, dann kommst du weit.
Nastja hat mich angesehen mit ihrem gehetzten Tierblick und genickt. Färb dir die Haare, hab ich ihr gesagt. Nimm bequeme Stiefel, die einen Absatz haben, mit dem es sich zu treten lohnt. Weine nie. Das macht nur Falten und du musst dich erneut bemalen.
Sie hat wieder genickt und zu weinen begonnen.
In Wien haben wir uns wie geplant wiedergetroffen. Solange es ging, uns ein Eckchen Heimat eingerichtet, mit einem kleinen Tisch und gesticktem Tischtuch und einer Thermoskanne voll heißem, süßem Tee. Sie beneidete mich um Slavko. Slavko bedeutete zumindest dreimal in der Woche ein Dach über dem Kopf und ruhigere Arbeit, aber Slavko brauchte keine zwei Frauen unseres Alters. Er brauchte keine Mangelware, niemanden, der schwächer war als ich. Nastja hat noch ihren Traum, den Traum vom Heiraten und einem kleinen Ehemann in einer kleinen Wohnung, mit kleinem Gehalt und kleinem Glück, und sie, die kleine Nastja, für immer zu Hause, nie wieder auf der Straße. Ich habe keinen Platz für Schwächen. Und ich dulde auch keine in meiner Nähe, wenn sie mich ablenken.
Zu Hause, als wir noch gemeinsam studierten, war sie immer die, die im Hintergrund blieb und wartete, bis ich ihr Vorsprechtermine und Projektbeschreibungen gebracht habe. Unsere Wege auf der Universität trennten sich bald, als sie Schauspielerei und ich Regie als Hauptfach belegte. In den gemeinsamen Vorlesungen saßen wir noch nebeneinander: Literatur, Theorie und die Deutsch- und Englischkurse, in denen sie uns Unsprechbares beibrachten. Hinter dem Rücken der durchaus engagierten Professoren, die noch nie einen Deutschen, noch nie einen Engländer sprechen gehört hatten, wurden sie Feindessprachen genannt, die keiner von uns wirklich einzusetzen wusste. Wir saßen nebeneinander, und ich spürte, wie sie darauf lauerte, dass ich fertig studiert haben und eine erfolgreiche Regisseurin sein würde, in deren Aufführungen sie die Hauptrollen genauso bekäme wie jetzt die Terminzettelchen. Diese Vorstellung machte mich noch stärker. Ihre Hoffnung beflügelte mich. Ich brauchte dieses leise ergebene Warten an meiner Seite, um meine Schritte umso entschlossener zu setzen. Sie wog all den Zweifel auf, den meine Mutter wie Gift in meine Adern träufelte.
Alles hatte sie darangesetzt, um mich von der Übersiedlung in die Stadt, in der ich beschlossen hatte zu inskribieren, wieder abzubringen.
Eine Großstadt, zu gefährlich für ein junges Mädchen. Und ein Studium? Wozu? Ich würde doch sowieso heiraten und die Schwelle waschen. Meine Schwester runzelte die Stirn, genauso wie sie. Eine ergebene Krankenschwester, die den Eingriffen des Chirurgen unbedankt assistiert. Vermutlich hat sie als Kind schon geübt, Mutters Urteil bis ins Ununterscheidbare zu kopieren. Sie gehörte Mutter, ich war das Vaterkind. Wie sie es mir immer und immer wieder erzählt haben. Meistens in Verbindung mit etwas, das ungehörig oder verboten war, und das natürlich mir zugeordnet worden ist. Meistens zu Recht.
Ich musste diese Information als gegeben zur Kenntnis nehmen, wusste ich doch so gut wie nichts mehr über Vater, eine vage Erinnerung an eine warme, große Brust, an der mein Hinterkopf lehnte, eine Pfeife mit schwarzem Griff und gelblichem Mundstück. Elfenbein. Seine Lieblingspfeife hätte er nie zurückgelassen, wenn er nicht beabsichtigt hätte, wiederzukommen.
*
»Was glauben die Leute«, sagt Nastja und lacht ungläubig. »Was glauben die Leute.«
Ich beschließe, ihr nicht zu antworten, es hat keinen Sinn, ich könnte ihr nichts erklären, nichts begreiflich machen von dem, was mir wichtig ist, sie hat noch nie kapiert, worum es ging, und ich habe oft davon profitiert.
»Diana?«
Der Geruch im Raum ist ätzend, wir haben das Gangfenster gekippt, aber die Luft steht immer noch in dem niedrigen Vorraum, in dem wir sitzen. Wir haben die Tür zum Zimmer geschlossen, damit wir später noch gut schlafen können. Ein kleines Tiegelchen Haarfarbe genügt, um uns in eine Wolke zu hüllen, mit jedem Atemzug wird der Eindruck, wir würden uns in einer Chemiefabrik befinden, nachhaltiger und überzeugender.
Meine Haare sind bereits unter einem Plastiksack verschwunden, zwischendurch tupfe ich die stinkenden Rinnsale, die ihren Weg beständig über meine Ohren, Stirn und Nacken suchen, mit einem zusammengeknüllten Stück Klopapier weg. Die Farbe juckt auf der Kopfhaut, aber man darf nicht kratzen. Wir teilen uns zwei Flaschen »Norwegisch Blond«, zuerst ist mein dunkler Nachwuchs dran, dann Nastjas ganzer Kopf, ihr ist es nie hell genug, obwohl ihre Spitzen weit oben bereits abbrechen, wenn man sie zu fest anfasst. Nastja wird oft zu fest angefasst.
Die Menschen wollen Ähnlichkeiten finden zwischen ihnen selbst und uns, und wir kommen ihnen gerne entgegen und erblonden gehorsam und schmerzhaft.
»Was glauben die Leute«, hebt Nastja wieder an, diesmal lauter, als fürchtete sie, dass ich sie nicht hören kann und nur darum schweige.
»Halt den Mund«, sage ich und sie schaut mich mit weit offenen blauen Kinderaugen an. Sie ist so perplex über meinen plötzlichen Sinneswandel, dass sie wirklich nichts mehr sagen kann, sie braucht erstaunlich lange, um den Mund wieder zu schließen. Ich stehe auf und lasse die Skelettbürste, mit der ich eben noch ihr Haar in artige Strähnen geteilt habe, auf den Tisch fallen, ich gehe zum Wasserhahn gegenüber und drehe ihn auf und höre dem Geräusch des rinnenden Wassers zu.
Nastja sitzt da und schaut mich an.
»Schau her«, sage ich überflüssigerweise.
»Schau ganz genau her.«
»Du bist verrückt«, sagt sie plötzlich kaum hörbar.
Für eine kräftige Stimme reicht ihr Mut nicht aus. Ich lache.
»Du wolltest doch wissen, was die Leute denken. Schau her.«
»Ich sehe nichts.«
»Weil du zu dämlich bist. Schau genau her: Da kommt das Wasser herausgeflossen, hier trifft es auf den Grund der Abwasch, sammelt sich zu einem höheren Pegel und fließt wieder ab. Dazu ein leises Rauschen und Gurgeln.«
»Du spinnst wirklich, Diana.«
»Keineswegs. Das Wasser ist zu keinem Zeitpunkt verändert, nicht wenn es aus der Wasserleitung spritzt, nicht beim Aufprallen auf den Beckenboden, nicht beim Verschwinden im Ausfluss. Es ist immer dasselbe Wasser, ein großer Strom von sinnlosem Wasser. Genau das spielt sich in jedem Kopf ab, dem du da draußen begegnest. Du spiegelst dich vielleicht kurz in diesem Wasser, aber das ist völlig irrelevant, dein Spiegelbild wird nicht haften bleiben, weder dein Schicksal noch dein Gesicht, deine multipel wechselnde Identität ist völlig austauschbar, es geht nicht darum. Denk daran: Du verschwindest vierundzwanzig Stunden am Tag, jede Sekunde in diesem dunklen schmalen Abfluss, aus dem übrigens schon wieder deine Haare raushängen. Ich habe dir oft gesagt, dass du nach dem Haarewaschen deine verdammten Haare aus dem Abfluss klauben sollst.«
Nastja glotzt. Ich nehme die Bürste und kehre damit an unseren Küchentisch zurück, der gleichzeitig unser Wasch- und Esstisch ist, wir haben nur diesen Vorraum mit Waschgelegenheit und Herd, dahinter das kleine Schlafkabinett, durchs Fenster sieht man eine Betonwand. Ich setze die Bürste vorsichtig auf Nastjas Kopf und drücke die Borsten dann mit einem Ruck fest in ihre Kopfhaut. Sie rührt sich nicht.