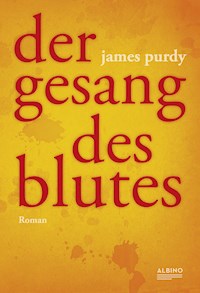
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Albino Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Garnet Montrose fühlt sich eher tot als lebendig. Niemand kann den Anblick des schrecklich entstellten Vietnamkriegs-Veteranen ertragen. Vereinsamt auf einer Farm in Virginia, pflegt er seine Erinnerungen an eine längst vergangene Liebe. Schließlich wird ein junger Mörder auf der Flucht keine Angst vor seinem hässlichen Gesicht haben. Zwischen Garnet und ihm entwickelt sich eine außergewöhnliche Freundschaft. Doch Daventry, der engelsgleiche wunderschöne junge Mann, kennt nur die totale Liebe oder die totale Zerstörung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 171
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
DER GESANG DES BLUTES
James Purdy
Der Gesangdes Blutes
Aus dem Amerikanischen von Dino Heicker und Michael Sollorz
Die Originalausgabe erschien 1975 unter dem Titel
In a Shallow Grave
bei Arbor House, New York
1. Auflage
© 2015 Albino Verlag, Berlin
in der Bruno Gmünder GmbH
Kleiststraße 23–26, D-10787 Berlin
Originaltitel: In a Shallow Grave
© 1975 by James Purdy
Aus dem Amerikanischen von Dino Heicker und Michael Sollorz
Redaktion: Gerhard Hoffmann
Umschlaggestaltung: Robert Schulze
ISBN 978-3-95985-037-7eISBN 978-3-95985-054-4
Mehr über unsere Bücher und Autoren:
www.albino-verlag.de
Für Edward G. Hefter, Robert Helps und George Andrew McKay
Was Sie jetzt brauchen werden, da Sie ja nun dabei sind, aus der Armee auszuscheiden«, hatte mein Captain zu mir gesagt, als ich meinen Ausmusterungssold abholte, »nannten sie zu Zeiten meines Großvaters einen Kammerdiener oder vielleicht einen Lohndiener. Es sei denn, Sie möchten im Veteranen-Hospital bleiben, wozu Sie mehr als jedes Recht besitzen … Aber Sie werden auf jeden Fall jemanden brauchen, der sich jetzt um Sie kümmert …«
Ich dachte nicht über einen Kammerdiener und /oder Lohndiener nach, bis ich etwa eine Woche wieder daheim in Virginia war. Eigentlich war alles, worüber ich in den ersten paar Tagen nachdachte, wie viele Vögel da in den frühen Morgenstunden sangen – nie hatte ich so einen Lärm gehört. Ich dachte auch an meine Eltern, die während meines Militärdienstes gestorben waren, und an jemanden, zu dem ich sehr bald komme. Ich fühlte außerdem eine Art zorniger Genugtuung, wenn nicht Dankbarkeit, für all das Geld, das ich in Händen hatte, ganz zu schweigen von dem, was mein Onkel mir vermacht hatte. Ich sage zornige oder grimmige Genugtuung angesichts der Tatsache, dass wir beide, der Captain und ich, wussten, es würde keinen Kammerdiener, Lohndiener oder gar Sklaven geben, der kommen und bei mir bleiben, geschweige mit mir essen oder mich berühren würde, weil ich vielleicht gleich erklären kann, dass infolge meiner Kriegsverletzungen, welche mir nahe des Südchinesisehen Meeres widerfuhren, mein Anblick jedem den Magen umdreht – ihn zum Erbrechen, wenn nicht gar in Ohnmacht zu fallen veranlasst.
Irgendwie musste ich grinsen, als ich über die Empfehlung des Captains wegen eines Kammerdieners oder Lohndieners nachdachte, denn ein anderer Soldat, der zur gleichen Zeit wie ich ausgemustert worden war, hatte es gleich auf den Punkt gebracht: »Wer sollte sich denn um dich kümmern wollen, du findest doch nicht mal mehr einen, der dir die Schuhe putzt.«
Doch hinter diesen alltäglichen Überlegungen und Sorgen flatterte unentwegt der unscharfe Gedanke auf, seinerzeit noch nicht in Worte gefasst, dass etwa zwei Meilen die Straße hinunter die Witwe Rance lebte, welche, obwohl es tausend Jahre her zu sein scheint und ihrer Erinnerung sicher entfallen war, die Liebste meiner Kinderzeit gewesen ist.
Wenn ich auch jeden Moment an sie dachte, schlafend oder wach, beim Lärm der Vogelchöre, war es schließlich nicht meine lebenslange Verliebtheit, die meinen Atem stocken ließ, sondern was ich noch anfangen konnte mit dem Rest, der von mir übrig war.
Bevor er meine Papiere unterschrieb, hatte der Militärarzt gesagt: »Auch wenn ihre Haut von den Verletzungen völlig entstellt ist, sollten Sie nicht vergessen, dass Sie ungeachtet Ihrer äußeren Erscheinung einen wunderbar starken Knochenbau besitzen, und es sind die Knochen, die einem Mann Haltung und gutes Aussehen geben.«
Nach meiner Rückkehr sollte ich in der Dunkelheit noch manches Mal einen großen Handspiegel hervorholen und mich betrachten, als suchte ich nach den Knochen, von denen er meinte, ich müsste stolz auf sie sein. Wohl wahr, im Mondlicht sah ich fast normal aus. Die Narben, Schmisse und Verfärbungen schmolzen gewissermaßen in die Nacht …
Ja, ich brauchte einen Diener, es blieb dabei. Keine Frau, das ist gewiss, würde diese Arbeit übernehmen, obwohl ich eine Frau bevorzugt hätte. Es musste also nicht nur ein Mann her, sondern auch ein junger – weil ich, wie Sie sehen, bereits meinen Plan hatte –, und er würde gut zu Fuß sein müssen. Denn schon bevor ich einige Inserate in die Lokalzeitungen setzte, wusste ich, dass ich durch ihn die Witwe Rance mit den Briefen, die ich ihr schreiben wollte, umwerben würde.
Aber nach meiner Kriegsverletzung war es ein vielleicht noch größerer Schock, als die Inserate beantwortet wurden und die Bewerber anfingen, sich persönlich vorzustellen. Nie zuvor hatte ich jemanden ausgefragt, immer war ich derjenige gewesen, der alle Fragen beantworten musste, und jetzt lag es bei mir, diese jungen Männer zu fragen, ob sie versuchen wollten, die Stellung anzunehmen. Allerdings brauchte es kaum Fragen, lassen Sie mich das sagen, und beinahe keine Antworten, weil all die jungen Männer sich ähnlich benahmen, das heißt, sie erblickten mich, und es begann ihnen schlecht zu werden, sie husteten und würgten, wenn sie zu mir hersahen, als müssten sie erbrechen. Dann standen sie auf und rissen in der Eile einen Schemel oder Hocker um, der im Weg stand, manche murmelten noch »Nein danke, mein Freund« oder »Tut mir leid mit Ihrem Ärger da drüben«. Einer fing sogar an, meine Hand zu schütteln, doch als er sah, dass die Entstellungen bis in meine Fingerspitzen reichten, besann er sich und war schneller wieder draußen als jene, die bei meinem Anblick gleich kehrtgemacht hatten.
Ich bin froh, dass der Doc mir einen reichlichen Vorrat an Medizin überlassen hat, denn sobald ein Bewerber würgend und Möbel umreißend hinausgestürzt war, schluckte ich mehr als meine übliche Handvoll Tabletten.
Ich herrschte hier über fünfzig Morgen Land, die Hinterlassenschaft meines Großvaters, der sie wiederum von seinem Vater geerbt hatte. Gleich hinter dem Haus ist der Ozean, der gewissermaßen meinen Stimmungen folgt, was bedeutet, dass er zuweilen sogar bei strahlendem Himmel tost und grollt und heult und weint wie ein kleines Kind. Weil ich gerade vom Weinen spreche, mein Doc sagt, die Verletzungen hätten meine Tränendrüsen nicht beschädigt, aber ich denke, in dieser Hinsicht wie in vielen anderen muss er sich geirrt haben, denn ich kann nicht weinen. Wenn ich damit anfange, fühle ich in besagten Drüsen einen starken Schmerz, als würden scharfe Felsen oder Mühlsteine über bloßliegende Nerven geschleift.
Wenn ich daran denke – ich weiß nicht, was ich ohne den Ozean täte.
Anfangs schrieb ich in Form eines Tagebuchs meine Gedanken nieder, doch eines Morgens verbrannte ich sie. Alle Seiten meines Tagebuches begannen mit einem Satz, der seitdem durch die Luft zu schweben schien wie Rauchringe auf einer Zigarettenreklame: Ich habe nun die Farbe von Maulbeersaft.
Es ist, als wäre jeder Stuhl, auf den ich mich setze, ein glühend heißer Ofen, mein Bett gleicht zermahlenem Glas, und sogar beim Gehen, vom Scheitel bis in meinen großen Zeh, habe ich das Gefühl, ich würde brennen … »Es ist die Erinnerung«, sagen die Ärzte. »Von den Kriegsverletzungen haben Sie sich erholt, es ist die Erinnerung, die Sie in den Schmerzen gefangen hält. Lernen Sie vergessen, und es wird Ihnen wieder gut gehen.«
Doch wenn ich, wie sie sagen, eine Erinnerung habe, so ist sie im Innersten der Erde vergraben, denn tatsächlich habe ich Mühe, mich von einem Tag zum nächsten zu erinnern.
Die »Inserate« und »Befragungen« nahmen ein ganzes Jahr in Anspruch. Noch heute kann ich die lange Reihe junger Männer sehen, die zu mir gekommen waren, um sich für eine Stellung zu bewerben, die niemand konnte haben wollen.
Der niedrigste Sklave der Welt würde es ablehnen, mich zu pflegen, selbst wenn er verhungern müsste, dachte ich einmal und schrieb es auf einen Fetzen Papier aus dem Hauptbuch.
Eines Nachts ahnte ich schließlich, dass jemand kommen und die Stellung annehmen würde, der noch verzweifelter war als ich, und kaum hatte diese Ahnung sein Kommen angekündigt, befiel mich eine gewisse Ruhe, und ich schlief.
Im Dachgeschoss stand eine kleine Blasebalgorgel, ich pflegte zu ihr hochzusteigen, sie aufzupumpen und Volkslieder auf ihr zu spielen und sogar zu singen, doch es machte mich nur noch beklommener im Kopf, denn es ist der Zweck von Volksliedern, obwohl es niemand zugeben will, dich zum Weinen zu bringen.
Keiner der Bewerber, die dann kamen, konnte meinen Anblick ertragen, alle wandten sich ab, um zu würgen oder zu stöhnen oder, zu schwach zum Stehen, sich hinzusetzen, und baten um ein Glas Wasser. Das Dienstmädchen, das zu der Zeit bei mir angestellt war, pflegte sie einzulassen und fast ebenso schnell wieder hinauszubringen. Ein Bewerber verweilte etwas länger als die anderen, und während das Mädchen an der Tür wartete, um ihn hinauszulassen, äußerte er die Befürchtung, wenn der Winter käme, würde das Haus zu skelettartig und zu dünn sein, um die großen Winde und Ozeanstürme draußen zu halten. Ich hörte kaum hin, da Kälte das Letzte war, worüber ich mir den Kopf zerbrach, und erinnerte ihn, dass es im Sommer luftig und kühl bleibt, während der Rest des Landes in drückender Hitze schmort.
Die ganze Zeit über, die Bewerber kamen und gingen, dachte ich, könnte ich nur meinen Kopf in ihren (Witwe Rances) Schoß legen, dann würden meine Stirn und mein Hirn abkühlen, meine Tränendrüsen würden funktionieren, und ich würde wieder ich selbst sein.
Mein gutes, altes Ich.
Nun zu den Bewerbern um diese Anstellung. Ich fertigte eine Liste ihrer Pflichten an, auf denselben Papierfetzen aus dem Hauptbuch, auf die ich schließlich die Geschichte meines Lebens schrieb. Sie müssten bei mir sitzen, mir ein Glas Wasser bringen, damit ich meine Tabletten schlucken konnte, gelegentlich oder sogar regelmäßig, wenn meine Füße frören, müssten sie sie reiben, und die Haut über meinem Herzen, und darauf achten, dass ich drei tüchtige Mahlzeiten täglich bekäme, selbst wenn ich überhaupt keine wollte, und schließlich müssten sie mir vorlesen, auch wenn ich zu nervös wäre, um still zu sitzen und ihnen zuzuhören. Sie würden mir vorlesen, während ich im Wohnzimmer oder wo auch immer auf- und abginge.
Ich bekam mit der Zeit eine ziemliche Übung, meine Fragen auf die Bewerber abzufeuern, während keiner von uns den anderen anschaute: »Kannst du einfache Mahlzeiten bereiten? Sagen wir, vorbereitete Suppe aufwärmen, Kaffee kochen, mir die Füße reiben, wenn ich einen Anfall habe, und die Haut über meinem Herzen, und kannst du der Witwe Rance Briefe bringen?« (Sie hatte eingewilligt, durch die Dienste eines Vermittlers meine Botschaften entgegenzunehmen.)
Jede Minute, jede Stunde dauerte eine Ewigkeit. Ich bin sechsundzwanzig, so steht es jedenfalls auf der hintersten Seite der Familienbibel, sie liegt da drüben, aufgeschlagen im Zweiten Buch Samuel, aber vielleicht meinte der Eintrag auch sechsundzwanzig Jahrtausende. Keine Medizin, kein neues Arzneimittel kann mir helfen, wenn ich in den Spiegel schaue. Welches Alter blickt mich an in diesem alten Glas, dessen Holzrahmen mit gemalter Kapuzinerkresse verziert ist? Ist es ein Mensch, ein Mann, ein verirrtes Tier, das mich da anschaut? Jemand, dem ich nie begegnete, den ich weder kannte noch traf …
Doch zurück zu den Pflichten der Bewerber. Sie lauteten, bei mir zu sitzen, mir ein Glas Wasser zu bringen und so weiter. Ich sagte das wohl alles schon, Sie sehen, wie falsch die Ärzte liegen, was meine Erinnerung betrifft.
Die Witwe Rance ist achtundzwanzig, benimmt sich aber manchmal wie eine alte, reiche Frau von sechzig. Von ihren beiden Ehemännern (das erste Mal heiratete sie mit sechzehn) starb der erste im selben Krieg, in dem auch ich gewesen bin. Ein Jahr nach seinem Tod heiratete sie erneut, seinen Bruder, und auch er zog in den Krieg und starb. Sie erzählte jedem, nun sei es genug, sie würde sich nicht wieder verheiraten. Ach ja, ich vergaß, ihre Babys sind beide gestorben, von jedem der Brüder hatte sie eines.
James Powell, der erste Bewerber, den ich anstellte, vermittelte mir deutlich den Eindruck, dass sie mich nun hasste und meine Briefe nur entgegennahm, weil ich ein Held bin, aber kommen wir zunächst einmal zu James Powell.
Ich kann ihn irgendwie vor mir sehen, wenn ich ein Auge zumache, schließe ich beide Augen, verschwindet er, dieser erste Bewerber. Dass ich mich überhaupt an ihn erinnere, mag nur daran liegen, dass er der erste war.
Ich erinnere mich auch, dass er hinter mir stand, als wollte er mir die Haare schneiden, und das machte mich nervös. Er brachte meine Eier mit Speck herein und stand hinter meinem Kopf an dem großen Kieferntisch, während ich aß. Schließlich, nach dem zweiten Tag, sagte ich: »James Powell, musst du immer hinter meinem Kopf stehen? Geh ans andere Ende des Tisches und steh mit den Händen an den Nähten deiner Hose, Kopf und Nase leicht erhoben, die Augen blicken auf … nichts! Ist das klar?«
Powell schluckte hart, vermutlich vor Wut, und sagte, dass es ihm klar wäre.
Dann begann ich, den knusprigen Speck zu essen, jedoch nur, um die Kraft zu haben, mein Leiden einen weiteren Tag zu ertragen, denn ich finde am Essen keinen Geschmack.
»Wie alt bist du, Powell?«
»Hätten Sie etwas dagegen, mich entweder bei meinem Vornamen zu nennen oder Mister zu sagen, wenn Sie mich ansprechen?«
»Selbstverständlich, Mr. Powell. Also, wie alt bist du?«
»Sechzehn Jahre, vier Monate und zwei Tage.«
»Ich habe noch nie gehört, dass jemand dieses Alters ›Mister‹ genannt wird.« Ich sagte das so leise, dass er es überhört haben mochte.
»Es ist nur fair, dir zu erzählen, James«, begann ich, doch ich konnte mich nicht erinnern, was ich ihm sagen wollte, und ich erhob mich schwankend vom Tisch. Er eilte zu mir und hielt mich unter den Achseln, und so gingen wir zu einem langen Sofa, wo ich aus seinen Armen auf das Polster glitt.
Mein »Anfall« hatte die tägliche Routine nach dem Frühstück gestört – er hätte einen Brief, den ich schreiben wollte, zur Witwe bringen müssen –, mich durchrieselte jetzt das seltsame Gefühl, als würde Eis langsam in meinen Füßen und Beinen aufsteigen, wie das Schierlingsgift, von dem Sokrates’ Schüler berichten, bis hin zu meinem Herzen. Ich wollte sterben, aber ich fürchtete das Erlebnis des Todes.
Seine Hände begannen meine Füße zu reiben, und ich glaube, um ihm gerecht zu werden, in diesem Moment verstand er meinen Zustand.
Obwohl es mir ziemlich schlecht ging, dachte ich an die Verletzung seiner Gefühle, als ich gesagt hatte, niemand in seinem Alter könnte Mister genannt werden, und weil er trotz allem noch so viel jünger war als ich, fast noch ein Kind, wenn auch auf seine Art in mancher Hinsicht alt und böse, fing ich an, mich bei ihm zu entschuldigen, in etwas konfuser Reihenfolge, vermutlich um meine Gedanken von meinem möglichen Tod abzulenken, doch meine Entschuldigungen kränkten ihn nur noch mehr, er stand verwirrt auf, ging hinüber zum Schaukelstuhl und setzte sich, wobei er seine Füße so stellte, dass der Stuhl mit ihm nicht schaukeln würde.
»Alles in Ordnung, es tut mir leid, Jim. Es tut mir leid, Mr. Powell.«
Daraufhin brach er zusammen und begann zu weinen. Ich bin nicht ganz sicher, weswegen er so weinte, aber ich nehme an, wegen allem.
Die zweite Hälfte des Tages, ich sagte es schon, als wir von meinem »Anfall« unterbrochen wurden, sollte damit beginnen, dass wir ins Arbeitszimmer gehen und ich anfangen würde, der Witwe Rance einen Brief zu schreiben.
James würde Block und Bleistift nehmen (er behauptete, Stenografie zu beherrschen), und ich würde zu diktieren beginnen:
»Liebstes und einziges Mädchen«
Doch dann wusste ich nichts mehr zu sagen, und nach einem Blick auf seinen Gesichtsausdruck brach es schließlich aus mir heraus: »Jetzt hör mal, Mr. Powell, ich begreife nicht, warum du dich benimmst, als würde es dir noch schlechter gehen als mir, und so tust, als wärst du auf glühende Kohlen gebettet.«
Er blickte auf seine Hände hinunter, besonders auf seine Fingernägel, und allmählich dämmerte mir, was ihn quälte, er wollte mir nicht die Füße reiben müssen, um das Aufsteigen der Kälte bis in mein Herz aufzuhalten, das heißt, er ekelte sich davor, den menschlichen Fuß zu berühren. Gut, der Fuß ist wirklich der Nigger des menschlichen Körpers, wie mir mein Sergeant einmal draußen vor dem Zelt erklärt hatte, schlecht behandelt, übelriechend selbst bei der elegantesten Dame, in Schuhe gezwängt und unglücklich unter den Lasten, die ihm aufgebürdet sind vom Tag deiner ersten Schritte an, und er ist der erste Teil des Körpers (er dachte an die Soldaten), der stirbt.
Ich hatte nie ganz verstanden, was der Sergeant meinte, bis ich auf James Powell traf. Jetzt aber wurde mir schlagartig alles klar, nicht dass ich mich darum scherte, ich meine, mein kommender Tod war mir egal, es war die schreckliche Tatsache, dass es auf dieser Welt keine Freude gibt, wohlgemerkt, ich mache keinen Menschen oder irgendwelche Umstände dafür verantwortlich, nur, was mich plötzlich beschäftigte, war, hatte irgendjemand auf dieser Welt Freude gekannt, wirkliche Freude? James Powell jedenfalls nicht, ich wusste es, ich musste ihn nicht fragen.
Ich hatte begonnen, meinen Brief an die Witwe Rance zu diktieren. James’ lange, ungeschnittene Fingernägel verursachten Geräusche auf dem gelblich linierten Papier:
Liebe Witwe Rance, alles, was ich zu sagen meinte, als Du mir die letzte Unterredung gewährtest, ist, dass ich Dir keineswegs nachspioniere, wenn ich so rücksichtsvoll verborgen hinter den Stockrosen stehe, die, wie ich auch weiß, auf einem anderen Besitz als dem Deinen wachsen. Ich stehe halb verborgen hinter diesen hohen, schlanken Pflanzen, um Dich davor zu bewahren, entsetzt und / oder erschrocken zu sein über meinen seit unserer Schulzeit veränderten Anblick, weil ich weiß, dass meine Erscheinung bei Dir Verwirrung auslöst, zumindest informiert mich James oder Mr. Powell dahingehend, dass Du unglücklich bist, wenn ich auftauche, ob hinter oder vor den Stockrosen …
»Halt!«, rief der erste Bewerber. »Halt, hören Sie? Sie machen sich lustig über mich … So etwas habe ich Ihnen nie von der Witwe Rance berichtet.«
Ich schaute ihn verblüfft an, weil es stimmte, ich verachtete ihn, und im Grunde meines Herzens machte ich mich wohl lustig über ihn. Wir kamen einfach nicht miteinander aus.
»Und diese Briefe«, schrie er und warf seinen Bleistift auf den Boden. »Begreifen Sie nicht, die Witwe Rance kann damit nichts anfangen. Sie will nie wieder von Ihnen hören. Sie hasst Ihre Briefe.«
Verstört von dem, was er gesagt hatte, sank ich zurück auf meinen Stuhl.
Nebenbei bemerkt, mein Name ist Garnet Montrose. Das ist ein Name, bei dem die Leute ins Stottern geraten, ein Umstand, den ich schon in der ersten Klasse bemerkte und bei Schulbällen (ich war ein großartiger Tänzer, ich denke, das war eine Sache, die ich wirklich gut machte, tanzen, ich konnte den ganzen Tag oder die ganze Nacht zu Kingdom Come tanzen, die Zeit vor meiner Einberufung lebte ich gewissermaßen in Tanzsälen, unter den sich ständig bewegenden Lichtern über mir, wissen Sie, diese kleinen blinkenden Farbtupfer, und der junge kleine Busen des Mädchens drückte gegen meinen Brustkorb, nun, wenn ich daran denke, habe ich vielleicht doch so etwas wie Freude gekannt, aber mich bekümmerte damals wie auch heute, dass ich nicht weiß, was ich anfangen soll mit dem Rest meines Lebens). Wenn die Leute meinen Namen hören, finden sie, der erste passe nicht zum zweiten, er klinge wie ein Mädchenname, und der zweite sei ihnen zu historisch, wie gesagt, sie kommen ins Stottern. Am häufigsten geschah das beim Militär, wenn sie mich nicht einfach bei meinen beiden Spitznamen riefen, welche mich, um die Wahrheit zu sagen, immer verwirrt haben, einer war Granit, der andere Grantig, und anfangs pflegten sie Witze und Wortspiele um den ersten Spitznamen zu machen und sagten »Pass bloß auf, Soldat, dass sie nicht meint, du wärst aus Stein!« Heute jedoch, wo ich wieder zu Hause bin, will ich bei meinen richtigen Namen genannt werden. Tatsächlich nennt mich aber niemand irgendwie, nun mögen Sie einwenden, dass mich ja niemand zu Gesicht bekommt, geschweige denn erkennen kann, um mich beim Namen zu nennen. Denn ich bin noch verschwommener als der Nebel und, das kommt nicht nur mir so vor, so wenig greifbar wie die Nacht.
Und dann begann Mr. Powell, mich zu beschimpfen, er schrie, ich sei ignorant, eingebildet, ein verblödeter Plantagenbesitzer und so weiter und so fort, dann floh er aus dem Haus, als stünde es in Flammen, und mir war klar, dass ich ihn nicht wiedersehen würde und aufs Neue überall Anzeigen schalten müsste auf der langen, ermüdenden Suche nach einer Krankenschwester, einem Leibwächter oder wem auch immer, der sich um jemanden zu kümmern hätte, der gar nicht mehr im Reich der Lebenden sein wollte. Wo würde ich ihn finden, sagen Sie es mir.
Als ich mich beruhigt hatte, sah ich den Stapel meiner Briefe an die Witwe Rance durch, Briefe, deren verblasste Kopien ich aufbewahrte. Ich hatte, vielleicht sogar von Mr. Powell, aus zweiter Hand gehört, dass der Methodistenpfarrer die Witwe besucht und zu ihr gesagt hätte: »Lassen Sie sich ruhig Briefe von ihm schicken, er bedeutet für Sie kein Übel.«





























