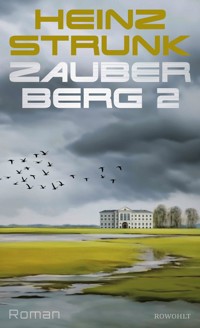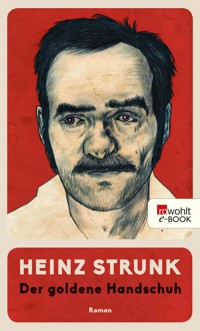
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieser phantastisch düstere, grell komische und unendlich traurige Roman ist der erste des Autors, der ohne autobiographische Züge auskommt. Ein Strunk-Buch ist es trotzdem ganz und gar. Sein schrecklicher Held heißt Fritz Honka – für in den siebziger Jahren aufgewachsene Deutsche der schwarze Mann ihrer Kindheit, ein Frauenmörder aus der untersten Unterschicht, der 1976 in einem spektakulären Prozess schaurige Berühmtheit erlangte. Honka, ein Würstchen, wie es im Buche steht, geistig und körperlich gezeichnet durch eine grausame Jugend voller Missbrauch und Gewalt, nahm seine Opfer aus der Hamburger Absturzkneipe «Zum Goldenen Handschuh» mit. Strunks Roman taucht tief ein in die infernalische Nachtwelt von Kiez, Kneipe, Abbruchquartier, deren Bewohnern das mitleidlose Leben alles Menschliche zu rauben droht. Mit erzählerischem Furor, historischer Genauigkeit und ungeheurem Mitgefühl zeichnet er das Bild einer Welt, in der nicht nur der Täter gerichtsnotorisch war, sondern auch alle seine unglücklichen Opfer. Immer wieder unternimmt der Roman indes Ausflüge in die oberen Etagen der Gesellschaft, zu den Angehörigen einer hanseatischen Reederdynastie mit Sitz in den Elbvororten, wo das Geld wohnt, die Menschlichkeit aber auch nicht unbedingt. Am Ende treffen sich Arm und Reich in der Vierundzwanzigstundenkaschemme am Hamburger Berg, zwischen Alkohol, Sex, Elend und Verbrechen: Menschen allesamt, bis zur letzten Stunde geschlagen mit dem Wunsch nach Glück. Jetzt im Kino, verfilmt von Fatih Akin
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 318
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Heinz Strunk
Der goldene Handschuh
Roman
Über dieses Buch
Dieser phantastisch düstere, grell komische und unendlich traurige Roman ist der erste des Autors, der ohne autobiographische Züge auskommt. Ein Strunk-Buch ist es trotzdem ganz und gar. Sein schrecklicher Held heißt Fritz Honka – für in den siebziger Jahren aufgewachsene Deutsche der schwarze Mann ihrer Kindheit, ein Frauenmörder aus der untersten Unterschicht, der 1976 in einem spektakulären Prozess schaurige Berühmtheit erlangte. Honka, ein Würstchen, wie es im Buche steht, geistig und körperlich gezeichnet durch eine grausame Jugend voller Missbrauch und Gewalt, nahm seine Opfer aus der Hamburger Absturzkneipe «Zum Goldenen Handschuh» mit.
Strunks Roman taucht tief ein in die infernalische Nachtwelt von Kiez, Kneipe, Abbruchquartier, deren Bewohnern das mitleidlose Leben alles Menschliche zu rauben droht. Mit erzählerischem Furor, historischer Genauigkeit und ungeheurem Mitgefühl zeichnet er das Bild einer Welt, in der nicht nur der Täter gerichtsnotorisch war, sondern auch alle seine unglücklichen Opfer. Immer wieder unternimmt der Roman indes Ausflüge in die oberen Etagen der Gesellschaft, zu den Angehörigen einer hanseatischen Reederdynastie mit Sitz in den Elbvororten, wo das Geld wohnt, die Menschlichkeit aber auch nicht unbedingt. Am Ende treffen sich Arm und Reich in der Vierundzwanzigstundenkaschemme am Hamburger Berg, zwischen Alkohol, Sex, Elend und Verbrechen: Menschen allesamt, bis zur letzten Stunde geschlagen mit dem Wunsch nach Glück.
Vita
Der Schriftsteller, Musiker und Schauspieler Heinz Strunk wurde 1962 in Bevensen geboren. Seit seinem ersten Roman Fleisch ist mein Gemüse hat er elf weitere Bücher veröffentlicht. Der goldene Handschuh stand monatelang auf der Bestsellerliste; die Verfilmung durch Fatih Akin lief im Wettbewerb der Berlinale. 2016 wurde der Autor mit dem Wilhelm-Raabe-Preis geehrt. MIt seinen Romanen Es ist immer so schön mit dir und Ein Sommer in Niendorf war er zwei Jahre in Folge für den Deutschen Buchpreis nominiert.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, März 2016
Copyright © 2016 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Covergestaltung ANZINGER WÜSCHNER RASP, München
Coverabbildung Umschlagabbildung: Dave Decat
ISBN 978-3-644-05081-5
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Dank an Sascha Nürnberg.
Dank an Yorck Niclas Prehm.
Dank außerdem an das Staatsarchiv Hamburg, das mir die bis dato unter Verschluss befindlichen Akten zum Fall Honka zugänglich gemacht hat.
«Wie lange aber, so frage ich, hält das ein Mensch aus, der trotz allem sein Herz und sein Gewissen nicht verloren hat? (…) Warum muß es überhaupt Menschen geben, die so sind? (…) Lieber Gott, was haben sie vor ihrer Geburt verbrochen? (…) Das Furchtbare, was geschehen ist, und das können Sie mir glauben, das kam nicht von meiner Seele. Nein, aus der Seele nicht! Denn sie ist nicht mit mir groß geworden. Sie ist mit mir klein geblieben. (…) Und dann stirbt auch die kleine Seele, die von Schmerzen verkrümmte Seele. (…) Sie hat einen aussichtslosen Kampf gekämpft, von Anfang an. (…) In meinem ganzen Leben war ich nie auch nur eine Sekunde ungetrübt froh oder glücklich! Weil ich immer wußte wie ich war und selbst nie dagegen ankam! Ich konnte mich selbst nicht verstehen – wußte doch genau, daß es bis zum bitteren Ende weitergehen würde, daß es niemals ein Zurück von meinem Trieb geben würde. (…) Ich sehe mich wieder als Jungen vor dem Altar und habe die gleichen Gedanken, die gleichen Wünsche wie damals: Junge sein, Junge bleiben, viele echte Freunde haben, ein kleiner ‹Freund aller Welt›, wie Kipling es genannt hat.»
Jürgen Bartsch
Ganz in der Nähe der Zeißstraße befindet sich eine aufgegebene Schokoladenfabrik. Am 2.11.1971 gegen 14 Uhr harkt dort im Hof der Hausmeister Herr Engel vor einem leeren Holzfass Laub. In einer Ecke stehen, Platte auf Platte, zwei Tische übereinander. Bei den Tischen lagern mehrere Pappkartons, ohne Inhalt und teilweise verrottet. Unter den Kartons kommt, zwischen Laub und lockerer Erde, ein Kopf zum Vorschein. Nachdem Engel noch eine Hand ausmacht, ruft er die Polizei.
Um 14.30 erhält Funkstreifenwagen Peter 23 den Befehl, in die Gaußstraße, Baustelle, zu kommen. Die Mordkommission erscheint wenig später am Fundort. Fundort im engeren Sinne ist eine Gerümpelecke an der südlichen Stirnseite der Wellblechgarage. Neben einem großen Weinfass liegen unmittelbar am Begrenzungszaun des Grundstücks die bereits stark verwesten Leichenteile. Man kann deutlich eine Hand, einen Schädel und Knochenteile, vermutlich vom Oberschenkel, erkennen. Es handelt sich um sechs in Zeitungspapier (letzte festgestellte Ausgabe: Bildzeitung vom 4.11.1970), zum Teil auch in Plastikmaterial eingewickelte Körperteile einer Frau, den Kopf, den linken Oberschenkel mit anhängendem Teil des Unterschenkels, den rechten Arm, mit freiliegender Gelenkkugel des Oberarmknochens, den linken Arm, den rechten Fuß, mit anhaftenden Teilen der Unterschenkelknochen.
Die Haut hat einen überwiegend schmutzig braunen und braungelblichen Farbton. An der Oberlippe dürfte sich zu Lebzeiten ein zarter Haarwuchs (sog. Damenbart) befunden haben. Am Schopf haften der Kopfhaut noch Reste mittel- bis dunkelblonden Haares an; wie es aussieht, wurde es auf eine grobe und nachlässige Weise bis auf eine Länge von etwa drei cm abgeschnitten. Auf jeden Fall besteht der Eindruck, dass der Zustand des Kopfhaares nicht einer besonderen Frisur entspricht. Die Liegezeit der Leichenteile wird auf etwa ein Jahr geschätzt. Fundort ist vermutlich nicht Ort des Todeseintritts.
Es war möglich, von dem rechten Kleinfinger einen Abdruck zu nehmen. Beim Vergleich mit den in der hiesigen Zehnfingerabdrucksammlung einliegenden Fingerabdrücken wurde festgestellt, dass er identisch ist mit dem Fingerabdruck des rechten Kleinfingers der wegen Diebstahls erkennungsdienstlich behandelten Elisabeth Gertraud Bräuer. Frau Bräuer war zur Todeszeit 42 Jahre alt. Sie war 1,75 groß und von schlanker Statur. Nach dem Tode ihres Verlobten führte sie ein unstetes Leben. Sie bevorzugte Männer mit eigener Wohnung, bei denen sie dann eine gewisse Zeit wohnte und ihnen den Haushalt führte.
Zunächst dringend tatverdächtig war der Arbeiter Winfried Schuldig, in dessen Strafsache Körperverletzung mit Todesfolge Frau Bräuer die Hauptbelastungszeugin war. Anlässlich eines Streits zwischen Herrn Schuldig und Herrn Stern kam es am 19.1.1970 zu Streitigkeiten, in deren Verlauf Schuldig, so nach der Aussage der anwesenden Bräuer, den Stern mit einer Sessellehne mehrfach auf den Kopf geschlagen haben soll. Am nächsten Morgen war Stern tot.
Schuldig wurde mehrere Tage lang observiert.
15.45. Zielperson geht zur Post. Dort zahlt er 200 DM ein. In der Post randaliert er und singt unflätige Lieder.
16.31. ZP ist stark angetrunken und spricht Menschen auf der Straße an (Zigarette, Feuer, usw.).
16.44. ZP steigt nebst Begleitung in den Bus 114, Fahrtrichtung Lattenkamp. Während der Fahrt benimmt sich ZP sehr auffällig. Er schreit unter anderem Folgendes: «Ich habe geweint und gelacht und den Nutten an den Arsch gefasst». Im Bus zeigt er den Fahrgästen mehrere Hundertmarkscheine.
17.32. ZP und seine Begleitung betreten den Imbiss «Rietz». ZP ist stark angetrunken, er torkelt erheblich und grölt auf der Straße. Beide Personen bestellen sich im Imbiss je ein halbes Hähnchen. Als diese serviert werden, kann die Rechnung nicht beglichen werden.
17.59. ZP verlässt zusammen mit der Frau den Imbiss, ohne etwas verzehrt zu haben. Vor dem Geschäft kommt es zu tätlichen Streitigkeiten zwischen beiden Personen. ZP schlägt der Frau mehrfach ins Gesicht. ZP versucht jetzt eine Taxe anzuhalten und fortzufahren. Es gelingt jedoch nicht.
18.06. Die Frau hat sich von ihm getrennt und ist in die Gaststätte «53» gegangen. ZP versucht mehrfach in das Lokal zu gelangen, wird jedoch immer wieder abgewiesen.
18.45. ZP geht zu Fuß in Richtung Hbf. Auf dem Bahnsteig der U-Bahn Richtung Ochsenzoll kommt es zu einer lautstarken Auseinandersetzung mit Jugendlichen. ZP droht den jungen Leuten Schläge an und entledigt sich dabei seines Mantels und seiner Jacke.
18.57. ZP steigt in den Bus Linie 114 und fährt durch bis zur Endstation Weg beim Jäger/Sportallee. 20.30 erfolgte Ablösung vor dem Haus der ZP.
Unmittelbar vor der Hauptverhandlung war Frau Bräuer unauffindbar. Der Prozess gegen Schuldig wurde dann in ihrer Abwesenheit geführt. Als Zeugin sagt u.a. Anneliese Sawatzki aus:
«Im März 1970 war ich hier in Hamburg in einem Müttergenesungsheim. Zu dieser Zeit habe ich Herrn Schuldig kennengelernt. Von der Heimleitung hatten wir Ausgang bekommen. Ich bin dann häufig in das Lokal ‹Rode› in Groß Borstel gegangen. Hier habe ich mit Herrn Schuldig ordentlich geschluckt, nachdem er mir tüchtig eingeschenkt hatte. Nachdem wir bereits erheblich angeschäkert waren, bot er mir an, dass ich mit meiner Tochter bei ihm wohnen könne. Ich ging mit ihm nach Hause in sein Gartenhaus. Zum GV ist es nicht gekommen, weil ich noch unter den Auswirkungen der Geburt stand. Ich weiß noch, dass wir in seinem Gartenhaus weiter getrunken haben. Weil ich diese Nacht nicht im Heim gewesen bin, wurde ich in das Frauenaufnahmeheim Mundsburg gebracht. Dort gefiel es mir aber nicht, weil in diesem Heim das letzte Volk verkehrte. Ich zog nun ganz zu Herrn Schuldig. Ich vertrug mich zu dieser Zeit gut mit Herrn Schuldig. Nur wenn er blau war, schlug er mich mit einer Latte, so dass ich am ganzen Körper blaue Stellen hatte. Bei der Latte handelte es sich um eine Sessellehne. Ich meine, es war die gleiche Sessellehne, mit der Herr Schuldig Herrn Stern erschlagen hat. Er äußerte mir gegenüber, dass er wegen dieser Sache keine Ruhe finden könne. Wenn wir von der Tat sprachen, fing er jedes Mal an zu weinen. In der Folgezeit kam es immer wieder vor, dass Herr Schuldig mich, wenn er betrunken war, vermöbelte. Wenn ich Geld bekam, musste ich es zum größten Teil sofort bei ihm abliefern. Am Freitag (Zahltag) stand er meistens vor dem Tor der Firma, in der ich beschäftigt bin, und verlangte von mir das Geld mit den Worten ‹Alte, gib die Kohle her›. Weil ich Angst hatte, gab ich ihm das Geld.
Zu seinem sexuellen Verhalten mir gegenüber kann ich sagen, dass er sich sehr brutal benahm. Er verlangte von mir den Mund- und Afterverkehr. Dazu ist es nicht gekommen, weil ich so etwas nicht mitmachen wollte. Auch sollte ich an Gruppensex teilnehmen. Hier habe ich mich auch verweigert. Am 10.11.1971 saßen wir in unserem Gartenhaus. Herr Schuldig hatte eine Flasche Whiskey aufgemacht. Nachdem der Whiskey alle war, meinte er: ‹Nun wollen wir alle lustig sein.› Plötzlich verzerrten sich seine Gesichtszüge und er holte den Ochsenziemer aus einer Ecke. Er schlug sofort zweimal mit aller Kraft auf mich ein. Die Schläge trafen mich beide am Kopf. Die Kopfhaut platzte, und ich blutete stark aus dieser Wunde. Er riss mir die Kleidung vom Körper, bis ich nackt war. Anschießend schlug er weiter auf mich ein. Er kniete über mir und drückte mir die Knie in den Magen. Er rief immer: ‹Du alte Sau, dich soll keiner mehr haben, ich mach dich jetzt fertig.› Ich wehrte mich mit letzter Kraft und konnte mich aus seinem Würgegriff befreien. Daraufhin beruhigte er sich wieder. Er sagte zu mir: ‹So, du alte Sau, verschwinde.›
Die Vernehmung wird abgebrochen, da die Zeugin völlig erschöpft ist und nicht mehr folgen kann. Die Vernehmung wird morgen fortgesetzt.»
Da man Schuldig die Tat nicht nachweisen kann, wird er aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Aber wer sonst soll Gertrud Bräuer umgebracht haben?
Teil IIch lernte auf St. Pauli eine ältere Frau kennen
Drei Uhr morgens an einem eisigen Tag im Februar 1974, der kleine, schiefe Mann mit dem eingedrückten Gesicht und den riesigen Händen sitzt seit zwölf Stunden auf seinem Stammplatz an der kurzen Seite des L-förmigen Tresens und redet auf seinen Nebenmann ein.
«… Ich kannte ma eine, die hab ich geliebt. Irgendwann war sie weg, aber ich weiß, dass sie wiederkommt … die hat immer so gut gerochen, einmalig war das … dies ganze parfümierte Fleisch, da denk ich noch mein Leben dran. Der Leberfleck am Bauch und alles … aber wenn die ein so sieht wie jetzt gerade, so weit kann man ja nich wegsinken, dass einem das egal ist …»
Den Nebenmann nennen sie hier Leiche. In Wirklichkeit heißt er Helmut Berger, wie der berühmte Filmschauspieler und amtierende schönste Mann der Welt. Seine Augen sind halb geschlossen, man weiß nie genau, ob er was mitkriegt oder nicht. Er schläft mehr als er wach ist, seine Schenkel sind wundgerieben vom In-die-Hose-Pissen. Manchmal rüttelt ihn der Kellner, ob noch Leben in ihm ist. Leiche hat dreizehn Jahre gesessen, wegen Mordes, als ihn mal jemand fragte, was für einer, hat er «heimtückischer» geantwortet. Da haben alle gelacht.
Der Schiefe nuschelt weiter: «Dann hat sie gesagt, ich will dich ficken, es ist wegen deim Gesicht. Ich will es mit meiner Fotze ruinieren oder meim Arsch … guck dich doch ma um, es gibt so viele Ärsche auf der Welt wie Gesichter, die einen rund und schön, andere platt wie ’ne Briefmarke oder wie geplatzte Schottersäcke. Jeda Mensch hat ein Arsch, eigentlich komisch … ein Arsch hat jeder, ob er normal is oder verrückt … ein Verrückter hat kein andern Gedanken als jeder andre normale Mensch auch, aber bei ihn sind sie sicher im Kopf eingesperrt und komm nich raus. Der Kopf ist ganz abgeschlossen, es geht da nichts rein, der bleibt ein Leben lang mit sich allein, ein See ohne Zufluss, ein totes Meer. Rudi zum Beispiel, Rudi hatte so Gedanken, wo man als normaler Mensch gar nich mitkommt. Er hat immer gesacht, dass er den elften Finger abschneiden muss, damit die sich da oben im Himmel nich vermehren und noch Platz is für seine Oma, und keiner wusste, was er damit meint … is doch wirklich verrückt, oder? … Ich träum von eim Tag, der ein ganzes Leben wert ist. Wenn deine Zeit kommt, dann kommt sie, da helfen keine Tränen, auch du musst einmal sterben, aber jetzt lache.»
Leiche reagiert nicht. Die Augen liegen so tief in den Höhlen, dass sie fast schon darin verschwinden. Die ersten zehn Knastjahre hat er ganz gut weggesteckt, doch plötzlich kippte es, da schien ein Tag fünfzig Stunden zu haben. Leiche verging so schnell, dass man zuschauen konnte, er löste sich regelrecht auf. Gesicht und Körper fielen ein, die Haare wurden dünn und die Nägel brüchig, er verlor fast alle Zähne, das Interesse an der Welt sickerte Tropfen für Tropfen aus ihm hinaus. Dann ruinierte er sich auch noch den Magen. Mit Spiritus. Nun hat er Magengeschwüre mit Satellitengeschwüren. Würde sich das Wort «sterbliche Überreste» nicht ausschließlich auf Verstorbene beziehen, es würde auf Leiche exakt passen. So wie «Lebensmüdigkeit».
Manche sitzen zwanzig, dreißig Stunden hier. Einmal hing einer zwei Tage und Nächte bewegungslos auf seinem Hocker, der war schon tot, wegen des Schichtwechsels hat aber keiner was gemerkt. Gesunder Schlaf, dachten die Leute. In der dritten Nacht war jemand gestürzt und hatte im Fallen den Toten mitgerissen, sonst wäre es wohl erst aufgefallen, wenn ihn die Ratten angenagt hätten. Gestorben und am dritten Tage auferstanden. Legendäre Geschichte das.
Gründer, Chef, Wirt und Inhaber des Lokals «Zum goldenen Handschuh», Hamburger Berg 2, ist der viermalige deutsche und zweimalige Europameister im Leichtgewicht, Herbert Nürnberg. Herbert, der fast jeden Tag persönlich hinter dem Tresen steht, ist eine Attraktion, eine Berühmtheit, allein schon wegen ihm kommen die Leute. Er kann Verrückte, Irre und Wahnsinnige voneinander unterscheiden, einen Schreihals von einem Schläger und einen Dieb von einem Mörder. Er sieht einem an, ob er Geld in der Hosentasche hat oder einen Bellmann.
Seit 1962 hat der Handschuh rund um die Uhr geöffnet, 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag. Es gibt einen vorderen und einen hinteren Teil. Hinten sind drei Tische, vorne vier. Rechts vom Eingang steht der L-förmige Tresen. Die Toiletten sind im Keller.
Ungefähr sechzig Sheffield sind schon durch die wunden Lungen des Schiefen gegangen, seine Brust ist von den vielen Zigaretten eingesunken, dazu hat er etwa einen Liter Fako getrunken, Fanta-Korn, im Verhältnis 1:1. Jetzt hat ihn der Schmiersuff befallen, der einem den ganzen Kopf und das ganze Denken zuschmiert und zukleistert, außerdem ist er müde. Er geht nach hinten zu den Schimmligen, um eine Runde zu schlafen. Die Schimmligen heißen nicht nur so, sie sehen auch so aus. Der Schiefe hält seinen Schädel in den Händen wie eine aufgeschnittene Melone, bevor er ihn auf den Ellenbogen ablegt. Im Moment des Ablegens ist er weg. Wenn der Schlaf kommt, dann plötzlich und kurz. Er schläft nie länger als eine Stunde.
Er wacht auf, als ein Schimmliger ihm die Schuhe auszuziehen versucht. Den linken hat er schon, jetzt nestelt er an den Schuhbändern des rechten herum, er muss den Schuh nur noch abziehen. Völliger Schwachsinn, die Treter sind so schief und krumm und kaputt wie der Schiefe selbst, die kann kein anderer Mensch mehr tragen, niemals. Einmal hat ihm einer im Schlaf die Schuhe ausgezogen, reingeschissen und wieder angezogen. Um diese Uhrzeit ist prinzipiell alles möglich. Er tritt im Halbschlaf um sich und trifft den Schimmligen, der das Gleichgewicht verliert und sich beim Versuch, den Sturz abzumildern, die linke Hand an einer herumliegenden Glasscherbe aufschneidet. Johannisbeerrotes Blut läuft im Strahl heraus. Er wischt seine blutende Hand im Gesicht des Schiefen ab und verschwindet irgendwo ganz hinten. Der Schiefe rappelt sich auf und kehrt nach vorne zurück. Anstelle von Leiche sitzt da jetzt Soldaten-Norbert.
«Was willst du trinken, Fiete? Ich geb einen aus.»
Diesen Spitznamen hat der Schiefe erst vor kurzem verpasst bekommen. Er weiß nicht mehr, von wem und warum, aber er hatte noch nie einen, und es macht ihn richtig stolz. Fiete, das klingt sympathisch, pfiffig. Ein schmales Grienen huscht über seine Züge, richtig zu lächeln traut er sich nicht, wegen seines verzogenen Gesichts. Er kommt sich vor wie was Besonderes. Ein Spitzname, obwohl «Fiete» nur einer zweiter Klasse ist, bedeutet hier eine Auszeichnung und kommt einem Adelstitel gleich. Spitznamen erster Klasse: Ritzen-Schorsch. Glatzen-Dieter. Nasen-Erni, Bulgaren-Harry, Doornkaat-Willy.
«Ich hab dich was gefragt.»
Fiete würde das Angebot von Soldaten-Norbert am liebsten ausschlagen, denn als Gegenleistung muss er einem von Norberts berüchtigten Endlos-Monologen lauschen. Aber er traut sich nicht.
«Fako.»
Soldaten-Norbert heißt so, weil er bei der Waffen-SS war. Im April 45 ist er in Kriegsgefangenschaft geraten und von dort direkt in die Fremdenlegion gewechselt. Die Legion war damals personell ausgeblutet, daher rekrutierten die Werber neue Mitglieder unter den Angehörigen von Wehrmacht und Waffen-SS, denen sich so die Möglichkeit bot, den Gefangenenlagern zu entkommen. Norbert wurde von 1948 bis 1953 in Indochina eingesetzt, nach seiner Entlassung ist er nie wieder auf die Beine gekommen. Ob als Schauermann, Nachtwächter oder Hilfsarbeiter, überall ist er schnell wieder rausgeflogen, meist wegen Alkohol. Seit ein paar Wochen arbeitet er bei der Müllabfuhr. Seitdem trinkt er etwas weniger, wegen des frühen Aufstehens. Aber der Abstieg vom SS- zum Müllmann ist hart, und heute hatte er die Schnauze mal wieder gestrichen voll, und er hat sich mit einem Alustock auf den Fußknöchel gehauen, bis der dick anschwoll. Das macht er immer so, wenn er krankgeschrieben werden will. «Ich weiß, dass das Selbstverstümmelung ist, mir doch egal, und wenn ich mir das Arschloch zunähe, ist das ja wohl immer noch meine Sache.» Jetzt kann er sich mal wieder in aller Ruhe eine Woche am Stück volllaufen lassen.
«Willst du auch noch was?», fragt Herbert.
«Was?», fragt Norbert zurück.
«Das heißt nicht ‹was›, sondern ‹wie bitte›. OB DU AUCH NOCH WAS ZU TRINKEN WILLST.»
Norbert ist schwerhörig und trägt deshalb ein Hörgerät. Im Krieg ist was Lautes direkt an seinem Ohr abgefeuert worden.
«TRINKEN!!??»
Er spielt mit dem Kabel seines Hörgeräts, das seitlich am Hals herunterläuft. Herbert wollte ihn mal in «Hörgeräte-Norbert» umtaufen, aber da verstand Norbert keinen Spaß.
«TRINKEN??!!»
Wenn Herbert eins nicht abkann, dann, wenn die Leute ihm nicht zuhören. Er hat Norbert schon öfter mit Lokalverbot gedroht, was Schlimmeres kann es für den nicht geben. Allein beim Gedanken daran treten Norbert dicke, glänzende Perlen auf die Stirn. Sofort bricht bei ihm der eklige Vergewaltigerschweiß aus. Er wird nie mehr auf normalem Wege eine Frau kennenlernen, selbst an die Nutten ist kein Rankommen mehr, seitdem er mal eine aus Versehen verprügelt hat. «Aus Versehen» ist natürlich gut, war aber wirklich so. Das hatte sich rumgesprochen, und seitdem lässt ihn keine mehr ran. Not macht erfinderisch, und so drückt er sich, sooft er kann, in Fußgängerzonen, Kaufhäusern, Bahnhöfen herum, überall, wo Geschiebe und Gedränge herrscht. Herumdrücken im wahrsten Sinne des Wortes, denn er trägt keine Unterwäsche und reibt seinen steifen Schwanz durch ein kreisrundes Loch, das er in den knallgelben Friesennerz geschnitten hat, an Frauen, die er heiß findet. Es dauert immer nur Sekunden, bis ihm einer abgeht. Er malt sich dann aus, wie die Frau nach Hause kommt und ihr Mann, ihr Chef, ihre Eltern sie wegen der mit Sperma besudelten Kleidung zur Rede stellen. Mit seinem alten, ranzigen Sperma. Sehr heiß, die Vorstellung. So einer ist Norbert. Ein richtiger Sittich. Ein paar Male war er kurz davor aufzufliegen, aber dann hat er sein extradoofes Gesicht aufgesetzt, eine Mischung aus harmlos und erstaunt, das hat er wirklich drauf, harmlos und erstaunt zugleich zu kucken, sein Spezialgesicht.
Norbert schmeißt einen Groschen auf den Boden und sagt zu einer Frau, die mit ihrem Freund oder Mann oder Bekannten zufällig hierhergeraten ist:
«Guck mal, da, ein Pissgroschen. Mehr bist du nicht wert.»
Einfach so. Er legt mit einem Fünfzig-Pfennig-Stück nach.
«Ich hab’s mir überlegt. So viel bist du wert. Aber keinen Pfennig mehr.»
Der Begleiter ist einen ganzen Kopf größer als Norbert, hat ihm aber an Härte, Entschlossenheit und vor allem Nerven nichts entgegenzusetzen. Sieht man sofort, so was.
«Irgendwann war sie mal ein kleines Mädchen, eines Tages ist sie tot, doch jetzt ist sie hier.»
«Komm, wir gehen. Das ist unter unserem Niveau.»
«Ich hab’s mir noch mal anders überlegt. Nichts bist du wert, hörst du? Indischer Sand, nichts!»
Sie sehen zu, dass sie Land gewinnen. Besser so. Erst mutig, dann blutig.
Fanta-Rolf ist nach zähen Scharmützeln in die zweite Zuhälter-Garde aufgestiegen, und jetzt ist es, glaubt er, nur noch eine Frage der Zeit, bis er ganz oben mitspielt. Er träumt davon, dort mitzumischen, wo die wirklichen Geschäfte gemacht werden, wo richtig was verteilt wird, weg vom ewigen Luden-Klein-klein. Dazu braucht es einen klaren Kopf, und das heißt: keinen Tropfen Alkohol, niemals Drogen. Am liebsten trinkt er Fanta, und jetzt heißt er auch so. Er stammt aus einem kleinen Kaff im Schwarzwald; als er nach Hamburg kam, sah er aus wie eine Knalltüte. Schritt für Schritt hat er sich in einen Bilderbuch-Luden verwandelt, lange Haare, vor Kraft strotzender Gockelgang, Maßanzug, goldene Ringe, Rolex Submariner oder Day Date. Hat er sich alles abgeguckt bei den Arschlöchern, die er inzwischen rechts überholt hat, dieselben, die ihn damals, als er neu war, nach Strich und Faden verarscht hatten. Die meisten von denen sind längst wieder in der Gosse gelandet, die dummen, armen Schweine. Abschreckendes Beispiel: Samba-Eddy, heute nur noch Edgar, war mal einer der ganz Großen und hat’s vermasselt, Alkohol, Drogen, Maßlosigkeit, konnte den Hals nicht vollkriegen. Er gehörte zu den attraktivsten Männern im Milieu, die Nutten rissen sich darum, für ihn zu arbeiten, in manchen Wochen verdiente er 50000 Mark. Obwohl er aussah wie ein Fotomodell, gehörte er zur besonders gemeinen, skrupellosen und hinterhältigen Sorte. Ein brutaler Schönling mit unwiderstehlichem Sex-Appeal, erotische Anziehung in ihrer einfachsten, zwingendsten Form. Kokain brach Eddy das Genick. Aus einem unglaublich dummen Grund: Er wollte sich selbst beweisen, dass Schnee ihm nichts anhaben kann, dass sein Wille stärker ist, stärker als seine Widersacher, stärker als die Droge, stärker als alles. Doch da hatte er sich ausnahmsweise den falschen Gegner ausgesucht, denn das Koks verbrannte ihn innerhalb nur weniger Monate, machte ihn kirre, führte zu einer furchtbaren Kälte und Verwahrlosung der Gefühle, er war seinen unersättlichen Gelüsten hilflos ausgeliefert und konnte nichts dagegen machen. Jeder einzige Tag in höchster Anspannung brannte ihm das Rote aus dem Blut, saugte das Mark aus den Knochen, ließ sein Hirn verdampfen, verdunsten, versickern. Er verprügelte Huren und zwang sie anschließend, ihm die dreckigen Schuhsohlen abzulecken. Er griff sich in der Toilette des «Salambo» einen Mann und pikste ihn, das heißt, er stach ihm ein Messer in den Hintern und drehte es ganz langsam um, wie in Zeitlupe. Dann passierte die Geschichte im «Hongkong». Eddy, bis oben hin dicht, fühlte sich in seiner Koks-Paranoia von einem harmlosen Witz beleidigt, zerschlug am Tresen eine Bierflasche und stieß sie dem Scherzbold in den Nacken, das zersplitterte Glas grub sich zentimetertief ins Fleisch. Er hatte Glück, dass er zu nur zwei Jahren Haft verurteilt wurde. Aber das war’s. Jetzt haust er in einer winzigen Wohnung am Hamburger Berg und wartet. Überall an den Wänden hängen Fotos, Zeitungsausschnitte mit den Gesichtern seiner Feinde, den wirklichen und den nur vermuteten, damit er sie bloß nicht vergisst. Die, von denen er keine Fotos hat, hat er aus dem Gedächtnis mit Filzer an die Tapete gekrakelt, die Namen stehen kaum leserlich darunter. Die Stunden sind durchsichtig, undeutlich, rasch folgen sie aufeinander. Er hat gelebt wie ein Tier und wird einsam sterben. Bis es so weit ist, sitzt er jeden Tag im Handschuh, gibt sich mit Leuten ab, die er früher noch nicht mal verprügelt hätte, und trinkt Indianerbier.
Das würde Fanta-Rolf nicht passieren, niemals. Hochmut kommt vor dem Fall. Sei freundlich auf dem Weg nach oben, denn auf dem Weg nach unten triffst du sie wieder. Runter kommen sie alle. Oder so ähnlich. Stimmt alles. Die Kalendersprüche, Redewendungen, geflügelten Worte sind nämlich gar nicht so doof, sondern, ganz im Gegenteil, nur allzu wahr, findet er. Wenn man sich dran hält, kann nicht viel passieren, da können die Klugscheißer so viel scheißen, wie sie wollen. Fanta-Rolfs Markenzeichen ist seine weiche Sprache, in der trotzdem eine ungeheure Aggressivität mitschwingt. Da hat er richtig lange dran gefeilt. Wenn er mit diesem speziellen, sanften Timbre spricht, gedämpft und beiläufig, kracht’s gleich. Ein Riesenvorteil ist seine Nervenstärke; als hätte er keinen Puls, nichts, wie tot. So was hat man, oder man hat es nicht, wie Reaktionsgeschwindigkeit oder Schlagkraft. Die meisten scheitern nämlich nicht an den Umständen, auch nicht am Pech, sondern an den zu schwachen Nerven.
Fanta-Rolfs Leidenschaft gehört dem HSV, und sein Stolz ist ein Jaguar E-Type, Rechtslenker, original aus England. Immer dabei ist seine rechte Hand Lutz, ein pausbäckiger Gnom mit glockenförmigem Torso, Hartgeldlude, unterste Kategorie. Bevor Rolf sich seiner angenommen hat, zählte er zu den Krebsen, so nennt man die ganz armen Willis, die auf der Suche nach Opfern, die sie abziehen können, durch die Kiezlokale stromern.
Die Musikbox ist seit einer Stunde nicht mehr gefüttert worden. Wenn von den Gästen keiner was reinschmeißt, übernimmt das meist Herbert, aber der hat keine Lust heute, zu wenig los. Fiete und Norbert stoßen an, dann legt Norbert los: «Mein Kamerad Peter hatte die Beine so oft gebrochen, dass er so lange nicht mehr gehen konnte, bis ihm die Waden weggeschrumpft waren … aber obwohl da nix mehr zu machen war, durfte er nicht nach Hause … er war nur noch ein lebender Abfallhaufen, wo die Würmer und Ratten graben … um die Augen sah das aus wie ein Fleck Erde unter einem Feldstein, wo es von Asseln, Käfern und Füßlern nur so wimmelt … sie haben ihn trotzdem wieder an die Front geschickt, und dann hat es ihn gleich erwischt, schwer erwischt, sie haben ihm den Kopf weggeschossen, der hatte keinen Kopf mehr, nur noch ein Loch auf dem Hals mit Blut drin, das blubberte wie eingekochte Marmelade im Topf … der reinste Brei, man konnte nichts mehr erkennen. Alles voller Blutklümpchen … das Blut hat den Boden getränkt …»
Das geht fünf, zehn, fünfzehn Minuten so, bis er mitten im Satz verstummt und in ein gedankenloses Delirium sinkt. Die Kriegserlebnisse haben sich unauslöschlich eingebrannt, er wird von seinen Erinnerungen innerlich aufgefressen. Ein abgeschlagenes Gespenst, das sich nur noch in der eigenen Verrücktheit auskennt, in den Adern das zähe, alte, schmutzige Naziblut.
Im «Handschuh» kann man gut Frauen kennenlernen, viel besser als im «Lehmitz», im «Schlusslicht» oder im «Elbschlosskeller». Wählerisch darf Fiete nicht sein, zerprügelt, zerschunden und zermörsert wie er ist. Bei Frauen seines Alters ist er chancenlos, die bleiben unerreichbar, undurchschaubar, unberechenbar. So lange er denken kann, hatte er Ältere, richtige Omas teilweise. Ihm ist das mittlerweile egal, er würde zur Not auch eine mit Amputation nehmen oder mit drei Arschlöchern.
Mittwoch ist immer ein schwieriger Tag, nie weiß man, in welchem der Läden was los ist und wo nicht. Es hatte Mittwoch schon High Life in Tüten gegeben, manchmal bleibt es aber gähnend leer, und niemand weiß, warum, selbst Herbert nicht, der sonst immer alles weiß. Fiete geht’s nicht gut, ihm ist elend zumute, er fühlt sich einsam. In der Musiktruhe läuft «Es geht eine Träne auf Reisen» von Salvatore Adamo, Fietes Lieblingslied.
Es geht eine Träne auf Reisen,
Sie geht auf die Reise zu mir.
Der Wind bringt sie mir mit den Wolken,
Und ich weiß, sie kommt nur von Dir.
Die Frau, die reinkommt, zittert vor Kälte und ist ziemlich klein. Wie dreckiger Rasierschaum ergießt sich graues, dünnes Haar über die Rückseite ihres eulenartigen Schädels. Die Kopfhaut ist an mehreren Stellen kahl. Sie steht da wie abgeschaltet, den Blick ins Leere gerichtet, vereist und ausdruckslos. Sie könnte fünfzig sein oder siebzig. Wie Soldaten-Norbert hat sie auch diesen eigentümlichen Gesichtsausdruck der Kriegsgeneration: uralt. Ein unbestimmbares, vorsintflutliches Alter. Unter ihrem Mantel trägt sie nichts als einen Kittel, einen schrecklichen, blauen Putzfrauenkittel. Je länger man sie anschaut, desto furchtbarer sieht sie aus, gerade wenn man Alkohol getrunken hat, so herum geht’s nämlich auch. Man vermag sich schon nicht mehr vorzustellen, wie die früher mal ausgesehen hat, als Frau.
Fiete gibt Anus ein Zeichen. Anus heißt eigentlich Arno, wird aber Anus genannt, dann lachen alle. Er weiß nicht, was das heißt, und lacht mit. Fiete möchte, dass Anus der Frau was zu trinken bringt. Geld, um sich selbst was zu kaufen, hat sie keins, indischer Sand, so was sieht Fiete. OFW, ohne festen Wohnsitz, eine Randständige. Wenn sie nichts trinkt, muss sie gehen, auch im Goldenen, und draußen herrschen Minusgrade. Das mit dem Ausgeben ist Fietes Taktik. Anus steckt den Frauen, von wem das Getränk ist, und die kommen angeschoben, «Danke» sagen.
«Ich heiß Gerda und wollt mich bedanken. Wer bist du denn?»
«Fiete.»
«Ach so.»
«Prost.»
«Wohl sein.»
Gerdas eingefallener Mund arbeitet gegen die Speichelflut. Eine Säberalma. Die heißen so, weil sie ihren Speichelfluss nicht mehr unter Kontrolle haben. Der Alkohol hat das Hirn zerfressen, die Nerven zerstört, und irgendwann rinnt ihnen dann der Speichel aus den Mundwinkeln. Erna, Inge, Herta, Ilse. Die anderen Almas, auch wenn sie noch so abgerissen sind, benutzen noch irgendwas, Lippenstift, Lidschatten, Rouge. Gerda nicht. In der Musikbox läuft «Du sollst nicht weinen» von Heintje.
Du sollst nicht weinen,
Wenn ich einmal von dir gehen muss.
Oh, denk nicht dran, noch ist der Tag so weit.
Auch morgen wird die Sonne wieder scheinen
Für dich und mich, genauso schön wie heut.
Genau gerade nicht. Nichts. Nie. Fiete kratzt mit den Fingernägeln das Etikett von einer leeren Bierflasche herunter und verteilt die Papierfitzelchen vor sich auf dem Tresen.
Du sollst nicht weinen,
Weil die Jahre viel zu schnell vergehen.
Und weil dein Junge einmal groß sein wird.
Denk an die Jahre, die noch vor uns liegen.
Vergiss den Tag, der mich einst von dir führt.
Bei «Weil dein Junge einmal groß sein wird» kommen ihr die Tränen. Fiete kann sich denken, was los ist, aber er will es gar nicht wissen.
Du sollst nicht weinen,
Wenn ich einmal von dir gehen muss.
Oh, denk nicht dran, noch ist der Tag so weit.
Auch morgen wird die Sonne wieder scheinen,
Und Rosen blühn noch lang vor Deiner Tür.
Welche Rosen? Gerda weint. So ein schönes Lied. Es lässt sich nur schwer vorstellen, welche Heldenverehrung Frauen wie sie Heintje entgegenbringen. Als Fiete ihr Feuer gibt, lässt sie einen Furz. Sie trinkt noch schneller als er, das macht ihn geil, auch das noch. Wie es wohl ist, Gerda den Kittel hochzuschieben?
Dummerweise wird die Anbahnung fast von Gisela vereitelt, die wie fast jeden Tag auf ihrer Tour auch im Handschuh nach dem Rechten schaut. Nachschaut. Hereinschaut. Gisela ist Majorin bei der Heilsarmee, Talstraße 11, eine Parallelstraße, nur ein paar hundert Meter entfernt. Sie ist ein Jahr älter als Gerda, sieht aber zehn Jahre jünger aus. Oder fünfzehn. Mindestens. Was bei Gerda schiefgelaufen ist, ist bei ihr richtig gelaufen. Vielmehr anders gelaufen. Sie war eine der Letzten, die kurz vor dem Mauerbau aus der Ostzone fliehen konnten, und ist dann statt im Handschuh bei der Heilsarmee gelandet. Das hätte auch alles ganz anders werden können, denn Gisela war in ihrem vorherigen Leben Atheistin gewesen. Doch dann ist ER ihr eines Nachts erschienen. Sie sieht es seither als die ihr von Gott zugedachte Aufgabe an, sich in ihrem Revier, der nördlichen Seite der Reeperbahn, um die armen Sünder zu kümmern. Arme Sünder, so sieht sie das, wortwörtlich. Wie viele Konvertiten meint sie es mit ihrer Religion besonders ernst. Ihr Glaube ist so einfach wie unerschütterlich, denn, davon ist sie überzeugt, man kann nie tiefer fallen als in die geöffneten Hände Gottes. Ob sie schon einmal einen ihrer Sünder wirklich und dauerhaft bekehrt hat, weiß sie selber nicht, aber es gab wohl noch niemanden im Milieu, der sich an ihr gestört hätte. Sie hat so eine Art, sich den Menschen nicht aufzudrängen, sie spürt, wann sie sich dazusetzen darf, wann ihr Rat gefragt ist und wann nicht. Die Wirte heißen sie ebenfalls willkommen, schon allein deshalb, weil es keinen Stress gibt, solange sie da ist. Was sie gar nicht gerne hört, sind Formulierungen wie «Engel von St. Pauli». Viel zu viel, überkandidelt, sie verrichtet ihre Arbeit so gut es geht, nicht mehr und nicht weniger.
Als Fiete zum allerersten Mal im Handschuh war, hat er Gisela, die ausnahmsweise mal keine Uniform trug, angemacht. Nachdem sie den obligatorischen Fako verschmähte, hatte Fiete, sturzbetrunken, etwas ziemlich Unflätiges zu ihr gesagt. Das war selbst für Gisela zu viel, und sie musste sich sehr zusammenreißen. Das war dann auch das letzte Mal, dass sie ohne Uniform unterwegs war. Später hat er sich bei ihr entschuldigt, das hat Gisela ihm hoch angerechnet.
Sie schaut sich um. Fiete zieht den Kopf ein und versucht sich noch kleiner zu machen, als er ohnehin schon ist mit seinen ein Meter achtundsechzig. Es ist ihm vor Gisela peinlich, gemeinsam mit so einem Gespenst, das dann doch noch. Gisela weiß natürlich Bescheid, wenn sie eines weiß, dann das. Herbert stellt ihr einen Kaffee hin, sie halten wie immer einen kurzen Plausch, danach geht sie nach hinten zu den Schimmligen. Ein Glück, denkt Fiete, sie hat mich nicht gesehen. Das stimmt natürlich nicht, Gisela sieht immer alles, aber sie hat so getan, als ob nicht.
Ewig wird die nicht hinten bleiben, wird Zeit zu gehen. Er fragt Gerda, ob sie mit zu ihm nach Hause kommt. Die scheint nur darauf gewartet zu haben und willigt sofort ein. Sie soll schon mal rausgehen und warten, Reeperbahn rechts runter, fünfzig Meter, er käme in zehn Minuten nach. Gerda krabbelt umständlich vom Hocker, nimmt ihren Beutel und schlurft nach draußen. Ihm ist das auch Herbert und sogar Anus gegenüber peinlich, mit so einer gemeinsam zu verschwinden. Fiete findet noch eine Mark sechzig in der Hosentasche und bestellt zwei doppelte Korn. Auf einmal. Verblendschnäpse. Draußen ist es bitterkalt, aber die Alma, Namen hat er schon wieder vergessen, wird bestimmt auf ihn warten. Wo soll die auch großartig hin. Die hat nur den dünnen Mantel und den Kittel. Aber wenn sie mitwill, muss sie das abkönnen.
Eisiger Wind, das hält kein Mensch lange aus. Zu Fuß nach Hause sind’s zweieinhalb Kilometer, halbe Stunde. Mit der Alma dauert es bestimmt doppelt so lange. Wo ist die überhaupt abgeblieben? Weg? Die kann doch nicht einfach abhauen, so eine haut doch nicht mehr ab. Er sucht und sucht und sucht, und schließlich, einen Steinwurf weiter, entdeckt er sie in der Nähe einer Wurstbude, wenn der Wind günstig steht, weht ab und an eine schöne warme Bratwurstbrise rüber.
Gerda kann nicht mehr. Sie kann wirklich nicht mehr. Fiete ist sauer, weil sie nicht am verabredeten Ort gewartet hat, aber jetzt hat zur Abwechslung mal Gerda die Nase voll. Eine Art Restwut, die sich jedes Lebewesen bewahrt, für Notfälle. Fiete kriegt sich wieder ein, und sie ziehen los.
Auf dem Weg sprechen sie kein Wort miteinander. Er kommt auch nicht auf die Idee, ihren Beutel zu tragen; es ist nicht böse oder unhöflich gemeint, er kommt einfach nicht auf den Gedanken. Gerdas Arme fühlen sich an, als wollten sie aus den Gelenken springen. Sie wechselt alle paar Sekunden die Last vom rechten zum linken Arm. Es gibt keine Löcher mehr, auf denen sie pfeifen könnte, noch nicht mal das letzte. Ihre Lippen sind ausgetrocknet, gelber Speichel klebt am Mundwinkel. Seidenweicher Regen setzt ein, aus dünnsten Fäden, tropfenloser Sprühregen. Bald sieht sie aus wie eine gebadete Maus. Zweimal legt sie sich hin. Jetzt verzögert sich der Heimweg noch mehr! Er hat Angst, dass er selber nicht mehr hochkommt, wenn er ihr aufhilft. Die sieht aus wie ein Käfer. Ein Mistkäfer, ein Schädling. Langsam wird es hell. Sie gehen im dünnen, blassen Morgenlicht, durch Altona, vorbei an kaputten Motorrädern, kaputten Fahrrädern, kaputten Leitungen. Eigentlich ist alles kaputt. Vorbei an schmutzigen, zerfressenen, abblätternden Außenwänden, zersplitterten Fensterscheiben, vor sich hin rostenden Emailschildern, bröckelnden Farben, unverputzten Mauern, bis sie die Zeißstraße 74 erreicht haben. Fietes Wohnung liegt im dritten Stock, Dachgeschoss.
Hier stinkt’s ja vielleicht. So was hat Gerda noch nie gerochen, und sie hat schon einiges gerochen. Der Dunst feuchter, vor sich hin modernder Teppiche, abgestandener Pisse, von Dreck, der aus der Luft rieselt, toten Tieren, Ratten, Mäusen, Vögeln, da muss auf jeden Fall irgendwas Totes dabei sein. Fiete, der sich schon wieder stocknüchtern fühlt, schenkt zwei Wassergläser Fako ein und geht erst mal pissen. Toilette ist auf dem Gang. Gerda schaut sich um. Die Wohnung ist sehr klein, 18 Quadratmeter, zwei Zimmer, die