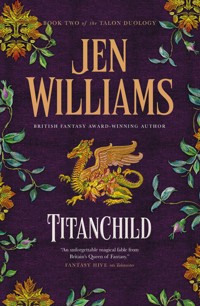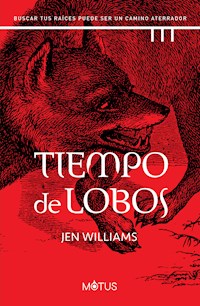9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Er reißt ihnen das Herz heraus. Er vergräbt es im Wald. Dann pflanzt er Blumen. Eine junge Frau findet nach dem Suizid ihrer Mutter in deren Nachlass unzählige Briefe eines seit vielen Jahren verurteilten Serienkillers. Der erste Thriller der preisgekrönten englischen Autorin Jen Williams Als Heather Evans den Nachlass ihrer Mutter ordnet, macht sie eine erstaunliche Entdeckung: Stapelweise findet sie Briefe eines verurteilten Serienkillers. Michael Reave hatte zahlreiche junge Frauen auf bestialische Weise getötet. Seit 20 Jahren verbüßt er nun schon seine Strafe in einem Hochsicherheitsgefängnis. Doch jetzt ist wieder eine junge Frau getötet worden. Man findet sie in einem ausgehöhlten Baumstumpf. Und dort, wo eigentlich ihr Herz schlagen sollte, stecken Blumen. Genauso hatte es seinerzeit Reave zelebriert. Als eine zweite Frauenleiche gefunden wird, entschließen sich Heather und Detective Ben Parker zu einem gefährlichen Schritt. Heather soll mit Michael Reave persönlich sprechen, ihm die Fragen stellen, die nur er beantworten kann. Doch die Wahrheit wird für Heather zu einem Wettlauf um ihr Leben. Gruselig wie die fantastischen Märchenwelten der Brüder Grimm und totale Spannung bis zur letzten Seite – der erste Thriller der preisgekrönten Autorin Jen Williams. »Ein Meisterwerk!« The Times
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 483
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Jen Williams
Der Herzgräber
Thriller
Über dieses Buch
Als Heather Evans nach dem Suizid ihrer Mutter deren Nachlass ordnet, findet sie stapelweise Briefe des verurteilten Serienkillers Michael Reave. Er hatte vor 20 Jahren zahlreiche junge Frauen auf bestialische Weise getötet. Seither verbüßt er seine Strafe in einem Hochsicherheitsgefängnis.
Doch jetzt werden wieder junge Frauen getötet. Auf die gleiche Weise wie damals. Die erste Leiche findet man in einem ausgehöhlten Baumstumpf. Und dort, wo eigentlich das Herz schlagen sollte, stecken Blumen. Genauso hatte es seinerzeit Reave zelebriert.
Heather muss mit Michael Reave persönlich sprechen, ihm die Fragen stellen, die nur er beantworten kann. Warum beging ihre Mutter Selbstmord? Was weiß Reave über sie? Heather ahnt nicht, wie gefährlich die Wahrheit sein kann und wie nah sie dem Tod ist.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Jen Williams lebt mit ihrem Partner und einer unmöglichen Katze im Südwesten von London. Schon als Kind war sie fasziniert von Drachen, Hexen und gruseligen Märchen. Für ihre Bücher im Fantasy-Bereich wurde sie mehrfach ausgezeichnet. Wenn sie keine Bücher oder Beiträge für Magazine schreibt, arbeitet sie als Buchhändlerin und freiberufliche Redakteurin.
Irene Eisenhut studierte Anglistik und Germanistik. Nach einem Auslandsaufenthalt in den USA, lebt und arbeitet sie seit mehreren Jahren als freie Übersetzerin in Bonn.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die englische Originalausgabe erscheint 2021 unter dem Titel›A dark and secret Place‹ bei HarperCollins, London.
© Copyright Jennifer Williams 2021
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2022 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstraße 114, D-60596 Frankfurt am Main
Redaktion: Silke Reutler
Covergestaltung und -abbildung: © Johannes Wiebel | punchdesignunter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-491316-2
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Widmung
1. KAPITEL
2. KAPITEL
3. KAPITEL
4. KAPITEL
5. KAPITEL
6. KAPITEL
7. KAPITEL
8. KAPITEL
9. KAPITEL
10. KAPITEL
11. KAPITEL
12. KAPITEL
13. KAPITEL
14. KAPITEL
15. KAPITEL
16. KAPITEL
17. KAPITEL
18. KAPITEL
19. KAPITEL
20. KAPITEL
21. KAPITEL
22. KAPITEL
23. KAPITEL
24. KAPITEL
25. KAPITEL
26. KAPITEL
27. KAPITEL
28. KAPITEL
29. KAPITEL
30. KAPITEL
31. KAPITEL
32. KAPITEL
33. KAPITEL
34. KAPITEL
35. KAPITEL
36. KAPITEL
37. KAPITEL
38. KAPITEL
39. KAPITEL
40. KAPITEL
41. KAPITEL
42. KAPITEL
43. KAPITEL
44. KAPITEL
45. KAPITEL
46. KAPITEL
47. KAPITEL
Danksagung
Für Juliet
Die Teufelin auf meiner Schulter, die flüsterte:
Schreib ein gruseliges Buch!
1. KAPITEL
Licht fiel durch die geöffnete Tür auf das Gesicht des Jungen, und zum ersten Mal wandte er sich nicht davon ab. Seine Arme und Beine waren zu schwer, das Band um seinen Hals zu eng, zu fest. Und es war ja auch nicht so, dass ihn das Abwenden früher auch nur einmal gerettet hätte.
Die Gestalt im Licht verharrte, als würde sie die Veränderung in seinem Verhalten bemerken. Dann beugte sie sich herunter, um den Lederriemen mit groben, ruckartigen Bewegungen zu öffnen. Das Band löste sich, und die Gestalt fasste nach seinem Kopf, um ein dickes Büschel seines schwarzen Haars zu packen, dicht an der Wurzel.
Noch Jahre später würde er nicht erklären können, was in dem Moment anders gewesen war. Ausgehungert und müde, die Knochen schwer, die Haut voller Blutergüsse, hatte er geglaubt, dass er sich mit dieser Realität seines Daseins abfinden müsste. Aber als die Finger dieses Mal sein Haar verdrehten und die Nägel über seine Kopfhaut kratzten, erwachte etwas in ihm.
»Du kleine Bestie«, sagte sie geistesabwesend. Ihre Gestalt füllte die Schranktür aus, so dass kaum Licht hineindrang. »Du dreckige kleine Bestie. Du stinkst, weißt du das? Du schmutziges kleines Miststück.«
Vielleicht erkannte sie im allerletzten Augenblick, was sie in ihm geweckt hatte, denn für den Bruchteil einer Sekunde flackerte in ihr ein Gefühl auf und zuckte über ihr blasses, teigiges Gesicht. Möglicherweise hatte sie etwas in seinen Augen gesehen, einen Blick, der ihr fremd war, denn der Junge sah deutlich, wie sie panisch auf den Riemen schaute.
Doch da war es schon zu spät. Er sprang auf, den Mund weit aufgerissen, die Hände zu Krallen gespreizt. Kreischend wich sie zurück. Hinter ihr war direkt der Treppenabsatz – daran konnte er sich aus der Zeit vor dem Schrank noch dunkel erinnern – auf dem sie beide krachend landeten. Der Junge brüllte, die Frau schrie. Obwohl jener Moment des Fallens ausgesprochen kurz war, brannten sich einige Eindrücke in sein Gedächtnis ein: der Schmerz, der ihn durchzuckte, als sie ihm ein Büschel Haare aus der Schläfe riss; das gewaltige Gefühl, das ihn erfasste, als er stürzte, und der wilde Taumel, der ihn erfasste, als seine Krallen – seine Nägel – sich in ihre Haut bohrten.
Sie schlugen auf dem Boden auf. Anschließend Stille. Es schien niemand sonst im Haus zu sein. Keine lauten Stimmen, keine spitzen Finger, kein warnendes aufleuchtendes Rot. Die Frau, seine Mutter, lag unter ihm, in seltsamen Verrenkungen, ihr Hals überspannt und unverhüllt, als versuche sie, ihn zu besänftigen. Der rechte Unterarm war abgeknickt, und ein Knochen, der entsetzlich weiß unter ihrer gräulichen Haut hervorstach, zeigte zum Fenster. Der Ärmel ihres gelben Kittels hatte sich um ihn verfangen.
»Muh?«
Ein dünnes Rinnsal von Blut lief aus ihrer Nase und aus ihrem Mund, und ihre Augen – grün wie seine – blickten auf eine Stelle über seinem Kopf. Vorsichtig legte er eine Hand auf ihren Mund und ihre Nase und drückte zu, während er fasziniert beobachtete, wie die Haut sich dadurch zusammenschob und Falten warf. Er legte sein ganzes Gewicht in seinen Arm, drückte noch fester zu und spürte, wie ihre Lippen aufplatzten, als sie gegen ihre Zähne gepresst wurden und …
Er hielt inne. Er musste nach draußen.
Es war ein kalter grauer Morgen. Herbst, vermutete er. Das Licht brannte in seinen Augen, aber nicht so sehr, wie er es erwartet hatte. Sie schienen es vielmehr aufzusaugen, während er den Blick mit einem wachsenden Gefühl des Friedens über den Himmel und die trostlose Landschaft wandern ließ. Da war der Wald, in dem er früher gespielt hatte, und dessen Laub sich braun und rot färbte. Dort die Felder, deren Böden vom Regen dunkel waren. Und dort die Wirtschaftsgebäude, die sein Vater hatte verfallen lassen. Irgendwo dahinter lag eine befestigte Straße, aber der Weg bis dorthin war weit. Die Leiche seiner Mutter, die er bis auf das struppige Gras hinter sich hergezogen hatte, sah schon viel hübscher aus – hier draußen war sie etwas anderes. Er griff nach ihren Fußgelenken und zerrte sie noch weiter über den Feldweg auf den brachliegenden Acker dahinter.
»Hier.« Er öffnete den Mund, um noch mehr zu sagen, doch er konnte nicht. Das Gras, das sie wie ein Kissen umrahmte, war feucht, und er konnte das Leben darauf spüren; kleine Fliegen und Käfer, das fröhliche Interesse der Würmer. Der Junge kniete sich neben sie hin und spürte eine riesige Wut in sich aufsteigen. Sie war wie eine Landschaft, die seinen ganzen Horizont einnahm. Eine Zeitlang war er losgelöst von sich selbst und sah nichts, außer dieser roten Wut. Hörte nichts, außer tosendem Donner. Er kehrte erst wieder zu sich selbst zurück, als ihn ein höfliches Hüsteln hinter ihm zusammenschrecken ließ. Seine Arme waren bis zu den Ellenbogen mit Blut besudelt, und in seinem Mund schmeckte es nach Metall. Zwischen seinen Zähnen klebte etwas.
»Was haben wir denn hier? Wer ist denn das?«
Ein Mann stand im Gras, groß und mit breiten Schultern. Er trug einen Hut und betrachtete den Jungen mit einer Art leisen Neugier, als wäre er gerade jemandem begegnet, der einen Drachen bastelte oder mit Murmeln spielte. Der Junge verharrte. Der Mann gehörte zwar nicht zum Haus, aber das bedeutete nicht, dass der Junge ungestraft davonkommen würde. Natürlich würde er bestraft werden. Als er den Blick senkte, um zu sehen, was er mit seiner Mutter gemacht hatte, verschleierte sich seine Sicht.
»Jetzt nimm’s doch nicht so schwer!« Der Mann machte einen Schritt auf ihn zu, und der Junge bemerkte zum ersten Mal, dass der Fremde einen Hund dabeihatte. Einen riesigen schwarzen Hund mit zotteligem Fell und gelbbraunen Augen, die auf ihn gerichtet waren. Sein Atem dampfte leicht in der kühlen Morgenluft. »Weißt du, ich hatte völlig vergessen, dass die Reaves’ einen Jungen hatten, aber hier bist du. In der Tat, hier bist du.«
Der Junge öffnete den Mund und schloss ihn wieder. Die Reaves’, die Reaves’ waren seine Familie, und sie würden böse auf ihn sein.
»Und was für eine Kreatur du doch bist.« Der Junge zuckte zusammen und erinnerte sich, wie seine Mutter ihn genannt hatte. »Bestie«, »Miststück« und »Dreckskerl«, doch der Mann klang erfreut. Als der Junge aufblickte, schüttelte er sanft seinen Kopf. »Du kommst mit mir mit, mein kleiner Wolf. Mein kleiner Barghest.«
Der Hund öffnete das Maul, und eine lange rosa Zunge kam zum Vorschein. Nach einem Augenblick begann er, das Blut vom Gras zu lecken.
2. KAPITEL
Frierend, müde und nicht in der Stimmung, plumpe Freundlichkeiten auszutauschen, zwang sich Heather, höflich zu lächeln. Einen Moment später überdachte sie das noch einmal und ließ es bleiben – zu viel zu lächeln würde in einer Zeit wie dieser eher unangemessen wirken. Und außerdem war sie sich nur zu bewusst, dass sie ungefähr so willkommen war wie ein Hundehaufen in einem Schwimmbecken.
»Danke, dass Sie auf mich gewartet haben, Mr. Ramsey. Das ist sehr nett von Ihnen.«
Mr. Ramsey warf ihr einen finsteren Blick zu.
»Wenn du öfter hier gewesen wärst, hättest du vermutlich einen eigenen Schlüssel zum Haus deiner Mutter.« Er schniefte und ließ mit einem einzigen bronchialen Geräusch durchblicken, was er von Heather Evans hielt. »Deine arme Mutter. Ich … ich weiß, wie traurig das alles ist. Sehr traurig sogar. Einfach eine schreckliche Sache, das Ganze.«
»Ja, das stimmt.« Heather wiegte die Schlüssel in der Hand, während sie auf die hochragenden Bäume und die Sträucher schaute, die das Haus vor der Straße verbargen. »Lassen Sie sich von mir nicht aufhalten, Mr. Ramsey.«
Er versteifte, und die Tränensäcke unter seinen Augen nahmen einen noch dunkleren Farbton an. Heather blieb stumm, und die Stille legte sich wie ein Tuch über diesen wolkenverhangenen Morgen. Sie konnte an seinem Gesicht erkennen, dass er sich gerade fragte, ob er ihr einmal gehörig die Meinung sagen sollte. Aber schließlich drehte er sich um und ging zurück zu seinem Haus.
Heather stand noch einen Augenblick lang da, holte tief Luft und lauschte der Stille. Balesford war ein Ort mit frei stehenden, weit auseinanderliegenden Einfamilienhäusern und hohen Zäunen, mit Menschen, die sich alle gespenstig ähnlich sahen und gleich sprachen. Diese an Kent grenzende Gemeinde gehörte eigentlich noch zu London, war aber nicht mehr als ein blutleerer Ableger – keine Farbe, kein Leben.
Sie seufzte und klimperte mit den Schlüsseln in der Hand, bevor sie noch einmal tief Luft holte und zum Gartentor ging, das sich hinter den riesigen immergrünen Sträuchern verbarg. Auf der anderen Seite befand sich ein gepflegter Rasen mit leicht zugewachsenen Blumenbeeten, und ein Kiesweg führte zum Haus. Nichts an der Umgebung erschien außergewöhnlich. Und ganz bestimmt nicht ungewöhnlich. Trotzdem spürte Heather, wie ihr Magen sich zusammenzog, als sie durch den Garten ging. Das Haus wirkte nicht einladend, hatte es noch nie. Langweiliger Kieselrauputz rahmte trostlose Fenster ein und deutete auf ein Gebäude hin, das verschlossen war und für immer verschlossen bleiben würde. Auf dem Boden neben der Eingangstür, die in einem farblosen Beige gestrichen war, stand ein großer Terrakottatopf, gefüllt mit schwarzer Erde. In die glatte orangefarbene Oberfläche war ein Herz eingeritzt, seine Linie war zackig und überschnitt sich an der Spitze. Heather runzelte die Stirn – sie hätte nicht gedacht, dass ihre Mutter etwas für Rustikales übrig hatte – und warum war der Topf leer? Es passte nicht zu ihrer Mutter, etwas unfertig zu lassen … ein aberwitziger Gedanke, wenn man bedachte, wie alles zu Ende gegangen war. Einen Augenblick lang befürchtete Heather loszuheulen, genau da, auf dieser Treppenstufe. Stattdessen zwickte sie sich schnell in den Arm, und die Tränen wichen zurück. Dafür ist jetzt keine Zeit. Sie entdeckte ein paar Federn auf dem Boden, wahrscheinlich von einer Taube, verzog das Gesicht und stieß sie mit der Spitze ihres Joggingschuhs weg, während sie den richtigen Schlüssel im Bund suchte.
Als sie die Tür öffnete, rutschten Briefe und ein Haufen Werbung über den Boden. Sie trat in eine stille, verstaubte Diele. Es war später Vormittag, doch der düstere Septemberhimmel und die hohen Bäume im Garten hüllten das Haus schon in dunkle Schatten. Eilig knipste sie sämtliche Lichtschalter an, die sie sah, und blinzelte, als ein kitschiger Lampenschirm zu pastellfarbenem Leben erwachte.
Das Wohnzimmer war aufgeräumt und staubig. Nirgends eine schmutzige Tasse, kein aufgeschlagenes Buch auf dem Sofa. Ein alter roter Mantel, dessen dicke Wolle an den Ärmeln von kleinen Knötchen überzogen war, hing über der Rückenlehne eines Stuhls. Die Küche präsentierte sich in einem ähnlichen Zustand. Alles sauber und aufgeräumt. Ihre Mutter hatte selbst den Kalender auf das Septemberblatt umgeschlagen, stellte Heather fest, obwohl sie gewusst hatte, dass sie den Rest des Monats nicht mehr erleben würde.
»Was hatte das denn für einen Sinn, Mum?« Sie fuhr mit den Fingern über die glatten Seiten und bemerkte, dass in den kleinen Kästchen nichts stand. Keine Notizen wie: Milch abbestellen/mich umbringen.
Heather stieg die Treppe hinauf, die Schritte gedämpft durch den Teppich. Das Schlafzimmer war genauso adrett wie der Rest des Hauses. Der Frisiertisch ihrer Mutter war ordentlich und sauber. Verschiedene Glastiegel mit Cremes und Parfümflakons standen nebeneinander aufgereiht wie Soldaten, und eine Haarbürste und ein altmodischer Handspiegel lagen daneben. Heather setzte sich hin. Ihr Blick wanderte über die Bürste, bei der ihre Mum nicht so sorgfältig gewesen war, nicht so penibel. Zwischen den Borsten hingen feine blonde Haare und auch ein paar drahtige graue.
Organisches Material, dachte Heather. Dieser Begriff, gewichtig und giftig, schien sich aus irgendeinem Grund in ihr festzusetzen. Du hast organisches Material hinterlassen, Mum. Hast du das gewollt?
Ein zusammengeknülltes, leicht vergilbtes Stück Papier mit einer engen Schrifttype darauf war das Einzige, was auf dem Frisiertisch fehl am Platz wirkte. Heather hob es auf, um sich von der Haarbürste abzulenken, und strich es glatt. Sie rechnete damit, auf die Seite eines von ihr verfassten Artikels zu schauen – ihre Mutter hatte zwar keinen engen Kontakt zu ihr gehabt, doch Heather war sich sicher, dass sie die Karriere ihrer Tochter trotzdem immer noch kritisch beobachtet hatte –, aber ihre Vermutung stellte sich als ein Irrtum heraus. Sie blickte vielmehr auf eine Seite aus einem Buch, nach der Schrift und der Beschaffenheit des Papiers zu urteilen, ein ziemlich altes Buch. Ein Holzschnitt war darauf abgebildet, und er stellte etwas dar, das sie erst nach intensivem Betrachten erkannte – eine Ziege oder ein Lamm schien sich über ein anderes Tier zu beugen. Vielleicht über einen Hund? Der Bauch dieses Tiers war aufgeschlitzt, und ein paar kleinere Ziegen schoben Steine in die merkwürdig sauber aussehende Öffnung. Heather überflog den Text, aus dem sie erfuhr, dass der Wolf durstig war, als er aufwachte, und zum Fluss ging, um zu trinken …
Die Seite stammte aus einem Märchenbuch, doch was ihre Mutter damit gewollt hatte, konnte sie sich nicht erklären. Colleen hatte die althergebrachten, blutrünstigen Erzählungen nie gemocht. Heathers Gutenachtgeschichten hatte aus einer strengen Diät aus glücklichen Ponys und Mädchen in Internaten bestanden. Die Seite löste ein ungutes Gefühl in ihr aus: das seltsame Bild, die Art, wie es auf dem Tisch zusammengeknüllt zurückgelassen worden war. Wollte ihre Mutter überhaupt, dass sie es entdeckte?
»Wer weiß schon, was du gedacht hast? Du musst … du musst den Verstand verloren haben …«
Heather kam das Zimmer plötzlich sehr warm und eng vor, die Stille darin zu laut. Sie stand auf, leicht zittrig, und stieß dabei so fest gegen den Frisiertisch, dass eine Parfümflasche umkippte – der Verschluss fiel heraus, was sie noch mehr erschrecken ließ.
»Mist.«
Der Duft breitete sich im Zimmer aus, blumig und schwer, und erinnerte sie an die Leichenhalle. Vor allem an den Warteraum, der mit mehreren geschmackvollen Blumengestecken bestückt gewesen war, als könnten sie einen von dem, was man gleich zu sehen bekommen würde, ablenken. Sie schüttelte den Kopf. Es war wichtig, sich nicht darauf zu fixieren. Das hatte Terry gesagt, ihre Mitbewohnerin. Denk nicht an den Geruch, denk nicht an den Wind, der über einsame Klippen peitscht, und denk auf keinen Fall an die besondere Wirkung, die ein Tropfen auf das organische Material einer Leiche hat, der sehr langsam darauf hinabfällt …
»Mist. Ich brauche frische Luft.«
Heather stopfte das zerknüllte Papier in eine Schublade, in der sie es nicht sehen konnte, und stapfte die Treppe wieder hinunter. Sie war auf dem Weg zur Hintertür, als es vorne an der Haustür klingelte.
Das enge, schlechte Gefühl in ihrer Brust wurde augenblicklich durch Wut ersetzt. Wahrscheinlich war es jemand, der etwas verkaufen oder für einen wohltätigen Zweck sammeln wollte. Oder der verdammte Mr. Ramsey. Sie stürmte zur Tür und genoss bereits den Blick des Eindringlings, wenn sie sagen würde: Was fällt Ihnen ein, sehen Sie nicht, dass ich trauere?, als sie völlig unerwartet eine große, gut gekleidete, ältere Frau vor sich stehen sah. Sie hielt keine Broschüre oder Spendenbüchse in der Hand, sondern eine zugedeckte Auflaufform, und in ihrem Blick lag Mitgefühl.
»Ähm, kann ich Ihnen helfen?«
»Heather? Aber natürlich, Sie sind es.« Die Frau lächelte, und Heather merkte, wie ihre Wut verflog. Die Fremde hatte graues, sehr kurz geschnittenes Haar. Eine Frisur, die den meisten Menschen nicht schmeichelte, doch sie hatte auffallend gut geformte Wangenknochen und ein schmales, hübsches Gesicht. Heather konnte ihr Alter nicht schätzen. Sie war eindeutig alt, älter als ihre Mutter, aber ihre Haut hatte fast keine Falten, und ihre hellgrauen Augen waren klar und wach. Mary Poppins, schoss es Heather durch den Kopf. Sie erinnert mich an Mary Poppins. »Ich bin Lillian, meine Liebe, und wohne ein paar Häuser weiter. Ich wollte nur kurz vorbeischauen und mich vergewissern, dass Sie zurechtkommen.« Sie hob die Auflaufform an, nur für den Fall, dass Heather sie noch nicht gesehen hatte. »Kann ich das irgendwo abstellen?«
Heather trat schnell von der Tür zurück. »Entschuldigung, natürlich. Kommen Sie herein.«
Die Frau bewegte sich geschmeidig durch den Flur und marschierte zielstrebig zur Küche, woraus zu schließen war, dass sie sich im Haus auskannte.
»Das ist nur ein Eintopf«, verkündete Lillian, während sie die Schüssel auf die Arbeitsplatte stellte. »Lamm, Möhren, Zwiebeln und so weiter. Sie sind doch keine Vegetarierin, oder, meine Liebe? Nein? Das habe ich mir gedacht. Gut. Wärmen Sie das Gericht im Ofen auf.« Als sie Heathers Miene sah, lächelte sie erneut. »Ich weiß, wie man sich in einer solchen Situation fühlt. Da vergisst man leicht, richtig zu essen. Aber damit tut man sich überhaupt keinen Gefallen. Sehen Sie zu, dass Sie abends immer etwas Warmes in den Bauch bekommen. Colleen war eine liebe Freundin. Sie würde sich die Haare einzeln ausreißen, wenn sie wüsste, dass Sie deswegen vom Fleisch fallen.«
Heather nickte, bemüht, etwas Passendes zu erwidern.
»Wie freundlich von Ihnen, an mich zu denken, äh, Lillian. Haben Sie meine Mum gut gekannt? Ich meine, Colleen. Sie wohnen hier in der Gegend? Dann sind Sie wohl vor ein paar Jahren hierhergezogen, oder?« Sie dachte an ihre Kindheit und an die wenigen Besuche, die sie ihrer Mutter als Erwachsene abgestattet hatte, und versuchte, sich an Lillian zu erinnern. Doch die Frau kam ihr nicht bekannt vor.
»Gleich um die Ecke«, antwortete Lillian und sah sich in der Küche um, als könnte sie jedes Staubkorn ausmachen, für das Colleen sich geschämt hätte. Obwohl sie für Mr. Ramsey sofort nur Verachtung verspürt hatte, fand sie die Vorstellung, Lillian zu enttäuschen, seltsam beunruhigend. »Colleen und ich haben hin und wieder einen Nachmittag miteinander verbracht, Tee getrunken und über Dinge gesprochen, über die alte Damen eben so sprechen.«
Heather nickte, wenngleich sie es merkwürdig fand, an ihre Mutter als »alte Dame« zu denken.
»Welchen Eindruck hat sie auf Sie gemacht? In den vergangenen Wochen?« Die Frage schien Lillian zögern zu lassen, und so versuchte Heather, entspannter zu wirken, indem sie die Arme nicht mehr länger verschränkte, sondern sie locker herunterhängen ließ. »Wissen Sie, ich habe sie nicht so häufig gesehen, wie ich sie hätte sehen sollen. Für mich ist das alles ein ziemlicher Schock.«
»Sie war eine starke Frau, Ihre Mutter. Erstaunlich stark sogar. Aber, na ja, das ist wohl eine Generationssache. Menschen in meinem Alter sprechen nicht über Gefühle.« Lillian lächelte zaghaft. »Wir tun das einfach nicht, und wenn Colleen Probleme hatte, dann habe ich leider nichts davon gewusst.«
Heather dachte an die zusammengeknüllte Buchseite auf dem Frisiertisch und an das gequälte Gesicht des Polizisten, als er ihr den Ehering ihrer Mutter in die Hand drückte.
»Meine Mutter hat also nichts gesagt, was Ihnen merkwürdig vorgekommen wäre? Sie hat sich nicht seltsam verhalten?«
»Du liebe Güte.« Lillian senkte ihren Blick auf die Arbeitsplatte, als hätte Heather gerade ein unanständiges Wort im Beisein eines Pfarrers gesagt. »Colleen hat erwähnt, dass Sie Journalistin sind, aber …«
»Tut mir leid, ich …« Heather sah weg und lächelte zaghaft. Ich kann nicht einmal eine zwanglose Unterhaltung führen. Mum hätte das wahrscheinlich witzig gefunden. »Hören Sie, kann ich Ihnen eine Tasse Tee machen?«
»Nein, danke, meine Liebe«, antwortete Lillian und winkte ab. »Mir würde es nicht im Traum einfallen, Sie jetzt zu belästigen. Ich wollte das hier nur vorbeibringen und kurz nach Ihnen schauen. Wissen Sie, Colleen hat ständig von Ihnen gesprochen.«
»Wirklich?« Heather lächelte wieder, dieses Mal jedoch gezwungen. »Wir sind nicht immer so gut miteinander ausgekommen. Ich war als Kind eine Nervensäge, wie sie Ihnen bestimmt erzählt hat.«
»Oh nein, ganz und gar nicht«, erwiderte Lillian und strich einen Fussel von ihrem Ärmel. »Sie hat ihr Goldmädchen immer nur in den höchsten Tönen gelobt.«
Heather hatte plötzlich den Eindruck, dass Lillian log, nickte aber dennoch. Die Frau drückte Heathers Arm kurz, als sie sich aufmachte zu gehen.
»Wenn es irgendetwas gibt, das ich tun kann, meine Liebe, dann lassen Sie es mich einfach wissen. Wie schon gesagt, ich wohne ganz in der Nähe, und gerne koche und backe ich für Sie oder wasche sogar, wenn Ihnen das gerade alles zu viel ist …« Heather folgte ihr den Flur entlang wie ein Schulkind, das sich verlaufen hat. Die Menschen ließen sich von Lillian wahrscheinlich oft mitziehen, vermutete sie.
»Oh, sehen Sie nur.« Lillian war vor einem kleinen Beistelltisch stehen geblieben, auf dem Colleen ihre Schlüssel und die tägliche Post aufbewahrte. Darauf stand auch ein gerahmtes Foto. Es zeigte Heather als Jugendliche in ihrem alten Zimmer. Sie saß auf dem Bett, groß und schlaksig, das Haar hing ihr vor den Augen, und sie hielt eine Auszeichnung in der Hand, die sie in der Schule erhalten hatte. Für einen Aufsatz, eine Kurzgeschichte, an die Heather sich nicht mehr erinnern konnte. Es schnürte ihr die Kehle zu, als sie das Foto sah – es war nur wenige Wochen vor dem Tod ihres Vaters aufgenommen worden, und die Beziehung zwischen ihr und ihrer Mutter hatte begonnen zu vergiften.
»Das ist mein Lieblingsfoto von Ihnen«, sagte Lillian und klang erfreut, was sich Heather nicht erklären konnte. »Ist es nicht bezaubernd?«
Heather öffnete den Mund, ohne recht zu wissen, was sie sagen sollte. Sie hatte keine Ahnung, warum ihre Mutter das Bild überhaupt gerahmt hatte, und erst recht nicht, warum diese Fremde so begeistert davon war, denn sie machte ein mürrisches Gesicht darauf und trug ein viel zu großes T-Shirt von Akte X.
»Na gut, jetzt halte ich Sie nicht länger auf.« Lillian war schon zur Tür hinaus, ihre sauberen weißen Schuhe knirschten auf dem Kies. »Und denken Sie daran, meine Liebe, egal, was Sie brauchen, lassen Sie es mich wissen.«
Heather hob die Post vom Boden im Flur auf und warf sie auf die Arbeitsplatte in der Küche. Viele Werbeprospekte, ein paar Rechnungen, Speisekarten von verschiedenen Lieferservices. Stirnrunzelnd sortierte sie die Briefe aus, um die sie sich kümmern müsste, und warf den Rest in den Mülleimer. Irgendetwas Verdorbenes musste sich darin befinden – irgendwelche Essensreste, wahrscheinlich die der letzten Mahlzeit ihrer Mutter –, und der Geruch nach vergammeltem Fleisch stieg ihr in die Nase und schlug ihr auf den Magen. Heather hatte plötzlich das Gefühl, sich übergeben zu müssen und stürzte zur Hintertür. An der frischen Luft würde es ihr bestimmt sofort besser gehen.
Hohe Tannenbäume verstellten die Sicht auf die Nachbarn. In ihrer Kindheit – als sie auch hier gelebt hatte und ihrer Mutter ständig zwischen den Beinen herumgelaufen war – waren diese Bäume noch sehr viel kleiner gewesen und hatten sehr viel freundlicher gewirkt. Jetzt verdunkelten sie den Garten, schützten Heather vor fremden Blicken und hielten die Welt da draußen fern. Vor der Hintertür gab es eine kleine Fläche aus Beton, auf der zwei schmiedeeiserne Stühle, ein Tisch und ein weiterer Blumentopf mit leerer Erde standen. Leer. An der frischen Luft fühlte sie sich etwas besser. Heather fragte sich, warum sie überhaupt im Haus herumgewandert war, in Zimmer geschaut, Fotos betrachtet und auf Frisiertischen herumgestöbert hatte. Weil ich nachsehe, ob sie auch wirklich nicht da ist, dachte sie und zuckte zusammen. Weil ein Teil von mir noch immer glaubt, dass sie im Bad sein könnte und die Toilette schrubbt. Oder dass sie im Wohnzimmer sitzt und fernsieht. Ich suche nach Geistern.
»Verdammter Mist.« Sie holte tief Luft und wartete darauf, dass die Übelkeit nachließ. »Was für ein schreckliches Chaos, Mum. Ehrlich.«
Ihre Gedanken wanderten zurück zu der zerknüllten Seite, und sie fragte sich, in welchem geistigen Zustand ihre Mutter gewesen sein musste, ehe sie sich das Leben genommen hatte. Was war ihr durch den Kopf gegangen? Heather hatte Schwierigkeiten, sich vorzustellen, wie ihre Mum – eine Frau, die pedantisch war, was den Einsatz von Untersetzern und Lesezeichen anging – eine Seite aus einem Buch herausriss, und erst recht, wie sie die zusammenknüllte, als sei sie Müll. Doch genau das war der dunkle, düstere Kern, die beängstigende Wahrheit, der Heather nicht ins Auge sehen wollte: ihre Mutter war nicht bei Verstand gewesen. Etwas musste Besitz von ihr ergriffen und sie ihrer Vernunft beraubt haben. Ein grausamer, tödlicher Fremder, der sich in dem Kopf ihrer Mutter eingenistet hatte. »Nichts von dem ergibt für mich Sinn. Nichts davon.«
Kurz nachdem sie angerufen worden war, um die Leiche ihrer Mutter zu identifizieren, hatte die Polizei sie mit einem Seelsorger in Kontakt gebracht, der sehr freundlich gewesen war und sich viel Zeit genommen hatte. Er hatte über Schock gesprochen und darüber, wie gut Menschen eine ernste Depression verheimlichen konnten, selbst vor den engsten Angehörigen. Heather hatte geduldig zugehört und über ihre eigene Taubheit hinweg genickt. Obwohl sie verstanden hatte, was der Seelsorger ihr sagen wollte, hatte sich das selbst in dem Augenblick … falsch angefühlt. Diese alten Instinkte waren aufgeflackert. Die, die ihr sagten, wann an einer Geschichte etwas dran war und wann nicht.
»Du bist lächerlich«, sagte sie zu sich selbst und hörte, wie kalt und schwach ihre Stimme klang. »Paranoid.«
Ein Auto hupte irgendwo auf der Straße vor dem Haus, und sie zuckte zusammen. Dicke Tränen liefen ihr über die Wangen, die sie gereizt mit dem Handrücken wegwischte. Nach einem Augenblick zog sie ihr Handy aus der Hosentasche. Im Display leuchtete ihr eine Textnachricht entgegen.
Hallo Fremde – man sagt, du seist wieder in Balesford. Wollen wir uns treffen? Ich war so traurig, als ich das von deiner Mum gehört habe. Ich hoffe, du bist okay. xxx
Nikki Appiah. Heathers Blick wanderte über die dunklen Bäume, und sie fragte sich, ob die Nachbarn hinter ihren Gardinen standen, sie beobachteten um sich gegenseitig Bericht zu erstatten. Sie schniefte und blinzelte die Tränen weg, bevor sie eine Antwort tippte.
Bist du bei der Nachbarschaftswache, oder was? Ja, ich bin für ein paar Tage hier. Hast du jetzt Zeit? Wollen wir uns im Spoons treffen? Ich brauche einen Drink.
Sie hielt inne und fügte dann ein grüngesichtiges, kotzendes Emoticon hinzu.
Nikkis Antwort poppte fast augenblicklich auf.
Es ist elf Uhr morgens, Hev. Aber ja, lass uns in der Stadt treffen. Es ist schon viel zu lange her und ich freu mich, dein Gesicht zu sehen (auch wenn’s grün ist). In einer Stunde? xxx
Heather steckte das Handy weg. Der Himmel verdunkelte sich, und die Luft nahm einen säuerlichen, mineralischen Geruch an – es würde bald regnen. Ihr würde es guttun, wenn sie irgendwo anders war. Der Wind wurde stärker und fuhr durch die hohen Sträucher und ließ sie sich hin und her wiegen. Für einen kurzen Augenblick glaubte Heather, zu viel Bewegung dort zu sehen. Als würde etwas im Rhythmus des Winds mitschwingen, um seine Schritte zu verbergen. Sie starrte auf die dunklen Schatten und versuchte, eine Gestalt auszumachen. Nach ein paar Sekunden drehte sie sich um, tat es als Einbildung ab, und ging zur Hintertür. Das Haus wirkte noch immer leer und unergründlich. Eine kleine, irdische Kapsel.
»Was hast du gedacht, Mum?«
Heather kam ihre eigene Stimme fremd und traurig vor. Sie wischte sich die letzten Tränen von den Wangen und ging durch den Flur zur Vorderseite des Hauses hinaus, wo der Mietwagen stand.
3. KAPITEL
Der Wind war im Laufe des Vormittags noch stärker geworden, hatte die grauen Wolken vertrieben und einen blitzblanken Himmel hinterlassen. Es war freundlich, aber kühl. Beverly freute sich, denn ihre Enkel, Tess und James, würden dann zumindest ein paar Stunden im Garten verbringen können. Wie alle Jugendlichen waren sie ständig mit ihren Handys und anderen technischen Geräten beschäftigt. Doch Beverly bemerkte mit Stolz, dass sie die beiden noch immer in ihren Garten locken konnte, wenn das Wetter schön war. Mit diesem Gedanken im Kopf schlüpfte sie in ihre Jacke – immer noch die dünne, der Herbst hatte noch nicht endgültig Einzug gehalten – und ging zum hinteren Tor hinaus. Ihr Garten war wunderschön, hatte aber keine Rosskastanien, wohingegen auf den Feldern weiter draußen zwei Prachtexemplare standen, und sie wollte nachsehen, ob diese bereits ihre Früchte abwarfen.
Sie betrachtete die Baumreihe, die das Feld umschloss und aus Eichen, Birken und Ulmen und den beiden großen Rosskastanien bestand. In der Sonne leuchtete das Laub wie Buntglas, grün, gelb, rot und golden. Und tatsächlich, dort auf dem Gras lagen verstreut die stacheligen grünen Gehäuse. Sie waren aufgeplatzt und offenbarten ihre milchig blassen Innenseiten. Beverly begann, ihre Taschen mit den heruntergefallenen Kastanien zu füllen. Doch sie sammelte nur die Früchte ein, die den Fall unversehrt überstanden hatten und suchte insbesondere nach solchen, die eine flache Seite besaßen und damit besonders gut geeignet waren, den Gegner zu vernichten. Ein- oder zweimal stieß sie auf ein Gehäuse, das nur teilweise aufgeplatzt war. Sie drückte mit ihrem Stiefel auf einen Teil der Gehäuse und lächelte zufrieden, wenn die Kastanien herausquollen, ganz glatt und neugeboren. Eine davon war besonders schön flach.
»Ich glaube, die behalte ich für mich.« Beverly ließ sie in eine Innentasche gleiten. Conkers, das Spiel mit den Kastanien, machte nur Spaß, wenn sie mindestens einen ihrer Enkel schlagen konnte. Es war das Exemplar, das sie gleich danach aufhob, nahe der Wurzeln des großen alten Baums, das sich seltsam anfühlte. Sie verzog das Gesicht, hielt die Kastanie ins Licht und bemerkte die dunkelrote Schliere an ihrem Finger erst, als deren Geruch ihr in die Nase stieg: wie vom Hintereingang der Metzgerei an einem heißen Tag.
Beverly schrie auf und ließ die Kastanie fallen. Das Gras unter ihren Füßen war dunkel: durchtränkt von Blut, wie sie jetzt begriff.
»Das muss dieser verdammte Köter gewesen sein«, sagte sie aufgebracht und hielt ihre schmutzige Hand von sich weg, als hätte sie sie sich verbrannt. »Dieser verdammte Hund hat schon wieder was erwischt.«
Doch sie konnte weder einen zerfetzten Hasen noch einen größeren Vogel sehen – beides hatte sie in der Vergangenheit schon auf den Feldern entdeckt. Stattdessen trat sie näher zu dem Stamm der alten Kastanie und stellt fest, dass aus dessen Wurzeln Blut quoll, als wäre der Baum zur Ader gelassen worden. An seinem unteren Ende befand sich ein großer Hohlraum. Normalerweise war er mit Erde und altem Laub vollgestopft, doch jetzt steckte etwas anderes darin.
»Oh Gott. Oh Gott, nein, oh Gott …«
Beverly ließ die Arme sinken, ihre Finger waren taub. Sie blickte in ein Gesicht, in das Gesicht einer Frau. Die Augen geschlossen, der Mund geöffnet, wie zu einem Gebet. Die wächsernen Wangen überzogen dunkle Sprenkel, und Blumen ragten aus den Zähnen. Rosa Blumen, stellte Beverly fest. In ihrem Haus würde es nie wieder rosa Blumen geben. Hundsrosen, nach dem Aussehen zu urteilen.
Unter den Kopf der Frau waren zwei Füße gequetscht, nackt, bis auf einen silbernen Zehenring und blassrosa Nagellack. Da war auch ein Arm. Die Hand lag mit der Innenfläche nach oben gerichtet auf dem Gras, als würde sie um Hilfe bitten oder jemanden herbeiwinken. Sie konnte sogar den Ärmel einer roten Jacke erkennen, die breiten Knöpfe am Aufschlag waren mit feuchten Tropfen überzogen. Alles war derart eng in die Öffnung gezwängt, dass Beverly die Haarfarbe der Frau oder ihren Oberkörper, wenn er sich überhaupt darin befand, nicht sehen konnte. Aber was sie sehen konnte, war eine Art weicher Vorhang aus violettem, schnurähnlichem Zeug, der zu beiden Seiten des Arms herabhing. In der Rinde über dem Hohlraum war ein Herz eingeritzt, zweifellos die romantische Geste eines Liebenden.
Schlagartig bemerkte Beverly, dass sie drohte, ohnmächtig zu werden. Taumelnd trat sie von dem Baum weg und begann zurück zum Haus laufen, das Gesicht tränennass.
4. KAPITEL
»Der Laden hier war schon immer ein mieser Schuppen.«
Heather stellte die beiden Gläser ab und ließ drei Tüten Chips auf den Tisch fallen. Nikki griff nach der Packung mit Salz- und Essiggeschmack und betrachtete sie kritisch.
»Du wolltest hierhin«, stellte Nikki milde fest. Sie sah aus wie früher. Das schwarze Haar zu ordentlichen Zöpfen geflochten, die Brille etwas schmaler, eine modischere Version der Brillen, die sie in ihrer Schulzeit getragen hatte. Sie hatte sogar einen grob gestrickten marineblauen Pullover an, der Heather unweigerlich an ihre alte Schuluniform erinnerte. »In Balesford gibt es zwar nicht viele angesagte Läden, aber wir hätten schon was Besseres finden können als das Wetherspoons.«
»Ach komm, um der guten alten Zeiten willen.« Heather nippte an ihrem Glas und verzog das Gesicht. Sie war bei der Bestellung der Getränke an der Bar in alte Gewohnheiten verfallen und bei dem Drink gelandet, den sie in erster Linie mit ihrer Schulzeit verband – Cola mit Rum. Nikki hatte sich eine Weißweinschorle bestellt, schien aber mehr an den Chips interessiert zu sein. »Tut mir leid, dass ich mich nicht früher bei dir gemeldet habe, aber … die letzten Tage waren völlig chaotisch. Woher weißt du überhaupt, dass ich hier bin? Hast du Spione, die das Haus überwachen? Arbeitest du jetzt beim Geheimdienst, oder was?«
Nikki lächelte und schüttelte den Kopf. »Du weißt doch, dass meine Tante in deiner Straße wohnt, und sie ist quasi der Geheimdienst von Balesford. Alle haben bloß darauf gewartet, dass du auftauchst. Und Mr. Ramsey hat dann jedem erzählt, dass du nicht einmal einen Schlüssel zum Haus deiner Mutter hast.« Nikkis Lächeln verschwand. »Es tut mir so leid, Hev. Wirklich. Das ist alles so schrecklich. Wie geht's dir?«
Heather zuckte mit den Achseln, riss eine Tüte Chips auf und wich dem Blick ihrer Freundin aus. Nikki war schon immer die Nette gewesen, die Liebenswürdige, und in das Gesicht eines Menschen zu blicken, der echtes Mitgefühl zeigte, überforderte sie gerade. Insbesondere nach dieser Aufregung im Haus. Organisches Material.
»Ich glaub, mir geht’s so gut, wie es unter diesen Umständen eben möglich ist. Ich habe mich vorhin im Haus umgesehen und dabei fast ständig gedacht, dass sie gleich doch noch um die Ecke kommen würde, verstehst du? Als ob das alles, ich weiß nicht, ein Schreibfehler ist. Ich …« Heather schnürte es die Kehle zu. Der Raum schien zu schwanken und der Boden unter ihren Füßen zu verschwinden. »Ich war eine ganze Weile nicht mehr zu Hause. Und, na ja, sie war kein Riesenfan von mir, wie du weißt.«
»Darum geht’s doch nicht.«
»Stimmt.« Heather trank einen Schluck und blinzelte, als der Rum durch ihre Kehle brannte. Die Spannung in ihren Schultern und die Kopfschmerzen, die sich angeschlichen hatten, ließen nach. »Warum hat sie sich umgebracht, Nikki? Ich begreife das nicht. Das … das fühlt sich nicht richtig an. Es macht keinen Sinn.«
Nikki wirkte leicht befangen. Sie rutschte auf ihrem Stuhl hin und her. Der Pub begann sich zu füllen. Die Leute kamen herein, um das günstige Tagesgericht in ihrer Mittagspause zu essen. Ein Curry, das für fünf Pfund zu haben war. »Tante Shanice wollte zuerst nicht glauben, was Mr. Ramsey ihr da erzählt hat. Sie hat sein Gerede erst als Unsinn abgetan … Heather, Selbstmord zu verstehen ist schwer. Deine Mum muss sehr unglücklich gewesen sein. Vielleicht hatte sie schon lange richtig große Probleme. Und es kann durchaus sein, dass niemand geahnt hat, wie sehr sie litt. Psychische Krankheiten können derart verheerend sein.«
»Ja. Und ich wäre die Letzte gewesen, der sie es gesagt hätte. Es ist nur …«. Heather zuckte mit den Achseln. »Du hast doch meine Mutter gekannt. Sie mochte kein großes Aufheben, ihr war es am liebsten, wenn alles so leise wie möglich verlief. Diese Tat fühlt sich an wie eine große Geste, als wollte sie mir etwas sagen. Oder mich bestrafen.« Heather bemerkte Nikkis Gesichtsausdruck und seufzte. »Ja, ich weiß, das hört sich total klischeehaft an. Ich weigere mich, das Offensichtliche zu akzeptieren, weil die Wahrheit zu unangenehm ist. Also beziehe ich alles auf mich, verdammt nochmal. Aber ich werde einfach das Gefühl nicht los, dass ich irgendwas übersehe. Ist deiner Tante etwas aufgefallen? Ich meine, in letzter Zeit, an meiner Mutter?«
»Hev …« Nikki griff nach Heathers Hand und drückte sie leicht. Heather konnte ihrer Freundin wieder nicht in die Augen sehen. »Manche … Manche Dinge lassen sich einfach nicht nachvollziehen oder auflösen.«
Heather nickte und starrte auf die klebrige Tischplatte.
»Ja, egal. Lass uns nicht weiter darüber sprechen. Das ist alles Unsinn. Wie geht’s dir? Ist schon eine Weile her, dass wir zusammen ausgegangen sind. Was machst du denn so? Immer noch unterrichten, nehme ich an?«
»Ja, das stimmt, und dein Gesichtsausdruck sagt mir, dass du entsetzt bist.« Nikki lächelte und nippte an ihrer Weinschorle. »Ich unterrichte mittlerweile am College, Englisch und Geschichte, was du wissen könntest, wenn du meinen Updates auf Facebook jemals Beachtung schenken würdest. Bist du immer noch bei der Zeitung?«
Heather erschrak, was sie zu verbergen versuchte, indem sie sich gleich mehrere Chips in den Mund stopfte und aß. »Hat nicht funktioniert. Ich arbeite seit einiger Zeit freiberuflich, passt besser zu mir.« Noch mehr unangenehme Erinnerungen. Sie kippte den Rest ihres Drinks herunter und zog die Augenbrauen hoch. »Trinken wir noch einen?«
Die beiden verbrachten den Rest des Nachmittags im Pub und stiegen auf Limonade um, als die Ränder des Raums zu verschwimmen begannen. Irgendwann schlug eine von ihnen vor, Essen zu bestellen. Kurz darauf war ihr Tisch voll mit Tellern, Papadamkrümeln und Spritzern grellgelber Currysauce. Sie sprachen von der Schule und kramten all die alten Geschichten aus, die nun einmal bei solchen Gelegenheiten ausgekramt werden. Schließlich trafen die ersten Abendgäste ein, und sie entschieden, dass sie jetzt wohl besser nach Hause gingen – den ganzen Tag im Pub zu verbringen ließe eine Lehrerin nicht wirklich gut dastehen, gab Nikki zu bedenken.
»Wie du meinst, Professorin.«
Draußen war es mittlerweile düster und kalt geworden. Als Nikki ihnen ein Taxi rief, merkte Heather, wie das kleine Arsenal an guter Laune, das sich über den Nachmittag hinweg aufgebaut hatte, in die Dunkelheit verschwand. Sie würde jetzt nicht nach Hause fahren, in ihr unaufgeräumtes, aber dennoch gemütliches Zimmer in ihrer WG mit ihren ebenso unordentlichen Mitbewohnern, sondern in das leere Haus ihrer Mutter, in dem ihr zweifellos eine lange Nacht mit vielen quälenden Erinnerungen und unbeantworteten Fragen bevorstand. Heathers Gefühle mussten sich auf ihrem Gesicht widerspiegeln, denn als Nikki ihr Handy zurück in die Tasche steckte, berührte sie sanft ihren Arm.
»He, das Taxi wird in ein paar Minuten da sein. Alles in Ordnung mit dir?«
Heather zuckte mit den Achseln. Die viele Limonade und Cola rumorten in ihrem Magen, und sie war zu erschöpft, um so zu tun, als ginge es ihr gut.
»Der Abschiedsbrief war wirklich seltsam. Habe ich dir davon erzählt?«
Nikki schüttelte den Kopf, die braunen Augen düster.
»Ich meine, wie du schon gesagt hast, sie war in einer schlechten Verfassung. Da kann man wohl kaum erwarten, dass ein derartiger Brief Sinn macht.« Heather versuchte zu lächeln, doch ihre Lippen wollten ihr nicht gehorchen, also gab sie den Versuch auf. Stattdessen öffnete sie ihre Umhängetasche und zog ein Stück Papier aus einem Notizbuch, blasslila, mit dem Bild eines Zaunkönigs am oberen Rand, neben dem Aufdruck ›Meine Notizen‹. Sie trug aus Gründen, die sie nicht genauer hinterfragen wollte, das Blatt mit sich herum, seit die Polizei es ihr zusammen mit den Habseligkeiten ihrer Mutter übergeben hatte. Die krakelige Handschrift von Colleen Evans setzte in der Mitte an. Heather reichte Nikki den Brief, den sie stirnrunzelnd entgegennahm und vorsichtig mit den Fingern glatt strich.
»An euch beide. Ich weiß, dies wird ein Schock sein, und es tut mir leid, dass ihr euch nun mit diesem Chaos auseinandersetzen müsst, aber ich kann nicht mehr damit leben – ihr wisst nicht, was ich weiß, und welche Entscheidungen ich habe treffen müssen. Dies hier ist der Weg der Feiglinge, heißt es – die Menschen, die das sagen, wissen nicht, womit ich gelebt habe, kennen nicht diesen schrecklichen Schatten, der mich immer begleitet hat. All diese Monster im Wald, sie sind nie wirklich verschwunden, nicht für mich. Und vielleicht verdiene ich das hier. Ich bedaure aufrichtig, was auf euch zukommen wird, wozu es auch immer gut sein mag. Was immer ihr auch denken mögt, ich liebe euch beide. Das habe ich immer getan.«
Nikki sagte nichts, sondern presste stattdessen die Lippen aufeinander und blickte auf die Straße. Nach einem Augenblick strich sie sich schniefend eine Träne aus dem Augenwinkel.
»Oh, Hev, das ist schrecklich. Deine arme Mum.«
»Aber, ist dir nichts aufgefallen?« Heather nahm den Brief wieder an sich, faltete ihn und steckte ihn zurück in ihre Tasche. Sie war froh, ihn nicht mehr sehen zu müssen. »An euch beide. Ich liebe euch beide. Was bedeutet das? Sie hat außer mir keine Familie mehr. Und dann, was meint sie mit diesen Entscheidungen?«
Nikki schüttelte langsam den Kopf. »Okay, das ist seltsam. Aber vielleicht hat sie dich und deinen Vater gemeint? Wenn sie in einer derart schlechten seelischen Verfassung war, hat sie womöglich irgendwie vergessen, dass er schon gestorben ist. Oder … oder diese Zeilen waren auch an denjenigen gerichtet, der ihren Körper gefunden hat, wer immer das auch war.«
»Aber ›an euch beide‹ hört sich so konkret an. Als hätte sie an zwei bestimmte Personen gedacht. Und Monster im Wald? Was zum Teufel meint sie damit?« Heather seufzte. »Du hast recht, sie könnte von Dad gesprochen haben. Aber ich hasse diese Ungewissheit. Und jetzt werde ich mich den Rest meines Lebens fragen, wovon sie da redet – als sei ihr Scheißselbstmord nicht schon schlimm genug, hat sie mir obendrein auch noch einen kryptischen, rätselhaften Abschiedsbrief hinterlassen.« Irgendwo bellte ein Hund, und es hatte zu nieseln begonnen. Die Straße war fast menschenleer, weil alle vor dem Regen geflüchtet waren. Nur an der Bushaltestelle stand eine schattenhafte Gestalt und bewegte sich nicht. Ein Bus fuhr donnernd an ihr vorbei, ohne zu halten, und sie wandte ihr Gesicht vom Licht der Scheinwerfer ab.
»Ich verstehe. Du wirst dich nach der Beerdigung besser fühlen, denke ich. Sie sollen einem doch dabei helfen abzuschließen, oder?« Nikki presste die Lippen aufeinander, als sei sie sich selbst nicht sicher, ob das stimmte. »Hast du angefangen …?«
»Oh, das meiste ist geregelt.« Heathers Mund formte sich zu einem kleinen Lächeln. Nikki zu sehen und jemanden zu haben, der einen zu den praktischen Dingen des Lebens zurückführte, tat gut. »In einer Situation wie dieser sind Menschen wirklich hilfsbereit, weißt du das? Aber meine Mutter hatte ihr Handy bei sich … und das hat den Sturz leider nicht überstanden. Deshalb muss ich jetzt ihr Adressbuch finden, falls sie eins gehabt hat. Schreibt man sich heutzutage überhaupt noch Telefonnummern auf? Ich nehme an, wenn jemand, dann meine Mutter.«
»Solltest du etwas brauchen, egal was, sag einfach Bescheid. Meine Mum und Tante Shanice stehen bereit.« Nikki nickte zum Bordstein. »Da kommt unser Taxi.«
Ein paar Stunden später wachte Heather im Gästezimmer ihrer Mutter auf und starrte in völlige Dunkelheit. Panikartig griff sie nach ihrem Handy, das auf dem Nachttisch lag. Das Licht des Displays tauchte den Raum in unterschiedlich graue Schatten. Du bist nur im Gästezimmer, ermahnte sie sich, das sind nur die dämlichen, schweren Vorhänge. Vor dem Fenster ihres Schlafzimmers zu Hause stand eine Straßenlaterne. Daher war es bei ihr nie richtig dunkel. Doch hier war sie wie blind aufgewacht, durch die zahlreichen Bäume im Garten und die langen, dicht bestickten Gardinen. Leicht zitternd knipste sie die Nachttischlampe an und setzte sich auf, das Handy in der Hand.
Ein Geräusch. Ein Poltern, direkt über ihr. Heather rieb sich die Augen und rief sich in Erinnerung, dass sie eine erwachsene Frau war in einem ihr nicht vertrauten Haus – da musste sie mit seltsamen, ihr Angst einjagenden Geräuschen rechnen. Das Poltern verwandelte sich in eine Art Schlurfen, und sie spürte, wie sie eine Gänsehaut bekam.
»Okay«, sagte sie laut. »Auf dem Dachboden ist ein Vogel. Eine Taube oder nistende Stare, oder sonst was.« Ihre Stimme klang vertraut und normal, und sie nickte sich selbst zu. »Ein Vogel ist nur ein Vogel. Kein Grund zur Beunruhigung.«
Sie blieb noch ein paar Minuten länger liegen, horchte nach den schwachen Geräuschen und wurde immer ungehaltener. Schließlich warf sie die Bettdecke zurück und stapfte auf den Flur. Vielleicht würden ihre lauten Schritte den Vogel erschrecken und dazu bringen wegzufliegen, dachte sie. Nachdem sie die letzten Minuten in dem hellen Licht der Nachttischlampe gelegen hatte, erschien der Treppensatz besonders finster. Heather blinzelte mehrfach und wartete darauf, dass ihre Augen sich an die Dunkelheit gewöhnten. Es war kalt, der Teppich unter ihren nackten Füßen seltsam eisig.
»Dieses verdammte Haus.«
Die Falltür zum Dachboden war nur als schwacher Umriss in der Decke zu erkennen. Heather blieb darunter stehen, und die schlurfenden und klappernden Geräusche hörten schlagartig auf, als wäre sie bemerkt worden. Immer noch neugierig und sehr viel wacher als noch vor ein paar Minuten, verharrte sie eine Weile an der Stelle, lauschte und rieb sich gelegentlich die Arme. Es war derart kalt, dass sie schon fast glaubte, ihren eigenen Atem zu sehen.
Das Haus war völlig still. Selbst das übliche Knacken und Knirschen eines Gebäudes schienen aufgehört zu haben.
Als Heather sich umdrehte, um zurück ins Gästezimmer zu gehen, erblickte sie das Fenster am Ende des Treppenabsatzes. Sie nahm eine Bewegung wahr, nur einen Augenblick lang, als würde sie von den Bäumen aus beobachtet werden. Weit aufgerissene Augen, leuchtend und ganz und gar nicht menschlich, starrten sie durch die dunkle Scheibe an.
»Was …«
Eine Sekunde später wehte ein Windstoß durch die Bäume und das, was auch immer dieses Trugbild herbeigeführt hatte, löste sich in Nichts auf. Denn das muss es gewesen sein, sagte sie zu sich selbst. Deine Augen spielen dir einen Streich, du Trottel. Trotzdem trat sie ans Fenster und spähte hinaus. Doch außer den Straßenlaternen, die durch die Äste der Bäume schienen, und dem Mondlicht, das seltsame Umrisse und undeutliche Formen schuf, war nichts zu sehen.
Wütend auf sich selbst, ging sie zurück ins Bett. Die Nachttischlampe ließ sie bis zum Morgen eingeschaltet. Obwohl sie in dieser Nacht keine Geräusche mehr hörte, kehrten ihre Gedanken immer wieder zu ihnen zurück. Und wenn sie dann einmal schlief, träumte sie von Federn, flaumig und braun, und von dem runden Gesicht ihres Vaters, puterrot vor Zorn.
5. KAPITEL
Der nächste Morgen war für Heather nicht erfreulich.
Sie hatte gewusst, dass das Haus ihrer Mutter viele unangenehme Gefühle heraufbeschwören würde. Und so war sie nicht im Geringsten überrascht, als sie in diesem ungewohnten Bett aufwachte und den Eindruck hatte, ein Tuch des Elends hätte sich über sie gelegt. Ihr Vater hatte dieses Zimmer früher als Abstellkammer benutzt und all seinen Krimskrams darin aufbewahrt – alte Autohandbücher, große Plastikeimer, um Bier zu Hause zu brauen und eine riesige Tiefkühltruhe, die ihre Mutter vollgestopft hatte mit Fertiggerichten und Fürst-Pückler-Eis. Heather hatte diesen Raum als Kind geliebt und war davon überzeugt gewesen, dass er alle Geheimnisse ihres Vaters barg. Jetzt war es ein kleines Gästezimmer, sauber und ohne jede Persönlichkeit. Trotzdem spürte Heather ihre Mutter noch immer überall – in dem Stapel Handtücher auf dem Hocker, in dem Zierdeckchen auf der Fensterbank und in der leeren Vase. Es war zu kalt und zu still, und so stand sie auf, drehte die Heizung auf die höchste Stufe und schaltete den Fernseher und das Radio ein. Als ein beruhigender Geräuschpegel entstanden war, machte sie sich eine Tasse starken Tee, setzte sich an den Küchentisch und begann, eine Liste der zu erledigenden Aufgaben zu erstellen.
Sie fand, zu ihrer eigenen Überraschung, das Adressbuch ihrer Mutter sofort. Es lag, fast schon in Vergessenheit geraten, in einem Zeitungsständer im Wohnzimmer. Sie rief all die Menschen an, die angerufen werden mussten, überbrachte ihnen die schlechte Neuigkeit und nahm Beileidsbekundungen entgegen. Als diese unangenehme Angelegenheit erledigt war, fand sie sich auf der Treppe wieder auf dem Weg nach oben. Ihre Hand ruhte auf dem Türknauf ihres alten Zimmers. Sie unterdrückte ein Seufzen und trat hinein. Es war noch immer als ihr Jugendzimmer erkennbar. Die Farbe der Tagesdecke, die sauber und ordentlich über das Bett gelegt war, konnte nur ein Teenager ausgesucht haben, und die Tapete wies noch immer ein paar winzige kahle Stellen auf, die von heruntergerissenen alten Klebestreifen herrührten – ihre Mutter hatte die Poster abgenommen und zusammengerollt, kurz nachdem Heather das Haus verlassen hatte. Heather hatte sich im Laufe der Jahre daran gewöhnt, dass dies nicht mehr ihr Zimmer war. Doch sie bemerkte zum ersten Mal, dass ihre Mutter offensichtlich begonnen hatte, den Raum anderweitig zu nutzen – in der Ecke stand ein kleiner Beistelltisch mit Bastelmaterial.
Heather lächelte leise und setzte sich auf den Klappstuhl, um sich den Krimskrams anzusehen. Ihre Mutter schien tatsächlich eines ihrer alten, ausrangierten Bastelsets aufbewahrt zu haben, eine teure Packung mit unterschiedlich farbiger Knetmasse, die Heather unbedingt einmal zum Geburtstag geschenkt haben wollte. Colleen hatte lustige Serviettenringe daraus gemacht und sie mit Stechpalmenzweigen und Schneemännern verziert. Neben den fertigen Exemplaren war eine Haftnotiz, auf der die Adresse eines nahe gelegenen Altenheims stand. Hatte sie vorgehabt, sie der Seniorenresidenz für ihren Weihnachtsbasar zu schenken? Sie waren oft dorthin gegangen, als sie klein war, hatten Kuchen gekauft und mit den alten Herrschaften geplaudert. Heather griff nach einem der Serviettenringe und hielt ihn mit einem Finger. Ihre Mutter hatte sich große Mühe gegeben, ihn zu gestalten. Ein Ring war erst zur Hälfte fertig. Was brachte einen Menschen dazu, seine beschauliche Bastelarbeit wegzulegen und stattdessen darüber nachzudenken, sich das Leben zu nehmen?
Die glatte Knete auf ihrem Finger erinnerte sie an ihre eigenen Versuche, etwas daraus herzustellen. Die Masse war zu fest, wenn sie aus der Packung kam, um sie sofort bearbeiten zu können. Also musste sie mit den Händen aufgewärmt und weich geknetet werden, aber Heathers kleine Finger waren nie gut darin gewesen. Ihr fiel plötzlich ein, wie sie in genau diesem Zimmer mit ihrer Mutter gesessen hatte, der Teppich sorgsam mit Zeitungen ausgelegt, vor beiden kleine Teller. Ihre Mum hatte jedes Stück bunter Knete mit ihren Händen aufgewärmt und weich gemacht, bevor sie es Heather gegeben hatte, damit sie etwas daraus basteln konnte …
Heather legte den Serviettenring zurück, ihre Hand zitterte. Nikki hat recht, sagte sie zu sich selbst. Ich kann nicht wissen, was Mum so zugesetzt hat. Ich sehe Rätsel, wo keine sind.
Trotzdem ließ sie das Gefühl nicht los, dass hier irgendwo irgendwas ganz und gar nicht stimmte, als sie das Zimmer verließ und sich umdrehte, um noch einmal auf den kleinen, arbeitsreichen Tisch zu schauen.
Heather verbrachte den nächsten Tag damit, durch das Haus zu wandern, Notizen zu machen und sich darüber zu wundern, wie viel Krempel ein Mensch in seinem Leben ansammeln konnte. Mittags wärmte sie sich den Eintopf auf, den Lillian gebracht hatte, und aß ihn aus einer großen Schüssel, während sie vor dem Fernseher saß. Das Gericht war lecker und nahrhaft, doch war ihr zum Schluss leicht übel, und sie fragte sich, ob sie zu lange mit dem Aufwärmen gewartet hatte – ob eine Zutat bereits verdorben war. Sie wusch die Auflaufform sorgfältig ab, nur für den Fall, dass Lillian vorbeikommen würde, um sie abzuholen.
Es gab bei jedem Raum so viel zu bedenken. Was sollte mit den Kleidern, dem Krimskrams und den alten Fotos geschehen, was mit so langweiligem Zeug wie Bettwäsche und Vorhängen? In jedem Zimmer kamen neue Erinnerungen hoch, als sei das Haus voll mit Geistern aus ihrer Kindheit. Doch die meisten Erinnerungen waren nicht so angenehm wie die, als sie mit Knete auf dem Boden ihres Schlafzimmers gespielt hatte. In der Tür zum Bad fiel ihr ein heftiger Streit ein, der dort stattgefunden und in dessen Verlauf sie derart fest gegen die Badewanne getreten hatte, dass sie in die Notaufnahme des Krankenhauses fahren musste. Als sie so dastand, fragte sie sich, warum in aller Welt sie niemanden hierher mitgenommen hatte, um ihr bei all dem beizustehen. Terry, ihr Mitbewohner, hatte sogar angeboten, ihr zu helfen, aber sie hatte automatisch abgelehnt. Und auch Nikki wäre bestimmt bereit gewesen, einige unangenehme Aufgaben zu übernehmen.
Warum verhielt sie sich so? Fürchtete sie, dass Terry sie wegen ihrer gewöhnlichen Vorstadtkindheit abgeurteilt hätte? Oder hatte sie eher Angst davor, dass er sie in einem verletzlichen Zustand gesehen hätte?
Das Durchgehen der Papiere und das Räumen hatten überall Staub aufgewirbelt, also holte Heather den Staubsauger hervor und schob ihn – ziemlich lustlos – durchs Wohnzimmer. Als sie ein paar Haare aufsaugen wollte, stieß sie mit der Düse gegen etwas Hartes unter dem Sofa. Sie griff danach, zerrte es hervor und stellte überrascht fest, dass es sich um ein Buch handelte. Ein ziemlich altes sogar, dem Aussehen nach zu urteilen. Sie wischte den Staub und die Flusen ab und betrachtete stirnrunzelnd den Einband. Es war eine Märchensammlung, eine zerfledderte alte Taschenbuchausgabe, und vorne auf dem Deckel war ein großer schwarzer Wolf abgebildet, der das Maul weit geöffnet hatte, so dass all seine tödlichen Zähne zu sehen waren.
»Seltsam.« Sie warf es ins Regal und brachte die Arbeit zu Ende.
Als sie vor die Haustür trat, um dort einen Müllsack abzustellen, atmete sie tief die kalte herbstliche Luft ein. Als sie sieben oder acht gewesen war, hatte sie mit ihrer neuen Lupe hier draußen gesessen und kleine Löcher in trockenes Laub oder Papierschnipsel gebrannt, was immer ihr in die Hände gefallen war. Sie hatte herausgefunden, dass Ameisen aufplatzten, wenn man sie mit der Lupe verbrannte, und sie hatte einen unterhaltsamen Nachmitttag damit verbracht, viele verschrumpelte winzige Ameisenleichen auf dem Gartenweg zu hinterlassen, bis ihre Mutter hinausgekommen war und sie dabei erwischt hatte.
Heather hatte eine Woche lang nicht draußen spielen dürfen, im Hochsommer. Und sie konnte sich noch immer so lebhaft an die rasende Wut erinnern, die sie damals empfand, dass ihre Wangen rot wurden. Eingesperrt in ihrem Zimmer, hatte sie sich andere kleine Formen der Zerstörung einfallen lassen – wie zum Beispiel die Teller kaputt zu machen, auf denen ihr die Sandwiches gebracht wurden, oder das Parfüm ihrer Mutter ins Waschbecken zu kippen. Sie war darüber so böse gewesen – was alles nur noch viel schlimmer gemacht hatte.
Deshalb wollte ich nicht, dass Terry mitkommt. Wer möchte schon, dass die erwachsenen Freunde herausfinden, wie man als Kind war? Heather stand in der Kälte und spürte, wie eine weitere Welle der Verzweiflung sie erfasste.
»Die Geister sind einfach viel zu laut.« Sie wischte sich die Hände an der Jeans ab und ging wieder hinein.
Nachdem sie schon mehrere Stunden lang geräumt und sortiert hatte, fiel ihr der Dachboden wieder ein. Sie hatte keine seltsamen Geräusche mehr gehört, doch als sie mit einem Becher Tee in den Händen darunter entlangging, blickte sie unwillkürlich nach oben. Der Mann im Speicher, dachte sie. Als ich klein war, hat ihn Granddad immer für alles verantwortlich gemacht, was abhandengekommen war, egal was.
Das war kein beruhigender Gedanke, und Heather wusste, dass sie oben nachsehen musste. Andernfalls würde sie die ganze Nacht im Bett liegen und auf den Mann im Speicher lauschen – oder noch schlimmer, auf die sanften Schritte ihrer Mutter.
»Herrgott, was ist falsch mit mir? Es gibt keine Monster auf dem Dachboden. Ein paar Tage allein in diesem Haus, und ich verhalte mich wie eine hysterische Fünfjährige.«
Eine Stunde später saß sie im Schneidersitz auf dem Boden des überraschend gemütlichen Raums und sah eine Kiste mit alten Schallplatten durch. Darunter war viel Schund, Bands und Sänger in merkwürdigen Anzügen, die sie nicht kannte, aber auch ein paar vielversprechende: Led Zeppelin, Siouxsie Sioux und David Bowie. Zweifellos die Platten ihres Vaters. Er hatte ihr einmal erzählt, dass er in der Zeit, als er ihre Mutter kennenlernte, seine eigene Band gründen wollte und angefangen hatte, Bassgitarre zu spielen, es aber nie richtig hinbekommen hatte. Heather lächelte zaghaft und legte die Platten beiseite. Sie würde sie entweder behalten oder auf eBay verkaufen. Als sie in der Kiste weiterkramte, stellte sie überrascht fest, dass eine alte, zerbeulte Keksdose unter all den Schallplatten gesteckt hatte. Sie hob sie heraus, öffnete den Deckel und rümpfte die Nase, als ihr Staub entgegenwirbelte. Zwei dicke Bündel Briefe lagen eingezwängt im Innern, verschnürt mit einem Gummiband.