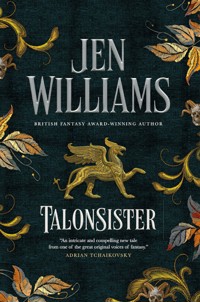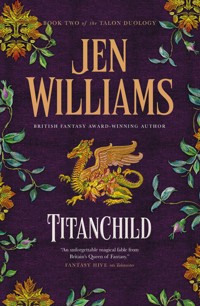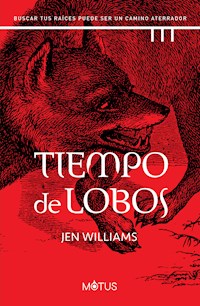9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ronin-Hörverlag, ein Imprint von Omondi GmbH
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: The Winnowing Flame
- Sprache: Deutsch
Wenn die Vergangenheit erwacht, entscheidet eine ungewöhnliche Allianz über das Schicksal der Welt
Die große Stadt Ebora liegt in Trümmern, ihr Glanz ist vergangen, und ihre Bewohner zerfallen im Schatten alter Schuld. Tormalin der Schwurlose, einst Krieger seines stolzen Volkes, sucht Erlösung fern der Ruinen – bis er auf die exzentrische Entdeckerin Lady Vincenza »Vintage« de Grazon trifft. Mit unstillbarer Neugier und unerschütterlichem Charme zieht sie ihn in eine Expedition, die mehr birgt als nur Artefakte und Legenden.
Als die entflohene Hexe Noon, deren feurige Magie ebenso gefährlich wie unkontrollierbar ist, zu ihnen stößt, wird aus einer Suche nach Vergessen ein Kampf um Freiheit, Wahrheit und Hoffnung. Und ein Wettlauf gegen die Dunkelheit beginnt.
Gemeinsam enthüllen sie Geheimnisse, die tief unter vergessenen Städten schlummern, und stoßen auf Spuren einer Bedrohung, die älter ist als das Reich selbst. Schon bald erkennen sie, dass nicht nur Eboras Zukunft, sondern das Schicksal der ganzen Welt in ihren Händen liegt.
Der atemberaubende Auftakt zu einer epischen Fantasy-Trilogie voller Magie, Intrigen und unvergesslicher Helden – packend erzählt von der ersten bis zur letzten Seite.
»Fürchte dich nicht vor dem, was du bist.« – Jen Williams, Der Neunte Regen
__________
Band 1 der preisgekrönten Fantasy-Reihe »The Winnowing Flame« von Jen Williams
Ausgezeichnet mit dem British Fantasy Award für Bester Fantasyroman
Für Fans von Robin Hobb und Andrzej Sapkowski
Ein High-Fantasy-Epos, das in eine einzigartige Welt voller Magie, Monster und unvergesslicher Figuren entführt
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 811
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titel
Widmung
Brief
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Danksagung
Über die Autorin
Weitere spannende Titel im Ronin Hörverlag
Der Lehrling des Feldschers
Die Lügen des Locke Lamora
Impressum
Cover
Inhaltsverzeichnis
Titelseite
Inhaltsbeginn
Impressum
Der Neunte RegenThe Ninth Rain
The Winnowing Flame Buch 1
von Jen Williams
Aus dem Englischenvon Claudia Kern & Björn Sülter
Für Paul
(den meisten als Wills bekannt)
Mit Liebe von deiner Schwester
Mein lieber Marin, du bittest mich, am Anfang zu beginnen, aber du ahnst nicht, was das bedeutet. Anfänge sind sehr schwer zu definieren, fast so schwer wie wahre Enden. Wo soll ich also beginnen? Wie soll man einen Wandteppich wie diesen auftrennen? Natürlich gab es einen Faden, mit dem alles begann, aber dafür muss ich weit ausholen; über den Beginn deines jungen Lebens hinaus und sogar über den Beginn meines eigenen. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt.
Aus den privaten Briefen von Master Marin de Grazon, von Lady Vincenza »Vintage« de Grazon
Prolog
Vor zweihundert Jahren
»Werden wir Schwierigkeiten bekommen?«
Hestillion griff nach der Hand des Jungen und drückte sie kurz. Er sah mit weit aufgerissenen, feuchten Augen zu ihr hoch – seine Angst war nicht zu übersehen. Es kamen nicht viele Menschen nach Ebora – aber Angst hatten sie alle. Sie schenkte ihm ein Lächeln und ging mit ihm ein wenig schneller den hallenden Korridor entlang. Zu beiden Seiten von ihnen hingen riesige Ölgemälde an den Wänden. Sie waren staubig und grau. Einige hatte man wie Leichen mit Laken bedeckt.
»Natürlich nicht, Louis. Du bist doch bei mir, oder etwa nicht? Ich kann im Palast überall hingehen, wo ich will. Und du bist mein Freund.«
»Ich habe gehört, dass die Leute verrückt werden können, wenn sie ihn nur ansehen.« Er hielt inne, als ob er spürte, dass er etwas Falsches gesagt haben könnte. »Eboraner natürlich nicht. Ich meine andere Menschen, die von außerhalb.«
Hestillion lächelte ihm erneut zu. Dieses Mal war es aufrichtiger. So etwas hatte sie in den Träumen der Delegierten gespürt. Ygseril befand sich im Mittelpunkt ihrer nächtlichen Wanderungen. Meist war er unsichtbar, aber doch immer da. Seine Wurzeln krochen aus allen Ecken hervor. Alle hatten Angst vor ihm, dank der bösen Träume, hervorgerufen von den Geschichten und Gerüchten der letzten Jahrtausende. Hestillion hatte sich versteckt gehalten, während sie ihre Albträume erforscht hatte. Die Menschen hatten nur wenig für die eboranische Kunst des Traumwandelns übrig.
»Es ist wirklich ein erschreckender Anblick, das verspreche ich dir, aber er kann dir nichts anhaben.« In Wahrheit hatte der Junge Ygseril bereits gesehen, zumindest teilweise. Der große Schatten des Baumgottes mit seinen silbrigen Ästen ragte über dem Dach des Palastes auf, und man konnte ihn von der Mauer und sogar von den Ausläufern des Gebirges aus erkennen; so hatte man es ihr zumindest gesagt. Der Junge und sein Vater, der Weinhändler, hätten es kaum übersehen können, als sie in Ebora eingetroffen waren. Sie hätten den Baumgott auf ihrer Reise mit den zähen, kleinen Bergponys bestimmt bemerkt, während der Wein rhythmisch in den Holzfässern schwappte. Auch das hatte Hestillion in ihren Träumen gesehen. »Wir sind da, schau.«
Am Ende des Gangs befand sich eine kunstvoll geschnitzte Doppeltür. Einst waren die in das Holz geätzten Phönixe und Drachen mit Goldfarbe bemalt gewesen. Ihre Augen hatten geleuchtet und jeder Zahn, jede Klaue und jede Kralle war aus Perlmutt gewesen. Doch all das war längst abgeblättert oder abgenutzt, staubig und traurig wie alles andere in Ebora. Hestillion lehnte sich mit ihrem Gewicht gegen eine der Türen, die sich langsam öffnete und sie in einen leichten Staubregen hüllte. Im Inneren befand sich die höhlenartige Halle der Wurzeln. Sie wartete, bis Louis sich orientiert hatte.
»Ich ... oh, es ist ...« Er griff nach oben, um seine Mütze abzunehmen, und erinnerte sich dann, dass er sie in seinem Zimmer gelassen hatte. »Lady Hestillion, das ist der größte Ort, an dem ich je gewesen bin!«
Hestillion nickte. Sie zweifelte nicht daran, dass es so war. Die Halle der Wurzeln befand sich in der Mitte des Palastes, der wiederum im Zentrum von Ebora lag. Der Boden unter ihren Füßen bestand aus blassgrünem Marmor, mit Gold geätzt – zumindest hier war es noch nicht abgenutzt –, und darüber spannte sich die Decke als glitzerndes Gitter aus Kristall und fein gesponnenem Blei, das die schwache Sonne des Tages hereinließ. Aus dem Marmor brach auch Ygseril selbst hervor: uralte graugrüne Rinde, gewellt und verdreht, ein verschlungenes Gewirr aus Wurzeln, die sich in alle Richtungen ausbreiteten, und Äste, die blattlos hoch über sie hinausragten und sich durch das kreisrunde Loch im Dach in die Höhe reckten. Dort glitzerten kleine Stücke des blauen Himmels, als würden sie von den Armen Ygserils in Scherben geschnitten. Die Rinde des Baumstamms war faltig und zerknittert, wie die Haut eines ausgetrockneten Leichnams. Was, wie sie fand, durchaus angemessen war.
»Was denkst du?«, wollte sie wissen. »Was hältst du von unserem Gott?«
Louis presste die Lippen zusammen und suchte offensichtlich nach einer Antwort, die ihr gefallen würde. Hestillion hielt ihre Ungeduld im Zaum. Manchmal hatte sie das Gefühl, sie könnte die stotternden Gedanken aus den Köpfen dieser einfältigen Besucher herausreißen. Die Menschen waren ja so einfach gestrickt.
»Er ist sehr schön, Lady Hestillion«, sagte er schließlich. »So etwas habe ich noch nie gesehen, nicht einmal in den tiefsten Rebwäldern. Mein Vater sagt, dass dort die ältesten Bäume von ganz Sarn wachsen.«
»Nun, streng genommen ist er gar kein richtiger Baum.« Hestillion ging mit Louis über den Marmorboden zu der Stelle, an der die Wurzeln begannen. Die Lederstiefel des Jungen gaben seltsame, dumpfe Töne von sich, während ihre Seidenpantoffeln nur ein leises Flüstern vernehmen ließen. »Er ist das Herz, der Beschützer, die Mutter und der Vater von Ebora. Der Baumgott nährt uns mit seinen Wurzeln, er erhebt uns in seinen Zweigen. Als unsere Feinde, die Jure’lia, zuletzt kamen, fiel der Achte Regen von seinen Ästen und das Wurmvolk wurde aus ganz Sarn vertrieben.« Sie hielt inne, schürzte die Lippen und fügte den Rest nur in Gedanken hinzu: Und dann starb Ygseril und überließ uns alle dem sicheren Tod.
»Der Achte Regen, als die letzten Kriegsbestien geboren wurden!« Louis starrte auf den gewaltigen Baumstamm, der sich über ihnen erhob, und ein Lächeln erschien auf seinem rundlichen, aufrichtigen Gesicht. »Die letzte große Schlacht. Mein Vater erzählte, dass die Krieger der Ebora Rüstungen trugen, die so hell waren, dass man sie nicht ansehen konnte. Sie ritten auf den Rücken schneeweißer Greifen und ihre Schwerter loderten wie Feuer. Die große Seuche der Jure’lia-Königin und ihres Wurmvolkes wurde zurückgedrängt, und ihre Giganten riss man in Stücke.«
Er hielt inne. Dank seiner Begeisterung für die alten Schlachtengeschichten hatte er sich in ihrer Gegenwart endlich entspannt. »Der Leichenmond macht mir Angst«, beichtete er ihr. »Meine Oma sagt, wenn er dir zuzwinkert, bist du beim nächsten Sonnenuntergang tot.«
Bäuerlicher Blödsinn, dachte Hestillion. Der Leichenmond war nur ein weiterer zerstörter Gigant, der wie eine Fliege in Bernstein am Himmel hing. Sie hatten mittlerweile den Rand des Marmors erreicht, der von einem Obsidianring eingefasst war. Dahinter verschlangen sich die Wurzeln, die wie gekrümmte Rücken silbergrüner Seeungeheuer in die Höhe ragten. Als Hestillion die Wurzeln betreten wollte, blieb Louis stehen und zog ihre Hand scharf zurück.
»Das dürfen wir nicht!«
Sie sah in seine großen Augen und lächelte. Dann ließ sie ihr blassgolden schimmerndes Haar über eine Schulter fallen und warf ihm den naheliegendsten Köder zu. »Hast du etwa Angst?«
Der Junge verzog das Gesicht, und gemeinsam stiegen sie auf die Wurzeln. Er stolperte, da seine Stiefel zu steif waren, um sich der Struktur der Rinde anzupassen. Hestillion dagegen erklomm diese Wurzeln schon, seit sie laufen konnte. Vorsichtig führte sie ihn weiter hinein, bis sie sich dem gewaltigen Baumstamm selbst näherten und nichts anderes mehr sehen konnten als eine graugrüne Wand aus Graten und Wirbeln. So nah, wie sie nun waren, wollte man fast glauben, Gesichter in der Rinde zu erkennen; vielleicht waren es die traurigen Gesichter all jener Eboraner, die seit dem Achten Regen gestorben waren. Die dichten Wurzeln unter ihren Füßen schlängelten sich spiralförmig in die Dunkelheit hinab. Hestillion kniete sich hin und schlug ihr Seidengewand zur Seite, um es nicht so sehr zu zerknittern. Sie löste ihren breiten gelben Gürtel von der Taille, wickelte ihn um ihren rechten Arm, bedeckte damit ihren Ärmel und zog das Ende unter der Achsel fest.
»Komm, knie dich neben mich.«
Louis sah nun wieder unsicher aus, und Hestillion konnte nahezu jeden Gedanken auf seinem Gesicht ablesen. Ein Teil von ihm sträubte sich gegen die Vorstellung, vor einem fremden Gott zu knien – selbst vor einem toten. Also schenkte sie ihm ihr sonnigstes Lächeln.
»Nur zum Spaß. Und auch nur für einen Moment.«
Er nickte und kniete sich etwas weniger anmutig neben sie auf die Wurzeln. Er drehte sich zu ihr um, vielleicht um eine Bemerkung über die sonderbar glatte Beschaffenheit des Holzes unter seinen Händen zu machen. Doch Hestillion zog das Messer aus ihrem Gewand und hielt es im gedämpften Licht der Halle in die Höhe. Es war so scharf, dass sie es ihm nur an die Kehle drücken musste. Sie bezweifelte, dass er die Klinge überhaupt gesehen hatte, so schnell war alles vorbei. Einen Augenblick später war der Junge auf den Rücken gefallen und sein Blut lief dick und rot über seine Finger. Er zitterte und trat unkontrolliert um sich, ein Ausdruck ohnmächtiger Überraschung auf dem Gesicht. Hestillion lehnte sich so weit zurück, wie sie konnte, und blickte zu den entfernten Ästen hinauf.
»Blut für dich!« Sie atmete langsam ein. Das Blut hatte den Gürtel an ihrem Arm durchtränkt und sickerte schnell in die Seide darunter. So viel zum Thema saubere Angelegenheit. »Lebensblut für deine Wurzeln! Ich verspreche dir das und mehr!«
»Hest!«
Der Schrei kam von der anderen Seite des Flurs. Sie drehte sich um und sah die schlanke Gestalt ihres Bruders Tormalin an der halb geöffneten Tür stehen. In der staubigen Dämmerung wirkte sein schwarzes Haar wie Tinte auf einem Blatt Papier. Selbst aus dieser Entfernung konnte sie den Ausdruck der Besorgnis auf seinem Gesicht erkennen.
»Hestillion, was hast du getan?« Er lief auf sie zu. Hestillion sah auf den Körper des Weinhändlerjungen hinunter, dessen Blut sich schwarz von den Wurzeln abzeichnete, und blickte dann hinauf zu den Ästen. Es war keine Antwort zu hören, keine frischen Knospen oder fließenden Säfte zu erkennen. Der Gott war immer noch tot.
»Nichts«, sagte sie verbittert. »Ich habe überhaupt nichts getan.«
»Schwester!« Er hatte den Rand der Wurzeln erreicht, und sie konnte erkennen, wie er versuchte, sein Entsetzen über ihre Tat zu verbergen. Sein Gesicht war ausdruckslos. Das machte sie nur noch wütender. »Schwester, das ... das haben sie doch schon versucht.«
Kapitel 1
Vor fünfzig Jahren
Tormalin schulterte seinen Rucksack und rückte den Schwertgürtel zurecht. Er konnte deutlich hören, dass sich von hinten eine Kutsche näherte, begnügte sich für den Moment aber damit, sie und die unvermeidliche Konfrontation, die sie mit sich bringen würde, zu ignorieren. Stattdessen fokussierte er sich auf die verlassene Durchgangsstraße vor ihm und den Leichenmond, der silbern im frühen Nachmittagslicht vom Himmel herabschaute.
Einst war dies eine der prächtigsten Straßen der Stadt gewesen. Fast alle Adligen Eboras hatten hier ein oder zwei Häuser besessen. Die Straße war voller Kutschen und Pferde gewesen, erfüllt von Dienern, die Besorgungen machten, und von Karren, die Waren aus ganz Sarn verkauften. Überall konnte man Eboranerinnen treffen, deren Gesichter von Schleiern verdeckt oder deren Haare – je nach Mode der Woche – zu hoch aufragenden, kunstvollen Formen geflochten waren, oder Eboraner, die in Seide gekleidet erlesene Schwerter bei sich trugen. Nun war die Straße in einem erbärmlichen Zustand, und überall wuchs Unkraut aus dem Stein. Es gab hier keine Menschen mehr. Die wenigen Überlebenden waren in Richtung des zentralen Palastes gezogen. Dafür gab es jedoch Wölfe. Tormalin hatte bereits die Anwesenheit einiger gespürt, die seinen Schritten folgten. Sie hielten sich gerade so außer Sichtweite. Alles, was er sah, war ein Paar gelber Augen, die unheilvoll aus den Schatten einer verfallenen Villa starrten. Unkraut und Wölfe – das war alles, was vom glorreichen Ebora noch übriggeblieben war.
Die Kutsche kam näher, und das scharfe Klackern der Pferdehufe durchschnitt schmerzhaft laut die Stille. Tormalin seufzte, immer noch entschlossen, nicht hinzusehen. Weit in der Ferne war die blasse Linie der Mauer zu erkennen. Er würde die Nacht im Wachturm verbringen, wenn er sie erreichte. Wann waren die Wachtürme zuletzt besetzt gewesen? Vermutlich würde das im Palast niemand mehr wissen. Die Blutpest war ihre größte Sorge.
Die Kutsche hielt an, und die Tür schwang klappernd auf. Er hörte niemanden aussteigen, aber sie war schon immer äußerst leichtfüßig gewesen.
»Tormalin!«
Er drehte sich schließlich doch um und verzog das Gesicht zu einem Lächeln. »Schwesterherz.«
Sie trug gelbe Seide, bestickt mit schwarzen Drachen. Die Farbe schmeichelte ihr nicht – das Gelb war zu grell für ihr blasses, goldenes Haar und ihre Haut, die an Pergament erinnerte. Dennoch musste er zugeben, dass nichts auf der zerstörten, von Wölfen bevölkerten Straße heller leuchtete als sie.
»Ich kann nicht fassen, dass du das wirklich tun wirst.« Sie huschte zu ihm hinüber, hielt ihre Robe dabei von ihren Sandalen fern und tänzelte anmutig über die Risse im Boden. »Ich meine, du hast schon einige dumme, egoistische Dinge getan, aber das?«
Tormalin richtete seinen Blick auf den Kutscher, der peinlich bemüht war, sie nicht anzusehen. Er war ein Mann aus dem Flachland, dessen rötliche Haut von einer breitkrempigen Kappe verdeckt wurde. Er war ein menschlicher Diener, sicherlich einer der wenigen, die es in Ebora noch gab. Einen Moment lang fiel Tormalin auf, wie seltsam er und seine Schwester auf ihn wirken mussten; wie fremdartig. Die Eboraner waren größer als die Menschen, langbeinig, aber anmutig, und ihre Haut – welche Farbe sie auch haben mochte – glänzte wie fein gemasertes Holz. Die Menschen sahen im Vergleich dazu fast ... schäbig aus. Und dann waren da natürlich noch die Augen. Die Menschen hatten nie viel für eboranische Augen übriggehabt. Tormalin verzog das Gesicht und wandte seine Aufmerksamkeit wieder seiner Schwester zu.
»Ich spreche schon seit Jahren davon, Hest. Ich habe den letzten Monat damit verbracht, meine Angelegenheiten in Ordnung zu bringen, Karten zu sammeln, meine Reise zu organisieren. Bist du wirklich nur aufgetaucht, um ausgerechnet jetzt deine Überraschung zum Ausdruck zu bringen?«
Sie stand vor ihm, einen ganzen Kopf kleiner als er, und funkelte ihn an. Ihre Augen hatten genau wie seine die Farbe von getrocknetem Blut oder altem Wein.
»Du läufst davon«, sagte sie. »Du lässt uns alle zurück, damit wir hier zu Staub zerfallen.«
»Ich werde viel Gutes für Ebora tun«, antwortete er und räusperte sich. »Ich beabsichtige, zu allen großen Orten der Macht zu reisen. Ich werde neue Handelswege eröffnen und von unserer Notlage berichten. Irgendwann wird man uns helfen.«
»Das ist überhaupt nicht das, was du vorhast!« Irgendwo in der Ferne heulte ein Wolf. »Orte der Macht? Eher zum Rumhuren und Saufen in verrufenen Tavernen.« Sie lehnte sich noch näher zu ihm heran. »Du hast gar nicht vor, wiederzukommen.«
»Dank dir haben wir seit Jahrzehnten keinen anständigen Wein mehr im Palast, und was die Hurerei angeht ...« Er bemerkte ihren Gesichtsausdruck und wandte den Blick ab. »Ach. Nun ja. Ich dachte, ich hätte dich letzte Nacht in meinen Träumen wahrgenommen, kleine Schwester. Du wirst langsam wirklich gut. Ich habe dich nicht gesehen, nicht ein einziges Mal.«
Dieser Versuch der Schmeichelei machte sie nur noch wütender. »In den vergangenen drei Wochen sind die letzten vier Mitglieder des Hohen Rates an Blutpest erkrankt. Lady Rellistin hustet bei jeder Sitzung in ihr Taschentuch, während ihre Haut aufbricht und blutet. Alle anderen, die noch übrig sind, irren im Palast umher und sehen zu, wie wir alle langsam sterben und uns in Nichts auflösen. Dein eigener Cousin Aldasair hat schon vor Monaten aufgehört, mit irgendjemandem zu sprechen, und Ygseril ist ein toter Wächter, der die letzten Jahre von –«
»Und was soll ich dagegen tun?« Mühsam senkte er seine Stimme und sah erneut zum Kutscher hinüber. »Was kann ich tun, Hest? Was kannst du tun? Ich werde nicht hierbleiben und zusehen, wie alle sterben. Ich will nicht mitansehen, wie alles zusammenbricht. Macht mich das zu einem Feigling?« Er hob die Arme und ließ sie dann wieder sinken. »Dann bin ich gerne ein Feigling. Ich will da draußen sein, jenseits der Mauer, und die Welt sehen, bevor mich die Blutpest mitreißt. Ich habe vielleicht noch hundert Jahre zu leben, und ich will sie nicht hier verbringen. Ohne Ygseril –« Er hielt inne und kämpfte gegen eine so starke Welle der Trauer an, dass er sie fast schmecken konnte. »Ohne ihn werden wir verblassen, wir enden schwach, gebrochen und alt.« Er deutete auf die verlassene Straße und die zerstörten Häuser, deren Fenster wie leere Augenhöhlen aussahen. Seine Stimme wurde sanfter. Er wollte sie nicht verletzen, wenn alles ohnehin schon so schwer war. »Was Ebora einst war, Hestillion, existiert nicht mehr. Es ist eine Erinnerung, und sie wird nicht wiederkehren. Unsere Zeit ist vorbei, Hest. Das Alter oder die Blutpest werden uns irgendwann holen. Also komm mit mir. Es gibt so viel zu sehen, so viele Orte, an denen Menschen leben. Komm einfach mit.«
»Tormalin der Schwurlose«, spuckte sie förmlich aus und trat einen Schritt von ihm weg. »So haben sie dich genannt, weil du ein Faulpelz warst, und ich dachte immer: Wie können sie es wagen, meinen Bruder so zu nennen? Sogar im Scherz. Aber sie hatten recht. Du sorgst dich um nichts anderes als um dich selbst, Schwurloser.«
»Ich sorge mich um dich, Schwester.« Tormalin war plötzlich sehr müde, und er hatte noch einen langen Weg vor sich, um vor Einbruch der Nacht eine Unterkunft zu finden. Er wünschte sich, sie wäre ihm nie hierher gefolgt und dass ihre sture Borniertheit ihnen dieses Gespräch erspart hätte. »Du hast recht. Es ist mir nicht wichtig genug, hierzubleiben und euch alle sterben zu sehen. Ich kann das einfach nicht tun, Hest.« Er räusperte sich und versuchte, das Zittern in seiner Stimme zu verbergen. »Ich kann einfach nicht.«
Ein rauer Wind wehte über die Straße und erfüllte die Stille mit dem kalten Geräusch von trockenem Laub, das über den rissigen Stein kroch. Tormalin wurde plötzlich schwindlig, so als stünde er am Rande eines Abgrunds, einer großen Leere, die ihn zu sich zog. In diesem Moment wandte Hestillion sich von ihm ab und ging zurück zur Kutsche. Sie kletterte hinein und das Letzte, was er von seiner Schwester sah, war ihr zarter weißer Fuß in dem gelben Seidenpantoffel. Der Kutscher trieb die Pferde an, die offensichtlich froh waren, wegzukommen, da sie Wölfe in der Nähe witterten. Vor seinen Augen fuhr die Kutsche in zügigem Tempo davon.
Er sah ihr einen Moment lang nach; das einzig Lebendige in einer toten Landschaft, die silbernen Zweige von Ygseril wie eine zu Eis erstarrte Wolke hinter ihnen.
Und dann ging er.
Tormalin hielt auf der Kuppe eines niedrigen Hügels inne. Er hatte die Ruinen der Stadt längst hinter sich gelassen und war seit etwa einem Tag nur noch durch unwegsames Buschland gereist. Hier und da konnte man Überreste alter Karren erkennen, die wie Schlangenknochen im Staub lagen, oder Hütten, die einst Besuchern von Ebora gedient hatten. Tor war beeindruckt, dass sie überhaupt noch standen, auch wenn ein starker Windstoß sie sicher jeden Moment in Stücke reißen konnte. All das waren Überbleibsel aus der Zeit vor den Aaskriegen, als die Menschen noch freiwillig die lange Reise nach Ebora angetreten hatten. Er war damals kaum mehr als ein Kind gewesen. Mittlerweile hatte sich eine tiefviolette Dämmerung über das Buschland gelegt, und am Rande von Eboras zerstörten Grenzregionen ragte die Mauer vor ihm auf. Ihre weißen Steine strahlten im schwindenden Licht als tristes Lila.
Tor schnaubte. Das war es also. Wenn er erst einmal jenseits der Mauer war, würde er auch nicht zurückkehren. Denn trotz allem, was er Hestillion gegenüber behauptet hatte, war er kein Narr. Ebora selbst war eine Krankheit, und sie alle längst infiziert. Er musste hier weg, solange es noch ein paar Vergnügungen zu erleben gab, bevor er selbst zu demjenigen würde, der sich in einem fein eingerichteten Schlafzimmer langsam zu Tode hustete.
Weit rechts ragte ein Wachturm wie ein Reißzahn aus der Mauer und hob sich scharf und zackig gegen den Schatten des Berges ab. Die Fenster waren alle dunkel, doch es war gerade noch hell genug, um die eingemeißelten Stufen zu erkennen. Hatte er erst ein Dach über dem Kopf, würde er ein Feuer machen und sich für den Abend einrichten. Er stellte sich vor, wie er auf einen Beobachter wirken würde: der einsame Abenteurer, der zu unbekannten Orten aufbricht, sein sagenumwobenes Schwert in der Scheide – aber bereit, es beim ersten Anzeichen von Gefahr zu ziehen. Er hob sein Kinn und stellte sich die scharfen Züge seines Gesichts vor, die vom unheimlichen Schein des Sichelmondes erhellt wurden. Sein glänzendes schwarzes Haar, das sogar im Zopf glatt und seidig wirkte. Fast wünschte er sich, er könne sich selbst sehen.
Seine Abenteuerlust beflügelte ihn, und während er die Treppe hinaufstieg, spürte er, wie frische Energie durch seinen Körper strömte. Die Tür des Turms wurde von einem Haufen trockener Blätter und anderer Überbleibsel des Waldes halb offengehalten. Hätte er besser aufgepasst, wäre ihm aufgefallen, dass das Laub vor Kurzem zur Seite geschoben worden und im Turm nicht alles so dunkel war, wie es hätte sein sollen. Doch Tor dachte nur an den Weinschlauch und den in helles Wachs gewickelten Käse in seinem Rucksack. Er hatte sich dieses kleine Festmahl für den Moment aufgespart, wenn er das nächste Mal ein Dach über dem Kopf hätte, und soweit es ihn betraf, war dieser baufällige Turm dafür gut genug.
Er stieg die kreisförmig angeordneten Stufen hinauf zum Turmzimmer. Diese Tür war zwar verschlossen, er konnte sie aber mit dem Ellbogen problemlos aufstoßen und fiel halb hindurch in den runden Raum dahinter.
Bewegung, Scharren und Licht. Er hatte sein Schwert schon halb herausgezogen, als er die schmuddelige Gestalt am hinteren Fenster als Mensch erkannte – es war ein Mann mit dunklen Augen inmitten eines schmutzigen Gesichts. Im Zentrum des Raumes brannte ein kleines, räucherndes Feuer. Die beiden Fenster waren mit zerbrochenen Brettern und Lumpen verdeckt. Nach dem ersten Schreck war er nun eher verwundert; er hatte nicht erwartet, an diesem Ort auf Menschen zu treffen.
»Was tun Sie hier?« Tor hielt inne und steckte sein Schwert zurück in die Scheide. Er sah sich in dem Turmzimmer um. Es schien, als ob der Ort schon mindestens eine Weile bewohnt war – fein säuberlich abgenagte Knochen von kleinen Hühnern lagen überall auf dem Steinboden herum, daneben schmutzige Lumpen, zwei kleine verkrustete Zinnschüsseln und eine halbleere Flasche mit irgendeiner dunklen Flüssigkeit.
Tor räusperte sich. »Was ist los? Können Sie nicht sprechen?«
Der Mann hatte fettiges, hellblondes Haar und einen stoppeligen Bart in derselben Farbe. Er presste sich immer noch an die Wand, ließ dann aber abrupt seine Schultern sinken. Die Energie, die er für die Flucht zusammengerafft hatte, schien ihn verlassen zu haben.
»Wenn Sie nicht sprechen wollen, muss ich mir mit Ihnen das Feuer teilen.« Tor schob mit seinem Stiefel einen Haufen Lumpen beiseite, setzte sich vorsichtig auf den Boden und schlug die Beine übereinander. Als er seinen Weinschlauch herausholen wollte, kam ihm etwas in den Sinn. Wäre er nicht gezwungen, ihn mit dem Mann zu teilen? Er beschloss, ihn noch eine Nacht länger aufzusparen. Stattdessen nahm er seinen Rucksack ab und suchte darin nach seiner kleinen Reiseteekanne. Das Feuer war erbärmlich, aber mit einer Handvoll getrockneter Blätter, die er für diesen Zweck mitgebracht hatte, wurde es schon bald etwas heller. Das Wasser sollte damit zum Kochen zu bringen sein.
Der Mann starrte ihn noch immer an. Tor machte sich daran, etwas von seinem Wasservorrat in eine flache Blechschale zu kippen und in seiner Tasche nach einem der kleinen Teebeutel zu suchen, die er eingepackt hatte.
»Eboraner.« Die Stimme des Mannes erinnerte an ein verrostetes Scharnier und vermischte verschiedene Dialekte des Flachlands, die Tor gut kannte. Er fragte sich, wie lange es her war, dass der Mann überhaupt mit jemandem gesprochen hatte. »Blutsauger. Mörder.«
Tor räusperte sich und passte sich der Sprechweise des Mannes aus dem Flachland an. »Ach, so ist das also?« Er seufzte und lehnte sich zurück. »Ich wollte Ihnen gerade Tee anbieten, alter Mann.«
»Sie nennen mich alt?« Der Mann lachte. »Ausgerechnet Sie? Mein Großvater hat mir Geschichten über die Aaskriege erzählt. Ihr seid Blutsauger. Ihr fresst die Leute auf dem Schlachtfeld bei lebendigem Leib. Das hat mein Großvater mir erzählt.«
Tor musste wieder an sein Schwert denken. Genau genommen befand sich der Mann unerlaubterweise auf eboranischem Land.
»Ihr Großvater dürfte gar nicht mehr am Leben gewesen sein. Die Aaskriege liegen über dreihundert Jahre zurück.«
Keiner von ihnen war damals dabei gewesen, und doch taten sie alle so, als wäre es eine persönliche Beleidigung. Warum mussten sie die Erinnerung weitergeben? Über all die Jahre hinweg gaben sie die Geschichten weiter, so wie sie auch braune Augen und abstehende Ohren weitergaben. Warum konnten sie es nicht einfach vergessen?
»So war es nicht.« Tor stocherte in der Blechschale herum und ärgerte sich darüber, wie verkrampft seine Stimme klang. Plötzlich wünschte er sich, dass die Fenster nicht vernagelt wären. Er saß hier drinnen fest und musste den Gestank des Mannes ertragen. »Keiner wollte ... als Ygseril starb ... er hat uns immer versorgt und genährt. Ohne ihn drohte der Tod unseres ganzen Volkes. Ein langsamer Übergang ins Nichts.«
Der Mann schnaubte belustigt. Erstaunlicherweise kam er jedoch zum Feuer hinüber und hockte sich hin.
»Ja, euer Baumgott ist gestorben und hat euer kostbares Elixier mitgenommen. Vielleicht hättet ihr damals alle sterben sollen, anstatt uns das Blut auszusaugen. Vielleicht hätte das passieren sollen.«
Der Mann ließ sich nieder und musterte Tor mit seinen dunklen Augen, als ob er irgendeine Art von Erklärung erwartete. Eine Erklärung für Generationen von Völkermord.
»Was machen Sie hier oben? Dies ist ein Außenposten. Kein Zufluchtsort für Landstreicher.«
Der Mann zuckte mit den Schultern. Unter einem Haufen Lumpen holte er eine fettverschmierte Silberflasche hervor. Er öffnete sie und nahm einen Schluck. Tor stieg der Geruch von starkem Alkohol in die Nase.
»Ich besuche meine Tochter«, sagte er. »War jahrelang weg. Ich habe Geld verdient und es dann wieder verloren. Zeit, nach Hause zu gehen und zu sehen, was los ist. Sehen, wer noch lebt. Meine Leute hatten eine Siedlung in den Wäldern westlich von hier. Ich kann wohl von Glück reden, wenn ihr Eboraner dort noch jemanden am Leben gelassen habt.«
»Ihr Volk lebt in einem Wald?« Tor hob eine Augenbraue. »In einem ruhigen, hoffe ich?«
Das schmutzige Gesicht des Mannes verzog sich zu einem halbseitigen Lächeln. »Nicht so ruhig, wie wir es gerne hätten, aber wo ist das jetzt schon noch so? Diese Welt ist vergiftet. Oh, wir haben dicke, starke Mauern, machen Sie sich da mal keine Sorgen. Oder zumindest ... hatten wir die damals.«
»Warum haben Sie Ihre Familie für so lange Zeit allein gelassen?« Tor dachte an Hestillion. Das kaum hörbare Scharren der gelben Hausschuhe, der Duft von ihr, der seine Träume durchwehte. Traumwandeln war schon immer ihr besonderes Talent gewesen.
»Ach, ich war damals ein anderer Mann«, antwortete er, als ob das alles erklären würde. »Werden Sie mir mein Blut aussaugen?«
Tor blickte finster drein. »Wie Sie bestimmt wissen, war Menschenblut nicht der Segen, für den man es gehalten hat. Es gibt leider keinen wirklichen Ersatz für Ygserils Elixier. Diejenigen, die es übertrieben haben ... haben dafür gebüßt. Inzwischen gibt es Vereinbarungen. Absprachen mit den Menschen, um die wir uns kümmern.« Er setzte sich ein wenig aufrechter hin. Wenn er einfach zu einem anderen Wachturm gegangen wäre, könnte er jetzt seinen Wein trinken. »Sie werden entschädigt, und wir nehmen das Blut nur noch in ... kleinen Dosen zu uns.« Er sparte aus, dass es kaum eine Rolle spielte – die Blutpest kümmerte sich nur wenig darum, wie viel Blut man zu sich genommen hatte. »Es ist wirklich nicht hilfreich, wenn Sie versuchen, alles so erbärmlich klingen zu lassen.«
Da krümmte sich der Mann vor Lachen, schaukelte hin und her und klammerte sich an seine Knie. Tor schwieg und ließ den Mann gewähren. Er kümmerte sich wieder um die Zubereitung des Tees. Als das Lachen des Mannes zu einem leisen Schniefen verstummt war, holte Tor zwei Tonbecher aus seiner Tasche und hielt sie hoch.
»Werden Sie mit eboranischem Abschaum Tee trinken?«
Einen Moment lang sagte der Mann gar nichts. Sein Gesicht war unbewegt. Das wenige Wasser in der flachen Zinnschale war heiß, also goss Tor es in den Topf und über die verschrumpelten Blätter. Ein warmer, würziger Duft stieg empor, der sich fast umgehend im säuerlich-schweißigen Geruch des Raumes verlor.
»Ich habe Ihr Schwert gesehen«, sagte der Mann. »Es ist ein schönes Schwert. Solche Schwerter sieht man heute gar nicht mehr. Woher haben Sie es?«
Tor runzelte die Stirn. Wollte der Mann andeuten, dass er es gestohlen hatte? »Es war das Schwert meines Vaters. Aus Winnow-geschmiedetem Stahl, wenn Sie es wissen müssen. Man nennt es den Neunten Regen.«
Der Mann schnaubte verächtlich. »Wir haben den Neunten Regen noch nicht erlebt. Der letzte war der Achte. Ich hätte gedacht, Sie würden sich daran erinnern. Warum nennen Sie es den Neunten Regen?«
»Das ist eine lange und komplizierte Geschichte, die ich nicht mit irgendeinem Menschen teilen möchte, der mich bereits mehr als einmal beleidigt hat.«
»Ich sollte Sie töten«, sagte der Mann leise. »Ein Eboraner weniger. Das würde die Welt für meine Tochter sicherer machen, nicht wahr?«
»Sie können es gerne versuchen«, sagte Tor. »Ich glaube allerdings, dass es besser für sie gewesen wäre, ihren Vater in jungen Jahren bei sich zu haben, um ihre Welt sicherer zu machen.«
Das ließ den Mann verstummen. Als Tor ihm den Tee reichte, nahm er ihn entgegen und nickte, vielleicht aus Dank oder Zustimmung. Sie tranken schweigend, und Tor beobachtete die schwarzen Rauchschwaden, die sich unter der Decke kräuselten und durch einen Spalt entwichen. Schließlich legte sich der Mann auf seiner Seite des Feuers hin, mit dem Rücken zu Tor. Dieser nahm an, dass man von einem Menschen wohl nicht mehr Vertrauen bekommen konnte. Er zog seine eigene Bettrolle heraus und machte es sich auf dem steinigen Boden so bequem wie möglich. Er hatte noch einen weiten Weg vor sich und wahrscheinlich würden ihn auch noch schlimmere Orte zum Schlafen erwarten.
Tor erwachte in stickiger Dunkelheit. Nur ein feiner, grauer Lichtstreifen am Rand des Fensters verriet ihm, dass der Morgen dämmerte. Der Mensch schlief noch immer neben der Glut des Feuers. Tor raffte seine Sachen zusammen, bewegte sich so leise wie möglich und blieb schließlich über den Mann gebeugt stehen. Die Falten in seinem Gesicht sahen unglaublich tief aus, als hätte er schon tausend Leben gelebt anstatt der lächerlich kurzen Zeit, die man den Menschen zugestand. Er fragte sich, ob der Mann seine Tochter wiedersehen würde oder ob er überhaupt eine Tochter hatte. Würde sie ihn noch kennen wollen? Manch abgebrochene Bande ließen sich nicht wieder kitten. Ohne groß darüber nachzudenken, nahm er ein Päckchen Tee aus seinem Rucksack und legte es neben den ausgestreckten Arm des Mannes, wo er es bemerken würde, sobald er aufwachte. Zweifellos würde der Tee ihm besser bekommen als die gefährliche Substanz in seiner Silberflasche.
Draußen erhellte ein schwaches Licht aus dem Osten die Welt, und sein Atem bildete eine Wolke, als er dieses Mal die Stufen auf der anderen Seite der Mauer hinunterging. Er versuchte, sich darüber zu freuen – schließlich ging er damit über die Grenze von Ebora hinaus, und das für immer. Aber sein Rücken war steif von der Nacht auf den kalten Steinen, und alles, woran er denken konnte, war, wie froh er sein würde, die Mauer nicht mehr sehen zu müssen. Seine Träume waren von halb verdeckten, aus rotem Stein gemeißelten Gesichtern heimgesucht worden, von denen er wusste, dass sie im Inneren hohl und verrottet waren. Das hatte nicht gerade für einen erholsamen Schlaf gesorgt.
Dichter, tiefgrüner Wald bedeckte die andere Seite der Mauer. Er hatte sich wie eine Flutwelle bis an die Steine herangepirscht. Schnell verlor sich Tor in diesem Wald, und als die Mauer außer Sichtweite war, spürte er, wie die Anspannung aus seinem Körper wich. Sein stetiger Aufstieg würde ihn zu den Ausläufern des Tarahüttengebirges und von dort aus direkt zum westlichen Pass führen.
Um die Mittagszeit wurden die Bäume lichter und der Boden felsiger. Tor drehte sich um und wurde vom Anblick Eboras, das sich unter ihm ausbreitete, wie ein mondsüchtiger Hase erfasst. Die verfallenen Gebäude der äußeren Stadt waren staubgrau und zerstört, die Straßen kaum mehr als Kinderzeichnungen im Dreck. Bäume und Gestrüpp hatten die Gehwege überwuchert und schimmerten wie dunkle Wunden des Bösen, während über dem fernen Palast die stille Gestalt Ygserils wie ein silbernes Gespenst wirkte, dessen kahle Äste am Himmel kratzten.
»Warum hast du uns verlassen?« Tor leckte sich über die Lippen, sein Mund war plötzlich trocken. »Siehst du überhaupt, was du getan hast? Siehst du es?«
Der Baumgott war so tot wie der Leichenmond, der am Himmel über ihm hing und schwieg. Tormalin der Schwurlose wandte dem großen Baum den Rücken zu und ging in der aufrichtigen Hoffnung davon, Ebora nie wieder sehen zu müssen.
Kapitel 2
Vor fünf Jahren
Du fragst mich, lieber Marin, wie ich mich mit einem so offensichtlichen Unruhestifter einlassen konnte (natürlich mit deinem üblichen Taktgefühl – ich freue mich, dass meine Schwester immer noch Geld für dein Pensionat verschwendet). Ich fand ihn, wenn du es denn so genau wissen musst, sturzbetrunken vor einer Taverne. Neben ihm lagen mehrere leere Flaschen im Staub. Es war ein schwüler Tag, und er hatte sein Gesicht der Sonne zugewandt und genoss sie wie eine Katze. Auf dem Boden, ein paar Zentimeter von seinen langen Fingern entfernt, lag das schönste Schwert, das ich je gesehen hatte. Es war dick beschmiert mit teilweise geronnenem Blut. Nun ja. Du weißt ja, wie selten es ist, einen Eboraner zu sehen, Marin, also sagte ich zu ihm: »Mein Lieber, was bei Sarns gesegneten Knochen hast du getrieben?« Er grinste mich an und sagte: »Wild gewordene Monstrositäten getötet. Jeder hier hat mir für meine Dienste einen Drink spendiert. Gibst du mir auch einen aus?«
Ich frage dich also, wie könnte man einen so offensichtlichen Unruhestifter nicht lieben? Manchmal frage ich mich, ob wir nicht doch alle vom selben Blut sind.
Aus den privaten Briefen von Master Marin de Grazon, von Lady Vincenza »Vintage« de Grazon
Vintage hob die Armbrust und genoss das vertraute Gewicht in ihren Händen. Nach einigem Gerangel hatte sie sich einen dicken Ast auf halber Höhe eines Baumes gesichert und konnte in etwa fünfzehn Metern Entfernung den Erbsenkrabbler im gegenüberliegenden Weinstock erkennen, ohne dass ein Hindernis zwischen ihm und dem Pfeil in ihrer Armbrust lag. Er war ein großer, sich langsam bewegender Bastard, eher wie eine Blattlaus, aber von der Größe eines Katers, mit dunkelgrünen Flecken auf der glitzernden Haut – eine echte Laune der Natur. Er hing an einer Ranke und riss mit seinem durchsichtigen Kiefer voller Eifer an den fetten, violetten Weintrauben, die er zwischen seinen Vorderbeinen eingeklemmt hielt. Es waren ihre Weintrauben. Trauben, die sie fast dreißig Jahre lang kultiviert und angebaut, verfeinert und sortiert hatte, bis ihre Früchte – und was noch wichtiger war, deren Wein – als die besten gegolten hatten, die je aus den Weinwäldern gekommen waren.
Und der kleine Bastard kaute gedankenlos darauf herum. Ohne jede Wertschätzung.
Vintage zielte und drückte den Abzug der Armbrust. Sie wusste um die Anspannung, die sich dadurch in ihren Armen aufbauen würde. Trotzdem flog der Pfeil zielsicher und leicht. Der Erbsenkrabbler zerplatzte wie ein prallgefüllter Ballon aus Haut und besprenkelte Reben und Ranken mit wässrigen Eingeweiden. Vintage verzog das Gesicht, wenngleich sie auch einen Hauch von Genugtuung verspürte; die Armbrust, die ihr Bruder vor so vielen Jahren entworfen hatte, funktionierte noch immer.
Sie befestigte die Waffe wieder an ihrem Gürtel und glitt den Baumstamm hinunter, ohne sich um ihre bereits mehrfach geflickte Lederhose zu sorgen. Dann bahnte sie sich einen Weg durch das Laub bis zu der Stelle, an der der Erbsenkrabbler sein unschönes Ende gefunden hatte. Dem Schaden an der Pflanze nach zu urteilen, hatte die Kreatur einen Großteil des Tages damit verbracht, sich durch ihre Trauben zu fressen – und zur Abwechslung sogar ein wenig an der Rebe selbst genagt. Es handelte sich um die Gilly-Rebe, eine besonders robuste Pflanze mit Ästen, die stellenweise den Umfang ihrer Oberschenkel aufwiesen, und Trauben, die so groß wie eine Faust werden konnten. Und doch konnten selbst sie einen anhaltenden Befall mit Erbsenkrabblern nicht überstehen.
»Ein Ärgernis«, murmelte sie leise vor sich hin. »Genau das bist du.«
Es waren keine Krabbler mehr zu sehen, doch der Anblick ihrer dezimierten Trauben bescherte ihr trotzdem ein flaues Gefühl in der Magengegend. Es sollte hier gar keine Erbsenkrabbler geben, nicht in diesem unberührten Teil des Rebenwaldes. Dies war ein ruhiger Ort, so frei von Gefahren, wie man es in Sarn nur sein konnte – sie hatte viele Jahre damit verbracht, dafür zu sorgen.
Vintage zog sich den Hut mit der breiten Krempe tiefer ins Gesicht, wandte sich ab und ging in Richtung Westen, wo sie einen ganz bestimmten Aussichtsbaum kannte. Sie war davon überzeugt, dass sie sich viel zu viele Gedanken machte und dass sie mit zunehmendem Alter immer paranoider wurde.
Allerdings war sie noch nie gut darin gewesen, ihren Impulsen zu widerstehen.
Der Wald war stickig und grün und summte vor Leben. Sie spürte es auf ihrer Haut und schmeckte es auf der Zunge – lebendig und stets im Wachstum. Ringsherum ragten die hohen, dicken Stämme der Weinreben auf, die meisten länger als zwei Männer, die mit Kopf und Fuß aneinanderlagen. Ihre verschlungenen Äste wanden sich umeinander wie betrunkene Herren, die sich nach einer besonders harten Nacht mit zu viel Branntwein gegenseitig festhielten. Und die Reben schlangen sich um sie herum; riesige, pralle Früchte, wohin sie auch blickte – violett und rosa und rot, blassgrün und tiefgelb. Einige versteckten sich im Schatten und andere glühten in den heißen Sonnenstrahlen, die es bis hier herunterschafften.
Gerade hatte sie die sich abzeichnende Form des Ausgucks mit der leuchtend roten Farbe in der Mitte entdeckt, als sie etwas durch das Unterholz auf sich zukommen hörte. Instinktiv griff sie nach der Armbrust an ihrem Gürtel, doch die Gestalt, die rechts von ihr aus dem Gebüsch auftauchte, hatte ein schmales, weißes Gesicht und blondes Haar, das ihr auf der schweißnassen Stirn klebte. Vintage seufzte.
»Was machst du hier draußen, Bernhart?«
Der Junge sah sie verblüfft an. Er war, wenn sie sich recht erinnerte, etwa elf Jahre alt und das jüngste Mitglied ihrer Belegschaft. Er trug weiche Kleidung aus braunem und grünem Leinen, und ein kurzer Bogen baumelte über seinem Rücken. Er hatte nur vergessen, seinen Hut aufzusetzen.
»Lady Vincenza, Master Ezion hat mich gebeten, Sie zu suchen.« Er holte tief Luft und wischte sich mit einer Hand über die schweißnasse Stirn. »Es gibt etwas im Haus zu erledigen, wofür man Sie braucht.«
Vintage schnaubte. »Etwas Geschäftliches? Warum sollten sie mich dafür brauchen? Ich habe Ezi schon vor Jahren gesagt, dass er solche Dinge selbst regeln kann.« Sie kniff die Augen zusammen. »Sie wollen mich nicht hier draußen im Rebenwald haben. Ist es nicht so, mein Junge?«
Sein verschwitztes Gesicht lief zartrosa an, und als er sprach, starrte er wie versteinert auf ihren rechten Ellbogen. »Sie sagten, es sei sehr wichtig, Mylady.«
»Bernhart, sag mir eins: Wer sorgt dafür, dass es am Vorabend des Mondfestes Honiggebäck für all die kleinen Lümmel gibt?«
Bernhart räusperte sich. »Sie sagten, Sie seien schon seit Tagen hier draußen, und dass es sich für eine Dame Ihres Alters nicht ziemen würde, Mylady.«
Vintage brach in Gelächter aus. »Bernhart, bitte versprich mir eins: Wenn du irgendwann erwachsen bist, habe bitte so viel gesunden Menschenverstand, um eine Frau von vierzig Jahren nie mit dem Ausdruck ›eine Dame Ihres Alters‹ zu bezeichnen. Ich garantiere dir, dass das nicht gut für dich ausgehen würde, mein Lieber.« Sie seufzte und betrachtete sein blasses Gesicht und die viel zu rosigen Wangen. »Komm mit mir. Ich möchte einen Blick vom Aussichtsbaum werfen. Wirst du mich begleiten, junger Mann? Es scheint, als ob meine alten Knochen deine Hilfe brauchen könnten.«
Bernhart grinste schief. »Darf ich vielleicht einmal Ihre Armbrust ausprobieren?«
»Fordere dein Glück lieber nicht heraus.«
Der Aussichtsbaum verfügte am Stamm über eine Reihe grob gesägter Holzbretter, was das Klettern einfacher gestaltete als bei ihrem vorherigen Ausguck – obwohl dieser hier viel höher war. Als sie die schlichte Aussichtsplattform schließlich erreichten, konnten sie weit über den Wald blicken. Das dunkle Grün der Baumkronen breitete sich unter ihnen wie eine zerknitterte Decke aus, und die fernen Berge waren nur als grauer Schatten am Horizont zu erkennen. Inmitten all dieses üppigen Lebens lag ein gewaltiges Gebiet verzerrter Eigentümlichkeit. Vintage brauchte den Jungen gar nicht anzusehen, um zu wissen, dass auch er es anstarrte.
»Wächst es?«, fragte er nach einer Weile.
»Zweimal im Jahr gehen wir zur Grenze hinunter«, sagte sie leise. »Wir gehen alle zusammen: unsere Stärksten, unsere Klügsten und unsere Mutigsten. Dann drängen wir das Wachstum zurück und düngen den Boden mit Salz. Marin, die Götter seien ihm gnädig, bringt sogar seine Priesterfreunde mit, und sie segnen den Boden.« Sie seufzte. »Aber trotzdem wächst es, Jahr für Jahr.«
»Aber es ist doch tot«, sagte Bernhart. »Es ist ein totes Ding. Nichts darin kann mehr am Leben sein.« Er hielt inne, und Vintage fragte sich, ob seine Mutter ihm das erzählte, wenn er einen besonders schlimmen Albtraum gehabt hatte. Das Haus befand sich zwar nicht in der Nähe der Wildnis, aber offenbar nahe genug für schlechte Träume. »Es ist nur die leere Hülle eines Giganten. Warum macht sie den Wald ...« Er hielt inne und rang nach dem richtigen Wort. »Warum macht sie den Wald krank?«
»Sie zieht Parasitengeister an«, entgegnete Vintage. Sie nahm das Fernrohr von ihrem Gürtel und hielt es ans Auge. Das zerstörte Waldstück wirkte plötzlich viel näher, und sie runzelte die Stirn, als sie über die geschwärzten Äste und den wabernden Nebel blickte. »Es ist längst tot, Bernhart. Nur noch die leere, zerstörte Hülle eines Jure’lia-Schiffes. Aber es ist wie eine Leiche, die Fliegen anzieht. Die Parasitengeister werden davon angelockt. Wenn wir wüssten, warum oder wie, oder was sie wirklich sind ...« Sie ließ das Fernrohr sinken und biss sich auf die Lippe. »Ich wollte schon immer mehr über sie und ihre Verbindung zum Wurmvolk herausfinden. Es steht so wenig über die Jure’lia geschrieben, und die Eboraner haben sich immer sehr bedeckt gehalten, wenn es um ihre regelmäßigen Auseinandersetzungen mit ihnen ging. Alles, was wir noch haben, sind die Überreste ihrer Giganten und eine Menge sehr unangenehmer Geschichten. Wenn die Eboraner doch nur etwas ... kontaktfreudiger wären. Aber natürlich haben sie heutzutage überhaupt keine Zeit mehr für Menschen.« Sie kräuselte die Lippen, als ein Gesicht aus der Vergangenheit unaufgefordert in ihrem Kopf auftauchte – Augen in der Farbe von getrocknetem Blut, ein sardonisches Lächeln und die Erinnerung an ihre Hände. Ihre Berührungen waren immer so warm gewesen. Nur mit Mühe gelang es Vintage, sich von den angenehmen Gedanken loszureißen.
»Ihr habt sicher jedes Buch, das je darüber geschrieben wurde, Mylady. Über die Wildnis, das Wurmvolk und die Parasitengeister«, sagte Bernhart. »In Eurer Bibliothek, meine ich.«
Vintage lächelte und legte kurz ihre Hand auf das Gesicht des Jungen. Ihre Finger zeichneten sich tiefbraun auf seiner weißen Wange ab. »Es gibt größere Bibliotheken als meine, Bernhart. Und ich vermute, dass ich das, was ich wissen will, nicht in einem Buch finden kann. Genau genommen –«
Sie spürten und hörten es gleichzeitig; ein leises Grollen, das unangenehm in ihrer Brust vibrierte. Eher unwillkürlich blickte Vintage zurück in den wilden Teil des Waldes. Dort, wo es am dunkelsten war, erzitterten die Baumkronen, die geschwärzten Blätter raschelten. Eigentlich hätten sie es aus dieser Entfernung gar nicht hören können, aber sie vernahmen es trotzdem: ein nüchternes, hohles Geräusch, wie das Rauschen von Wasser auf trockenem Boden. Ein durchscheinender, schmutzig-gelber Umriss schob sich kurz zwischen den oberen Ästen der Bäume hervor. Dunkle Flecken auf dem Rücken der Gestalt und mehrere Wedel mit seltsamen weißen Lichtern an ihren Enden waren zu erkennen. Der Parasitengeist drehte sich für einen Moment in die Luft und streckte seine Wedel blindlings in den hellen Himmel über ihm, dann sank er wieder in die Tiefe. Sein seltsam grollender Schrei schwand mit ihm.
»Zur Hölle mit den Göttern, das kann kein gutes Omen sein.« Vintage schaute den Jungen an und sah, dass er ganz still dastand und die Augen weit aufgerissen hatte. Die Röte auf seinen Wangen war verschwunden. Sanft berührte sie seine Schulter, und er zuckte zusammen, als würde er aus einem Traum aufwachen. »Weißt du, ich hätte wirklich Lust, Ezion das Fell über die Ohren zu ziehen, weil er dich allein hierhergeschickt hat. Komm, Bernhart, wir bringen dich nach Hause. Ich lasse dir vom Koch ein paar Honigkuchen machen.«
Sie hatten sich im Speisesaal versammelt. Das beste Besteck und Porzellan lag auf dem Tisch aus Weinholz ausgebreitet. Es schien fast, als warteten sie darauf, dass der Imperator persönlich auf ein Rosinenbrötchen vorbeikam. Die Familienmitglieder von Vintage trugen trotz der Hitze ihre besten Seiden- und Satinkleider. Sie beobachtete mit besonderem Vergnügen ihre Gesichter, als sie zum Tisch schritt und ihre festen Stiefel laut auf dem polierten Boden aufschlagen ließ. Vintage nahm ihren Hut ab und warf ihn auf den Tisch, während ihre Augen bereits die Leckereien musterten, die die Bediensteten für das Abendessen vorbereitet hatten. Direkt hinter ihr lungerte Bernhart in der Tür herum. Obwohl sie ihm gesagt hatte, dass er gehen könne, war er unwillig, den Schauplatz eines sich anbahnenden Streits zu verlassen.
»Ist noch etwas von dem guten Käse übrig?«, fragte sie und zog mit staubigen Fingern einen Teller zu sich heran. »Der mit den Beeren drin?«
»Schwester.« Ezion erhob sich langsam. Er trug eine dunkelblaue Seidenjacke über dem gestärkten Hemdkragen, und seine dunklen Augen funkelten vor Ungeduld. »Ich bin froh, dass du zu uns zurückgekehrt bist. Vielleicht möchtest du dich für das Abendessen umziehen?«
Vintage sah sich am Tisch um. Der Blick von Carla, Ezions Frau, traf ihren mit kaum zu bändigender Freude, und Vintage zwinkerte ihr zu. Die Frau war mal wieder hochschwanger, ihr runder Bauch dehnte das exquisit geschneiderte Kleid bis zum Äußersten, während die verschiedenen Nichten und Neffen von Vintage mit Besteck und Tellern klapperten.
»Ich glaube, ich fühle mich wohl, wie ich bin, Ezi.« Sie streckte die Hand aus und hob eines der winzigen Gebäckstücke mit den Fingern auf, wobei sie den kleinen Finger ausstreckte, als würde sie eine feine Porzellantasse halten. »Was hast du dir eigentlich dabei gedacht, Bernhart allein in die Reben zu schicken?«
Ezion runzelte für jeden erkennbar die Stirn. »Er ist ein Diener, Vincenza. Ich habe angenommen, dass es zu seinen Aufgaben gehört, derartige Dinge zu tun.«
Vintage erwiderte das Stirnrunzeln, drehte sich wieder zur Tür um und hielt dem wartenden Jungen das kleine Gebäckstück hin. »Hier, Bernhart, nimm das und mach dir einen schönen Tag. Ich bin sicher, du kannst noch ein paar Pfeile mit hübschen Federn ausstatten.«
Bernhart warf ihr einen unsicheren Blick zu. Der sich anbahnende Streit schien ihn mehr zu interessieren als die Süßigkeit, doch schließlich entschied er sich für das Gebäck. Er nahm ihr das Stück aus den Fingern und verließ den Raum, nicht jedoch, ohne die Tür sorgfältig hinter sich zu schließen.
»Der Junge wird eines Tages die Reben für uns pflegen. Du weißt, es ist seine Aufgabe, dort draußen zu sein, Vincenza. Wenn wir nicht –«
»Die Wildnis breitet sich aus«, unterbrach sie ihn. »Und wir haben heute einen Parasitengeist gesehen, der sich über die Baumkronen erhob. Er war wirklich sehr groß.«
Ein paar Momente lang erwiderte Ezion nichts. Seine Kinder beobachteten das Geschehen mittlerweile mit großen Augen. Sie waren mit den Geschichten über den kranken Wald aufgewachsen, auch wenn beim Abendessen nicht oft darüber gesprochen wurde.
»Alles ist unter Kontrolle«, sagte er schließlich mit monotoner Stimme. »Wir beobachten es. Da gibt es nichts, worüber man sich Sorgen machen muss. Deshalb kannst du auch im Haus bleiben und musst nicht in den Wäldern herumschleichen. Du hast dich zu sehr aufgeregt.«
Vintage verspürte einen schmerzenden Stich der Wut, doch Carla ergriff das Wort.
»Wie kann es sich ausbreiten, Vin? Müssen wir die Grenzen vielleicht häufiger kontrollieren?«
Vintage schürzte ihre Lippen. »Ich weiß es nicht. Das ist genau das Problem. Wir wissen einfach nicht genug darüber.« Sie holte tief Luft und bereitete sich darauf vor, einen alten Streitpunkt wieder aufleben zu lassen. »Ich werde im Frühjahr gehen. Ich habe schon viel zu lange gewartet, aber es ist noch nicht zu spät. Ezion, mein Lieber, wir müssen Nachforschungen anstellen, müssen in die Welt hinausgehen und herausfinden, was wir können. Es gibt da draußen außerhalb unserer eigenen Wälder einige Stätten mit alten Giganten, von denen ich lernen kann. Wir müssen mehr über die Wildnis und die Parasitengeister erfahren. Genug mit dem Lesen und dem Schmökern in alten Büchern. Ich muss gehen.«
Ezion gluckste vor Lachen, was ihm überhaupt nicht gut zu Gesicht stand. »Nicht das schon wieder. Es ist lächerlich. Du bist eine vierzigjährige Frau, Vincenza, und zudem das Oberhaupt dieser Familie! Ich werde ganz sicher nicht zulassen, dass du quer durch Sarn nach Gott weiß wohin läufst.«
»Genau so ist es! Ich bin eine vierzigjährige Frau, die ihr ganzes Leben damit verbracht hat, diesen Ort zu führen, diese Reben anzubauen und diesen Wein herzustellen.« Sie deutete grimmig auf die Glaskelche, die alle mit dem blassgoldenen Wein gefüllt waren, der aus der Traube Farrah’s Folly hergestellt wurde. Das konnte sie an der Farbe erkennen. »Und ich habe genug davon. Für all das hier«, sie breitete die Arme aus, »bist ab sofort du verantwortlich, Ezion. Und nicht mehr ich.«
Sie nahm ihren Hut vom Tisch und setzte ihn sich wieder auf den Kopf, bevor sie aus dem Zimmer stürmte und die Tür so fest zuschlug, dass man noch draußen das Besteck klappern hörte.
Im Korridor lehnte sie sich kurz an die Wand und war überrascht, wie stark ihr Herz klopfte. Das war die Wut, sagte sie sich. Dann tauchte Bernharts Kopf hinter einer Ecke auf.
»Geht es Ihnen gut, Mylady?«
Sie hielt inne. Ein langsames Kribbeln arbeitete sich von ihren Zehen nach oben. Es fühlte sich an, als stünde eine große Veränderung bevor. Wie die Schwere in der Luft, wenn ein Sturm aufzog. Niemand würde sie jetzt noch aufhalten können.
»Mir geht es gut, Bernhart, mein Lieber.« Sie grinste ihn an und freute sich, dass der Junge zurücklächelte. »Hol mir meine Reisetaschen aus dem Lager, Junge. Ich werde verdammt noch mal sofort aufbrechen.«
Kapitel 3
Jetzt
Die Droge Akaris wird hergestellt, indem man eine bestimmte Kombination aus Substanzen auf extreme Temperaturen erhitzt, dann abkühlt, rührt und siebt. Nur das Winnowfeuer kann die erforderlichen Temperaturen erzeugen und scheint die Substanzen auch auf andere, weniger offensichtliche Weise zu beeinflussen. Akaris wird nur an einem einzigen Ort hergestellt: in der Winnowry auf der Insel Corineth, vor der Küste von Mushenska. Auch an anderen Orten wurde versucht, die Droge mit Hilfe von eigenen, illegalen Finsterhexen herzustellen, doch nahmen all diese Versuche ein abruptes und ziemlich unangenehmes Ende. Die Winnowry, so sagt man, ist rücksichtslos, wenn es darum geht, ihre eigenen Interessen zu schützen.
Was die Droge selbst betrifft: In ihrer reinen Form versetzt sie den Konsumenten in einen tiefen und traumlosen Schlaf (der wertvoller ist, als man denkt). In Verbindung mit verschiedenen Stimulanzien jedoch, von denen es in Sarn eine große Auswahl gibt, führt sie zu einer Art Wachtraum. Allen Berichten zufolge sind die Träume unter dem Einfluss von gepanschtem Akaris äußerst lebendig, wild und oft nervenaufreibend.
Auszug aus den Tagebüchern von Lady Vincenza »Vintage« de Grazon
Noon wachte auf. Irgendwo unten stritt jemand. Sie glitt aus ihrem schmalen Bett und warf einen Blick aus dem winzigen, verschmierten Fenster. Draußen war es wieder einmal bedeckt, ein einziges Grau, von oben bis unten. Sie ging zu den Gitterstäben ihrer Zelle hinüber. Es gab wenig zu sehen. Die riesige Leere, das Herz der Winnowry, breitete sich direkt unter ihr aus. Auf der anderen Seite befand sich die nördliche Wand mit Zellen, die alle identisch mit ihrer waren; gehauen aus totem schwarzen Fels, die Böden und die Decken nicht mehr als Gitter aus massivem Eisen. In der Winnowry war es immer düster, die winzigen Fenster in dicken Schichten mit Blei und Wachs verschmiert, und die Öllampen in den Gängen spendeten nur ein nebliges, gelbstichiges Licht.
Noon lehnte sich gegen das Gitter und lauschte. Die meiste Zeit war die Winnowry erfüllt von der Stille Hunderter Frauen, die in Angst lebten – vor sich selbst und voreinander.
»Sprich leiser, Finster-Anya«, war die flüsternde, auf sonderbare Weise metallisch klingende Stimme einer der Schwestern zu hören. Man konnte ihre Anspannung erkennen.
»Das werde ich nicht!« Anya war eine der älteren Finsterhexen, doch ihre Stimme klang an diesem Morgen nicht nur wegen ihres Alters brüchig. Die Frau war schon seit fast zwanzig Jahren hier, doppelt so lange wie Noon. Noon konnte sich kaum vorstellen, wie das war. Aber sie fürchtete, dass sie es herausfinden würde.
»Was kannst du schon tun? Was kannst du mir antun? Es wäre besser für mich, tot zu sein – für uns alle.« Die Stimme der Frau hallte durch den weiten Raum und wirkte dabei wie ein Echo, als wäre sie gefangen.
Anya stammte aus Reidn, einem riesigen Stadtstaat weit im Osten, den Noon noch nie gesehen hatte, und sie sprach in der dort üblichen, irgendwie beruhigend-beschwingten Sprache. Finsterhexen konnten überall geboren werden. Die Winnowry war voller Frauen aus ganz Sarn, und in den letzten zehn Jahren hatte Noon all ihre Sprachen kennengelernt. Das war, wie sie betreten feststellte, der einzig positive Nebenaspekt an diesem Ort.
»Niemand wird dich töten, Finster-Anya.« Die Schwester, die zu ihr sprach, benutzte die für die meisten in Sarn übliche Flachlandsprache. Sie wählte ihre Worte ruhig und mit Bedacht – vielleicht in der Hoffnung, so den Eindruck zu erwecken, dass alles in Ordnung war und an diesem Ort nichts außer Kontrolle geraten konnte. Ihr Gebrauch der verbreiteten Sprache deutete zudem darauf hin, dass sie wollte, dass jeder das wusste.
»Oh nein, ich bin zu nützlich! Wenn du mich tötest, hast du eine Sklavin weniger, um deine Droge herzustellen.« Ein Krachen und das Klappern von Eisen waren zu hören. Finster-Anya warf sich gegen die Gitterstäbe. Noon blickte durch das Eisengitter direkt nach unten und sah Finster-Marians blasses Gesicht, wie es aus der Zelle zu ihr hinaufblickte. Die Tätowierung mit dem Fledermausflügel auf ihrer Stirn schien fast zu leuchten und wirkte dadurch wie von ihrem Körper getrennt. Noon berührte unbewusst ihre eigene Stirn, da sie wusste, dass das gleiche Zeichen auch in ihre Haut eingebrannt war.
»Was macht sie da?«, flüsterte Marian. Noon schüttelte nur den Kopf.
»Du wirst dich beruhigen, Finster-Anya. Beruhige dich sofort, oder ich unternehme etwas.«
Ein bestürztes Gemurmel war von der anderen Seite der Winnowry zu hören. Der ganze Ort erwachte, und jede Finsterhexe lauschte, um mitzubekommen, was als Nächstes passieren würde.
Noon drückte sich gegen die Gitterstäbe. »Hey! Lass sie in Ruhe!« Ihre Stimme, die eher an Flüstern und das Sprechen leiser Worte gewöhnt war, überschlug sich, als sie schrie: »Lass sie einfach in Ruhe!«
»Ich soll mich beruhigen? Versuch es doch!«, schrie Finster-Anya. Das rhythmische Schlagen ihres Körpers gegen die Gitterstäbe hallte schrecklich laut durch das riesige Nichts. Noon presste die Lippen aufeinander und spürte, wie ihr eigenes Herz schneller schlug. Solch unkontrollierte Wut war in der Winnowry nicht erlaubt. So etwas gehörte zum Schlimmsten, was sie tun konnten.
Und dann tauchte unfassbarerweise ein grünlich-blaues Licht in der Düsternis auf, das ihr Gefängnis erhellte.
Noon taumelte von den Gitterstäben zurück, als sie Marian unter sich keuchen hörte.
»Feuer und Blut! Oh, jetzt hat sie es geschafft«, murmelte Noon. »Sie hat es verdammt noch mal geschafft.«
Aus den anderen Zellen ertönten Rufe, von unten war ein gellender Schrei zu hören. Irgendwo musste jemand den Hebel betätigt haben, denn einer der riesigen Wassertanks, die über ihnen aufgereiht waren, kippte zur Seite. Ein Schwall von Wasser, schwarz und silbern im schwachen Licht, stürzte herunter durch die Zellen auf der gegenüberliegenden Seite und rauschte durch die Eisengitter, sodass jede Finsterhexe auf dieser Seite der Winnowry von einem Moment auf den anderen klitschnass war. Die Frauen schrien auf – das Wasser war eiskalt – und das Winnowfeuer, das gerade so außer Sichtweite war, erstarb. Noon zitterte, als ein feiner Nebel aus Wassertröpfchen auf sie zuflog, und wich ein paar Schritte zurück. In der empörten Kakophonie aus den Stimmen von fünfzig plötzlich durchnässten Frauen konnte sie nicht hören, was mit Finster-Anya geschah, aber sie vernahm das Klirren einer Zellentür von irgendwo unter ihr.
»Es wird eine Woche dauern, bis sie den Tank wieder auffüllen können«, sagte Marian mit leiser Stimme. »Es ist so schwierig, ihn wieder aufzufüllen. Deswegen benutzen sie ihn nur ungern. Aber es scheint, dass sie in letzter Zeit immer schwieriger zufriedenzustellen sind.«
»Empfindliche Bastarde«, stimmte Noon zu. Sie trat wieder an die Gitterstäbe heran. »Bastarde!«
Doch ihr einsamer Schrei ging im Echo des tropfenden Wassers unter. Noon starrte auf die gegenüberliegenden Zellen und die durchnässten, unglücklichen Frauen. Sie presste ihre Hand auf den Mund und biss auf einem losen Hautfetzen an ihrem Daumen herum. Es würde wahrscheinlich genauso lange dauern, bis die Frauen auf der anderen Seite getrocknet waren, wie es dauerte, den Tank wieder aufzufüllen. Man würde ihnen keine trockene Kleidung geben, und die Winnowry war immer feucht und kühl. Die hohen schwarzen Steine ihrer Türme blickten auf ein kaltes und gefährliches Meer hinunter. Die Insel, auf der man sie erbaut hatte, war von allen Bäumen und Gräsern befreit worden – selbst die oberste Schicht des Bodens hatte man abgetragen. Wenn es etwas gab, das man über die Schwestern sagen konnte, dann, dass sie gründlich waren.
»Wie hat sie das geschafft?«, flüsterte Marian. Ihre Stimme war unter dem Stöhnen der anderen Finsterhexen kaum zu hören. Das stetige Tropfen klang wie ein sanfter Regen, während sich das Wasser seinen Weg durch die Zellen bahnte.
»Die Schwester muss so dumm gewesen sein, in die Nähe des Gitters zu gehen.«
Sie wussten beide, dass das sehr unwahrscheinlich war. Die Wächter der Winnowry trugen lange Handschuhe und Ärmel, üppige Kapuzen hielten ihr Haar zurück und ihre Gesichter waren verborgen durch glatte Silbermasken mit schmalen Schlitzen für Augen und Mund. Für sie wäre es eine Katastrophe, wenn eine Finsterhexe ihre nackte Haut berühren würde, obwohl Noon sich oft fragte, was die Hexe, die ihre Lebensenergie stahl, davon hatte. Man könnte genug nehmen, um sie bewusstlos werden zu lassen – oder sie zu töten, flüsterte eine Stimme in ihrem Kopf – aber was dann? All das half nichts, wenn man sich nicht bereits außerhalb der Zelle befand oder zumindest schon kurz vor dem Ausgang ...
Noon setzte sich auf die Gitter am Boden und schob ihre Finger durch die Lücken. Marian griff nach ihr, aber wie immer war der Abstand zu groß, als dass sie sich hätten erreichen können. Sie wollten sich einfach nur gegenseitig versichern, dass sie nicht allein waren.
»Irgendwie hat sie es geschafft«, sagte Noon leise. »Sie ist nah genug rangekommen, um sich zu nehmen, was sie brauchte.« Ihr Herz hämmerte immer noch in ihrer Brust. »Was glaubst du, ist mit ihr passiert? Glaubst du, sie ist entkommen?«
Marian antwortete nicht sofort. Als sie es tat, klang sie besorgt. »Natürlich nicht. Das weißt du doch, Noon. Sie haben sie übergossen und dann weggebracht. Es gibt keinen Weg hier raus. Das weißt du.«
»Das weiß ich«, stimmte Noon zu und knabberte wieder an ihrem Daumen. »Ich weiß es.«
»Finster-Noon. Aufstehen, bitte.«
Noon rappelte sich auf. Sie erkannte die Stimme von Schwester Owain, blickte auf und sah die große Gestalt vor ihrer Zellentür.