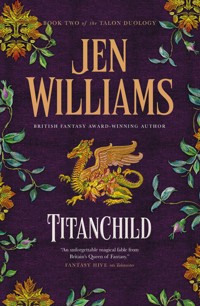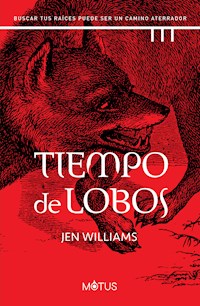12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Eine uralte Sage, ein totes Mädchen und eine Nacht, die das Leben dreier Menschen für immer verändern wird – ein fesselnder und verstörender Thriller aus der Feder der preisgekrönten englischen Autorin Jen Williams. In einem malerischen Küstenort verschwindet ein Mädchen. Am helllichten Tag, am Strand. Nicht das erste Mädchen, das hier in den letzten Jahren verschwunden ist. Charlie ist mit ihrer Nichte nach Hithechurch gefahren, um für ein Buch zu recherchieren. Was niemand ahnt: Charlie kennt den Ort nur zu gut, hat sich doch hier in den 80er Jahren ihr Leben in nur einer Nacht dramatisch verändert. Doch die Vergangenheit scheint nicht zu ruhen, bei ihren Nachforschungen stößt sie auf schier Unfassbares ….
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 509
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Jen Williams
Die Totenbraut
Thriller
Über dieses Buch
Eine uralte Sage, ein totes Mädchen und eine Nacht, die das Leben dreier Menschen für immer verändern wird.
Hithechurch, 1988
Die elfjährige Charlie liebt Schauergeschichten und ist bekannt dafür, die anderen Kinder in dem malerischen Küstenort mit ihren eigenen Erzählungen zu erschrecken. Vor allem eine Sage lässt sie nicht los und Charlie selbst wird Teil einer Geschichte, die grausamer ist, als alles, was sie sich hätte vorstellen können.
Hithechurch, heute
Als Charlie viele Jahre später mit ihrer Nichte Katie an den Ort des Grauens zurückkehrt, scheint sich die Vergangenheit zu wiederholen – erneut verschwindet ein Mädchen. Charlie begibt sich auf die Suche nach ihm und begegnet einem alten Feind, der erbarmungsloser ist als je zuvor.
Der neue atmosphärische Thriller der preisgekrönten Autorin Jen Williams
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Jen Williams lebt mit ihrem Partner und einer unmöglichen Katze im Südwesten von London. Für ihre Bücher im Fantasy-Bereich wurde sie mehrfach ausgezeichnet. Wenn sie keine Bücher oder Beiträge für Magazine schreibt, arbeitet sie als Buchhändlerin und freiberufliche Redakteurin. »Totenbraut« ist nach »Herzgräber« ihr zweiter Thriller.
Irene Eisenhut studierte Anglistik und Germanistik. Nach einem Auslandsaufenthalt in den USA, lebt und arbeitet sie seit mehreren Jahren als freie Übersetzerin in Bonn.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die Originalausgabe erschien 2023 unter dem Titel »Games for Dead Girls« bei Harper Collins, London.
© Copyright 2023 Jen Williams
Für die deutschsprachige Ausgabe: © 2023 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstraße 114, D-60596 Frankfurt/Main
Redaktion: Silke Reutler
Covergestaltung: Johannes Wiebel | punchdesign
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-491318-6
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Widmung]
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
Für alle, die mit mir im Wohnwagen waren
Prolog
Vor sechs Monaten
Auf dem feuchten Sand saß eine Möwe, grau, gedrungen und gut genährt.
Jedes Mal, wenn sie mit ihrer Familie den Urlaub an der Küste verbrachte, war Cheryl überrascht, wie groß und trotzig diese Vögel aus der Nähe aussahen. Und dieser hier warf ihr obendrein auch noch einen finsteren Blick zu. Seine winzigen, gelben Augen funkelten wütend. Die Möwe hackte mit ihrem Schnabel auf einem Zigarettenstummel herum, den jemand am Strand liegen gelassen hatte. Cheryl schaltete die Kamera ihres Handys ein, doch bis sie sie auf den Vogel gerichtet hatte, hatte der die Kippe schon fallen gelassen und hüpfte weg.
»Mist. Dann eben nicht.«
Sie bemerkte eine kleine Schar von Vögeln einige Meter weiter weg an einem Strandabschnitt, der fast menschenleer war. Wie die meisten anderen Strandbesucher, hatte sich auch Cheryls Familie heute mit ihren Handtüchern und Picknicktaschen näher an dem kleinen Jahrmarkt niedergelassen, der sich über die Wellenbrecher aus Beton erstreckte. Dort standen auch Holzbuden, an denen es Eis und frisch gebackene Donuts zu kaufen gab. Auf Cheryl, die schon jetzt ihrer quengeligen Cousins und Cousinen überdrüssig war, hatte der ruhige Strandabschnitt verlockend gewirkt. Nur Sand, Kieselsteine und das beständige graubraune Meer.
Sie schien nicht die Einzige zu sein, die die Stille bevorzugte. Etwas weiter vorn stand ein bunter Windschutz, die rosa-blauen Ränder leicht zerfleddert, der in der steifen, vom Meer her wehenden Brise hin und her flatterte. Ein großer Mann schlug gerade mit einem Hammer die Stangen rhythmisch in den feuchten Sand. Cheryl war sofort davon fasziniert. Er war größer als ihr Vater, also mindestens ein Meter fünfundneunzig, und alt, Anfang bis Ende sechzig, nach seinem eisengrauen Haar und seinem zerfurchten Gesicht zu urteilen. Er trug ein sauberes, langärmeliges weißes Hemd, das vorne und an den Handgelenken ordentlich zugeknöpft war, eine beigefarbene Hose und braune Ledersandalen. Ein seltsames Outfit für den Strand. Sie schlenderte näher, um einen genaueren Blick zu werfen.
Trotz seines Alters – er kam Cheryl, die gerade erst fünfzehn geworden war, unglaublich alt vor – schlug der Mann die Stangen fest und entschlossen in den Boden, und sie konnte die enorme Kraft in seinen sehnigen Armen spüren. Als er sie bemerkte, hielt er inne.
»Was suchst du hier, Mädchen?«
Cheryl zuckte zusammen. Die Stimme, die gerade zu ihr gesprochen hatte, kam nicht von dem Mann, sondern von irgendjemand hinter dem Windschutz. Cheryl machte einen Schritt nach vorne und spähte neugierig dahinter. Wie es aussah, war diese Familie äußerst bedacht darauf, den Wind zu meiden. Der große Mann hatte eigentlich eine Art Festung gebaut, mit Wänden rundherum und einer kleinen Öffnung vorn mit Blick aufs Meer. Sie nahm flüchtig zwei altmodische, gestreifte Liegestühle wahr, mehrere feinsäuberlich ausgebreitete Handtücher, einen großen, klassischen Picknickkorb und eine lange, dunkelblaue Plane, die um etwas Sperriges gewickelt war – doch ihr Interesse galt der Frau, die auf dem Handtuch lag, das ihr am nächsten war. Sie war es, die gesprochen hatte.
»Nichts, tut mir leid. Ich bin nur rumgelaufen«, antwortete Cheryl, schob sich eine lose Haarsträhne hinters Ohr und ließ das Handy zurück in die Gesäßtasche ihrer Jeans gleiten. »Der Strand hier ist so schön«, sagte sie.
Die Frau bewegte sich auf ihrem Handtuch. Sie trug einen blau-weiß geblümten Badeanzug im Vintage-Stil, und ihre langen Beine waren so braun gebrannt, dass sie fast ledrig wirkten. Ihre Fußnägel waren rot lackiert, und sie rieb ihre Oberschenkel mit einer ölig aussehenden Sonnenmilch ein. Cheryl sah so gut wie nichts von ihrem Gesicht, weil ein riesiger Sonnenhut es fast vollständig verdeckte.
»Dieser Strand ist schön für junge Leute.« Ihre Stimme klang ebenfalls ledrig. »Deshalb kommen wir ja hierher, stimmt’s, mein Schatz?«, sagte sie zu dem Mann mit dem Hammer gerichtet.
Cheryl blinzelte. Weder sie noch er konnten für »junge Leute« gehalten werden, beim besten Willen nicht.
»Meiner Familie scheint er zu gefallen«, erwiderte Cheryl, hauptsächlich um die Stille auszufüllen. »Wir kommen jedes Jahr hierher.«
Die Frau hob den Kopf, so dass das Mädchen einen kurzen Blick auf die untere Hälfte ihres Gesichts erhaschen konnte, auf dem sich ein atemberaubendes Lächeln ausgebreitet hatte. Lippenstift, so rot wie vergiftete Äpfel in einem Disney-Film, und ein spitzes, unversöhnliches Kinn. Ihre Haut sah seltsam aus, irgendwie straffgezogen, und dann lehnte sich die Frau auch schon wieder zurück, um sich die Beine weiter einzucremen.
»Der Strand, die Sonne«, fuhr die Frau fort. »Das Meer. Zuckerwatte, Hotdogs, Eiscreme. Es gibt doch nichts Schöneres. Jeder sollte einmal an die Küste fahren, findest du nicht auch?«
»Hm, ja«, erwiderte Cheryl, obwohl sie eher der Meinung war, dass jeder einmal nach Disney World fahren sollte und nicht in ein mieses Kaff an der Südostküste Englands. Doch die Frau schien von der Idee begeistert zu sein.
»Selbst böse Mädchen dürfen an den Strand.«
Die Art, wie die Frau »böse Mädchen« gesagt hatte, ließ Cheryl die Stirn runzeln, aber ihre Aufmerksamkeit galt jetzt der Plane. Sie schien zu zucken, als hätte der Wind sie plötzlich erfasst. Dabei lag sie geschützt hinter dem Windschutz.
»Wie bitte?«, fragte Cheryl abgelenkt.
Die Frau klappte den Verschluss ihrer Sonnenmilch zu, und Cheryl bemerkte erst jetzt die offene Schachtel neben ihrem Bein, die ein bisschen aussah wie eine größere, nicht ganz so ordentliche Version des Nähsets, das ihre Mutter in ihrer Bastelkiste aufbewahrte. Neben einer großen Schere mit orangefarbenen Plastikgriffen lagen mehrere Rollen mit schwarzem und gelbem Garn und ein rostig aussehender Fingerhut. Seltsam, so etwas mit an den Strand zu nehmen, fand Cheryl, aber vielleicht entspannte sich die Frau ja beim Sticken oder einer anderen Art von Handarbeit.
»Du hältst dich bestimmt schon zu alt für den Strand«, sagte die Frau und blickte wieder lächelnd auf. Cheryl ertappte sich dabei, dass sie zurücklächelte. »Zu alt, um Sandburgen zu bauen und Krabben zu fischen, oder, meine Süße?
»Ja, schon.« Cheryl zuckte mit den Achseln. »Meine Cousins und Cousinen haben noch immer Spaß daran, aber …«
»Wie alt bist du?«
»Fünfzehn.«
»Da beschäftigst du dich lieber mit deinem Handy und schaust dir Sachen für Erwachsene an, stimmt’s?«
Cheryl stutzte leicht. Sie hatte das Gefühl, ihren Vater zu hören, der sich regelmäßig darüber beschwerte, wie viel Zeit sie an ihrem Handy verbrachte, aber die Frau kicherte in sich hinein, als würde sie Cheryl und ihre Eigenarten mögen.
»Du hast keine Ahnung, wie jung du bist. Das ist einer der Vorzüge der Jugend – man weiß nicht einmal, dass man Sand in den Händen hat, geschweige denn, dass er einem durch die Finger rinnt.«
»Okay.« Cheryl sah hinüber zu dem großen Mann, der noch immer nichts gesagt hatte. Er schaute auf den Strand, als hätte er diese Unterhaltung schon oft gehört. »Ich sollte jetzt besser wieder zurück zu meiner Familie gehen, sie werden bestimmt schon ihre Sandwiches essen wollen …«
Plötzlich begann die Plane, sich hin und her zu bewegen, so heftig, dass Cheryl unwillkürlich einen Satz nach hinten machte. Ein gedämpftes Stöhnen erklang.
»Hey! Was …?«
»Siehst du?« Die Frau blickte auf, die roten Lippen missmutig verzogen. Cheryl konnte zum ersten Mal ihr gesamtes Gesicht sehen, und das Blut in ihren Adern schien zu gefrieren. »Siehst du, wie mir meine Großzügigkeit gedankt wird? Mit Unfug! Mit Unsinn! Mit Ungehorsam!«
Cheryl bemerkte zu spät, dass der große Mann nicht mehr neben dem Windschutz stand. Sie konnte noch einen kurzen Blick auf die weiter zappelnde und stöhnende Plane werfen, ehe sich zwei starke Arme um sie schlossen und sie strampelnd hochgehoben wurde.
1. Kapitel
Heute
Als das alte Schild des Campingplatzes vor mir auftauchte – comicartige große braune Buchstaben und ausgerechnet ein comicartiger bunter Papagei, als ob Papageien an der kühlen Südostküste Englands heimisch wären –, war das wie ein Tritt in die Magengrube. Der kalte Schweiß brach mir auf Stirn und Rücken aus, und ich musste an die Seite fahren. Katie, sicher angeschnallt auf dem Rücksitz, beugte sich so weit vor, dass ich den Sicherheitsgurt klicken hörte.
»Was ist denn los, Tante Charlie?«
»Alles in Ordnung, ich muss nur kurz … nachdenken.«
Mir war sofort klar, wie dumm das klingen musste, denn wir standen nur etwa hundert Meter entfernt von der Abzweigung zum Campingplatz, der unser Ziel war. Dichte Hecken säumten die Straße, hinter denen sich, verdeckt durch Laub, Wohnwagen an Wohnwagen reihte. Die trübe winterliche Sonne verschwand rasch vom Himmel, schon bald würde es völlig dunkel sein. Auch wenn es überhaupt keinen Grund gab, dass ich so kurz vor dem Campingplatz angehalten hatte, standen wir hier.
Ich drehte mich um und lächelte Katie an. Das Mädchen war immer ernst und der Blick, den sie mir zuwarf, fast schon feindselig, als ob ich der schlimmste Mensch auf der Welt sei. In dem düsteren Licht sah ihre Haut fast schon unnatürlich weiß aus, während die Stelle auf ihrer Nase mit den vielen Sommersprossen grau erschien. Ihr Haar, dunkelbraun und vorn zu einem strengen Pony geschnitten, fiel ihr locker über die Schultern und war leicht fettig, was mich stutzig machte. Denn fettiges Haar bedeutete, dass sie bald ein pubertierender Teenager sein würde. Ein Umstand, der mich irgendwie beunruhigte.
»He, das wird lustig«, sagte ich in dem für Erwachsenen typischen Tonfall, wenn sie sich selbst noch von einer Sache überzeugen mussten. »Nur wir beide, ein paar Wochen. Du kannst tun, was du willst – spielen, malen, an den Strand gehen. Alles, worauf du Lust hast. Und ich werde weiter für mein Buch recherchieren. Wenn du möchtest, kannst du mir dabei helfen.«
»Ich weiß«, sagte sie ausdruckslos. »Das hast du schon einmal gesagt.« Sie scharrte mit den Füßen im Fußraum, die in übergroßen bunten Turnschuhen mit regenbogenfarbenen Schnürsenkeln steckten. Sie trug eine ausgefranste Bermuda-Shorts und ein schlabbriges T-Shirt. Zum ersten Mal verspürte ich kurz Besorgnis. Das war nicht die passende Kleidung für Januar, auch wenn es im Auto warm war und der Wohnwagen über ein Heizgerät verfügte. »Können wir jetzt weiterfahren?«
Ich nickte, und meine aufgesetzte Fröhlichkeit versickerte im Autositz. Ein paar Sekunden lang saß ich wie erstarrt da, nicht bereit, diesen letzten Schritt zu machen. Das war keine gute Idee, oder? Doch dann dachte ich an den Brief, und ich ließ wortlos den Motor an.
Ich bog in die von hohen Nadelbäumen gesäumte Einfahrt, und die Reifen knirschten auf dem Kies. Die Laternen waren noch nicht alle angegangen, also orientierte ich mich hauptsächlich an der blassen Straßenmarkierung. Langsam rollten wir an den kleinen gedrungenen Gebäuden mit dem Lebensmittelladen und dem Fernseh- und Heizungsgeräteverleih vorbei. Daneben stand eine Telefonzelle, eine alte rote, aber ich bezweifelte, dass sich da noch ein funktionierendes Telefon drin befand. Ein Spielplatz – ein Klettergerüst, das aussah wie ein Baugerippe, Schaukeln, eine Rutsche voller Laub, der Boden bedeckt mit Mulch – und die Duschanlagen schlossen sich an. Dann die ersten Wohnwagen, lange, kapselförmige, fein säuberlich aufgereihte, unbewegliche Dinger.
Bei ihrem Anblick erwachte etwas in mir. Sie sahen genauso aus wie damals. Auf den ersten Blick erschienen sie identisch, aber wenn man genauer hinschaute, konnte man kleine Unterschiede erkennen – was für ein kleines Kind, das den ganzen Tag auf dem Gelände herumtollte, äußerst wichtig war, um wieder nach Hause zu finden.
»Was hast du gesagt?«, fragte Katie plötzlich. »Du hast doch was gesagt.«
»Nichts«, antwortete ich, den Blick noch immer auf die Straße gerichtet. »Ich habe nur laut gedacht.«
»Ich habe Hunger«, verkündete sie. »Essen wir zu Abend, wenn wir da sind?«
Ich nickte und schaute sie im Rückspiegel an. »Klar. Spaghetti mit Tomatensauce? Toast? Das ist doch das richtige Essen für heute Abend, oder?«
Sie lächelte und schaute nicht mehr ganz so frostig drein.
Mein Blick wanderte zurück zu den Wohnwagen, deren feine Unterschiede mir sofort auffielen. Die Muster an den Seiten zum Beispiel, farbige Streifen und Rechtecke – braun, ockerfarben, gelb, olivgrün, rostrot – alle sehr dezent und geschmackvoll auf cremefarbenem Untergrund. Oder die unterschiedlichen Formen, einige Wagen waren eckig, andere an den Kanten abgerundet. Manche hatten die Größe eines Bungalows, und die ausgefallensten Exemplare verfügten über Holztreppen, die zu ihren weiß gestrichenen und mit Blumen dekorierten Türen führten. Diese hatten auf ihren Dächern oft noch alte Satellitenschüsseln, in meiner Kindheit das ultimative Zeichen von Luxus.
Während wir im Schneckentempo weiterfuhren und die Scheinwerfer ein sanftes Licht in die rasch dunkler werdende Nacht warfen, sah ich, dass sich vielleicht doch einige Dinge verändert hatten. Rostflecken hier und da, Unkraut um einige Wohnwagen herum, Fenster, in denen Vorhänge oder Gardinen fehlten oder die mit Pappe abgedeckt waren. Ich wandte den Blick ab und sagte mir, dass ich mich besser darauf konzentrieren sollte, uns dorthin zu bringen, wo wir untergebracht waren. Mir würde später noch genügend Zeit bleiben, um mich umzusehen.
Wir bogen um ein paar Ecken, und endlich leuchteten alle Straßenlampen hell auf. Auf einmal wollte ich nur noch nach drinnen, raus aus dem alten Auto, weg von dem Benzin- und Ledergestank.
»Schau mal, wir sind da.«
Natürlich war es nicht der Wohnwagen. Den gab es schon lange nicht mehr, aus den unterschiedlichsten Gründen. Obwohl dieser hier relativ neu und in der Dämmerung grau, länglich und kastenförmig aussah, machte er trotzdem einen ziemlich billigen Eindruck. Ich konnte schneeweiße Gardinen in den Fenstern erkennen, und um den Wohnwagen herum war wohl in den letzten Wochen gefegt worden. Das stimmte mich zuversichtlicher, also parkte ich das Auto und stieg aus, Katie folgte dicht hinter mir. Ich bückte mich zur blauen Gasflasche, zog den Schlüssel darunter hervor, trat auf die leicht wackelige Metalltreppe und öffnete die Tür. Katie sauste an mir vorbei hinein und machte laute BRRRR-Geräusche.
»Ja, schon gut, lass uns die Heizung anmachen, damit es hier warm wird. Ich kümmere mich ums Abendessen, okay?«
Katie nickte und ließ sich auf eine der beiden schmalen Sitzbänke in der Essnische fallen. Ich schaltete die elektrische Heizung ein, wartete, bis die grauen Heizspiralen tieforange glühten, und fing dann an, einige unserer Taschen auszupacken. Im Nu fühlte sich der Wohnwagen so an, wie ich ihn aus meiner Kindheit in Erinnerung hatte – ein kleiner, gemütlicher Raum voll warmem gelbem Licht, in dem es nach Toast roch. Ich zog die Vorhänge vor den finsteren Fenstern zu. Schließlich setzte ich mich gegenüber von Katie an den schmalen Tisch in der Nische. Genüsslich verdrückten wir unser Abendessen. Zur Feier des Tages hatte ich die Spaghetti mit Käse überbacken.
»Schmeckt besser so, oder?«, sagte ich, mein Blick auf Katie gerichtet, deren Kopf über das Essen gebeugt war und die nur kurz aufsah, um einen Schluck von ihrem Kakao zu trinken. Sie antwortete mit einem Achselzucken.
Später schaltete ich den kleinen Fernseher ein und gab ihr die Fernbedienung. Sie zappte durch die Kanäle, das kleine Gesicht konzentriert, bis sie sich schließlich für eine Reality-TV-Show entschied, irgendetwas mit vielen schrecklichen Tattoos. Ich fragte mich kurz, ob das die richtige Sendung für ein Mädchen war, aber der Gedanke, dass ausgerechnet ich mich als Moralapostel aufspielte, erschien mir so lachhaft, dass ich genau das tat – ich lachte leise in mich hinein. Katie schaute mich an, sichtlich genervt.
»Was ist?«
»Nichts«, antwortete ich und deutete auf den Fernseher. »Ich hoffe nur, dass du keine Albträume davon bekommst.«
Sie schnaubte daraufhin, schien aber gleichzeitig das Interesse am Fernsehen zu verlieren. Als ich mich zu ihr auf das Sofa setzte, wandte sie sich zu mir und zog die Beine an, so dass ihre Füße mein Bein berührten.
»Dieses Buch da«, begann sie. »Was musst du dafür alles wissen? Wie recherchierst du das?«
»Nun, in dem Buch geht es um Volkssagen. Genauer gesagt, um Volkssagen aus dieser Gegend. Weißt du, was Sagen sind?«
Sie verdrehte die Augen und stieß mich mit dem Fuß. »Logo. Geschichten und so.«
»Nicht schlecht, du kleine Schlaubergerin.«
»O Gott, du bist so alt.«
Ich lachte. »Ja, Geschichten und so. Als ich so alt war wie du, mochte ich so etwas sehr, und vor allem mochte ich die Geschichten über diesen Ort.« Mein Lächeln fühlte sich mit einem Mal kalt und falsch an, also griff ich nach Katies Fuß und drückte ihn. Sie kreischte und verpasste mir wieder einen Stoß mit dem Fuß. »Deshalb wollte ich all diese Geschichten schon immer zusammentragen. Ich werde also einige Zeit hier in Hithechurch verbringen, um mit den Menschen hier über die Sagen aus der Gegend zu reden. Vielleicht werde ich auch noch ein paar andere Orte besuchen und alles aufschreiben, was die Leute mir erzählen. Und dann werde ich all diese Geschichten zu einem Buch zusammenfügen. Wahrscheinlich wird das ein dünnes Buch.«
»Du läufst also nur rum und redest mit Leuten?«
»Die meiste Zeit schon, ja.«
Katie verdrehte die Augen. »Ich verstehe nicht, warum du dafür hierherkommen musstest und das nicht einfach alles im Internet machen kannst, so wie ein normaler Mensch.«
»Weil das nicht dasselbe ist«, antwortete ich lächelnd. »Die Vergangenheit ist wichtig, Katie. Ich möchte in sie eintauchen. Dieser Ort hier ist wichtig. Also, für mich.« Ich konnte sie offensichtlich nicht überzeugen, also drückte ich wieder ihren Fuß. »Du musst aber nicht immer mitkommen. Dir wird doch nicht langweilig werden, oder?«
Katie verzog das Gesicht und dachte nach. Schließlich zuckte sie mit den Achseln. »Ich habe massenhaft Bücher dabei. Und ich will am Strand Muscheln sammeln gehen – ich habe mir sogar extra eins dafür in der Bücherei ausgeliehen.«
»Gut. Hier ist zwar gerade nicht viel los, und kalt ist es auch, aber ich freue mich, dass du mir Gesellschaft leistest. Wir werden viel Spaß haben, oder? Außerdem sind Ferien doch besser als Schule, stimmt’s?«
Katie wandte sich wieder ihrer Fernsehsendung zu. Ich trat zur Tür und öffnete sie einen Spalt. Die kalte Nachtluft drang herein. Katie motzte, aber ich öffnete sie noch etwas weiter, weil ich auf einmal das Bedürfnis hatte, in der Dunkelheit zu atmen. Ich konnte durch das Licht, das durch unsere Wohnwagentür nach draußen drang, die grauen Umrisse des Wohnwagens gegenüber erkennen, die Baumreihe rechts blieb weiter im Dunkeln. Alles war still. Meine Hand glitt wie von selbst in meine Hosentasche, und ich zog den Brief heraus. Ich hatte ihn in den vergangenen Wochen so oft auseinander- und wieder zusammengefaltet, dass sich das Papier inzwischen abgegriffen anfühlte. Ich faltete ihn erneut auseinander und hielt ihn ins Licht, obwohl ich genau wusste, was drinstand.
WENN SIE SIE AUFHALTEN WOLLEN, FINDEN SIE DAS, WAS SIE ZUSAMMEN VERGRABEN HABEN. ES WIRD SIE VERNICHTEN.
Die Handschrift war einfach und prägnant, die Buchstaben in zackigen Bewegungen aufs Papier gebracht. Der Brief war in einem schlichten braunen Umschlag angekommen. Anonym, ohne Absender, ohne Unterschrift. Auch die Schrift kannte ich nicht. Alles äußerst beunruhigend. Ein perfektes kleines Rätsel.
In meiner Phantasie verfolgten mich unzählige Augenpaare. Feinde, die mir irgendwo außer Sichtweite auflauerten. Ich faltete den Brief zusammen und steckte ihn wieder weg, obwohl ich das Gefühl hatte, dass er mir ein Loch ins Bein brannte.
Wer bist du?, fragte ich mich nicht zum ersten Mal. Und wie viel weißt du über mich?
Ich trat wieder hinein, machte die Tür zu und schloss sie mit dem Schlüssel ab, der innen steckte. Katie blickte auf. Vielleicht fragte sie sich, was ich da machte, aber sie stellte keine Fragen. Wortlos setzte ich mich neben sie auf das Sofa, den Blick auf den lächerlich kleinen Bildschirm des Fernsehers gerichtet. Erschöpfung legte sich über mich wie ein schwerer Mantel.
2. Kapitel
Juli 1988
Das misstönende Geklimper, das aus den vielen verschiedenen Spielautomaten und Videospielen in der Spielhalle dudelte, war fast laut genug, um den Alarm zu übertönen, der losging. Fast.
Charlie trat einen Schritt vom Automaten zurück, dem sie gerade einen so kräftigen Tritt verpasst hatte, dass ihr Fuß davon pochte. Ihr Gewinn, für den sie gerade drei Pfund ihres Feriengelds ausgegeben hatte, steckte noch immer fest, aber ein paar Münzen hatten sich ihren Weg in die Ablage gebahnt. Schnell sammelte sie das Geld ein und steckte es in ihre Taschen.
»He, was machst du da?«
Es war die Stimme der Frau in der Wechselkasse. Obwohl Charlie und ihre Familie erst seit ein paar Tagen hier in Urlaub waren, hatte sie die Angestellte bereits als potenzielle Gefahrenquelle erkannt. Sie saß fast immer auf einem gepolsterten Sitz neben dem Schalter und schaute, wer rein- oder rausging, die wachsamen Augen misstrauisch zusammengekniffen. Ihre Fingerkuppen waren dunkelgrau verfärbt von all den Münzen, die tagtäglich durch ihre Hände wanderten.
»Nichts«, antwortete Charlie.
»Warum ist dann der Alarm losgegangen?« Die Frau hatte die Arme vor der Brust verschränkt. »Wo sind deine Eltern? Du solltest nicht ohne Begleitung hier drin sein.«
»Da war ein Mann, dick, mit Bart. Er hat gegen den Automaten getreten und ist dann weggelaufen. Ich weiß nicht, warum.«
»Blödsinn. Du kannst nicht einfach hier reinspazieren und Ärger machen! Zeig gefälligst Respekt, du kleines …«
»Was ist hier los?«
Charlies älterer Cousin, Darren, trat zu ihr, und sie spürte eine Welle der Erleichterung, denn er war mit seinen siebzehn Jahren praktisch ein Erwachsener. Darren würde die Sache schon richten.
»Diese alte Schachtel schreit mich an.«
»Ist das deine kleine Schwester, junger Mann?«, fragte die Frau und richtete sich zu ihrer vollen Größe auf, wobei sie immer noch einen ganzen Kopf kleiner war als Darren. »Du solltest sie besser an der kurzen Leine halten!«
»Ja, schon gut.« Darren legte eine Hand auf Charlies Schulter und zog sie zu sich heran, weg von dem Automaten. »Regen Sie sich ab.«
»Was fällt dir ein, so mit mir zu reden! Raus hier, alle beide, und kommt ja nicht wieder. Weder ihr noch sonst jemand von eurer Sippe.«
Darren nickte, als ob das eine Anweisung war, die er täglich zu hören bekam, und schob Charlie zum Ausgang.
»Bravo, Charlotte.«
Sie traten aus der düsteren Spielhalle hinaus. Draußen herrschte eine drückende Hitze. Charlie stand ein paar Sekunden lang auf den Zehenspitzen, während ihre Augen sich erst einmal an das helle Tageslicht gewöhnen mussten.
»Ich war das nicht. Da waren ein paar ältere Jugendliche, die haben an allen Automaten herumgefummelt. Sie müssen mit dieser blöden Kuh verwandt sein, denn sie hat sie einfach machen lassen, bis was kaputtgegangen ist, und dann musste sie einen Sündenbock finden.«
Darren warf ihr diesen abschätzigen Blick zu, den die meisten in Charlies Familie aufsetzten, wenn sie ihnen mal wieder eine besonders haarsträubende Lügengeschichte auftischte. Eine hochgewachsene Gestalt trat aus der Spielhalle und starrte die beiden an, die Arme vor der Brust verschränkt. Charlie hatte den Mann schon vorhin bemerkt. Er reparierte die Automaten, wenn etwas mit ihnen nicht stimmte. Sie hatte Angst vor ihm. Sein Hemd war fleckig, und sein fettiges, aus der Stirn gestrichenes Haar reichte ihm fast bis zum Kragen.
»Los, lass uns gehen.« Darren griff nach Charlies Arm und schob sie weiter die Straße entlang, weg von dem großen Mann. »Wenn wir jetzt nicht mehr in die Spielhalle gehen dürfen, wird deine Mum ganz schön sauer sein.«
»Ich kann nichts dafür!«, protestierte Charlie erneut, doch sie war bereits abgelenkt. Hithechurch war ein kleiner Ort an der Küste. Im Sommer war dort immer viel los, aber heute wimmelte er von Menschen, und die Hauptstraße war für den Verkehr gesperrt. Ein merkwürdiger Festzug kam ihnen entgegen – eine Reihe von Reitern, um sie herum lauter Urlauber.
»Was ist das?«
»Woher soll ich das wissen? Irgendein Volksfest.« Darren sah sich bereits um, wahrscheinlich nach einem anderen Familienmitglied, bei dem er Charlie loswerden konnte.
Der Zug kam näher, angeführt von einem riesigen schwarzen Pferd mit einer weißen Blesse. Eine seltsame, ungepflegte Gestalt saß darauf, gekleidet in braunen und gelben Lumpen, beide Arme ausgestreckt, die Hände herunterbaumelnd. Das Unheimlichste an der Gestalt war jedoch ihr Gesicht. Charlie kniff unwillkürlich die Augen zusammen, ihr drehte sich der Magen um.
Die junge Frau – sie waren jetzt nahe genug, um die Gestalt zu erkennen – trug eine Maske, elfenbeinfarben, mit dreieckigen, schwarz umrandeten, ausgefransten Aussparungen für Augen und Nase, und statt eines Lochs für den Mund war da ein langer, gerader Strich mit dicken Nähten. Das Haar war strohgelb und hing zottelig bis zu den Schultern.
»Was ist das?«, fragte Charlie.
Sie hatte nicht geglaubt, dass überhaupt jemand ihre Frage, über all den Trubel hinweg, gehört hatte, aber Darren, der neben ihr stand, schnalzte missbilligend mit der Zunge.
»Eine Vogelscheuche, du Dummkopf.« Flugblätter wurden verteilt. Darren nahm eins von einer vorbeigehenden Frau entgegen und gab es Charlie. »Dieser Festzug hat irgendetwas mit einer alten Geschichte zu tun, die hier in der Gegend passiert ist.«
»Was denn für eine Geschichte?« Charlie schaute auf das Flugblatt, aber sie konnte ihren Blick nicht lange von der Vogelscheuche abwenden, so fasziniert war sie von ihr. »Geschichten passieren nicht. Nirgendwo. Geschichten werden erfunden.«
»Du weißt, was ich meine.«
Die Männer und Frauen, die hinter der Vogelscheuche herritten, waren sofort zu erkennen. Sie waren wie Piraten gekleidet, mit Seidenhemden, Augenklappen, Entermessern und aufgeklebten Bärten. Sie interagierten mit der Menge, lachten, riefen den Kindern irgendetwas zu und schwenkten Plastikschwerter. Ihnen folgte eine kleine Marschkapelle, die eine flotte Melodie spielte. Charlie blickte der davonreitenden Vogelscheuche hinterher und bemerkte, dass in den Ärmeln ihrer zerlumpten Jacke ein Stock steckte. So blieben die Arme der Frau gerade gestreckt.
»Kommjetzt«, rief Darren ungeduldig. »Ich bringe dich zurück zum Campingplatz.«
Charlie rührte sich erst nicht. Die Menge war größtenteils an ihnen vorbeigezogen und hinterließ eine Spur aus zerknitterten Flugblättern und Bonbonpapieren auf der Straße. Eine Frau am Ende des Zugs kam auf Charlie zu und drückte ihr etwas in die Hand.
»Eine schöne Piratenwoche!«, wünschte sie ihr strahlend und beeilte sich, die anderen wieder einzuholen. Charlie schaute auf ihre Hand, in der eine winzige Vogelscheuche aus Filz steckte. Erst da stellte sie fest, dass ein paar dieser Figürchen auch auf der Straße gelandet waren. Die Frau hatte sie an alle Kinder verteilt. Normalerweise hätte Charlie über so ein Geschenk die Nase gerümpft – es war ja eindeutig für kleine Kinder bestimmt, und sie war schon elf und damit viel zu alt für so etwas. Doch das seltsame kleine weiße Gesicht mit den dicken schwarzen Nähten faszinierte sie sofort.
»Komm jetzt«, rief Darren erneut und zerrte an ihrer Bluse. »Oder ich lass dich hier stehen.«
Sie gingen zurück zum Campingplatz. Für den Weg dorthin brauchten sie etwa fünfzehn Minuten, und er führte entlang einer langen, mit Gras- und Getreidefeldern gesäumten Landstraße, die nachts nicht beleuchtet war. Charlie trottete ihrem Cousin hinterher und behielt seine rote kurze Hose im Blick, während sie das Flugblatt las.
DIE GESCHICHTE VON SUSAN CARTWRIGHT
Die kleine Susan Cartwright lebte 1842 mit ihrem Vater in einer Fischerhütte in Hithechurch. Das Leben der beiden war hart und von Entbehrungen und Hunger geprägt. Ihr Überleben hing oft von den Launen des Meeres ab. Um Essen auf den Tisch zu bekommen, wurde Susans Vater Strandräuber – in dunklen, stürmischen Nächten stellte er Lichter auf, die vorbeifahrende Schiffe in die Irre führten, so dass sie vor der felsigen Küste auf Grund liefen und Susans Vater und seine Brüder die Ladung für sich einforderten. Als die kleine Susan alt genug war, um zu helfen, wurde auch sie in das Familiengeschäft einbezogen. Ihre Aufgabe war es, ihren Esel, an dessen zusammengeflicktem Sattel Laternen hingen, abends die Strandwege entlangzuführen.
Eines Nachts entging ein Piratenschiff nur knapp seinem Schicksal, an der berühmten Hithechurch Jawbone zu zerschellen. Als die Piraten begriffen, was passiert war, gingen sie an Land, um nach den Lichtern zu suchen, die ihnen fast das Leben gekostet hätten. Susans Familie ergriff die Flucht und ließ sie mit ihrem Esel zurück. Verzweifelt flüchtete sie auf die Felder, auf denen sie eine alte, zerlumpte Vogelscheuche entdeckte. Sie stellte sich neben sie, zog sich den Jutesack über den Kopf, und die Piraten liefen an ihr vorbei. Sie stöberten Susans Vater und ihre Onkel auf und nahmen blutige Rache, aber die tapfere Susan Cartwright überlebte.
Charlie stolperte über einen Stein auf der Straße und blickte auf, aber sie dachte noch immer an Susan Cartwright auf dem Feld. Eine stockfinstere Nacht, ein grauer Mond, und Piraten, die einem die Kehle durchschneiden wollen …
»Warum grinst du so?«
Darren hatte sich umgedreht und sah sie an. Weiter vorn ragte das Schild des Campingplatzes aus einer Reihe von Büschen heraus.
»Deshalb!«, antwortete sie und wedelte mit dem Flugblatt. »Das ist völlig verrückt. Diese Vogelscheuchenfrau hat dabei geholfen, dass Schiffe auf Grund gelaufen sind, damit sie das Zeug von Bord klauen konnten, aber anscheinend …« Sie betrachtete die fröhliche rote Schrift auf der Rückseite. »Anscheinend gibt es jedes Jahr einen Festtag ihr zu Ehren. Sie war eine Diebin!«
»Und eine Mörderin«, fügte Darren vergnügt hinzu. »Ich glaube kaum, dass alle von diesen sinkenden Schiffen lebend runtergekommen sind.«
»Wow.« Charlie zog die kleine Filzfigur aus ihrer Tasche und betrachtete die Vogelscheuche mit ihrem zusammengeflickten Gesicht noch einmal. Susan Cartwright war eine Diebin, Verbrecherin und Mörderin, und trotzdem wurde sie als Spielzeug an Kinder verteilt. In Wirklichkeit war Charlie begeistert. Zu Hause versuchte sie ständig, an die Horrorfilme heranzukommen, die ihre älteren Cousins und Cousinen sehen durften. In der Videothek trieb sie sich in der Horrorabteilung herum, schaute sich die Hüllen von VHS-Kassetten an mit Geisterhäusern oder mordlüsternen Clowns darauf, die Titel geschrieben wie mit triefendem Blut. In der Bibliothek war sie stets auf der Suche nach Büchern über unerklärliche Phänomene, wie Geister, Yetis oder spontane menschliche Selbstentzündungen, und gelegentlich probierte sie auch, sich ein Stephen-King-Buch auszuleihen. In ihrem Rucksack steckte ein eselsohriges Exemplar von The Usborne Book of True Ghost Stories, ein Kinderbuch über wahre Geistergeschichten, das sie trotz der Einwände ihrer Mutter schließlich vom Schulbuchklub bekommen hatte. Aber auf diesem Flugblatt hier, das Erwachsene tatsächlich an Kinder auf der Straße verteilten, war eine richtig grausige Geschichte mit Piraten, Mord und einer schaurigen Verkleidung. »Großartig.«
»Du weißt, wie du von hier aus zum Wohnwagen kommst, oder?«
Charlie riss ihren Blick von der Vogelscheuche los. Sie hatten inzwischen den Campingplatz erreicht, und eine Gruppe von Jungs in Darrens Alter stand neben dem Klettergerüst, die ihn auf keinen Fall in Gesellschaft seiner elfjährigen Cousine sehen sollten. Sie nickte zerstreut, und er lief hinüber zu ihnen. Seine schlaksige Gestalt bewegte sich überraschend anmutig über das struppige Gras. Charlie schlenderte in die andere Richtung zu dem Wohnwagen, der gerammelt voll war mit Mitgliedern ihrer Familie.
Die Geschichte von Susan, der Vogelscheuche, ließ sie nicht los. Leise herumschleichende Piraten spukten in ihrem Kopf herum, sie hörte die markerschütternden Schreie von Susans Vater, dem die Kehle mit der rostigen Schneide eines Entermessers aufgeschlitzt wurde. Und so bemerkte sie erst, als eine laut zugeschlagene Autotür sie aufschreckte, dass sie zum falschen Wohnwagen gelaufen war. Er ähnelte zwar farblich dem ihrer Familie – auch er war braun und gelb –, aber ein breiter weißer Streifen verlief über seine Mitte, und ein hellbraunes, leicht rostiges Auto parkte daneben, das sie nicht kannte, auf der Heckscheibe ein Stück silbernes Klebeband.
»Emily, hol deine Tasche. Sofort.« Der Mann, der gerade eben die Autotür zugeschlagen hatte, war stämmig und breitschultrig. Sein braunes, nach hinten gegeltes Haar glänzte im Sonnenlicht. Er machte einen verärgerten Eindruck, und seine Wangen waren gerötet, als hätte er Fieber. Um den Hals trug er eine dünne goldene Kette mit einem kleinen goldenen Kreuz daran.
Ein Mädchen, etwas so alt wie Charlie, tauchte auf der anderen Seite des Wagens auf, in den Armen eine schwere Reisetasche, so groß, dass ihr Kinn darauf lag. Sie hatte schwarzes, sehr kurzes Haar und trug Turnschuhe, die auseinanderzufallen schienen. Eine große, schlanke Frau in einem gelben Sommerkleid folgte einen Schritt hinter ihr. Sie sah zwar nicht sonderlich alt aus, aber ihr schwarzes Haar war mit grauen Strähnen durchzogen.
»Emily, was machst du da?« Das Mädchen bewegte sich zur Tür des Wohnwagens hin, aber offensichtlich nicht schnell genug für ihren Vater. Er stürmte zu ihr hinüber und packte sie so fest an ihrem dünnen Arm, dass sie fast stolperte. Charlie hörte, wie die Frau etwas murmelte, einen schwachen Protest, von dem der Vater aber keine Notiz nahm. Erneut zerrte er am Arm des Mädchens, und Charlie zuckte zusammen, als ihr die Reisetasche aus den Armen glitt und deren Inhalt sich auf dem Boden ergoss.
»Verdammt nochmal«, stieß der Mann wütend aus, sprang sichtlich angewidert weg und stapfte die kleine Treppe hinauf zur Tür des Wohnwagens. Mit ruckartigen Bewegungen schloss er sie auf und trat hinein. Charlie erfasste kurz die blanke Wut angesichts dieser himmelschreienden Ungerechtigkeit. Immerhin hatte das Mädchen wegen ihm die Tasche fallen gelassen, und jetzt gab er ihr die Schuld. Die Frau murmelte erneut etwas, aber statt dem Mädchen beim Einsammeln der Sachen zu helfen, ging sie an ihr vorbei in den Wohnwagen hinein. Seufzend kniete sich das Mädchen auf den Boden, um ein Paar alte, abgewetzte Badesandalen, zusammengefaltete Unterwäsche und Socken aufzuheben.
Zögernd machte Charlie einen kleinen Schritt nach vorn, um ihr zu helfen oder ihr zumindest zu zeigen, dass sie das Verhalten der Erwachsenen ihr gegenüber schäbig fand und mit ihr fühlte. Aber ihre Bewegung ließ das Mädchen jäh aufblicken. Sie hatte große, dunkelgrüne Augen. Genau diese Farbe hatte das Meer, auf dem sich die Piraten in Charlies Vorstellung herumtrieben.
Sie schaute Charlie finster an. »Was guckst duso?«
3. Kapitel
Heute
Als ich am nächsten Morgen in einem fremden Bett aufwachte, musste ich mich erst einmal kurz orientieren, ehe ich in das winzige Bad schlurfte. Beim Zähneputzen bemerkte ich, dass mein Haaransatz deutlich zu sehen war – mehr als ein Zentimeter meines roten Haars lugte unter dem dunklen Braunschwarz hervor. Ich zog mich an und steckte anschließend den Kopf in Katies Zimmer, um mich zu vergewissern, dass sie noch schlief. Dann fuhr ich die kurze Strecke in die Stadt, um in der kleinen Drogerie auf der Hauptstraße eine Packung Haarfärbemittel zu kaufen, mit der ich kurze Zeit später zum Wohnwagen zurückkehrte. Katie war in der Zwischenzeit aufgestanden und saß am Tisch, vor sich ein aufgeschlagenes Malbuch. Ich ließ sie weitermalen und ging erneut ins Bad. Die Farbe, für die ich mich entschieden hatte, war ein anderes Dunkelbraun, das hoffentlich nicht nur einigermaßen dem Farbton entsprach, den ich vorher benutzt hatte, sondern auch zu meinem sommersprossigen Gesicht passte. Ich trug das übelriechende Zeug auf, wickelte Frischhaltefolie um den Kopf und ging zurück ins Wohnzimmer, damit die Farbe einwirkte. Katie blickte von ihrem Malbuch auf und rümpfte die Nase.
»Du färbst dein Haar schon wieder?«, fragte sie und hielt die Seite mit dem Daumen fest.
»Nur den Ansatz«, antwortete ich, bemüht um einen lockeren Tonfall. »Willst du ein Specksandwich?«
»Warum machst du das?«
»Specksandwichs sind köstlich.«
Sie stieß einen dieser langen, leidenden Seufzer aus, die ganz typisch sind für Zehnjährige, denen die Erwachsenen auf die Nerven gehen. »Ich meine dein Haar.«
Ich wandte mich zum Herd um und schaltete den Ofen ein. »Einer der wenigen Vorteile, die das Erwachsensein mit sich bringt, ist, dass man jederzeit seine Haarfarbe ändern darf.«
Ich erinnerte mich an Katies Haar bei einer früheren Gelegenheit, daran, wie fein es gewesen war und wie ich ihr einen Grashalm herausgezupft hatte und wir beide darüber gelacht hatten. Ich zog ein Messer aus einer Schublade und stach damit in die Verpackung des Specks.
Als wir die Sandwiches aufgegessen hatten, war die Einwirkzeit des Färbemittels rum, und ich ging ins Bad, um mir die Haare über dem Waschbecken auszuwaschen. Durch das tropfende Wasser sah ich die Farbe im Abfluss verschwinden, und der Ton erinnerte mich noch mehr an Blut als vorher. Blut, das von einer rostigen Klinge tropfte. Blut, das im Sand versickerte. Ich ging ins Schlafzimmer und rubbelte mir das Haar mit einem Handtuch trocken, das ich von zu Hause mitgebracht hatte, ehe ich es föhnte. Als ich damit fertig war, stand ich vor dem langen Spiegel, der in den schmalen Kleiderschrank eingelassen war, und mir gefror das Blut in den Adern. Mit meinem kurzen, dunklen Haar sah ich genauso aus wie …
»Was machst du heute?«, fragte Katie, die in der Schlafzimmertür aufgetaucht war und sich an den Rahmen lehnte, als sei es eine Riesenanstrengung, gerade zu stehen.
»Kommt drauf an. Was würdest du denn gern tun?«, fragte ich lächelnd zurück und ignorierte den Geist im Spiegel. »An den Strand gehen? Dir ein paar Süßigkeiten im Laden kaufen? Ich finde, dass wir uns erst etwas eingelebt haben sollten, bevor ich mich in die Recherche stürze.«
Katie wandte sich ab und beugte die Knie, so dass sie ein paar Zentimeter an dem Rahmen hinunterglitt. »Ich will gar nicht raus. Ist zu kalt.«
»Bist du dir sicher? Du könntest hier auf den Spielplatz gehen, die Schaukeln sind bestimmt alle leer.«
Mein Vorschlag wurde mit einem fast schon angriffslustigen Blick bestraft, also wendete ich mich wieder dem Spiegel zu. Auf dem Nachttisch lag eine Schere, die ich aus der Küchenschublade geholt hatte. Ich griff danach und schnippelte an meinem Pony herum, das seit dem letzten Friseurbesuch etwas gewachsen war. Die fast schwarzen Haarschnipsel flatterten wie die Federn eines dunklen Vogels auf den Teppich.
»Du musst nicht rausgehen«, sagte ich zum Spiegel. »Ich werde ein paar Sachen in dem Laden besorgen. Irgendwelche Wünsche?«, fragte ich.
Doch Katie war schon wieder ins Wohnzimmer verschwunden.
Draußen war es kalt und grau, ich konnte Katie also wirklich keinen Vorwurf machen, dass sie lieber drinnen geblieben war. Der Laden, ein kleines, kastenförmiges Gebäude in der Nähe des Eingangs vom Campingplatz, hatte Grundnahrungsmittel, Zeitungen und Gasflaschen in seinem Sortiment. Ich hatte fast schon damit gerechnet, dass er im Januar geschlossen war, aber auf meinem Weg zur Drogerie heute Morgen hatte ich jemanden drinnen herumlaufen sehen. Als ich den Laden betrat, befand sich ein großer Mann hinter der Theke und füllte gerade pfeifend ein Fach mit Schokoriegeln auf. Ich ging an ihm vorbei zu den Regalen und tat so, als würde ich mich für die Waschmittel interessieren, aber in Wahrheit fühlte ich mich matt und seltsam leicht, als könnte ich jeden Moment davonschweben. Der Laden sah fast so aus wie damals, selbst die sich von den Wänden ablösenden, blassen Plakate mit den Touristenattraktionen hingen noch da, und die mit Eiscreme gefüllte Tiefkühltruhe brummte vor sich hin. Ich fühlte mich schlagartig in die Vergangenheit zurückversetzt. Panik stieg in mir auf, aber ich zwang sie nieder. Ich griff nach einer Packung Frühstücksflocken und einer Tüte Milch.
»Nur das hier, bitte.«
Der Mann hinter dem Ladentisch lächelte und drückte dann auf der alten Kasse herum, als hätte er nie zuvor eine gesehen.
»Tut mir leid, unsere andere Kasse hat den Geist aufgegeben, deshalb haben wir sie durch dieses antike Teil hier ersetzen müssen. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie das Ding funktioniert.« Er sprach mit einem leichten walisischen Akzent, was mich neugierig aufblicken ließ. Der Mann war schlank, hatte schmale Hüften und trug einen schwarzen Pullover. Die Ärmel waren bis zu den Ellenbogen hochgezogen und offenbarten straffe, muskulöse Arme mit leuchtenden Tattoos. Ich konnte Totenköpfe, Raben und spärlich bekleidete Frauen erkennen, alle miteinander verschlungen in einem Netz aus Tinte. Seine Augenbrauen waren buschig und dunkel, und er zog sie verwegen nach oben, während er sich mit der Kasse abmühte. »Eigentlich sollte so ein vorsintflutliches Gerät wie das hier doch einfach zu bedienen sein, oder?«
Ich beugte mich über den Ladentisch, um einen besseren Blick auf die Kasse werfen zu können, als würde ich mich damit auskennen.
»Wie wär’s damit, den Preis einzugeben und dann auf Artikel zu drücken?«
Er nahm eine Packung Frosties in die Hand, schaute auf den Preis und tippte ihn ein. Grinsend bongte er den Rest.
»Jetzt Zwischensumme«, sagte ich, verlegen und stolz zugleich.
»Ah, Sie sind meine Rettung, ja, das sind Sie wirklich.« Er suchte kurz hinter dem Ladentisch herum, bis er eine dünne Plastiktüte fand, die bestimmt schon kaputt sein würde, bevor ich den Wohnwagen erreichte, und begann, meinen Einkauf hineinzupacken. »Übernachten Sie hier auf dem Campingplatz?«
»Ja, ich bin mit meiner Nichte Katie für ein paar Wochen hier. Meine Schwester macht gerade eine schwere Zeit durch, also gönne ich ihr eine Pause von dem kleinen Gremlin. Und Katie tut ein Urlaub auch gut.«
»Das Wetter ist zwar mies, aber dafür ist es ruhig hier. Ich bin übrigens Joseph. Joseph Bevan.« Zu meinem Entsetzen streckte er mir die Hand entgegen über den Tresen. Ich zögerte, aber nach einem Moment schüttelte ich sie. Seine Haut war warm, und ich hatte das Gefühl, als würde mich ein Blitzschlag durchfahren.
»Hi.« Ich hatte nicht damit gerechnet, dass ich mich jetzt schon jemandem vorstellen musste. »Ich bin Sarah. Sarah Hewitt.« Da ich nicht so recht wusste, was ich sagen sollte, holte ich mein Portemonnaie heraus und reichte ihm eine 5-Pfund-Note. Die Geldschublade der Kasse sprang krachend auf, und er wich einen Schritt zurück, um nicht getroffen zu werden, dabei murmelte er leise »Mist«. »Ich recherchiere für ein Buch.«
Seine Augenbrauen schnellten wieder nach oben. »Echt? Toll.«
Ich lachte nervös. »So spannend ist es gar nicht. Nur ein persönliches Projekt über die Sagen hier aus dem Süden Englands. Über die aus dem Norden oder dem Westen gibt’s jede Menge Informationen, aber über die von hier …« Ich zuckte mit den Achseln. »Ich hatte einfach das Gefühl, dass es vielleicht etwas Interessantes zu erforschen gibt.«
»Darüber würde ich gern mehr erfahren. Egal, was es ist, solange dadurch ein bisschen Leben hier in die Bude kommt.« Er richtete sich auf, als spürte er, dass er womöglich etwas Falsches gesagt hatte. »Aber ich bin mir ganz sicher, dass Sie hier auf viel Interessantes stoßen werden. Sie sollten mit Stan reden. Er ist ein Freund meines Onkels und bekannt dafür, im Pub wilde Geschichten zu erzählen. Sie wissen schon, was ich meine.«
Ich klammerte mich an meine Einkäufe und nickte. Das war ein ungewöhnlich langes Gespräch für mich, und ich hatte das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren, wie eine Achterbahn, die zu schnell fuhr und von den Gleisen abkam.
»Gehört Ihrem Onkel der Laden?«
»Ja, aber er ist nie hier, wissen Sie.« Joseph reichte mir mein Wechselgeld und lehnte sich mit verschränkten Armen an die Wand, als würde er sich auf eine längere Unterhaltung einstellen. »Ich bin hier Mädchen für alles, passe auf den Campingplatz auf, mache die verdammten Duschkabinen sauber und so.« Er lachte, und ich stimmte in sein Lachen ein. Meine Finger und Wangen kribbelten noch immer von dem Blitzschlag. »Wenn es irgendein Problem mit Ihrem Wohnwagen geben sollte, sagen Sie mir Bescheid, ja? Eigentlich …« Er griff unter den Ladentisch und holte einen Zettel hervor, auf dem eine Nummer gekritzelt war. »Das ist meine Handynummer, für den Notfall, falls irgendwas mit dem Wohnwagen ist.«
»Oh, das ist wirklich nicht nötig …«, sagte ich und schaute auf das Stück Papier in meiner Hand. Das Gefühl von Panik wurde immer größer.
»Sie würden mir einen Gefallen tun, ehrlich, Sarah. Im Moment ist es hier so ruhig, dass ich fast verrückt werde. Ich würde mich sogar über eine verstopfte Toilette freuen, so schlimm ist es. Oh, und wenn Sie mit Stan reden wollen, er ist für gewöhnlich im Pub, im Smuggler’s Cove. Ich bin mir sicher, dass er Sie gern vollquatschen wird.« Joseph lächelte. Er hatte braune Augen. Ich steckte die Nummer in die Tasche.
»Tja, dann vielen Dank. Sollte ich Probleme mit der Toilette haben, sag ich Ihnen Bescheid.« Wie bitte?
Beschämt und verzweifelt ging ich in Richtung Tür. Ich musste hier raus, bevor ich noch etwas Schlimmeres von mir gab, doch da fiel mein Blick auf die Tageszeitungen in einem Ständer vor dem Fenster. Eine Schlagzeile in großen schwarzen Buchstaben leuchtete mir entgegen, als sei sie extra für mich dort platziert worden.
MÄDCHEN VOM STRAND BLEIBT AUCH NACH SECHS MONATEN WEITER VERMISST
Wie von selbst griff meine Hand nach der Zeitung, einem Lokalblatt namens The Lighthouse, dessen Verbreitungsgebiet mehrere nahe gelegene Küstenstädte umfasste. Angst erfasste mich, wie ein lähmendes Gift, und ich begann den Artikel zu lesen.
Sechs Monate nach dem Verschwinden von Cheryl Yates am Strand von Folkesholme wendet sich die Polizei heute erneut an die Bevölkerung und bittet um ihre Mitarbeit. Cheryl, 15, verbrachte mit ihrer Familie die Ferien hier und wurde zuletzt am Strand in Richtung Hithechurch gesehen. Laut ihrem Vater, Antony Yates, 47, war Cheryl glücklich, sowohl zu Hause als auch in der Schule, so dass sie keinen Grund hatte, wegzulaufen. Die Polizei stuft das Verschwinden als verdächtig ein. Frühere Hinweise aus der Bevölkerung führten dazu, dass Besitzer von blauen Lieferwagen in der Gegend gebeten wurden, sich bei der ermittelnden Behörde zu melden, und im September letzten Jahres wurde das Mobiltelefon von Cheryl sichergestellt, zu dem die Polizei jedoch keine weiteren Angaben machte. Cheryls Mutter, Sharon Yates, 45, hat die ermittelten Beamten zuletzt beschuldigt, das Verschwinden nicht ernst genug zu nehmen, und erklärte gegenüber dieser Zeitung: »Wäre Cheryl ein oder zwei Jahre jünger, würden sie den Ort auseinandernehmen.« Hithechurch selbst blickt auf eine Geschichte zurück von …
Mein Blick wanderte vom Artikel zum Foto des vermissten Mädchens, auf dem sie ein weißes Schulhemd und goldene Creolen trug. Ihr Gesicht umrahmte blondes Haar, sie sah glücklich aus. Der Pose nach zu urteilen, stammte das Bild von ihrem Instagram-Account. Joseph hatte mittlerweile bemerkt, worauf ich schaute, aber in meinen Ohren rauschte es so sehr, dass ich ihn nur leise hörte, als er erneut zu sprechen begann.
»… üble Angelegenheit, viele Gerüchte, doch die Polizei scheint auf dem Schlauch zu stehen. Niemand spricht es offen aus, aber der Stadtrat ist besorgt, dass sich diese Sache auf die Touristenzahlen im kommenden Sommer auswirkt. Diese verdammten Aasgeier.«
Ich nickte gedankenverloren. Mein Blick wanderte ans Ende der Seite, wo ich die Überschrift eines weiteren, kürzeren Artikels las: UMSTRITTENES BUCH WIRD WOMÖGLICH ALS SERIE VERFILMT. Ich blinzelte. Meine Angst machte schlagartig der unfassbaren Wut Platz, die in mir hochstieg.
»Danke«, sagte ich, steckte die Zeitung zurück in den Ständer und verließ den Laden, ohne Joseph noch einmal anzusehen. Der Himmel hatte sich verdunkelt, und ein eisiger Regen prasselte auf mich herab. Es war gerade erst einmal Mittag, und trotzdem hatte ich das Gefühl, als ob das Tageslicht nicht seine Energie an diesen kalten, unliebsamen Januartag verschwenden wollte und sich bereits woandershin verflüchtigte. Ich schlich zurück zum Wohnwagen, meine Finger wurden weiß, als sich die Schlaufen der Plastiktüte um sie wickelten, und gerade als ich an der Tür des Wohnwagens angekommen war, piepste mein Handy in der Tasche. Ich griff hastig danach und fürchtete mich bereits vor dem, was ich auf dem Display sehen würde. Wer könnte mir eine Nachricht schicken?
Ich lehnte mich mit der Schulter an die Tür und entsperrte das Telefon. Eine Bildnachricht leuchtete auf, ein beängstigend klares Foto von der Hauptstraße in Hithechurch in einem schwachen, winterlichen Morgenlicht. Es zeigte eine Frau mit kurzen, wirren Haaren, die auf die Tür der Drogerie zuging, den Arm erhoben, um sie zu öffnen. Aus dem Blickwinkel war ein Teil ihres Gesichts zu erkennen. Sie sah blass und ernst aus und hielt den Kopf gesenkt, als wollte sie den direkten Blickkontakt mit jemandem drinnen vermeiden. Ich sah müde aus. Kein Wunder.
Unter dem Foto stand eine Nachricht.
Warum verschwenden Sie Ihre Zeit?
Ich starrte auf das Bild und die kurze, eisige Botschaft. Dann hörte ich Katie aus dem Inneren des Wohnwagens nach mir rufen, und ich steckte das Handy zurück in meine Tasche. Meine Hand zitterte nur leicht.
In jener Nacht wachte ich mit klopfendem Herzen auf und lag zusammengerollt in der Mitte des Doppelbetts. Ein paar Sekunden verharrte ich in dieser Position, wie erstarrt. Der Atem stockte mir, während ich versuchte, herauszufinden, was mich aus dem Tiefschlaf gerissen hatte. Und da hörte ich es wieder. Mehrere laute Schläge gegen die Außenseite des Wohnwagens, ein blechernes bumm-bumm-bumm, gefolgt von schrillem Gelächter, das Geräusch von kleinen schnellen Schritten. All das war ungemein vertraut, aber auch äußerst beunruhigend. Wie oft waren meine Cousins, Cousinen und ich um den Wohnwagen herumgelaufen, hatten dagegen geklopft und uns gegenseitig laut zugerufen? Aber nie um drei Uhr morgens.
Ich setzte mich auf und zog die Knie an mein Kinn. Dann drang das Geräusch von der anderen Seite des Wohnwagens herüber – noch mehr Schläge, noch mehr Lachen. Ich dachte an Katie, die in ihrem kleinen Zimmer schlief, und runzelte die Stirn. Meine Angst schlug in Verärgerung um. Ich glitt aus dem Bett und zuckte zusammen, als ich die Kälte außerhalb der warmen Bettdecke spürte. Leise schlich ich mich aus meinem Zimmer. Katies Tür stand ein paar Zentimeter offen. Ich blieb stehen und horchte, ob sie schon wach war. Sollte sie den Krach bisher nicht mitbekommen haben, wollte ich sie nicht durch mein Herumtappen wecken. Wieder erklang Gelächter, und ich hörte eine Unterhaltung im Flüsterton.
Ich steckte meinen Kopf zur Tür hinein. Katie schlief tief und fest, wie ich erkennen konnte, das dunkle Haar auf dem Kissen. Im Gegensatz zu mir schlief sie mit ausgebreiteten Armen, zurückgelegtem Kopf und offenem Mund. Nach einem Moment hörte ich das zarte Geräusch ihres Schnarchens und lächelte.
Dann folgte ein weiterer lauter Schlag, diesmal ganz in der Nähe meines Kopfs, dass ich fast zu Tode erschrak. Wütend stürmte ich ins Wohnzimmer und riss die Vorhänge auf. Ich konnte niemanden sehen, aber ein Schatten huschte über das mit Reif überzogene Gras – da rannte jemand davon, und gleich darauf erklang wieder in der Ferne dieses Lachen.
»Verdammte Kinder«, murmelte ich, wütend darüber, dass mein Herz wieder so schnell pochte. »Haben nichts als Unsinn im Kopf.«
Aber als ich die Vorhänge wieder zuzog, dachte ich an die Nachricht mit dem Foto. Und an den Brief mit seinem sehr konkreten Ratschlag. Vielleicht war ich ja doch nicht ganz allein hier draußen.
4. Kapitel
Juli 1988
Als Charlie das zaghafte Klopfen an der Wohnwagentür hörte, flitzte sie durch das winzige Wohnzimmer, um sie zu öffnen, bevor es jemand anderes tun konnte. Vor ihr stand Emily, das Mädchen, das sie am Vortag kennengelernt hatte, und sie sah sehr unsicher aus. Ihr Haar war ordentlich gekämmt, sie trug die abgewetzten Badesandalen, rosa Shorts und ein T-Shirt, das ihr fast bis zu den Knien reichte. Vorsichtig spähte sie in den Wohnwagen, doch Charlie drehte bereits den Kopf nach hinten.
»Ich gehe ein bisschen raus, Mum, bis später!«, rief sie über ihre Schulter hinweg.
»Immer mit der Ruhe, junge Dame.«
Widerwillig blieb Charlie in der Tür stehen, während ihre Mutter sich vom Esstisch erhob, an dem auch noch Charlies Großmutter und zwei Tanten bei einer Runde Kniffel dicht gedrängt saßen. Sie unterbrachen bereitwillig ihr Spiel, zündeten sich Zigaretten an, und Rauch stieg in dünnen Fahnen an die Decke. Charlies Tante Marj nahm die Gelegenheit wahr, um aufzustehen und den Kessel aufzusetzen.
»Mum, ich gehe nur auf den Spielplatz schaukeln, okay?«
»Ach ja?« Charlies Mutter war eine groß gewachsene Frau mit breiten Hüften. Während Charlies Haar ein kaum zu bändigendes Durcheinander von orangeroten Locken war, fiel das Haar ihrer Mutter in sanften Wellen und war eher tiefrot als karottenfarben. »Und wer ist das?«
»Das ist meine Freundin Emily«, murmelte Charlie und deutete kurz auf das andere Mädchen. Emily sah ihrerseits verwirrt aus. Auf dem schmalen Sofa im Wohnzimmer saß auf der einen Seite Charlies Großvater und schlief fest mit einer Zeitung auf dem Schoß, während Darren auf der anderen Seite lümmelte, ein elektronisches Puzzlespiel vor der Nase. Carol, Charlies ältere Schwester, war gerade dabei, sich sorgfältig Wimperntusche aufzutragen, und blickte dafür auf einen kleinen Handspiegel. »Ich habe sie gestern kennengelernt.«
»Emily. Aha.« Der Gesichtsausdruck ihrer Mutter wurde weicher. »Na dann, ab mit euch«, sagte sie und machte eine entsprechende Handbewegung mit ihrer Zigarette. »Aber ihr seid vor Einbruch der Dunkelheit wieder hier. Und du kannst Jenny mitnehmen.«
»Was?« Charlie begann sofort rückwärts zur Tür zu gehen und schob Emily vor sich her. »Jenny wird nicht mitkommen wollen, du kannst sie doch nicht so einfach …«
Aber ihre Mutter rief bereits nach hinten in das Schlafzimmer, und Jenny, eine von Charlies Cousinen tauchte augenblicklich auf. Sie war zwölf, sah aber jünger aus, hatte eine dicke Brille auf der Nase und war ständig erkältet. Sie hielt eine ihrer »My-Little-Pony«-Figuren in der Hand, mit denen sie im Schlafzimmer gespielt hatte, und der Ärmel ihres Shirts war ausgebeult von den vielen zusammengeknüllten Taschentüchern.
»Mum …«
»Ab mit euch. Und haltet euch von Ärger fern.«
Auch heute war wieder ein heißer Sommertag, aber eine kühle, leicht nach Salz riechende Brise machte das Wetter erträglicher. Die drei Mädchen bummelten in der für Kinder typischen Weise zum Spielpatz. Jenny lief hinten, auf ihren großen Brillengläsern spiegelten sich die Sonnenstrahlen, während Charlie und Emily vorneweg latschten und sich eine Packung Kaubonbons teilten.
»Du hast eine große Familie«, sagte Emily. Sie hatte eine leise, kratzige Stimme, als hätte sie stundenlang geschrien oder noch nie zuvor gesprochen.
»Ja. Wir wohnen zu zehnt in dem Wohnwagen. Ich, Mum, Grandma, Granddad«, Charlie zählte sie mit den Fingern auf, »meine Schwester Carol, und dann noch Darren, Jenny, Tante Marj, Tante Beverly und Onkel David.«
Emily war beeindruckt. »Wie passt ihr da alle rein?«
»Das ist aber noch nicht einmal die Hälfte meiner Familie!« Charlie biss in ein weiteres Kaubonbon. »Manchmal kommt auch noch mein Onkel mit seinen Kindern für ein paar Tage vorbei. Sie schlafen dann auf Luftmatratzen im Wohnzimmer! Ich habe aber noch mehr Cousins und Cousinen«, fügte sie hinzu und kam so richtig in Fahrt. »Und wenn sie zu Besuch sind, schlafen sie in den Schränken und auf dem Dach.«
»Das stimmt nicht«, sagte Jenny, die hinter ihnen hertrottete. »Das hast du erfunden.«
Charlie warf ihrer Cousine einen vorwurfsvollen Blick zu, aber Emily schien das egal zu sein.
»Ich habe keine Cousins und Cousinen«, erklärte sie. »Es gibt nur mich.«
»Keine Brüder oder Schwestern?«
»Nur mich«, antwortete sie und rieb sich die dünnen Arme, als wäre ihr kalt. Charlie entdeckte einen großen lila Bluterguss unter ihrem ausgebeulten T-Shirt. »Und meinen Dad. Und Mum.«
»He, willst du aufs Klettergerüst?« Der kleine Spielplatz war gerade in Sichtweite gekommen, und auf dem Gebilde in der Mitte, das aus roten und gelben Metallrohren bestand, turnten keine Kinder herum. »Wir können uns ganz oben draufsetzen.
Emily nickte. Die beiden rannten über die Wiese und begannen am Gerüst hochzuklettern. Jenny folgte langsam und schnäuzte sich die Nase. Als sie das Gerüst erreichte, blieb sie stehen und schaute nach oben.
»Ich will da nicht rauf«, sagte sie. Ihre Nase war rot.
»Musst du ja nicht!« Charlie stieg die Rohre hinauf, ihre Turnschuhe rutschten auf dem Metall. Emily war ein paar Sprossen über ihr. »Dann geh und spring ins Meer!«
Die Mädchen lachten und setzten sich auf die obersten Sprossen, von wo aus sie den gesamten Spielplatz und die Duschanlagen überblicken konnten. Selbst die Wohnwagen erschienen von hier aus ein bisschen kleiner. Charlie sah hinunter zu Jenny, die sich auf den staubigen Boden unter dem Klettergerüst gesetzt hatte und mit ihrem Plastikpony spielte. Warme, sommerliche Geräusche drangen zu ihnen herüber: das Kinderlachen auf den Schaukeln, das Surren eines Rasenmähers, das Kreischen der Möwen.
»O sieh mal«, Emily legte ihre Hand auf das rote Rohr zwischen ihnen. Eine braune Gartenkreuzspinne von der Größe eines Pennys spazierte gerade darüber. Charlie schreckte zurück, aber Emily ließ sie auf ihren Handrücken krabbeln und hob sie zu sich.
»Hast du keine Angst vor Spinnen?«
»Nein, eigentlich nicht. Sie tun einem ja nichts.« Emily legte sie so weit wie möglich von Charlie entfernt ab. »Wir haben beim Hochklettern wahrscheinlich ihr Netz zerstört, und jetzt muss sie sich ein neues spinnen.«
»Hm.« Charlie unterdrückte einen Schauer und fragte sich, ob ihre Haut nun von winzigen unsichtbaren Spinnenfäden überzogen war. »Eine Freundin meiner Mutter war einmal in Spanien in Urlaub. Bei ihrer Rückkehr hatte sie diesen wirklich schmerzhaften Fleck auf der Wange, der sich immer schlimmer entzündete und größer wurde, bis er eines Tages aufplatzte und Hunderte von winzigen Babyspinnen hinauskrabbelten.«
Emily sah sie fassungslos an. »Ist die Geschichte wahr?«
Charlie nickte vergnügt. »Ja, ist sie. Die ist gut, oder?« Sie hatte sie in einem ihrer absoluten Lieblingsbücher aus der Bibliothek gelesen, Scary, Gross and True! Spine Tingling Tales – ein Buch voller schauriger Gruselgeschichten, das es aus Sicht ihrer Mutter nicht geben müsste. Sobald im Titel eines Buchs behautet wurde, dass es um wahre Geschichten ging, war es genau das richtige für Charlie.
»Kennst du noch andere Geschichten?«
Charlie grinste.
Während sie in der nächsten halben Stunde das Gerüst hinauf- und hinunterkletterten, mit den Händen an den Streben baumelten oder sich über die Sprossen schwangen, erzählte Charlie viele ihrer Lieblingsgruselgeschichten, von der alten Dame, die ihren Pudel nach einem verregneten Spaziergang in die Mikrowelle steckte, um ihn zu trocknen, bis hin zu Bloody Mary, der Geschichte des Geistermädchens, das in einem Spiegel erschien, wenn man sie herbeirief. Da wurde Emily ganz still.
»Ja.« Charlie war in ihrem Element. Sie schwang die Beine hin und her. Einer ihrer Turnschuhe hatte sich gelockert. »In der Mädchentoilette in meiner Schule. Sie hasst die Schule, weil sie dort umgebracht wurde. Das Ganze wurde vertuscht, und sie hat nie Gerechtigkeit erfahren.«
»Gerechtigkeit«, murmelte Emily.
»Wenn du also nachts auf die Toilette gehst und dreizehnmal ›Bloody Mary‹ in den Spiegel sagst, erscheint sie darin. Blutüberströmt. Und wenn du dich wegdrehst, weil du Angst hast, greift eine blutige Hand unter der Toilettentür nach dir und zerrt dich in die Hölle, wenn sie dich erwischt.« Charlie nickte zufrieden über dieses Detail, das sie selbst hinzugefügt hatte.
»Das ist alles völliger Unsinn«, rief Jenny. Sie war aufgestanden, ihr blasses, rundes Gesicht nach oben gewandt. Ihre