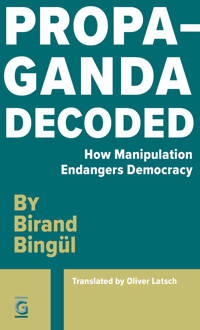4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Treffen sich zwei Kulturen … In ihrer Stadt ist Ursel Piepenkötter die unangefochtene Nummer eins. Als amtierende Oberbürgermeisterin liebt sie das Bad in der Menge, sie ist resolut und kämpferisch. Ihre Spezialdisziplinen: Tricksen, Tarnen, Täuschen. Ihr oberstes Ziel: die Wiederwahl. Doch die gerät in Gefahr, als Nuri Hodscha, der neue Geistliche der türkischen Gemeinde, zum Einstand ankündigt, eine prächtige Moschee bauen zu wollen. Vielen Bürgern der Stadt ist der Islam nicht geheuer – muss eine Bürgermeisterin da nicht eingreifen und Profil zeigen? Ursel Piepenkötter wittert die Chance, durch eine wohldosierte Portion Populismus die Wahl für sich zu entscheiden. Doch als sie Nuri Hodscha den Marsch blasen will, ist sie an den Falschen geraten: Der Mann Allahs ist ein Schlitzohr ohnegleichen. Ob Kuhhandel oder Erpressung – auch ihm sind alle Mittel recht. Noch 42 Tage bis zur Wahl. Zwei Gegner, die sich nichts geben. Der Kampf ist eröffnet ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 368
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Birand Bingül
Der Hodscha und die Piepenkötter
Roman
Für meine beiden Liebsten
Wie der Hodscha und die Piepenkötter sich das erste Mal trafen
Bis zu dem Tag, an dem Nuri Hodscha ankam und sich alles schlagartig ändern sollte, war die Stadt lange, lange langweilig gewesen.
Auf ihrer Homepage rühmte sie sich damit, in den Siebzigern die Bundesgartenschau ausgetragen zu haben. In den Achtzigern, darauf waren die Menschen recht stolz, hatte Robert Redford hier residiert. Na ja, es war eine Übernachtung. Auf der Durchreise. Weil alles eingeschneit war. Aber ein junger Reporter, der unbedingt groß rauskommen wollte, Bob Winter, hatte die ganze Nacht bei minus vierzehn Grad vor dem Hotel ausgeharrt, um Redford interviewen zu können. Als der tatsächlich erschien, war Bob Winter so überrascht, dass er bloß eine einzige, völlig hilflose Frage herausbrachte: «Did you sleep well?» Haben Sie gut geschlafen? Und auf dem Weg vom Hoteleingang bis zur wartenden Limousine soll Redford geantwortet haben: «Selten so gut geschlafen.» Kein Mensch außer Bob Winter weiß wirklich, ob der verschlafene Redford das oder etwas anderes murmelte wie «Selten geschlafen», «Gehen Sie schlafen» oder «Halt’s Maul, du Schmierfink, es ist fünf Uhr vierzig»…
Auch wenn sich die Leute in der Stadt durchaus im Christentum verwurzelt gaben, waren sie wahrlich nicht päpstlicher als der Papst. Der Kirchturm erhob sich schön und alt über das Stadtzentrum, er war aber bei weitem nicht der schönste oder älteste im Lande. Und so druckte die Zeitung, den historischen Moment begreifend, Winters vage Redford-Geschichte auf Seite eins. Am nächsten Tag wurde der Hotelier interviewt, am übernächsten das Zimmermädchen, am überübernächsten der Oberbürgermeister. Und irgendwann Bob Winter selbst. Kurzum, das war eine große Sache.
In den Neunzigern hatten die Strategen des Stadtmarketings versucht, Redford für eine Kampagne («Der schönste Schlaf Deutschlands erwartet Sie hier») zu gewinnen, aber sie bekamen nicht einmal eine Antwort von seinem Agenturbüro. Stattdessen luden sie dann den Bundespräsidenten ein, der auch schon drei Jahre später kam. Wie er schlief, ist nicht kolportiert. Fest steht nur, dass sich viele Stadtobere nach der Jahrtausendwende mit der Mittelmäßigkeit des Ortes abfanden und sich mehr den alltäglichen Sorgen ihrer Bürger widmeten. Das war vernünftig, aber zugleich ein wenig öde.
Alles änderte sich mit der Kandidatur von Ursel Piepenkötter für das Bürgermeisteramt. Konservativ hatten sie hier immer gewählt – doch als ihre Partei mit Ursel Piepenkötter erstmals eine Frau für die Oberbürgermeisterwahl aufstellte, sorgte das doch für einigen Gesprächsstoff. Mehr Menschen, als es zugegeben hätten, fragten sich: Kann die Piepenkötter das? Eine Frau? Darf die das? Und die Erzkonservativen schwadronierten an den Stammtischen, an denen sie sonst über Ausländer, Schwatte und Muslime scherzten, darüber, ob es in ihrer Partei keine brauchbaren Männer mehr gebe. Nee, nee, nee, sagten sie dann trüb und hatten den nächsten Anlass, einen zu kippen.
Die Piepenkötter trug stets Kostüm und randlose Brille. Diese war gerahmt von mittellangen braunen Haaren, die, gespickt mit blonden Strähnchen, auf ein Seidenhalstuch fielen. Wieselflinke nordseegraue Augen sahen einen angriffslustig an. Die schmalen Lippen verrieten Disziplin und Härte.
Noch als sie Jura studierte, war die Piepenkötter in den Ortsverband eingetreten und hatte sich dann kontinuierlich hochgearbeitet: Frauenunion, Arbeitskreise, Straßenwahlkämpfe, Stadträtin. Ursel Piepenkötter war längst keine Unbekannte mehr, schließlich hatte sie es bis ins ferne Berlin in den Bundestag geschafft. Irgendwann war sie zurückgekehrt in ihre Heimatstadt, denn ihr Mann war viel zu früh an Krebs gestorben, und sie wollte sich um ihren Sohn kümmern.
Ursel Piepenkötter gewann die Wahl zur Oberbürgermeisterin damals knapp. Sie hatte, so ließ ihr Pressesprecher immer wieder durchblicken, nach wie vor einen direkten Draht nach ganz oben, zur Kanzlerin.
Inzwischen war sie 44, ihr Sohn Patrick pubertierte, als gäbe es kein Morgen, und in sechs Wochen stand die Wiederwahl an. Die Piepenkötter lag in Umfragen mit einem ordentlichen Polster von zehn Punkten vor ihrem sozialdemokratischen Herausforderer, Hartmut Hausmann. Die Liberalen hatten zu ihren Gunsten auf einen Kandidaten verzichtet, die Grünen zu seinen Gunsten. Und Kasimir Kress von der rechtspopulistischen Contra-Partei wollte ohnehin nur Opposition machen, genauso wie die Linken.
SONNTAG, 22.AUGUST, NOCH 42TAGE BIS ZUR WAHL
Abgesehen davon nahmen die Dinge in der Stadt ihren gemächlichen Lauf. Bis schließlich ein Mann, ein einziger Mann, ein unscheinbarer, untersetzter, 47-jähriger Mann mit graumeliertem und präzise gestutztem Vollbart und mächtigen Augenbrauen, an denen er zu zwirbeln pflegte, in die Stadt kam. Sein Name war Nuri Hodscha.
Nuri Hodscha stammte aus der Türkei und landete pünktlich um zwölf Uhr fünfzig mit der Mittagsmaschine der Turkish Airlines aus Istanbul. Die dortige Religionsbehörde hatte ihn nach Deutschland entsandt. Das war seit langem so üblich und seit kurzem in Deutschland umstritten. Nuri Hodscha war der neue Imam des Moscheevereins Gabrielstraße. Das war der größere von zwei Moscheevereinen in der Stadt. Der andere galt als sehr rückwärtsgewandt und wurde vom Verfassungsschutz beobachtet. Die Vereine gab es schon seit Gastarbeiterzeiten, also ungefähr seit fünfzehn vor Redford.
Nuri Hodscha hatte sein bescheidenes Hab und Gut mitgebracht, außerdem vier Sucuk – typisch türkische Knoblauchwürste –, dann drei alte perlmuttsteinverzierte Kästchen mit verschiedenen Gebetsketten, zwei edle Ausgaben des Korans – eine auf Türkisch, eine auf Arabisch. Und schließlich, ganz unten in den Koffern, fand sich das, was ihm – neben seinem Glauben – am wichtigsten war: eine Plattensammlung mit auffällig vielen Alben von Bruce Springsteen. Er hing daran fast mehr als an seiner Tochter Hülya, seit Nuri festgestellt hatte, dass seine Plattensammlung im Gegensatz zu seiner 16-jährigen Tochter keine Widerworte gab.
Hülyas Kopftuch umschloss eng ihr ungeschminktes Gesicht. Ihre Augenbrauen hatte sie stets hochgezogen, als höre sie sehr aufmerksam zu. Ihre Augen waren bernsteinfarben und zugleich undurchdringlich. Ihre Lippen voll, doch zusammengekniffen. Ihre sonstige Kleidung war nicht modisch eng, aber eng genug, um einige Hinweise darauf zu geben, dass sie eine ziemlich attraktive Teenagerin war.
Osman holte sie ab. Er war eine Art Mädchen für alles rund um die Moschee, ein gutmütiger Bursche mit Segelohren und militärisch kurzen Haaren. Seine Augen glänzten dunkel. Er war schlank und ein Meter dreiundachtzig groß. Er hatte beim alten Hodscha gelernt, den Mund zu halten und sich seinen Teil zu denken. Das tat er auch, denn Osman war ein wacher Kerl. Er begrüßte den Hodscha so aufrichtig und devot – mit lauter Handküssen, tiefen Verbeugungen und, im Gegensatz zu praktisch allen anderen Männern, nur einem winzigen, verstohlenen Seitenblick auf Hülya–, dass Nuri Hodscha sich vom ersten Augenblick seiner Loyalität und Ergebenheit sicher war.
Alle Koffer passten in seinen Kombi, und die drei fuhren los Richtung Stadt.
«Eve değil önce camiye», sagte Nuri Hodscha kurz zu Osman mit tiefer, vibrierender Stimme – erst zur Moschee und nicht zur Privatwohnung.
Osman nickte untergeben.
«Wie gehen die Deutschen mit euch um?», fragte Nuri Hodscha.
Osman zögerte. Er war es nicht gewohnt, zu Rate gezogen zu werden. «Seit dem 12.September 2001 sind wir nicht mehr Luft. Entweder schauen sie uns schräg von der Seite an – oder sie wollen mit uns reden. Dialog hier, Dialog da. Wir werden oft eingeladen, viel öfter als unsere Brüder vom anderen Verein. Runde Tische, Austausch mit Christen, Juden und Atheisten, Stadtteilfeste, Kulturveranstaltungen…»
«Bringt das was?», fragte Nuri Hodscha.
Osman hob den Kopf und machte «Tse!». Das hieß so viel wie Nein.
«Die Angst vor den Muslimen ist groß. Und sie wird größer.»
«Ist ja auch schwer zu verstehen, wie irre Terroristen im Handstreich unsere Religion zur Geisel nehmen konnten. Und die meisten begreifen noch weniger, warum der Islam diesen Fluch nicht aus eigener Kraft abschütteln kann.»
«Seitdem dieser Verrückte diesen komischen Regisseur umgebracht hat da in Holland –»
«…Theo van Gogh…»
«…seitdem haben wir auch viel mit der Polizei zu tun. Die hatten Angst, dass das zu uns nach Deutschland rüberschwappt. Wir sollten die Gläubigen beruhigen, damit der Funke nicht überspringt.»
«Das habt ihr geschafft», sagte Nuri Hodscha.
«Ja. Aber die Situation ist, um ehrlich zu sein, schwierig. Die Scharfmacher auf beiden Seiten bekommen mehr Gehör als die Vernünftigen, auch wenn viel weniger Menschen hinter ihnen stehen. Die Oberbürgermeisterin und alle anderen wichtigen Leute wollen aber einfach nur eines haben: ihre Ruhe. Wegen jedem Mist melden die sich bei uns. Jetzt sollen wir auch noch Nachhilfe geben, Deutschkurse, was weiß ich.»
«Ach ach ach… Und der Hodscha vor mir?»
«Der hat irgendwann die Nase voll gehabt. Er fühlte sich als Mann Allahs und nicht als Sozialarbeiter oder gar als Lokalpolitiker; selbst wenn das manche in unserer Gemeinde erwartet haben. Es heißt: Die Zentrale in der Türkei hatte schließlich ein Einsehen und ließ ihn heimkehren. Herzlich willkommen noch einmal.» Osman schielte im Rückspiegel kurz zu Hülya hinüber, doch sie schaute teilnahmslos aus dem Fenster.
«Danke, mein Sohn… Ist es noch weit?»
«Eine halbe Stunde vielleicht.»
«Gut», sagte Nuri Hodscha, bevor er sich zurücklehnte, um ein gemütliches Nickerchen zu machen. Nuri Hodscha konnte allzeit und überall schlafen. Er schnarchte dabei wie eine kleine, feine Säge, die man sanft durchs Holz zieht. Hülya starrte wortlos auf die deutschen Autobahnen. Es war ein verregneter Sommersonntag. Eine Woche hatte sie noch Ferien, dann sollte sie mit der Schule beginnen.
Die Moschee lag zwischen einem Wohnviertel und dem angrenzenden Gewerbegebiet. Überall hingen Wahlplakate von der Piepenkötter und ihrem Konkurrenten. In dem Flachdachbau im Hinterhof hatte früher eine Spedition ihre Büros gehabt. Das Gebäude war rußgrau, sehr alt und notdürftig renoviert. Der Asphalt war hier und da streifenweise erneuert, sodass der Platz vor der Moschee einem Flickenteppich glich.
Osman hielt den Wagen sehr vorsichtig an, er wollte den neuen Hodscha nicht durch anatolisches, also abruptes Bremsen aufwecken. Hülya beugte sich kurz rüber und versetzte ihrem Vater einen deftigen Stoß vor die Schulter. Nuri Hodscha erwachte und sah seine Tochter vorwurfsvoll an. Die lächelte bloß spöttisch und zeigte mit dem Kinn auf die Hinterhofmoschee. Nuri Hodscha beugte sich etwas hinunter, um besser durch die Seitenscheibe sehen zu können, und sagte leise: «Allahım.» Es klang ebenso traurig wie empört.
Schon hielt Osman Nuri Hodscha die Tür auf und öffnete über ihm einen Regenschirm. Hülya stieg aus und zog ihr Kopftuch etwas tiefer in die Stirn. Mit den Fingern glitt sie an der Innenseite ihres Kopftuches entlang, um sicherzugehen, dass ihre Haare verdeckt waren. Sie waren erst ein paar Schritte auf dem Platz vor der Moschee gegangen, als Osman anfing, knapp die Räumlichkeiten zu erklären. In dem Moment löste sich unter dem Vordach des gegenüberliegenden Gebäudes ein Mann aus der dunklen Häuserzeile und kam zielstrebig auf Nuri Hodscha zu. Er klappte den Kragen seines Mantels hoch. Unter einer Baseballkappe sahen lange graue Haare hervor. Er hatte fleischige Lippen und glasige Schweinsaugen. Sein Gesicht war aufgequollen. Wenn er sprach, dröhnte seine Stimme wie eine Flugzeugturbine.
«Nicht die schönste Moschee, was?»
Nuri Hodscha sah den Mann fragend an.
«Sind Sie der neue Boss hier?», wollte der Mann wissen. Nuri Hodscha konnte den Alkohol in seinem Atem riechen. Er machte einen Viertelschritt zurück. Erst dann nickte er.
«Ja Mensch! Herzlich willkommen. Mer-ha-ba. Sprechen Sie Deutsch?»
«Ain biss-schen», sagte Nuri Hodscha mit schwerem Akzent. «Und Sie sain?»
«Bob Winter. Von der Neuen Presse. Zeitung… Reporter…», sagte der Mann mit der Fahne und holte zum Beweis einen Block und einen Stift hervor und fuchtelte mit diesem durch die Luft, als ob er schreiben würde.
«Gutt», sagte Nuri Hodscha, «Begrrüßkomitee oder was?», schob er nach und seine großen braunen Augen lächelten. Er zwirbelte an seiner rechten Augenbraue, wie er es häufig tat, wenn er angestrengt nachdachte.
Bob Winter lachte laut auf. Es klang beinahe so, als wiehere er. «Mann, Sie sind gut! Sie haben jetzt schon hundert Prozent mehr Witze gemacht als Ihr Vorgänger. Der war ja vielleicht eine Schlaftablette… Aber lassen wir das. Begrüßungskomitee, ja, so was in der Art, so was in der Art… Hätten Sie Zeit für ein paar Fragen? Geht ganz schnell und tut auch nicht weh. Und ein kleines Foto, das ist alles.» Er lachte wieder.
Nuri Hodscha legte den Kopf schief, wie er es immer tat, wenn er überrascht wurde. Dann schaute er hinüber zu der ehemaligen Spedition und begann ganz langsam mit dem Kopf zu nicken. Hülya, die ihn besser kannte als jeder andere, konnte in seinem Mundwinkel dieses hinterlistige Grinsen entdecken. Das verhieß, so viel hatte sie gelernt, nichts Gutes. Doch sie hatte keine Ahnung, was ihrem Vater so diebische Freude bereitete.
«Osman, eine çay für Här Winta. Hülya, Auto drrinnen wartest du.»
Osman nickte eifrig, Hülya verdrehte die Augen, und Bob Winter lachte wieder sein lautes, wieherndes Lachen, als der Hodscha ihn in die Moschee bat.
Nuri Hodscha lachte dagegen unmerklich in sich hinein. Sein Vater hatte ihm immer wieder eine türkische Redewendung eingebläut: «Vurduğun yerden ses getireceksin!» Wörtlich hieß das: «Wenn du zuschlägst, muss man es hören können!», das bedeutete so viel wie: Wenn du etwas machst, mach es richtig. Sei zielstrebig und suche den Erfolg. Sei nicht zaghaft und geh mutig voran. Nuri wollte seinem Vater, Allah hab ihn selig, ein guter Sohn sein und nach einer guten Stunde in Deutschland richtig feste und krachend zuschlagen. Mit Worten, versteht sich. Er war sich sicher, dass Allah das gutheißen würde, und wenn nicht, dann konnte er das mit ihm ja auch noch später besprechen. Zu sehr reizte es ihn, gleich mal den Deutschen auf den Zahn zu fühlen…
MONTAG, 23.AUGUST, NOCH 41TAGE BIS ZUR WAHL
Es klingelte ganz weit entfernt. Wieder und wieder. Langsam kam das Klingeln näher. Mit einem kleinen Stöhnen wachte Ursel Piepenkötter auf, ohne die Augen zu öffnen, und tastete nach dem Schnurlostelefon auf der Nachtkommode.
«Wer stört?», zischte sie leise in die Muschel, doch niemand antwortete. Sie ließ das Telefon einfach fallen, doch das unsägliche Poltern erinnerte sie schlagartig an die verfluchte Flasche Rotwein, die sie am Abend zuvor auf dem Empfang der Wirtschaftsjunioren getrunken haben musste. Vielleicht war es auch etwas mehr gewesen; ein bisschen nur.
Es klingelte wieder. Oh Gott, dieser Lärm! Aber sie wollte die Augen nicht öffnen, sie war doch eben erst ins Bett gegangen. Es musste drei Uhr nachts sein. Sie hasste es, halb betrunken aus dem Schlaf gerissen zu werden.
Na gut, nochmal blinde Kuh, dachte Ursel Piepenkötter, und patschte auf der Kommode herum, bis sie ihr Handy hatte. «Ja?», raunte sie. Niemand antwortete. Doch das Klingeln ging weiter und drohte, ihren Kopf zum Platzen zu bringen. Verdammt, dachte sie, die Tür! Sie zog die Decke über den Kopf und rollte sich eng zusammen. Sollte doch ihr Sohn Patrick die Tür aufmachen… Oder war er es? Und hatte mal wieder Ärger?
Mit einem Stöhnen hievte die Piepenkötter sich auf, tastete mit ihren Füßen so lange über den Boden, bis sie ihre Pantoffeln gefunden hatte, öffnete widerwillig erst das rechte, dann das linke Auge, fluchte, um sich anschließend in ihren seidenen Morgenmantel hineinzuarbeiten und sich unfallfrei die Treppe ihres Hauses hinunter zur Tür zu schleppen.
Sie öffnete sie einen Spaltbreit. Meierlein. Einfach nur Meierlein. Meierlein mit Fahrradhelm. Okay, ein Meierlein, das kaum noch atmen konnte vor Aufregung. Und warum war es um drei Uhr nachts so unangenehm hell? Sie machte die Tür auf.
«Endlich, Chefin!» Florian Meier war Ursel Piepenkötters persönlicher Referent. Sie schätzte ihn, denn er war eine treue Seele. Er war ein bisschen zu klein und zu schmal für einen stattlichen Mann, zu förmlich angezogen für seine 23Jahre, trug einen definitiv zu spießigen Seitenscheitel, aber er war loyal, fleißig und wissbegierig. Er engagierte sich in der Jungen Union und wurde schnell rot. Gerade war er puterrot.
«Meierlein?! Wollen Sie mir einen Herzkasper verpassen?»
«Ich-ich-ich… Sie sind nicht ans Telefon…!»
«Ja und?»
«Ich-ich-ich…»
«Jaaah?», fragte sie gedehnt, wie sie es immer tat, wenn sie langsam genervt war, weil ihr etwas nicht schnell genug ging – oder wenn sie Kopfschmerzen hatte, so wie gerade.
«Ich… also… die Zeitung… Moschee.» Meierlein war völlig aufgelöst.
«Meierlein», rief die Piepenkötter – viel zu laut, wie sie dann selbst merkte, als sich ihr Kater meldete. Sie rieb sich die Augen.
«Meierlein, ein in weiten Teilen grammatikalisch korrekter deutscher Satz reicht. Sonst sehen wir uns im Büro.»
Meierlein blickte sie ganz verzweifelt an, sie wollte schon die Tür zuwerfen, als er die Tageszeitung hochriss.
Die Piepenkötter las die Schlagzeile des Titelblatts.
«Ach du…!», sagte sie und spürte Adrenalin in sich aufsteigen. Viel Adrenalin.
«…Scheiße!», rief Meierlein. Das konnte man nur mit viel Mühe und Sympathie einen in weiten Teilen grammatikalisch korrekten deutschen Satz nennen, aber wenigstens war er eindeutig.
Die Piepenkötter schüttelte sich.
«Nicht so laut», sagte sie und suchte rasch die Fenster der Nachbarhäuser ab, die teilweise erhellt, aber nicht von Neugierigen besetzt waren – und zog Meierlein zu sich ins Haus.
«Was ist denn, Chefin?», fragte Meierlein.
«Eine Oberbürgermeisterin im Morgenrock bei der Lagebesprechung. Ungeschminkt. Das ist sicher nicht das, worauf die Menschheit gewartet hat», antwortete sie und nahm ihm die Zeitung ab. Da stand es schwarz auf weiß: «Neuer Imam fordert repräsentative Großmoschee».
Sie wollte weiterlesen, doch die Buchstaben verschwammen vor ihren Augen. Vielleicht waren es doch zwei Flaschen Rotwein gewesen. Oder ein bisschen mehr.
«Helfen Sie mir, Meierlein. Eine Moschee mit Minaretten?»
«Ja.»
«Höhe?»
«Stand nicht drin.»
«Mit diesem… Aufruf an die Gläubigen?»
«Muezzin-Ruf? Stand nicht drin.»
«Finanziert von wem?»
«Spenden. Geld kriegen die ja immer zusammen.»
Sie nickte langsam mit dem Kopf.
«Wie heißt der neue Imam?»
«Nuri Hodscha.»
«Der hat ja Nerven, der Dreckskerl. Gleich am ersten Tag in Deutschland so etwas… Wer hat das geschrieben?»
«Bob Winter.»
Sie nickte noch einmal.
«Bob Winter, dieser alte Hund», sagte sie. Sie konnte den versoffenen Lokalreporter nicht leiden.
«Hätte er nicht vorher bei uns anfragen müssen, um auch unsere Seite zu hören? Warum hat er unsere Meinung nicht eingeholt, bevor er diesen Artikel veröffentlicht?», fragte Meierlein.
«Meierlein! Seien Sie nicht naiv. So hat er zwei Seite-eins-Geschichten hintereinander. Mindestens…»
«Wir müssen schnell etwas tun!», rief Meierlein hektisch.
«Wie viel Uhr haben wir?»
Meierlein schaute auf seine Digitaluhr, dabei fielen ihm die Haare seines blonden Scheitels ins Gesicht, die er zurück in die Stirn schob. «Viertel vor sieben.»
Die Piepenkötter überlegte.
«Diese Muslime! Die werden auch größenwahnsinnig hier», sagte Meierlein und ging nervös auf und ab.
«Warum?», fragte die Piepenkötter.
«Warum? Meinen Sie das ernst? Eine große Moschee – für wen hält der sich?»
«Es könnte Größenwahn sein. Es könnte aber auch sein, dass er einfach ein angemessenes Gotteshaus für seine Gemeinde möchte. Oder würden Sie es mögen, wenn Ihr Kirchgang Sie jeden Sonntag in einen runtergekommenen Hinterhof führen würde?» Sie wusste, dass Meierlein sonntags immer zur Kirche ging.
«Also… Das heißt, Sie wollen das unterstützen?»
«Meierleeeiin! Was habe ich eben zu Ihnen gesagt?»
«Das mit dem Kirchgang?»
«Herrgott, Sie sollen nicht so naiv sein! Natürlich unterstütze ich das nicht. Ich will schließlich noch einmal wiedergewählt werden und nicht den Weltfrieden schaffen. Das Problem ist nur, wenn dieser Nuri tatsächlich das nötige Geld zusammenhat, dann werden wir ihn nur sehr schwer aufhalten.»
«Das fasse ich nicht.»
«Wissen wir irgendwas über ihn?»
«Auf die Schnelle habe ich nichts herausfinden können.»
«Hmmm… Lassen Sie für neun Uhr dreißig eine Pressekonferenz ansetzen», sagte die Piepenkötter.
«Ja, natürlich, Frau Oberbürgermeisterin. Wie wollen Sie denn, wenn ich fragen darf, vorgehen?»
«Tja… Sehr, sehr langsam, glaube ich. Salami-Taktik. Verzögern. Tricksen, tarnen, täuschen. Genehmigungsverfahren. Anhörungen. Das ganze Programm. Sprachlich etwas rechts auslegen, um die Seite ruhig zu halten, aber nicht zu direkt, eher subkutan. Mal schauen, ob der Hodscha nicht nur eine große Klappe hat, sondern auch noch einen langen Atem.»
Die Piepenkötter lächelte Meierlein an. Ein lustvolles Haifischlächeln.
Meierlein lächelte zurück. Ängstlich.
«Und jetzt ziehen Sie Leine. Ich muss mir noch ein Gesicht malen. Ach, und sehen Sie zu, dass Bob Winter seinen versoffenen Hintern zur Pressekonferenz bewegt», sagte die Piepenkötter und bugsierte Meierlein vor die Tür.
Meierlein setzte sich seinen Fahrradhelm auf und fuhr, so schnell er konnte, ins Büro.
Knapp drei Stunden später rauschte die Piepenkötter mit Meierlein und ihrer Sprecherin im Schlepptau in den kleinen Saal des Rathauses, in dem sie Pressekonferenzen abhielt. Gesicht, Kostüm, alles perfekt. Mit einem kurzen Blick in den Raum stellte sie fest, dass nicht nur die Zeitungsfritzen und das junge Huhn vom Lokalradio da waren, sondern auch das regionale Fernsehen. Die kamen nur, wenn sie fette Beute erwarteten. Ganz hinten in der Ecke lehnte Bob Winter mit der Schulter an der Wand. Er hatte sich eine Zigarette hinter das linke Ohr geklemmt und nickte ihr höhnisch zu. Ursel Piepenkötter übersah das geflissentlich, holte ihren Sprechzettel mit Stichworten hervor, straffte den Rücken und legte gewohnt zackig los.
«Vielen Dank für Ihr kurzfristiges Erscheinen. Ich will gleich zur Sache kommen. Wie Sie der heutigen Presse entnommen haben, soll der neue Hodscha des Moscheevereins Gabrielstraße gefordert haben, dass eine neue, repräsentative Moschee in der Stadt errichtet wird. Wenn wir dem Autor des Artikels ausnahmsweise mal Glauben schenken», die Reporter lachten und drehten sich zu Bob Winter um, der eine Art höfischen Knicks machte, «dann will ich Sie und die Menschen zuallererst beruhigen. Natürlich sind wir eine weltoffene, tolerante Stadt. Jeder soll hier seinen Glauben so leben können, wie er möchte, solange er andere damit nicht all zu sehr stört. So haben wir es immer gehalten, und so werden wir es in Zukunft tun.»
Die Piepenkötter blickte kurz hinunter auf ihren Sprechzettel. Sie setzte ihr Nonnengesicht auf, wie sie es gerne tat, wenn sie bluffte. Wie ein Mantra wiederholte sie innerlich die Formel «barmherzige Unschuld, barmherzige Unschuld». Dieser Blick – sie hatte ihre Auftritte nachher oft im Fernsehen studiert – war einfach hollywoodreif, fand sie. Zum Glück, denn jetzt brauchte sie mal wieder eine kleine Notlüge zur Beruhigung des Volkes.
«Wir sind Herr des Geschehens. Keiner in der Stadt – ich wiederhole: keiner – muss sich Sorgen machen, dass sich hier etwas in eine bestimmte Richtung verselbständigt. Ich nehme entsprechende Ängste in der Bevölkerung, die mir bereits zugetragen wurden, äußerst ernst. Und dann ist es auch so, dass bei uns in Deutschland – das ist vielleicht etwas ungewohnt für unseren neuen Hodscha – ein Moscheebau ja eine sehr langwierige Sache ist. Ein angemessener Ort ist zu finden, dann das Genehmigungsverfahren… Die Bürger müssen einbezogen und gehört werden. Kurz und gut, vielleicht macht man in der Türkei Politik, indem man alles an den erstbesten Journalisten hinausposaunt, der einem über den Weg oder den Teppich läuft. Bei uns nicht. Das sage ich in aller Deutlichkeit. Aber ich bin sicher, dass unser neuer Hodscha schon bald die Gepflogenheiten in Mitteleuropa lernen wird. Auf jeden Fall werden wir ihm dabei behilflich sein.
Und eines muss der neue Hodscha», sie schaute auf ihren Zettel, «Nuri Hodscha auch wissen: Wir sind hier die Mehrheit. Die Muslime sollten mit uns, nicht gegen uns arbeiten. Ich rechne damit, dass die Verantwortlichen im Moscheeverein, allesamt sehr vernünftige Leute, demnächst auf mich zukommen und sich der Fauxpas des neuen Hodschas dann wieder einrenken lässt. Bei mir hat sich bis heute kein einziger Muslim über die Moschee beschwert, und wir arbeiten ja, wie Sie wissen, seit einigen Jahren sehr vertrauensvoll und eng zusammen. Dieser Vorstoß scheint also auch in der Gemeinde Gabrielstraße nicht wirklich abgesprochen zu sein. Aber das müssen unsere muslimischen Freunde natürlich unter sich ausmachen. Wir stehen weiter für Dialog mit Augenmaß.
Zu guter Letzt meine ich mich zu erinnern, dass der alte Hodscha mir sagte, von den Jüngeren kämen immer weniger in die Moschee. Das wird sicher auch eine Rolle spielen, wenn wir irgendwann einmal über die Größe einer Moschee sprechen sollten. Großmoschee, da ist Bob Winters Phantasie wohl mit ihm durchgegangen. Aber das sind wir ja von ihm gewohnt und schätzen den Kollegen trotzdem.»
Die Journalisten lachten, und es gab die eine oder andere lahme Nachfrage, die ihren souveränen Auftritt jedoch zu keiner Zeit gefährdete, wie die Piepenkötter selbst fand. Läuft doch, dachte sie und wollte schon ihr Pult verlassen, da erhob Bob Winter seine Stimme:
«Gehen Sie heute hin?»
«Wie bitte?»
«Gehen Sie heute hin?»
«Wohin?»
«Der Moscheeverein stellt doch gleich Nuri Hodscha der Presse vor. Bisher sollte wohl der Sozialdezernent hingehen, aber angesichts der Situation wäre es ja denkbar…»
Die Piepenkötter zuckte für einen Augenblick innerlich zusammen und schaute aus dem Augenwinkel zu ihrer Pressesprecherin hinüber, die mit Mühe ihre Überraschung überspielte. Dann trat die Piepenkötter wieder ans Mikro und setzte ihr Nonnengesicht auf.
«Ja, Bob, das haben wir auch gedacht und bereits geändert. Sie können also mit mir rechnen. Aber Sie werden sehen: Für die nächste Schlagzeile auf Seite eins wird es für Sie nicht reichen.» Sie lachte, und alle lachten mit. Außer Bob Winter, der wenig später Osman anrufen sollte, um ihm – wie mit Nuri Hodscha verabredet – die Reaktion der Oberbürgermeisterin minutiös zu schildern.
Zur selben Zeit kniete Nuri Hodscha auf dem Boden seiner neuen Dienstwohnung und verrichtete das Gebet. Die Wohnung lag im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses ohne Aufzug. Sie hatte vier Zimmer, Küche, Diele und Bad.
Nuri Hodscha nahm das Beten sehr ernst. Er liebte die Bewegungen, die Rituale, diese mystische Versunkenheit. Am Ende des Gebets sagte er: «Allahım. Jetzt hast Du mich also nach Deutschland geführt.»
«Deutschland ist ein schönes Land, oder?», fragte Allah.
«Hier bin ich und hier will ich hart für Dich arbeiten.»
«Ich freue mich, das zu hören. Wobei du hart arbeiten nicht mit Übereifer verwechseln solltest.»
«Übereifer? Ich? Ich weiß nicht, wovon Du sprichst.»
«Nuriii!», sagte Allah.
«Okay okay okay. Aber ich habe es für Dich getan. Diese Hinterhofmoschee ist Deiner unwürdig!»
«Nein, Nuri, getan hast du es, um gleich einmal mit dem Kopf durch die Wand zu rennen, wie du es so gerne tust, und weil du trotz deines grauen Bartes immer noch deinen Vater beeindrucken willst… Was meiner würdig ist oder nicht, entscheide immer noch ich. Und mir ist lieber, die Gläubigen kommen frohen Herzens in eine heruntergekommene Moschee als trüben Herzens in eine funkelnde.»
«So weise wie Du habe ich das nicht betrachtet… Doch ist es nicht am besten, wenn die Gläubigen frohen Herzens in eine funkelnde Moschee kommen?»
«Nuri, du bist ein Schlitzohr, und ich muss gestehen, dass ich denselben Gedanken hatte. So ließ ich dich gewähren. Trotzdem hast du dich hitzig und vorschnell von deinem Dickkopf leiten lassen.»
«Ohne Dir widersprechen zu wollen, würde ich sagen, dass ich womöglich die Gelegenheit beim Schopf gepackt habe. Heißt es zu Unrecht, dass der Zweck die Mittel heiligt, Allahım?»
«Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. Allein, du solltest nicht gleich so weitermachen, wie du in der Türkei aufgehört hast. Es gibt Länder auf der Welt, die wesentlich weniger Komfort bieten als die europäischen…»
«Ich werde mich bemühen, aber Du hast mir keinen einfachen Charakter geschenkt, Allahım.»
«Hüte deine Zunge», sagte Allah streng. «Und ständig das letzte Wort haben zu wollen ist kein Charakterzug, sondern eine schlechte Angewohnheit!»
Gerade als Nuri Hodscha etwas erwidern wollte, klingelte es an der Tür. Osman war überpünktlich, um ihn zur feierlichen Vorstellung zu chauffieren. Nuri Hodscha erhob sich, verstaute seinen Gebetsteppich und drückte den Summer. Osman kam die Treppen hoch und begrüßte ihn untertänig.
«Osman, mein Sohn, hast du Winter ausgerichtet, er soll seine Kamera mitbringen?»
«Natürlich, mein Hodscha.»
«Und diese Piepenkötter kommt sicher?»
«Ja, mein Hodscha.»
«Und sie trägt Kostüm?»
«Wie immer, mein Hodscha. So hat er es gesagt.»
«Hülya!», rief Nuri, und seine bildhübsche Tochter kam, sich die Hände abtrocknend, aus der Küche. «Hülya, du bleibst hier und bereitest alles so vor, wie ich dir aufgetragen habe.»
Hülya nickte und ging mit schnellen Schritten wieder in die Küche.
Kaum saß Nuri auf der Rückbank von Osmans Wagen, schloss er die Augen für ein kurzes Nickerchen, sodass Osman beeindruckt war von der Gelassenheit des neuen Hodschas, der in den ersten vierundzwanzig Stunden seiner Amtszeit mehr Wirbel veranstaltet hatte als der alte in drei Jahren. Osman gefiel es, dass endlich etwas los war.
Er weckte den Hodscha erst, kurz bevor sie an der Moschee ankamen. Osman erlaubte sich, Nuri Hodscha viel Glück zu wünschen, stieg dann aus und öffnete ihm die Tür.
Die hohen Herren aus dem Moscheeverein hatten sich nicht lumpen lassen. Auf dem Vorplatz der Moschee herrschte ein großer Auftrieb. Auf der einen Seite führte eine junge Truppe Volkstänze auf, begleitet von scheppernder Musik aus zwei mickrigen Boxen; auf der anderen gab es türkische Leckereien, von Börek bis Döner. Am Moscheeeingang waren zwei Mikrofone aufgebaut, dort sollte der offizielle Teil der Begrüßung stattfinden. In der Moschee rezitierten Schuljungen den Koran. Viele neugierige Gemeindemitglieder waren ebenso da wie deutsche Honoratioren, außerdem Journalisten von deutschen und türkischen Redaktionen. Insgesamt waren es etwa hundertfünfzig Menschen, und es gab keinen Einzigen, der nicht auf die eine oder andere Art von Nuri Hodschas Vorstoß erfahren hatte. Die meisten Journalisten hatten bereits an der Pressekonferenz der Piepenkötter teilgenommen.
Als Nuri Hodscha aus dem Wagen stieg, klatschten viele höflich. Zunächst begrüßten ihn die Herren Vereinsvorstände, dann der evangelische Pfarrer. Der katholische Pastor schenkte ihm eine Bibel.
Nuri Hodscha genoss es, im Mittelpunkt zu stehen. Osman flüsterte ihm zu, die Pressesprecherin der Piepenkötter habe angerufen, die Oberbürgermeisterin sei aufgehalten worden, aber bereits auf dem Weg, man möge doch mit den Reden beginnen, damit die Oberbürgermeisterin nicht all zu lange warten müsse. So setzte sich eine Traube in Bewegung, Richtung Mikrofone. Verschiedene Leute, die Nuri Hodscha allesamt nicht kannte, verloren freundliche Worte über den Dialog im Allgemeinen und den neuen Hodscha im Besonderen. Keiner wagte es, das Moscheethema anzuschneiden, bis der metallicgraue Audi der Oberbürgermeisterin vorfuhr, der Pastor seine Rede über die Nächstenliebe eilig beendete und alle Anwesenden den Atem anhielten. Die erste Begegnung von ihr und Nuri Hodscha – der Platz vibrierte förmlich vor Spannung.
Beim Händedruck sahen sich die beiden kühl lächelnd in die Augen, und die Fotografen drückten auf die Auslöser.
«Herzlich willkommen», sagte die Piepenkötter in die vor ihr stehenden Mikrofone, sodass alle sie hören konnten. «Ich freue mich, dass Sie hier sind. Sie haben sich ja gleich gut eingeführt.» Die Leute lachten, teils unsicher, teils voller Vorfreude auf das anstehende Wortgefecht.
Nuri Hodscha machte einen Schritt auf die Mikrofone zu und erwiderte: «Fille Danck, Frrau Piepenköter. Jetzt wenigstens alle wissen, ich da bin.»
Noch ein Lacher.
Hatte dieser Mistkerl gerade wirklich Piepenköter gesagt? Köter? Aus den Augenwinkeln sah die Oberbürgermeisterin, wie empört Meierlein dreinblickte. Sollte sie den Hodscha korrigieren?
Dieses eine Mal schlucke ich es, dachte sie. Nur nicht provozieren lassen oder kleinkariert wirken oder sogar ausländerfeindlich. Vielleicht war es auch keine Absicht, und er konnte einfach nicht besser sprechen. Dass die Türken aber auch immer Leute schickten, die kaum oder gar kein Deutsch konnten.
Dann wandte sie sich dem Hodscha zu.
«Ja, fürwahr, Sie sind da. Ob sich wirklich alle darüber freuen, wird sich noch zeigen», sagte die Piepenkötter süffisant und sorgte sogar bei einigen türkischen Journalisten für ein Schmunzeln. Sie warf Nuri Hodscha einen aufreizenden Seitenblick zu. Sie gefiel sich in ihrer rhetorischen Überlegenheit.
Nuri Hodscha legte den Kopf schief, wie er es immer tat, wenn er überrascht wurde, doch als das Gelächter abebbte, sagte er ganz sanft:
«Sie sisch sischer werde frreuen, Frau Piepenköter.»
«Ach, ich hoffe auch, dass der erste Eindruck trügt. Sie sprechen ja auch sehr gut Deutsch, da werden wir uns bald sehr gut verstehen.» Diese Spitze brachte mehr Lacher bei den Deutschen.
«Deutsch früher gelernt. Bissschen vergessen. Aber bitte entschuldigen für erste Aindrruck. Allah hat mir geschenkt die Temperrament und die Eifer!»
«Das sind ja an sich erfreuliche Gaben, die unserem guten Dialog, den wir bisher mit Ihrer Gemeinde hatten, sicher nicht im Wege stehen werden.»
«Dialogg sär gutt, Frau Piepenköter», sagte Nuri Hodscha und ging einen kleinen Schritt auf die Piepenkötter zu.
«Das finde ich auch. Darauf können wir wirklich stolz sein: dass wir das bei all den alltäglichen Problemen und Problemchen miteinander hinbekommen. Da kann sich Herr Kress, das ist hier der Rechtsaußen bei uns, auf den Kopf stellen.» Auch die Piepenkötter machte einen kleinen Schritt auf Nuri zu. Ihre Gesichter trennte nur noch eine Handbreit. Beide musterten sich aufmerksam wie zwei Ringer, bevor sie in den Clinch gehen.
«Wenn Sie für Dialogg, wir sofort anfange, oda?», rief Nuri Hodscha und blickte in die Menschentraube vor ihm. Viele klatschten.
«Frrau Bürrgerobermeisterin, bitte sponntann swaite Aindruck machen direkt jetzt in maine Wohnung. Isch Sie einladen schönnes tradisionell Frrühstück.»
Ein Raunen ging durch die Menge. Etliche Gäste und die Mehrheit der Journalisten nickte. Und wie bei einem Tennisspiel wandten sich nun alle der Piepenkötter zu.
«Ja, also, mein Terminkalender…» Die Piepenkötter sah sich nach Meierlein um.
«Frrische Zutaten aus Türrkei. Unsere Gastfrreundschaft tut nischt ackseptiere Nain!», sagte Nuri und breitete in großer Geste die Arme vor der Piepenkötter aus. Einige jüngere Muslime pfiffen auf den Fingern.
Die Piepenkötter lächelte mechanisch in die Menge und wusste: Es gab keinen Ausweg, ohne richtig schlecht dazustehen. Und ein bisschen neugierig war sie auf diesen Hodscha schon geworden.
«Ja… ich. Ja, gut. Das ist mir auch wirklich wichtig. Also, kurz, wir haben noch Termine, da muss ich mich… Da bitte ich um Verständnis.»
«Wunderbaa», rief Nuri Hodscha und drückte die perplexe Piepenkötter an sich. Ein Jubel brach aus und ein Blitzlichtgewitter dazu.
«Das wäre doch ein tolles Bild. Dürfen wir Sie begleiten?», röhrte Bob Winter dazwischen.
Die Piepenkötter holte kopfschüttelnd Luft, aber da kam ihr Nuri Hodscha bereits zuvor.
«Natürlisch, natürlisch. Unser Gemainde sär ofen. Kommen Sie, kommen Sie… Obwohl: Sär wenig Pelatz. Vielleicht ein Fottorraff schießt Fotto und gibt Fotto die andere?! Unhöflisch in unsere Kültür so zu fille eng. Entschulden bitte. Sie– Sie komme mit!?», sagte Nuri Hodscha und zeigte auf Bob Winter. Noch einmal holte die Piepenkötter Luft, aber da hatte Bob Winter schon seine Nikon gehoben und «Klaro» gerufen.
Die Vorstellung von Nuri Hodscha endete in Bravorufen, Musik setzte ein, und nachdem alle Hände geschüttelt und Schultern geklopft waren, fuhr eine kleine Kolonne los, bestehend aus Osman und Nuri Hodscha im ersten Wagen und Bob Winter im zweiten. Im dritten saßen Meierlein, der Fahrer und die Piepenkötter, die sich dachte, dass der Hodscha vielleicht doch ein herzlicher, wenn auch übereifriger und spitzzüngiger Mann war.
«Dass maine Töchterschen Hülya», sagte Nuri Hodscha. Seine Tochter gab der Piepenkötter die Hand und sagte höflich «Guten Tag» mit deutlich weniger Akzent als ihr Vater. «Sie Deutsch Schule in Türrkei. Guttes Mädschen!» Die Piepenkötter begrüßte sie freundlich und erzählte, sie habe einen Sohn, Patrick, etwa im selben Alter wie Hülya.
«Und Ihre Frau?», fragte die Piepenkötter den Hodscha. «Ist sie nicht da?»
«Tott leider», sagte Nuri Hodscha, und Hülya senkte den Blick.
«Oh, verzeihen Sie, mein Beileid», sagte die Piepenkötter.
«Kain Problämm. Ist schon lange her.»
Die Piepenkötter räusperte sich und sah sich um. Es schien hier wirklich eng zu sein in dem Apartment, so wie der Hodscha erklärt hatte, aber sehr aufgeräumt. Die Piepenkötter sah die Dienstwohnung zum ersten Mal. Den vorherigen Hodscha hatte sie nie privat besucht. Bob Winter hielt die Kamera die ganze Zeit vor der Brust, sodass er gleich abdrücken konnte, wenn er ein gutes Motiv sah.
«Ja, dann, bitt schönn», sagte Nuri und öffnete die Wohnzimmertür. Dort hatte Hülya ein hinreißendes Frühstück vorbereitet. Eier, Oliven, Sucuk, Schafskäse, einen Vorspeisenteller mit Humus und Auberginenpüree, das Fladenbrot war warm und roch süßlich. Nur, sah die Piepenkötter mit Erschrecken: Es gab keine Stühle. Das Frühstück war auf einem ganz niedrigen Tisch vorbereitet. Sitzen musste sie wohl…
«Nehme Sie Pelatz, einfach auf die Boden. Tradisionell Frrühstück. Yer sofrası heißt. Bitte, bitte.»
«Also nein», erwiderte die Piepenkötter, «seien Sie mir nicht böse, aber ich fürchte, ich bin nicht passend gekleidet und –»
Da hatte Nuri Hodscha im Nu die Piepenkötter an den Schultern gepackt, «Kain Problämm, kain Problämm» gerufen und sie fest zu Boden gedrückt. Die Piepenkötter war überrascht von seiner Kraft, unsicher wegen der Kamera, verkrampft wegen ihres Rocks und verzweifelt, weil sie nicht wusste, was da mit ihr geschah. Also wand sie sich und versuchte, Nuri Hodschas Griff zu entkommen, während er beruhigend auf sie einsprach und Bob Winter zuzwinkerte. Schließlich landete sie irgendwie ungünstig auf beiden Knien und drohte wie ein hilfloser Käfer auf den Frühstückstisch zu kippen. Da griff sie doch nach Nuris helfenden Händen, um sich in eine seitliche und sittliche Position hieven zu lassen. Bob Winter betätigte genüsslich den Dauerauslöser. Als die Piepenkötter saß, verabschiedete er sich schnell, und der Hodscha und sie waren zum ersten Mal allein.
Mit dem Rücken zur Piepenkötter ließ Nuri Hodscha aus einem Samowar Tee in zwei kleine, am Bauch taillierte Gläser laufen und sagte: «Noch einmal herzlich willkommen.»
«Danke», sagte die Oberbürgermeisterin automatisch, sie rang immer noch damit, eine bequeme Sitzposition zu finden. Doch dann hielt sie inne: Noch einmal herzlich willkommen? Der schwere Akzent des Hodschas hatte sich schlagartig in einen leichten verwandelt, nur noch das R rollte er stark.
«Ein oder zwei Stück Zucker, Frau Piepenkötter?»
Piepenkötter?! Kein Köter mehr? Also, das war ja… dieser gerissene…
Nuri Hodscha drehte sich um, beide Teegläser in der Hand. Sein Grinsen war breiter als sein Ohrenabstand.
«Sie haben die ganze Zeit Theater… Sie… Woher können Sie so gut Deutsch?»
«Na ja, Theater. Sagen wir, ich habe Ihre Vorurteile bedient.» Nuri Hodscha lächelte milde. «Vor allem schützt das vor lästigen Fragen der Journalisten, wissen Sie. Und ich habe das gute Recht, missverstanden zu werden oder selber falsch zu verstehen. Ich dachte, das kann hier ganz nützlich sein. Für den Anfang.»
Jetzt grinste er so breit, wie der Bosporus an seiner breitesten Stelle war.
«Sie sind ja noch viel dreister, als ich dachte!»
«In der Schule.»
«Wie bitte?»
«In der Schule. Sie mich haben gefragt, wo ich so gut Deutsch gelernt habe.»
«In welcher Schule?»
«Acht Jahre deutsches Gymnasium in der Türkei», sagte Nuri Hodscha triumphierend.
«So was gibt es da?», fragte die Piepenkötter.
«Schon lange», sagte Nuri.
«Wer hat Sie mir bloß auf den Hals geschickt?», fragte die Piepenkötter. Sie hasste es, vorgeführt zu werden.
«Im Zweifel der da», sagte Nuri Hodscha ernst und zeigte Richtung Himmel.
«Das kriegen Sie wieder! Verlassen Sie sich drauf», sagte die Piepenkötter kämpferisch. Nuri sah sie einen Augenblick lang an, stand dann wieder auf und ging, scheinbar etwas suchend, ins Nebenzimmer. Er ließ die Tür weit offen. Und die Piepenkötter traute ihren Augen nicht: Da stand ein großer Esszimmertisch, dicht gedrängt an eine Sitzgruppe aus braunem Leder, und sechs Stühle waren aufeinandergestapelt. Seine Tochter musste das Esszimmer leer geräumt haben, während der Hodscha und sie auf dem Willkommensempfang waren. Nun trug er genüsslich Stuhl für Stuhl herüber.
«Das ist eine bodenlose Unverschämtheit!», brüllte die Piepenkötter und wollte aufspringen, was aus ihrer Position nicht ging, sodass sie erst auf alle viere musste, um hochzukommen. Nuri Hodscha stand wieder im Raum, stellte einen weiteren Stuhl ab und verschränkte die Arme vor seiner Brust.
«Ich bin die Oberbürgermeisterin! Sie werden mich noch kennenlernen, Sie… Sie!»
«Sie werden sich in Zukunft hüten, in Ihren Pressekonferenzen so herablassend über mich zu sprechen. Ich bin ein Mann Allahs, ich habe Theologie studiert, ich bin weder ein anatolischer Eseltreiber noch ein buckelndes Etwas!», knurrte er mit seiner tiefen Stimme zurück. Die beiden standen jetzt so nah voreinander, dass sich ihre Nasen beinahe berührten.
«Für wen halten Sie sich eigentlich? Sie eingebildeter Hornochse! Sie kommen in meine Stadt und führen mich vor? Unterschätzen Sie mich bloß nicht… Und das mit Ihrer Moschee, das können Sie vergessen. Nur über meine Leiche stellen Sie hier so einen Kasten hin!»
«Dann werde ich Sie bis zur Wahl mit der Moschee schön vor mir hertreiben, bis Sie keine Chance mehr haben zu gewinnen. Und nichts ist Ihnen doch wichtiger als Ihre Wiederwahl, hat mir Bob Winter erzählt.»
«Da haben Sie ja gleich den schmierigsten Verbündeten gefunden, den Sie hier finden konnten.»
«Immerhin habe ich überhaupt einen Verbündeten!»
«Ha!», rief die Piepenkötter.
«Selber ha!», rief Nuri Hodscha.
«Sie werden mich noch kennenlernen. Solche wie Sie, die verspeise ich zum Frühstück!»
«Das haben wir ja gerade gesehen», sagte der Hodscha und zeigte auf das Frühstück am Boden.
«Ich gewinne die Wahl!»
«Ich kriege meine Moschee!»
«Auf Wiedersehen, Herr Hodscha!»
«Gutten Tack!», sagte Nuri Hodscha, den gespielt schweren Akzent wiederaufnehmend.
Die Piepenkötter knallte die Tür zu und war fort.
Nuri Hodscha stand für einen Moment allein im Flur, sich die Hände reibend und leise lachend, bis Hülya aus der Küche kam und mit ihrem rechten Zeigefinger in Höhe der Schläfe energisch an ihr Kopftuch tippte. Dann nahm sie es ab, sie musste es nur vor Fremden tragen. Sie hatte schöne lange dunkelbraune Haare.
Nuri Hodscha tat so, als beachte er ihre wortlose Kritik nicht. Stattdessen ging er ins Wohnzimmer und nahm aus seinem perlmuttverzierten Kästchen eine alte, wunderschöne Gebetskette. Er schaltete seine kostspielige Stereoanlage an, legte eine Schallplatte auf und griff nach seinem mächtigen Kopfhörer. Zu Bruce Springsteens Liedzeilen aus Your Own Worst Enemy fiel er in einen ruhigen, traumlosen Mittagsschlaf:
And your own worst enemy has come to town
Your own worst enemy has come
Your world keeps turning round and round
But everything is upside down
Your own worst enemy has come to town.
DIENSTAG, 24.AUGUST, NOCH 40TAGE BIS ZUR WAHL
Am nächsten Morgen saß Patrick, der Sohn der Piepenkötter, vor seiner Mutter am Frühstückstisch. Er war siebzehn, sah gut aus mit seinen kunstvoll gegelten dunkelblonden Haaren, der sportlichen Figur und den nordseegrauen Augen seiner Mutter. In seinem Blick war etwas Hartes, aber auch Verletzliches. Die Piepenkötter selbst erinnerte er immer an James Dean. Sagen würde sie ihm das nie, er war schon selbstbewusst genug.
Die Piepenkötter kam verkleidet, wie Patrick es immer bei sich nannte, die Treppe herunter, das hieß: Kostüm, Make-up, alles bereit für einen tumben Tag im Rathaus, wie Patrick fand. Er konnte sich gar nicht vorstellen, was seine ach so wichtige Mutter den ganzen Tag lang eigentlich machte, bevor sie spätabends zurückkam. War ihm aber auch egal, denn was er sich alles in der Schule wegen seiner Mutter anhören musste, das war kaum zu ertragen.
Die Piepenkötter sagte eilig «Guten Morgen, mein Schatzi» und gab ihm lediglich einen achtlosen Luftkuss auf die Schläfe, um ihren Lippenstift nicht zu verschmieren. Patrick zuckte innerlich dreimal zusammen. Das erste Mal wegen Schatzi – er hasste dieses «Schatzi hier, Schatzi da» wie die Pest. Das zweite Mal wegen ihres aufdringlich süßen Parfüms, das ihm in einer unausweichlichen Wolke entgegenwehte. Und das dritte Mal, weil sie mit den Gedanken schon wieder sonst wo war außer bei ihm.
Er antwortete nicht, stattdessen hielt er nur die Zeitung hoch, die Neue Presse. Auf der Titelseite war ein Foto von ihr und Nuri Hodscha. Das Foto, das sie befürchtet hatte. Aber die Schlagzeile, die Bob Winter dazu gedichtet hatte, war wie ein Schlag ins Gesicht: «Piepenkötter: Kniefall vor neuem Hodscha– Kniefall vor Islam?» Es sah tatsächlich so aus, als würde sie vor dem Hodscha knien wie vor dem Papst persönlich.
Ursel Piepenkötter machte sich um wenige Dinge Sorgen, aber ihr Image, das war – um das zu wissen, war sie lange genug in der Politik – ihr kostbarstes Gut. Das würde sie sich von diesen beiden Hanseln, Nuri Hodscha und Bob Winter, nicht kaputt machen lassen. Kress, dieser Biedernazi, würde sie am Nachmittag in der Ratssitzung unter Druck setzen mit seinen weichgespült vorgetragenen Drecksparolen. Moscheebau, das war ein gefundenes Fressen für ihn.
Vor allem musste sie jetzt dafür sorgen, dass ihre eigene Fraktion uneingeschränkt zu ihr stand, bevor es ungemütlich wurde. Einige, das wusste sie, neideten ihr bis heute das Amt und würden selbst gerne die Geschäfte im Rathaus führen. Immerhin hatte sie in der Nacht auch schon eine Idee gehabt, wie sie Nuri schnellstmöglich seine Unverschämtheiten austreiben würde.
«Schöner Rock», sagte Patrick mit dem Mund voller Müsli und zeigte auf das Foto. Sie grinste ihn gequält an, wandte sich dann aber ruckartig ab, griff nach ihrer Handtasche, sagte wie mechanisch «Wennwasistrufanichliebedichtschüss» und rauschte aus der Haustür.
Patrick schüttelte verzweifelt den Kopf, aß das Müsli auf und legte sich wieder ins Bett. Zum Glück hatte er noch Sommerferien. An so einem Tag wäre er garantiert Spießruten gelaufen. Das sparte er sich gerne.
Nuri Hodscha hatte seit dem «Frühstück» mit der Piepenkötter alle Hände voll zu tun gehabt. Er hatte seine ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennengelernt, die Kurse für Kinder und Frauen in der Moschee abhielten. Er hatte sogar einige besonders verdiente und fromme Mitglieder der Gemeinde zu Hause besucht. Außerdem traf er den Moscheevorstand, in dem nur Männer vertreten waren.