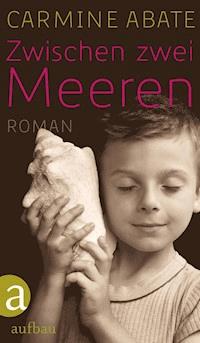9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als der alte Michelangelo in die Steinhütte auf dem Hügel zieht, hält sein Sohn Rino ihn endgültig für verrückt. Dabei will er nur den Schatz der Familie Arcuri bewahren, den sie über Generationen verteidigt hat gegen Plünderer, Faschisten und Mafiosi: die fruchtbare Erde »ihres« Hügels, den der Süßklee im Sommer blutrot färbt, und das Geheimnis, das sie birgt. In einer sturmdurchtosten Nacht lauscht Rino atemlos der Geschichte seiner Familie, die zugleich die Chronik eines Jahrhunderts ist, angefangen bei Nonna Sofia und den beiden Toten im Kirschhain.
Einer der wichtigsten zeitgenössischen Autoren Italiens legt hier sein preisgekröntes Meisterwerk vor: die Geschichte einer Familie und eines Jahrhunderts, die auch der Frage nachgeht, wie wir Vergangenheit und Zukunft miteinander versöhnen können.
»Es sind die wundervollen Beschreibungen von Gerüchen, Farben und Stimmungen, die Carmine Abates ›Der Hügel des Windes‹ so lebendig und lesenswert machen.«FREUNDIN.
»Abates Magie fängt den Zauber der Erinnerung ein.« L’Espresso.
Gewinner des Premio Campiello 2012
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 362
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
CARMINE ABATE
Der Hügel des Windes
Roman
Aus dem Italienischenvon Esther Hansen
Impressum
Die Originalausgabe mit dem Titel La collina del vento erschien 2012 bei Mondadori Editore, Mailand.
ISBN 978-3-8412-0632-9
Aufbau Digital, veröffentlicht im Aufbau Verlag, Berlin, August 2013
© Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, Berlin Die Originalausgabe erschien 2013 bei Aufbau, einer Marke der Aufbau Verlag GmbH & Co. KG
© 2012 Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Milano
This edition published in arrangement with Grandi Associati
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung und Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlages zulässig. Das gilt insbesondere für Übersetzungen, die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen sowie für das öffentliche Zugänglichmachen z.B. über das Internet.
Einbandgestaltung hißmann, heilmann, Hamburg unter Verwendung eines Motivs von bridgeman/Alinari
E-Book Konvertierung: le-tex publishing services GmbH, www.le-tex.de
www.aufbau-verlag.de
Inhaltsübersicht
Cover
Impressum
Versprechen
Duft
Ähnlichkeiten
Wind
Bestätigungen
Traum
Rot
Ausgrabungen
Wahrheiten
Epilog
Dank
Ein Bild und ein Versprechen. Eine Ausgrabungsstätteder Erinnerung. Carmine Abate über die Entstehung seines Romans
Informationen zum Buch
Informationen zu Autor/Übersetzerin
Für meinen Vater
Wie versprochen
Die Wahrheit ist ein Meer von Grashalmen, das sich im Winde wiegt;
sie will als Bewegung gefühlt, als Atem eingezogen sein.
Ein Fels ist sie nur für den, der sie nicht fühlt und atmet;
der soll sich den Kopf an ihr blutig stoßen.
Elias Canetti
Versprechen
Die Schüsse klangen wie der Auftakt eines Feuerwerks am helllichten Tag, mit einem trockenen und irrealen Echo, das vom Meer verschluckt wurde.
Die drei Kinder planschten gemeinsam mit den Fröschen nackt im vullo, einer Art Tümpel, in dem die letzten Rinnsale des Frühlings zusammenflossen. Arturo sprang rasch auf die Füße, mit dem Finger auf den Lippen gebot er seinen Brüdern zu schweigen, sein Blick wies auf den Hügel des Rossarco: »Still!«, befahl er mit leiser Stimme. Er war acht Jahre alt, ein Jahr jünger als Michele und eines älter als Angelo. Die beiden verstummten.
Eine Weile blies der Wind unzusammenhängende Klagelaute heran, ungewiss ob von Mensch oder Tier. Gleich darauf hörten sie weitere Schüsse, die wie die vorigen vom Gipfel des Hügels herabhallten. In der Ferne bellte ein Hund. Dann nichts mehr.
Die Kinder blickten hinauf, unruhig und besorgt, fragten sich, was passiert sei. Dort oben, zwischen den Kirschbäumen, arbeitete die Mutter, allein.
»Wir gehen nachsehen«, entschied Arturo schließlich. Angelo begann zu wimmern, und Michele versuchte ihm Mut zu machen: »Hab keine Angst, das sind nur die Schüsse von Jagdgewehren. Komm schon, gehen wir.«
Mit einem Sprung erklommen sie den Kiesrand des Vullo, zogen sich eilig an und durchquerten das Flussbett der Fiumara, das von großen, glitzernden Steinen und blühenden Oleanderflecken durchzogen war, dazwischen die von der ersten Junihitze benommenen Eidechsen. Dann rannten sie den Saumpfad hinauf, der zur Mutter führte.
Die drei Brüder kannten die Gegend wie ihre Westentasche. In den Schulferien jagten sie hinauf auf den Rossarco, bauten Hütten im Wald von Tripepi mit seinen dicht stehenden Steineichen, erforschten die Grotten der Timpalea, einer tiefen Schlucht mit ginster- und brombeergeblähten Stürzen voller Dornen, furchterregend wie das aufgerissene Maul eines Dämons. Während des Sommers streunten sie über den meerseitigen Hang des Hügels und lieferten sich immer wieder Schlachten mit den Kindern aus dem Küstenort Marina, quasi als Auftakt für den echten Krieg, in den sie als Volljährige ziehen würden. Ihr Heer bestand aus einem Dutzend Gleichaltriger, jeder bewaffnet mit Pfeil und Bogen aus Oleanderzweigen. Sobald die Marina-Piraten versuchten, den Rossarco einzunehmen und sich mit Obst vollzustopfen, wurden sie von den tödlichen Pfeilen mit Spitzen aus rostigen Nägeln zurückgedrängt, die manchmal ins Schwarze trafen und Blut und Schreie einforderten. Michele war der General, doch wenn es darum ging, die riskantesten Operationen anzuführen und sich ins Getümmel zu stürzen, schickte er Arturo vor, der vor nichts und niemandem Angst hatte.
Auch dieses Mal ging Arturo seinen Brüdern voraus.
Wenige Schritte vor dem Gipfel trafen sie auf die Mutter. Sie kam ihnen entgegen, den Esel ungeduldig am Halfter hinter sich herziehend. »Los, los, ich wollte euch gerade holen, wir gehen nach Hause«, sagte sie, ohne stehen zu bleiben.
»Was ist denn passiert, Mà?«, fragte Michele. Die Mutter rang sich ein Lächeln ab: »Nichts, nichts ist passiert. Ich habe die letzten zwei Körbe mit Kirschen gefüllt; ich hab zu Hause zu tun, gehen wir.«
Michele und Angelo stiegen auf den Esel, endlich beruhigt. Arturo, mit der Arglosigkeit des neugierigen Kindes, rannte zum Gipfel hinauf und erblickte eine Szenerie, die er niemals vergessen sollte: Zwischen dem Steineichenwald und den Kirschbäumen lagen auf dem roten Gras zwei junge Männer, beide reglos, eingehüllt in eine Wolke aus Fliegen, die sich wild summend in die frischen Blutlachen stürzten. Des einen Auge war dramatisch geöffnet, grau und zornig, und weiter unten, aus dem Mundwinkel, rann ihm ein Faden Blut über das Kinn und versickerte im Hemdkragen.
»Komm weg da!« Die Mutter war zurückgekehrt und zerrte das Kind mit aller Kraft fort. »Weg hier, hab ich gesagt!« Arturo gehorchte ihr zahm wie ein Lämmlein, verfolgt von dem grauen, zornigen Auge des Unbekannten, das nicht von ihm abließ.
Zu Hause stellte die Mutter die Körbe mit Kirschen ab, schickte die Jungen in den Stall, den Esel einsperren, und begann zu kochen.
Am Abend kam ihr Mann Alberto aus der Schwefelmine, wo er seit vielen Jahren arbeitete; und während seine Frau ihm den Rücken mit einem eingeseiften Lappen schrubbte, redete sie mit ihm, lange und eindringlich.
Nach dem Essen rief sie Arturo zu sich: »Arturì, auch ich war wie vom Donner gerührt, als ich die da im Gras liegen sah. Aber du musst mir schwören, dass du nie jemandem davon erzählst, auch nicht deinen Brüdern, und dass du alles vergisst, du hast nichts gesehen, rein gar nichts. Sonst kommt das Verderben über unsere Familie, und dann sind wir alle des Unglücks.«
Also hatte das Kind es geschworen, hatte Zeige- und Mittelfinger aneinandergelegt und zweimal darauf geküsst. Doch sosehr Arturo sich auch mühte, es zu vergessen, im Dunkel der großen Kammer leuchtete das graue und zornige Auge des Mannes immer wieder auf.
Wer waren diese beiden blutverschmierten Männer, wer hatte sie erschossen und warum? Er fand keine Antwort, und die Mutter konnte er nicht fragen: Versprochen ist versprochen. Er küsste sich erneut auf die geschlossenen Finger, als hätte er sich versündigt, und schlief endlich ein.
Eines Tages holte ihn der Vater noch vor Morgengrauen aus dem Bett und sagte mit feierlicher Stimme: »Aufwachen, Arturo, wir gehen zur Arbeit. Du bist nun groß und stark genug und musst mithelfen, für unser Vorankommen zu sorgen.«
Das Kind gähnte. Vorankommen? Er begriff nicht, er war schrecklich müde und das frühe Aufstehen nicht gewohnt, er schlief den ganzen Weg auf der Kruppe des Esels, an Micheles Rücken gelehnt. Der duftende Wind des Hügels und die Stimme des Vaters weckten ihn, er musste vom Esel steigen und bekam eine Hacke in die Hand gedrückt. Die Zeit der Kriegsspiele war endgültig vorbei.
Wie seine Brüder wurde auch Arturo schlagartig erwachsen, im Alter von neun Jahren. Die Landarbeit war anstrengend, aber zum Glück abwechslungsreich, sie langweilte und schreckte ihn nicht. Nur wenn er zwischen dem Wald von Tripepi und den Kirschbäumen hindurchlief, rann ihm ein kalter Schauer über den Rücken, und selbst mit geschlossenen Augen sah er den Mann im Gras liegen, der ihn zornig anblickte, fast als habe er ihn mit einem seiner unfehlbaren Pfeile getötet. Manchmal war er versucht, den Brüdern davon zu erzählen: Vielleicht, wenn er dieses Geheimnis loswürde, so dachte er, würde das graue Auge des Toten ihn nicht mehr verfolgen, doch dann hätte die Mutter ihm zur Strafe gnadenlos die Gurgel umgedreht, so wie sie es mit den Hähnchen für den Sonntagsbraten machte. Also schwieg Arturo lieber.
»Versprochen ist versprochen«, wiederholte die Mutter, während der Vater nie mehr in die Mine ging, all seine Kraft auf die Feldarbeit konzentrierte und jeden Morgen die Söhne und seine Frau anspornte: »Die anderen Dorfbewohner verlassen in Massen das Land und gehen nach La Merika, weil sie und ihre Familien hier hungern. Wenn wir so weitermachen, wenn wir nicht vor der harten Arbeit zurückschrecken, liegt unser La Merika weniger als eineinhalb Stunden von zu Hause entfernt; überhaupt, unser Land ist besser als La Merika, denn wir kennen keine Herren, die uns herumkommandieren und uns zwingen, härter zu buckeln als ein Muli.«
Jahr um Jahr dieselben Worte, dieselbe Beharrlichkeit. Bis die Söhne zum Militärdienst einberufen wurden, einer nach dem anderen, am Vorabend des Großen Krieges.
Mein Vater hat mir in die Augen gesehen, wie um sich zu vergewissern, dass ich die Geschichte weiter hören wollte: Es sei die Geschichte unserer Familie, hat er gesagt, bevor er verstummte, die im Guten wie im Bösen mit dem Hügel des Rossarco verbunden sei.
Eine Weile waren es nur die Zikaden, die mit ihrem lauten Gesang die Stille durchbrachen, sie über die Maßen dehnten. Und dann hörte ich plötzlich ein kummervolles, unerwartetes Flehen, fast eine Bitte um Komplizenschaft, das auf wer weiß welche Enthüllungen schließen ließ: »Hör zu, mein Sohn, ich weiß, dass es für dich nicht leicht wird, den Finger in unsere Wunden zu legen oder das Glück von damals ohne Bedauern nachzuempfinden, aber du musst die Wahrheit erfahren, bevor ich sterbe und mit mir unsere Geschichte. Eines Tages dann wirst du es sein, der sie seinen Kindern erzählt. Versprichst du mir das?«
Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, ich war überrascht: Mein Vater hatte es stets umgangen, mit mir über die mehr oder weniger dunklen Familienangelegenheiten zu sprechen, immer wenn ich ihn um Aufklärung bat, hatte er sich kurz angebunden und abwehrend gezeigt.
»Erschrick nicht, es ist nur ... Solange ich lebe, werde ich dir genauere Informationen geben können, und vielleicht bekommt die eine oder andere Wunde Zeit, zu verheilen. Außerdem erinnere ich mich besser an das, was ich als Kind oder Jugendlicher erlebt habe. Bei den jüngeren Ereignissen komme ich oft durcheinander und vergesse sie zusehends. Wenn du nach meinem Tod alles erzählst, machst du mir eine doppelte Freude, und eines Tages wirst du verstehen, warum.«
Wir standen auf dem Hügel des Rossarco. Am nächsten Tag, dem 27. August, sollte ich ins Trentin zurückkehren, wo ich an einer Mittelschule unterrichtete. Meine Sommerferien neigten sich dem Ende zu, und ich hatte meine Frau Simona am Strand bei Punta Alice zurückgelassen, um den Tag vor der Abreise mit meinem Vater zu verbringen. Die ganze Zeit hatte ich fast ausschließlich geschwiegen und beklommen seiner Wahrheit der Begebenheiten gelauscht, unterbrochen von zornigen Ausrufen und sorgenvollen Seufzern, als fürchte er, mich nie mehr wiederzusehen.
»Versprochen?«
Ich sah ihn ohne Erwiderung an: In seinen Augen glomm ein trübes Licht aus Wut und Unrast. Er, der beliebteste Lehrer an der Schule von Spillace, unserem Dorf, wirkte nun wie ein einsamer Bandit, der am liebsten auf dem Rossarco Wurzeln geschlagen hätte wie einer seiner jahrhundertealten Olivenbäume, mit langem, struppigem Bart und quer über die Schulter gehängtem Jagdgewehr, von dem er sich nicht einmal zum Schlafen trennte aus Furcht vor wer weiß welchen Anschlägen.
»Versprochen?«, rief er ungeduldig.
Am liebsten hätte ich erwidert: »Nein, Pà, besteh bitte nicht darauf«, doch stattdessen nickte ich verlegen: Mein Lebtag hatte ich ihm nichts abschlagen können. Über sein Gesicht huschte ein befriedigtes Lächeln. Dann fuhr er fort, genüsslich von seinem Vater Arturo, dem größten Sturkopf und Rebellen der Familie Arcuri, zu erzählen, von den ersten Ausgrabungen auf dem Hügel, von den Geheimnissen, die darunter verborgen lagen, von der stürmischen Liebe zu meiner Mutter, die ihn immer noch umtrieb. Über die zwei toten Männer zwischen dem Wald von Tripepi und den Kirschbäumen lediglich ein paar eingestreute Andeutungen, mit denen er als geübter Fabulierer meine Aufmerksamkeit wachhielt. Und je länger er erzählte, desto gelassener wurde er, so als würfe er endlich einen unerträglichen Ballast ab oder fände in den Geschichten den Grund und die Kraft, sich von Spillace zu trennen. »In weniger als einem Monat, sobald ich die Hütte hergerichtet habe, werde ich hierherziehen«, schloss er.
Ich reagierte nicht darauf. Seit Jahren kündigte er diese bizarre Trennung an, doch den endgültigen Schritt vollzog er nie, und ich war überzeugt, dass er ihn auch dieses Mal nicht tun würde. Im Übrigen schwirrte mir der Kopf von tausend Bildern, die einander in wilden Strudeln überlagerten, ohne dass ich eines hätte fassen können, um bei ihm mit der Einlösung meines Versprechens zu beginnen.
Mein Vater hingegen konnte in meinen Gedanken lesen (wenn auch vielleicht nicht in meinem Herzen), und kurz bevor ich mich verabschiedete, um Simona abzuholen, schlug er mir vor: »Fang bei der Ankunft des Fremden auf unserem Hügel an. Der Rest ergibt sich von selbst. Folge einfach der Wahrheit des Lebens.«
1
Sie beschatteten ihn seit Tagen, ohne dass es ihm auffiel, er ging schnellen Schrittes, mit gesenktem Kopf und gerunzelter Stirn. Was suchte er auf dem Hügel? Hin und wieder hielt er inne, nahm einen Block aus der Jackentasche und notierte darin etwas, an den Stamm eines Olivenbaums gestützt. Dann schob er sich die Brille auf die Nasenspitze, hob den Blick des spionierenden Fremden vom Papier und hielt sich die offene Hand schützend über die Augen, um besser in die Ferne zu sehen.
Der Hügel hatte die längliche und geschwungene Form eines am Strand liegenden umgedrehten Bootes. Als Farbe dominierte das purpurne Rot der Süßkleeblüten. Rundherum Obstbäume, Mastixsträucher, Lorbeer-, Ginster-, Rosmarin- und Holunderbüsche, ein Weinberg, uralte Olivenbäume und Flecken von Feigenkakteen hier und da, außerdem ein Steineichenwald, der die abgewandte Seite wie eine halbe, schief sitzende Krone überzog.
Mehr als ein reales Bild musste die Landschaft ihm wie ein mediterranes Gemälde in einem Rahmen aus blendendem Licht vorkommen, wäre da nicht dieser Duft gewesen, der in die Luft aufstieg. Der Mann atmete ihn begierig ein, man sah, dass er ihn mochte, er kam direkt aus der Haut und dem Bauch des Hügels, kitzelte ihn angenehm in der Nase wie das Aroma von frisch gebackenem Brot. Er lächelte, das erste Mal während seiner tagelangen einsamen Wanderungen. Und mit diesem Lächeln auf den Lippen wandte er sich der Seite des Hügels zu, die zum Ionischen Meer hin abfiel.
Er durchquerte das Weizenfeld und strich mit den Händen über die grünen Ähren. Es war die Geste eines Kindes, fast eine Liebkosung, die so gar nicht zu seiner würdigen Haltung passen wollte, der tiefen Stirnfurche, dem graumelierten Spitzbart eines reifen Mannes. Er ahnte nicht, dass er beobachtet wurde, und bis zum großen Olivenbaum fiel ihm weiterhin nichts auf.
An diesem Punkt erlosch sein Lächeln jäh. Aus einem Mastixstrauch war ein Mann mit einem Gewehr im Anschlag getreten, der ihn zum Anhalten aufforderte: »Bleibt stehen, aber sofort. Ein Schritt, und ich erschieße Euch. Seit drei Tagen geistert Ihr hier herum. Warum? Es ist weder die Jahreszeit für Schnecken noch für Pilze.«
Mit festem Blick auf das Gewehr, als wolle er es unschädlich machen, erwiderte der Fremde: »Ich habe kein Geld bei mir.« Vielleicht dachte er, den letzten Briganten vor sich zu haben, der sich einbildete, Herr der Gegend zu sein.
Sein Gegenüber lachte verächtlich, die Augen von der Krempe eines Schlapphutes überschattet. Sein Gesicht war dunkel von der Sonne, grau vom Bart, die Zähne gelb und sein Körper robust wie der eines gut genährten Bauern. »Ich bin kein Räuber und auch kein Verbrecher. Mir gehört dieses Land, mein Name ist überall respektiert: Arcuri Alberto. Und wer seid Ihr?«, bellte er.
»Ich heiße Paolo Orsi. Ich bin Archäologe und komme aus dem Trentin.«
»Und was ist das, ein Archologe?«
»Ich mache Ausgrabungen und rekonstruiere mit dem gefundenen Material die Geschichte antiker Völker«, erwiderte der Fremde ruhig.
»Was sucht Ihr hier oben?«
»Ich suche die antike Stadt Krimisa und ihr berühmtes Heiligtum des Apollon Alaios, die beide seit Jahrtausenden unter einem dieser Hügel bei Punta Alice begraben liegen.«
»Aha«, machte Alberto mit einem Rest Misstrauen in der Stimme. Er hatte Paolo Orsis Worte nicht ganz verstanden, doch immerhin senkte er das Gewehr und forderte ihn mit freundlicheren Gesten auf, ihm zu folgen.
Sie gingen bis zu einer großzügigen Steinhütte, der sogenannten casella, die als Stall, Vorratsraum, Regenunterstand und Schlafplatz diente, hauptsächlich zur Getreideernte und Weinlese.
»Kommt herein«, sagte Alberto zu dem Gast und hielt die Tür auf. Er hieß ihn auf einem Holzhocker Platz nehmen und bot ihm Wein aus einer kleinen Amphore an, die er gancella nannte. Dann klärte er ihn auf: »Ihr werdet seit einigen Tagen von den Wachen beobachtet. Es geht das Gerücht, Ihr wärt ein österreichischer Spion.«
Paolo Orsi brach in ungläubiges Gelächter aus.
»Das ist nicht zum Lachen«, fuhr Alberto fort. »Wenn Ihr Euch hier weiter grundlos herumtreibt, sperren sie Euch sicher ein.«
»Aber ich habe einen Grund, einen sehr guten Grund, ich habe nichts zu befürchten. Und gerade jetzt, da ich glaube, es gefunden zu haben: das Ausgrabungsgebiet, das auf den antiken Landkarten Piloru heißt, am Abhang dieses Hügels gegenüber der Landzunge Punta Alice.« Er schrie es fast heraus, so dass sich sein Gegenüber fragte, ob er wohl etwas taub sei, denn er wirkte nicht erbost, er lächelte sogar, beflügelt durch den kräftigen Wein, den er getrunken hatte.
Paolo Orsi sagte, dass die Archäologie seit vierzig Jahren sein Leben sei, die Mitarbeiter nannten ihn hinter seinem Rücken »den Trüffelhund«, er irrte sich fast nie. Und dann erzählte er von den außergewöhnlichen Entdeckungen, die er in Sizilien und Kalabrien gemacht hatte, ausgehend von einem Stein, einer Handvoll Erde, einer Intuition. Mit der Begeisterung eines Kindes rief er unbekannte Worte in den Raum wie Fibeln, Nekropolen, Votiv-Pinakes und die Namen geheimnisvoller Orte: Hipponion, Medma, Kaulonia, Taurianum, Rhegion, Temesa, Terina, Locri Epizephyrii, wo er in den letzten Jahren gegraben habe oder weitere Ausgrabungskampagnen organisieren wolle, schloss er, schließlich sei er auch Leiter des Denkmalamts für die klassische Antike Kalabriens. In seiner Stimme lag keine Spur von Aufschneiderei, nur obsessive Leidenschaft.
So ein Mann hatte bestimmt keine Familie, dachte Alberto Arcuri und fragte: »Habt Ihr Kinder?«
»Nein, ich bin nicht verheiratet und werde auch niemals heiraten. Eine Frau würde nur meinem Beruf im Wege stehen. Ich mag Kinder, aber ich hätte keine Zeit, mich um sie zu kümmern. Und Ihr?«
»Drei Söhne: Michele, Arturo und Angelo. Alle drei beim Militär, leider, der älteste sollte dieser Tage entlassen werden, aber sie haben ihn mir zurückbehalten. Den jüngsten haben sie vor einer Woche eingezogen. Hoffen wir, dass sie so gesund und munter wiederkommen, wie sie gegangen sind. Ihr lest doch die Zeitungen, was glaubt Ihr, wird Italien wirklich bald in den Krieg eintreten?«
Es war das Frühjahr 1915. Der Fremde wurde ernst und stellte eine beruhigende Prognose, die kaum mehr als eine Hoffnung war: »Ich glaube nicht. Und wenn es eintritt, wird der Krieg nicht mehr lange andauern, so heißt es zumindest. Eure Söhne werden bald zurückkehren.« Das waren genau die Worte, die der besorgte Vater hören wollte.
»Euer Wort in Gottes Ohr!«, sagte Alberto. Er erzählte von den Opfern, unter denen man die Kinder großgezogen hatte und die man für ihre Zukunft brachte. Schon als junger Mann hatte er sich als Akkordarbeiter in der Schwefelmine zwischen Strongoli und San Nicola dell’Alto verdingt. Auch er grub, aber unter der Erde, manchmal kam er mit zerschundenem Rücken aus dem Stollen, mit Gift im Leib, in den Lungen, in der Kehle, um danach noch auf den Feldern zu buckeln. Fünfzehn Jahre so, mit einem einzigen Gedanken im Kopf: aus dem Dunkel aufzusteigen, aus dem Gestank des Stollens an das Licht und in den Duft des Hügels, und ihn Scholle um Scholle zu erwerben. Die ersten zwei Anteile, jedes zu fünf Morgen, hatte er von seinem seligen Vater und dessen kinderlosem Bruder geerbt. Doch sie waren steinig und unfruchtbar wie die anderen Böden auch, welche die Bauern im Anschluss an die Flurparzellierung im Jahr 1892 erhalten hatten. Die Flächen des Rossarco, die zu weit von Spillace entfernt lagen und seit Jahrhunderten unbewirtschaftet waren, hatten die Arcuris jenen Dorfbewohnern abgekauft, die das Land verließen, um möglichst schnell nach La Merika auszuwandern.
Nicht einmal er wusste, wie es gelungen war, den Rossarco in ihren Besitz zu bekommen. Es war eine Mischung aus Opferbereitschaft, Glück und Verstand gewesen und vor allem eine Willensstärke, noch härter als der steinige Boden, den er mit Hilfe seiner Söhne am Ende bezähmt hatte. Auch deshalb konnte er es nicht erwarten, dass sie zurückkehrten.
»Habt Ihr hier beim Umspaten je etwas Antikes gefunden, zum Beispiel eine Münze oder Terrakottascherben?«, fragte Paolo Orsi und brachte das Gespräch damit wieder auf den Grund seiner Erkundungen zurück.
»Schön wär’s! Vielleicht die Tonscherben eines Kruges, ja, aber nichts von Wert. Ich kenne jede Handbreit dieses Hügels, außer den Sockel nackter Erde um den Piloru herum, der uns nicht gehört, und die Schlucht der Timpalea, die eher für Ziegen als für Menschen gemacht ist.« Er machte eine Pause, um Atem zu holen, und zwang sich zu einem vorauseilenden Lächeln. »Wenn Ihr hingegen in meinem Dorf herumfragt, werdet Ihr hören, dass wir einen Beutel Goldmünzen gefunden und uns mit ihrem Verkauf den Rossarco genommen haben. Wenn eine Familie wie wir vorankommt, glauben die Neider mehr ihren Hirngespinsten als ihrem Verstand.«
»Von Neid und Missgunst hier in Kalabrien weiß ich auch so einiges zu berichten ... Aber sagt mir, Signor Arcuri, habt Ihr die Scherben der Amphore aufbewahrt?«
»Nein, die haben wir zusammen mit dem Geröll in die Fiumara geworfen.«
»Schade«, meinte Paolo Orsi, und dann gab er einen Rat, der in seinem polternden Tonfall mehr wie eine unumstößliche Order klang: »Wenn Ihr auf weitere Scherben stoßt, vor allem auf schwarz bemalte oder sonst wie verzierte, hebt sie auf. Vielleicht findet sich unter hundert Stück ja eine, die für unsere Erkundungen interessant ist.«
»Ja, in Ordnung«, sagte Alberto mit einem pfiffigen Lächeln auf den Lippen. Und er nahm einen tiefen Schluck Wein, um das Versprechen zu bekräftigen.
Als sie die Hütte verließen, war die Sonne hinter dem Sila-Gebirge untergegangen, die prächtigen Farben des Hügels waren wie von einem Schleier milchigen Lichts überzogen, und der Wind roch nach Meer.
Bevor er sich verabschiedete, beschrieb Paolo Orsi mit dem Blick einen Halbkreis, der den ganzen Hügel und die ihn umgebende Landschaft einschloss, bis nach Spillace. Im selben Moment sah er einen weißen Vogel, der tschilpend und einsam über der Casella hin und her schoss.
»Das ist eine weiße Schwalbe«, klärte ihn Alberto auf. »Seit zwei Tagen fliegt sie hier kreuz und quer über den Himmel. Sie sucht ihre Gefährten, findet sie, bleibt kurz bei ihnen, flattert dann weiter und weiß nicht, wohin: Flattert und flattert mit offenem Schnäbelchen bis zum Abend, mir brummt der Kopf von ihrem Gezeter, und ich weiß nicht, ob sie vor Freude oder vor Schmerz schreit, bis sie unter dem Dach der Hütte verschwindet, wo sie ihr Nest hat.«
»Unglaublich! Seit meiner Kindheit im Trentin bewege ich mich unter Schwalben-Himmeln. Und doch habe ich noch nie eine Albino-Schwalbe gesehen, schon gar nicht eine so schöne wie diese.« Und dann, im Begeisterungstaumel, sprach er einen Satz aus, den Alberto Arcuri seiner Familie wiederholen würde, als sei er von ihm, und den auch mein Vater viele Jahre später übernehmen und sich mit bitterem Beigeschmack zu eigen machen sollte: »Diese Orte haben einen inneren und äußeren Reichtum. Nur wer sie lieben kann, wird sie verstehen und ihre Schönheiten und versteckten Reichtümer zu schätzen wissen. Die anderen sind blind und dumm. Oder unehrliche Halunken, die nur an sich und die eigene Tasche denken.«
Schließlich stieg Paolo Orsi mit langen, schnellen Schritten wieder hinab, fast als fürchte er, zu spät zu einer Verabredung zu kommen.
An der Wegkreuzung, jenseits der Fiumara, standen zwei Uniformierte. Sie warteten darauf, ihn festzunehmen.
2
Zu Hause erzählte Alberto Arcuri seiner Frau Sofia die Geschichte ihrer Begegnung bis in alle Einzelheiten, selbst vom Flug der Albino-Schwalbe, und auch an den folgenden Abenden sprach er immer wieder von Paolo Orsi, fast wie von einem alten Freund, dessen geheimste Wünsche er genau kenne. Mit künstlicher Fröhlichkeit hallte seine Stimme durch die Stille des Hauses.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!