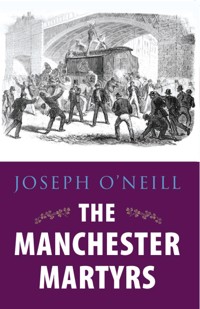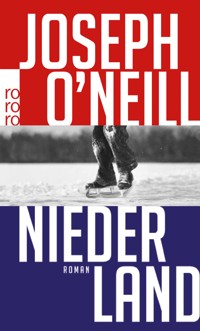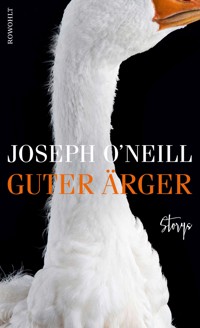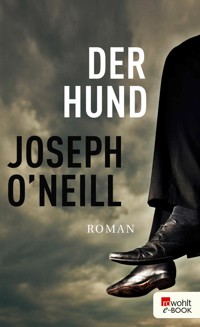
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
2007, kurz vor Beginn der internationalen Finanzkrise, begegnet ein New Yorker Anwalt, dem das Lebensglück gerade abhold ist, einem alten Studienfreund. Spontan nimmt er dessen Angebot an, in Dubai das immense Familienvermögen eines libanesischen Clans zu verwalten. Er hofft auf einen Neuanfang in der modernsten Stadt der Welt. Erst als er sich im verschwenderisch möblierten Luxusgefängnis eines für Expatriates gebauten Wohnturms mit Blick auf den Persischen Golf wiederfindet und die dubiosen Finanzgeschäfte seiner Auftraggeber sich durchaus nicht von ihm verwalten lassen wollen, dämmert ihm, dass er vielleicht eine Hölle gegen eine andere eingetauscht hat. Und da sitzt er nun, allein mit sich und seinen Gedanken, während die Krise um ihn herum Fahrt aufnimmt. Was für den Araber der "Hund", ist für uns der Prügelknabe – ein Mann, dessen schier endlose Fähigkeiten, sich die Welt zurechtzuargumentieren, an den moralischen Kategorien des modernen Kapitalismus ebenso zuschanden werden wie an denen der Ehe und am praktischen Alltagsleben. Joseph O'Neills origineller, weil sich monologisch in Innenwelten auffaltender, aber äußerst rege am Geschehen dieser Erde teilnehmender Roman, von der Kritik als Paradebeispiel für eine neue, weltumspannenden Literatur gepriesen, beschreibt die Demontage eines ganz normalen Zeitgenossen, der keineswegs zu gut ist für diese Welt, der für sein Glück kämpft und rackert und lügt und betrügt, aber trotzdem an ihr scheitert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 402
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Joseph O'Neill
Der Hund
Roman
Über dieses Buch
2007, kurz vor Beginn der internationalen Finanzkrise, begegnet ein New Yorker Anwalt, dem das Lebensglück gerade abhold ist, einem alten Studienfreund. Spontan nimmt er dessen Angebot an, in Dubai das immense Familienvermögen eines libanesischen Clans zu verwalten. Er hofft auf einen Neuanfang in der modernsten Stadt der Welt.
Erst als er sich im verschwenderisch möblierten Luxusgefängnis eines für Expatriates gebauten Wohnturms mit Blick auf den Persischen Golf wiederfindet und die dubiosen Finanzgeschäfte seiner Auftraggeber sich durchaus nicht von ihm verwalten lassen wollen, dämmert ihm, dass er vielleicht eine Hölle gegen eine andere eingetauscht hat. Und da sitzt er nun, allein mit sich und seinen Gedanken, während die Krise um ihn herum Fahrt aufnimmt.
Was für den Araber der «Hund», ist für uns der Prügelknabe – ein Mann, dessen schier endlose Fähigkeiten, sich die Welt zurechtzuargumentieren, an den moralischen Kategorien des modernen Kapitalismus ebenso zuschanden werden wie an denen der Ehe und am praktischen Alltagsleben. Joseph O’Neills origineller, weil sich monologisch in Innenwelten auffaltender, aber äußerst rege am Geschehen dieser Erde teilnehmender Roman, von der Kritik als Paradebeispiel für eine neue, weltumspannende Literatur gepriesen, beschreibt die Demontage eines ganz normalen Zeitgenossen, der keineswegs zu gut ist für diese Welt, der für sein Glück kämpft und rackert und lügt und betrügt, aber trotzdem an ihr scheitert.
Vita
Joseph O’Neill wurde 1964 als Sohn eines Iren und einer Türkin in Cork geboren und wuchs in Holland auf. Er studierte Jura in Cambridge und arbeitete als Anwalt in London. Später ließ er sich als freier Autor in New York nieder. Für seinen internationalen Bestseller «Niederland» wurde er 2009 mit dem PEN/Faulkner-Award ausgezeichnet, «The Dog» war für den Man Booker Prize 2015 nominiert.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2014 unter dem Titel «The Dog» bei Pantheon, New York.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Mai 2016
Copyright © 2016 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
«The Dog» Copyright © 2014 by Joseph O’Neill
Umschlaggestaltung Anzinger und Rasp, München
ISBN 978-3-644-04201-8
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Widmung
Motto
Vielleicht empfand ich ...
Natürlich kommt mir ...
Ich habe mehr ...
Es gibt hier ...
Es mag wie ...
Dass ich sie ...
Das ganze Verdienst ...
Aber welche Möglichkeiten ...
Am Tag nach ...
Der Pasha ist ...
Mila lernte ich ...
Mrs. Ted Wilson ...
Apropos, wer anders ...
Es muss ein, ...
Ich denke gern, ...
Bryan Adams ist ...
Ich bin jedoch ...
Ich will damit ...
Dem, was als ...
Leichter gesagt als ...
Nicht so schnell.
Mein Vormittag fängt ...
Ungeachtet eines gelegentlichen, ...
Der Dreier. Das ...
Vom Belt Parkway ...
Dass ich halb ...
Dank
Für M, P, O und G
Noch immer riecht es hier nach Blut: Alle Wohlgerüche Arabiens würden diese Hand nicht wohlriechend machen.
Shakespeare, Macbeth
Mir ist zu Mute, wie einem Steine im Schachspiel es sein mag, wenn der Mitspieler von ihm sagt: Der Stein kann nicht mehr gerückt werden.
Kierkegaard, Entweder–Oder
Vielleicht empfand ich das Leben zu Lande und in der Luft immer stärker als ineffektiv, vielleicht hatte ich immer stärker das Gefühl, dass die Anhäufung von Erfahrungen schließlich und endlich, wenn man alles bedenkt, schlicht auf zusätzliches Gewicht hinausläuft, sodass man sich am Ende dahinschleppt, als wäre man in einem dieser Winnie-der-Pu-Anzüge gefangen, wie sie Erforscher der Tiefsee tragen, und fing deshalb mit dem Tauchen an. Wie nicht anders zu erwarten, verschärfte diese Entscheidung anfangs das Problem der Ineffizienz. Da war das mit einer neuen Beschäftigung verbundene Herumstümpern, und da war die Erschöpfung, die das übermäßige Betrachten von Jacques-Cousteau-Filmen hervorruft. Doch sobald ich einen Tauchkurs für Fortgeschrittene und einen Fischerkennungskurs absolviert hatte und richtig, ja bei jeder Gelegenheit zu tauchen begann, lernte ich, dass die Unterwasserwelt ein nahezu reiner Ersatz für die Welt sein kann, von der aus man in sie eintritt. Ich kann nicht umhin, darauf hinzuweisen, dass dieser Ersatz sich dergestalt auswirkt, dass er begrenzt, was man die biographische Bedeutung des Lebens nennen könnte – die Tragweite, zu der jedes einzelne Atemholen verdammt zu sein scheint. Fast ohne metaphorischen Sinn ein Fisch im Wasser zu sein: welche Befreiung.
Ich tauchte gern in Musandam. Mein Partner war unweigerlich Ollie Christakos, der aus Cootamundra in Australien stammt. Eines Morgens folgten wir draußen bei einer der Inseln in etwa dreizehn Meter Tiefe einer Felswand. An der Spitze der Insel herrschten starke Strömungen, und sobald wir sie durchschwommen hatten, blickte ich auf und sah, so schien es einen Moment lang, eine riesige Motte im offenen Wasser über mir dahineilen. Es war bemerkenswert, und ich drehte mich, um Ollie darauf aufmerksam zu machen. Er war mit etwas anderem beschäftigt. Er deutete unter uns, weiter die Wand hinunter in grünviolettes, abgrundtiefes Wasser. Ich sah hin: Da war nichts. Mit ganz untypischer Erregung zeigte Ollie immer wieder hin, und wieder schaute ich und sah nichts. Auf dem Motorboot erzählte ich ihm von dem Adlerrochen. Er erklärte, er habe etwas viel Besseres als einen Adlerrochen gesehen und sei ganz ehrlich gesagt etwas enttäuscht darüber, dass ich es nicht bestätigen könne. Ollie sagte: «Ich habe den Mann aus Atlantis gesehen.»
So hörte ich zum ersten Mal von Ted Wilson – als dem Mann von Atlantis. Der Spitzname entstammte der Fernsehserie gleichen Namens aus den Siebzigern. Sie zeigt in der Hauptrolle Patrick Duffy als einzigen Überlebenden einer untergegangenen Unterwasser-Zivilisation, der in diverse Abenteuer verwickelt wird, in denen er seine ungewöhnlichen aquatischen Fähigkeiten nutzbringend einsetzt. Aus meiner Kindheit habe ich nur noch folgende Erinnerung an den Mann aus Atlantis: Der amphibische Held bewegt sich nicht mit Hilfe der Arme, die seitlich angelegt bleiben, durch das flüssige Element, sondern durch eine kräftige, wellenförmige Bewegung von Oberkörper und Beinen. Niemand behauptete, Wilson sei ein Supermann. Aber es hieß, er verbringe mehr Zeit unter als über der Wasseroberfläche, er gehe stets allein tauchen, und seine Vorliebe gelte Tauchgängen, darunter auch nächtliche, die für einen Alleintaucher viel zu riskant seien. Es hieß, er trage einen Neoprenanzug, dessen Färbung – olivgrün mit blassen Wirbeln in Hellgrün, Dunkelgrün und Gelb – ihn in den Riffen und drum herum, wo das Versteckspiel nun mal die natürliche Lebensweise ist, praktisch unsichtbar machte. Unter den fanatischeren Tauchern vor Ort bildete eine Unterwasser-Sichtung von Wilson einen Grund dafür, eine E-Mail an Interessierte zu schicken, in der die relevanten Einzelheiten des Ereignisses aufgeführt wurden, und für kurze Zeit richtete irgendein Spaßvogel eine Internetseite mit einer Graphik ein, in der bestätigte Sichtungen durch ein grinsendes Emoticon und unbestätigte durch ein Emoticon mit zweifelndem Gesichtsausdruck dargestellt wurden. Was soll’s. Die Leute tun alles Mögliche, um eine Beschäftigung zu haben. Wer weiß, ob die Graphik, die meiner Meinung nach eine regelrechte Hetzjagd darstellte, überhaupt irgendeine faktische Grundlage hatte: Vielleicht ist es überflüssig zu erwähnen, dass der Mann aus Atlantis und seine Beweggründe Anlass zu vielerlei Spekulationen und bloßen Meinungsäußerungen gaben und dass man demzufolge – zumal im Lichte all der anderen Dinge, die über ihn gesagt wurden – kaum sicher sein kann, wo bei Wilsons unterseeischem Leben die Wahrheit endete und die Legende begann; aber es scheint außer Frage zu stehen, dass er ungewöhnlich viel Zeit unter Wasser verbrachte.
Ich muss hier sehr darauf achten, mich deutlich davon abzugrenzen, wie dieser Mann, Wilson, durch die Mühle des Gerüchts gedreht wurde. Es ist eine Sache, aufdringliche Vermutungen über die Freizeitbeschäftigungen eines Menschen anzustellen, und eine ganz andere, ihn in eine Maschine zu stecken, die durch Mahlen zerkleinert. Genau das passierte mit Ted Wilson. Er wurde zu Staub zerredet. Das ist Dubai, nehme ich an – ein Land des Klatsches. Vielleicht schließt die Geheimnistuerei des Herrschers jeden anderen Zustand aus, vielleicht auch nicht. Es ist keine Frage, dass es überall im Emirat ausgedehnte Undurchsichtigkeiten gibt, die mich, da wir gerade beim Thema sind, an unterseeische Tiefen denken lassen. Und so macht uns das Land, ob uns das gefällt oder nicht, zu Klatschbasen, und es macht uns anfällig für Leichtgläubigkeit und Bescheidwisserei. Ich bin mir nicht sicher, ob es eine gute Methode gibt, dem entgegenzuwirken; es kann sogar sein, dass ein Moment eintritt, da der Veteran des niemals endenden Kampfes um solide Fakten weniger Ahnung denn je hat. Vor nicht allzu langer Zeit hörte ich, in Satwa sei ein tasmanischer Tiger zu verkaufen, und glaubte die Geschichte halb.
Ted Wilson, stellte sich heraus, hatte eine Wohnung im «Situation» – dem Apartmentgebäude, in dem auch ich wohne. Seine Wohnung lag in der neunzehnten Etage, zwei über meiner. Unsere Interaktion bestand aus einem kurzen Gruß im Fahrstuhl. Dann pflegten wir während der Hinauf- oder Hinunterfahrt die ägyptischen Hieroglyphen zu betrachten, die die Edelstahlwände der Fahrstuhlkabine zieren. Diese Begegnungen reduzierten meine Neugier, was ihn anging, praktisch auf null. Wilson war ein Mann in den Vierzigern von durchschnittlicher Größe und durchschnittlichem Gewicht, mit größtenteils kahlem Kopf. Er hatte die Art von Gesicht, die ich als rein angelsächsisch empfinde, d.h. bar aller Farbe und aller typischen Merkmale, und vielleicht war es eine Reaktion auf diesen Mangel, dass er, wie ich bemerkte, damit herumprobierte, sich Ziegenbärtchen, Vollbärte, Schnurrbärte, Koteletten wachsen zu lassen. Von Kiemen oder Schwimmhäuten zwischen den Fingern war nichts zu sehen.
Das Auffällige an ihm war sein amerikanischer Akzent. Amerikaner ziehen nur wenige hierher, was normalerweise damit erklärt wird, dass wir Bundessteuern auf weltweites Einkommen bezahlen müssen und daher relativ wenig von den steuerlichen Vorteilen profitieren, die die Vereinigten Arabischen Emirate ihren Einwohnern bieten. Diese Theorie stimmt, glaube ich, nur zum Teil. Eine weitere Erklärung muss darin liegen, dass der typische amerikanische Kandidat für ein Leben am Golf, der sich ohne abwertende Absicht als der mittelmäßige Büroarbeiter bezeichnen ließe, wenig Neigung zum Auswandern hat. Um es anders zu formulieren, ein Mensch braucht normalerweise einen besonderen Anreiz, um hier zu sein – oder, vielleicht noch genauer, um nicht anderswo zu sein –, und das gilt bestimmt umso mehr für den Amerikaner, der, anstatt sein Glück in Kalifornien, Texas oder New York zu suchen, beschließt, in diese seltsame Wüstenmetropole zu kommen. So oder so, das Schicksal wird die erwartete Rolle spielen. Ich sage das wohl aus Erfahrung.
Anfang 2007 lief ich in einem Garderobenraum in New York einem ehemaligen College-Kommilitonen, Edmund Batros, über den Weg. Ich hatte seit Jahren nicht mehr an Eddie gedacht, und natürlich fiel es schwer, diesen Siebenunddreißigjährigen ohne Verblüffung mit seinem Gegenstück in der Erinnerung gleichzusetzen. Während er im College ein pummeliger junger Libanese gewesen war, dem ein Glas Bier die Sprache zu verschlagen schien und der allen ein bisschen leidtat, machte der erwachsene Eddie in jeder Hinsicht – bis zum Brustbein aufgeknöpftes rosa Hemd, Sonnenbräune, glamouröse Begleiterin, Zwanzig-Dollar-Trinkgeld für die Garderobenfrau – den Eindruck eines unverschämt zufriedenen Mannes von Welt. Wenn er mich nicht angesprochen und sich zu erkennen gegeben hätte, hätte ich ihn gar nicht erkannt. Wir umarmten einander, und es gab ein großes Hallo um die wunderbare Unwahrscheinlichkeit des Ganzen. Eddie war nur kurz in der Stadt, und wir kamen überein, uns am nächsten Tag zum Essen im Asia de Cuba zu treffen. Dort, an dem angeblich holographischen Wasserfall, ergingen wir uns in Erinnerungen an das Jahr, in dem wir in einem Haus in Dublin gelebt hatten, bewohnt von College-Studenten, deren einzige Gemeinsamkeit darin bestand, dass sie keine Iren waren: Außer mir und Eddie gab es noch einen Belgier, einen Engländer und einen Griechen. Eddie und ich waren keineswegs dicke Freunde, aber wir hatten als zufälliges Bindeglied die französische Sprache: Ich sprach sie wegen meiner frankophonen Schweizer Mutter, Eddie, weil er wie viele Libanesen mehrsprachig aufgewachsen war und flüssig, wenn auch leicht fremdartig Französisch, Englisch und Arabisch sprach. In Irland pflegten wir einander Bemerkungen auf Französisch zuzumurmeln und hatten das Gefühl, dem käme eine besondere Bedeutung zu. Ich hatte keine Ahnung, dass seine Familie Hunderte von Millionen Dollar schwer war.
Jetzt bestellte er einen Drink nach dem anderen. Wie ein paar alte Dokumentare kamen wir nicht umhin, die diversen Schicksale zu betrachten, die längst aus den Augen verlorenen Freunden oder Beinahe-Freunden widerfahren waren. Eddie mit seinem Facebook-Account war viel mehr auf dem Laufenden als ich. Von ihm erfuhr ich, dass ein armer Kerl zwei autistische Kinder hatte, dass ein anderer sich beim Flughafen Dublin von einer Fußgängerbrücke gestürzt hatte. Während er erzählte, sah ich mich mit einer seltsam schmerzhaften idiosynkratischen Erinnerung konfrontiert – wie während der Rugby-Saison in regelmäßigen Abständen eine riesige, chaotische Menschenmenge die Straße füllte, in der unser Haus lag, und anscheinend dank eines arithmetischen Wunders ohne Rest in das Stadion am oberen Ende hineinging, eine verhängnisvolle Massensubtraktion, die mich mit meiner ausgiebigen jugendlichen Melancholie an die tapfere kollektive Heiterkeit unserer Spezies angesichts des Todes denken ließ. Aus dem Stadion kam ab und zu der berühmte irische Refrain:
Alive, alive-o
Alive, alive-o.
Diesen Flashback behielt ich Eddie gegenüber natürlich für mich.
Er zog eine Sonnenbrille aus seiner Brusttasche und setzte sie mit großem Zeremoniell auf.
«Das ist ja wohl nicht dein Ernst», sagte ich. Der junge Eddie hatte albernerweise ständig ebendiese Brille getragen, sogar im Haus. Er gehörte zu den Leuten, für die Top Gun ein toller Film war.
Eddie sagte: «O doch, ich rocke immer noch die Aviators.» Er sagte: «Erinnerst du dich noch an den Zoff mit dem Statistikdozenten?»
Und ob ich mich erinnerte. Der Mann hatte Eddie verboten, in seiner Vorlesung eine Sonnenbrille zu tragen. Das Verbot hatte Eddie niedergeschmettert. Seine Sonnenbrille war mit Gläsern für seine Kurzsichtigkeit ausgestattet; eine normale Brille tragen zu müssen hätte ihn vernichtet. Ich riet ihm: «Der kann dich mal. Du machst dein Ding. Wir leben in einer freien Welt.»
«Das ist ein richtiger Arsch. Bestimmt schmeißt er mich aus seiner Veranstaltung.»
Ich sagte: «Soll er doch! Du beschließt, Sonnenbrille zu tragen, also trag Sonnenbrille. Was will er eigentlich – hat er etwa zu bestimmen, was du trägst? Eddie, manchmal muss man eine Linie im Sand ziehen.»
Linie im Sand? Was quatschte ich da? Was wusste ich denn von Linien im Sand?
Der junge Eddie erklärte: «Je vous ai compris!» Er hielt daran fest, seine Sonnenbrille zu tragen. Der Dozent unternahm nichts.
«Das war eine echte Lektion», sagte mir Eddie im Asia de Cuba. «Bekämpft sie auf den Stränden. Bekämpft sie an den Landungsabschnitten.» Er nahm die Ray-Ban ab – er hatte sie als Talisman aufbewahrt und besaß eine Sammlung von Hunderten von Bifokalbrillen mit getönten Gläsern für den täglichen Gebrauch; auf Reisen beförderte er seine Sonnenbrillen persönlich in einer eigens dafür angefertigten Fototasche – und erzählte mir, er habe von seinem Vater die Leitung verschiedener Batros-Unternehmen übernommen. Im Gegenzug erzählte ich ihm ein wenig von meiner eigenen Situation. Entweder war ich dabei offenherziger, als ich gedacht hatte, oder Eddie Batros hatte inzwischen etwas von einem Psychologen, denn bald darauf schrieb er mir und bot mir einen Job an. Er erklärte, er habe schon seit einiger Zeit vor, einen Familientreuhänder zu bestellen («der ein Auge auf unsere diversen Holdings, Trusts, Wertpapierbestände etc. hat»), habe bisher aber noch niemand Geeigneten gefunden, der sowohl bereit sei, nach Dubai (dem offiziellen Sitz der Batros Group wie auch einiger Mitglieder der Familie Batros) zu ziehen, als auch – wie es ein solcher Mensch per definitionem müsse – das «unbegrenzte Vertrauen» der Familie genieße. «Wider alle Hoffnung», wie er es formulierte, frage er sich, ob ich vielleicht bereit sei, die Stelle in Betracht zu ziehen. In seiner E-Mail versicherte er:
Ich kenne keinen ehrlicheren Menschen als dich.
Für diese Feststellung gab es keine vernünftige Grundlage, aber ich war davon gerührt – einen Moment lang weinte ich sogar ein bisschen. Ich schrieb zurück und bekundete mein Interesse. Eddie antwortete:
OK. Du wirst Sandro treffen und dich dann entscheiden müssen. Er wird sich bald mit dir in Verbindung setzen.
Sandro war der ältere der beiden Batros-Brüder. Ich hatte ihn nie kennengelernt.
Sofort fasste ich einen Plan. Der Plan war, New York – [Dubai] zu fliegen. Das heißt, ich hatte kein Interesse an Dubai an sich. Ich hatte Interesse daran, aus New York herauszukommen. Wenn Eddies Job in Dschibuti gewesen wäre, hätte der Plan gelautet, New York – [Dschibuti] zu fliegen.
Natürlich kommt mir Dschibuti nicht von ungefähr in den Sinn. Die französische Fremdenlegion war dort lange präsent, und zu den frühesten und tadelnswert naivsten Äußerungsformen meines Wunsches, New York zu fliehen, gehört meine Begeisterung für die Légion étrangère. Die Männer ohne Vergangenheit! Ich empfand sie plötzlich als wunderbar, diese Internationalen mit dem weißen Képi, deren Vorgänger, wie meine Online-Recherchen ergaben, ruhmreich bei Magenta, Puebla und Dien Bien Phu, bei Kolwezi und Bir Hakeim, bei Aisne, Narvik und Fort Bamboo gekämpft hatten. Vous, légionnaires, vous êtes soldats pour mourir, et je vous envoie où l’on meurt. Sofern die Wikipedia-Seite nicht in die Irre führt, konnten solcherlei Aufrufe einen Menschen in die Schlacht schicken, der aus irgendeinem beliebigen Winkel der Welt stammte, doch den obligatorischen Loyalitäten seines Herkunftslandes keineswegs verpflichtet, sondern einzig durch die aufrichtige Kameradschaft gebunden war, in die er sich freiwillig und demütig begeben hatte, eine brüderliche Bindung, die sein Ehrenkodex mit bewegender Direktheit auf den Begriff bringt. Ich hatte große Lust, in ein Flugzeug nach Paris zu steigen und zu unterschreiben.
Obwohl eher Gelächter angezeigt wäre, blicke ich mit Erstaunen und Besorgnis auf diesen Möchtegernsoldaten zurück. Wie konnte dieser Mann, der kein Verbrechen begangen hatte und sich meines Wissens und meiner Überzeugung nach nicht viel mehr hatte zuschulden kommen lassen, als die dem Menschen innewohnende Eigenheit, Verletzungen zuzufügen – wie konnte er sich zu dieser absurden Gesellschaft von Desperados und Ausreißern hingezogen fühlen? Ich erinnere mich, dass ich mich nach einem fernen, einsamen Schicksal sehnte, das niemandem Scham und Ungelegenheiten bereitete, nach einem Leben, das weder im Recht noch im Unrecht war. Dann kam Eddie Batros des Weges.
Während die Wochen verstrichen und ich weder von Eddie noch von seinem Bruder irgendetwas hörte und täglich gegen den Drang ankämpfte, Eddie um ein Update anzuschreiben, kam es mir so vor, als würde alle fünf Minuten mein neuer Bestimmungsort – Dubai – erwähnt. «Gott, inzwischen könnte ich schon in meinem Pool in Dubai liegen», stöhnte eine englische Flugbegleiterin während einer Startverzögerung. Der albanische Geschäftsführer des Baumarkts in meinem Viertel sagte zu jemandem: «Dort gibt es ein Hotel auf dem Meeresgrund. Dort gibt es Millionäre, Milliardäre. Beckham wohnt dort, Brad Pitt wohnt dort, dort krachen jeden Tag Lamborghinis in andere Lamborghinis, dort scheint jeden Tag die Sonne, das Benzin ist praktisch umsonst, es gibt keine Steuern, es ist der Himmel auf Erden.» Dubai war plötzlich allgegenwärtig, sogar im Büro. Ein Team von Capital Markets flog zu einer zweitägigen Konsultation hin, die sich auf zehn Tage ausdehnte, und die ganze Geschichte geriet zu einer derartigen Explosion von Kostennoten, dass Karen von der Verwaltung sich die Sache näher anschauen musste. Die reisenden Partner, Dzeko und Olsenburger, berichteten, dass man das Quantum an Honoraren und Erstattungen innerhalb der entsprechenden faktischen Matrix sehen müsse, nämlich dass der Mandant das Team in einem Sieben-Sterne-Hotel in Maisonette-Suiten zu zweitausend US-Dollar pro Nacht untergebracht habe, die unter anderem ein Kissenmenü mit zwölf verschiedenen Kissen, einen 42-Zoll-Plasmafernseher in einem Blattgoldrahmen, einen Regenraum, einen Butler-Service und Duschgel, Shampoo und Cremes von Hermès boten. Für die Herstellung einer angemessenen Bezugsgröße für die Kostennoten sei außerdem bedeutsam, dass der Mandant vollkommen hemmungslos den hoteleigenen Rolls-Royce-Chauffeurservice und mehr als einmal auch den hoteleigenen Hubschrauber-Service in Anspruch genommen habe. Überdies könne man übermäßige Zurückhaltung bei den Kostennoten vonseiten der Kanzlei als tendenzielle Unterberechnung betrachten, was in den Augen dieses Mandanten ganz offensichtlich nicht zu einer Kanzlei von Weltniveau passe. Hinterher, als er sich mit Cocktails volllaufen ließ, erklärte Dzeko etwas informeller, dass diese Öl-Araber – er wolle das nicht verallgemeinern, es gebe natürlich auch noch andere Arten von Arabern –, dass diese speziellen Öl-Araber entweder überhaupt keinen Begriff davon hätten, wie Geld funktionierte, keine Ahnung von Gewinn oder Wert, oder dass sie alles darüber wüssten, aber einfach darauf schissen und ein perverses Vergnügen daran fänden, die dämlichen Abendländer wie Schweine herumrennen und auf allen vieren Bargeld aufschnobern zu sehen.
Dzeko war das, was wir einen Wühler nannten, d.h. die Sorte Anwalt, deren enormer Fleiß auf dem gleichen intellektuellen Niveau stand wie der eines Arbeiters, der einen Graben aushebt, weshalb es überraschend war, dass er mit diesen Überlegungen herauskam. Aber Dubai hatte seinen inneren Theoretiker zum Vorschein gebracht. Solcherart war die Wirkungsmacht der Marke, die natürlich niemals wirkungsmächtiger war als 2007. Mitten in einer dieser aufgeregten und manchmal beängstigenden Google-Anfälle, mit denen ich seinerzeit meine Abende verbrachte, gab ich schließlich «dubai» anstatt, beispielsweise, «fruchtbarkeit + alter» oder «psychopathie» oder «narzissmus» oder «riesig + brüste» oder «tritt + sanft + träume» in das Suchfeld ein.
Ich traute meinen Augen nicht, teils weil ich ihnen gar nicht trauen sollte bzw. ihnen auf besondere Weise trauen sollte, denn viele der Bildersuchergebnisse waren keine Fotos des realen Dubai, sondern von Darstellungen eines Dubai, das im Bau oder noch bloßes Konzept war. Jedenfalls gewann ich den Eindruck einer phantastischen schon bestehenden und/oder zukünftigen Stadt, einer Abrakadabrapolis, in der Gebäude gegeneinanderflatterten und Wolkenkratzer wackelig aussahen oder zerknittert oder womöglich doppelt so hoch und schlank wie das Empire State Building waren, einer Stadt, deren Küstenlinie bizarre künstliche Halbinseln sowie die bereits berühmten und allgemein als «Die Welt» bekannten Inselchen aufwies, so genannt, weil sie derart angeordnet waren, dass sie aus der Vogelperspektive eine physische Weltkarte bildeten; einer Stadt, in der riesige Stelzen aus der Erde ragten und dreihundert Meter höher wie Hans’ Bohnenranke in einer synthetischen Wolke verschwanden. Anscheinend enthielt die Wolke eine Plattform mit einem Park und anderen Annehmlichkeiten – oder würde sie zu gegebener Zeit enthalten.
Die Marketing-Strategen rechneten offenbar damit, dass ich, der elektronische Reisende, die Kunde – Dubai! – verbreitete. Aber wenn es möglich wäre, einen antonymen Eigennamen zu Marco Polo zu bilden, dann trüge ich diesen Namen. Für mich war dieses Wunderland das Gleiche wie jeder andere von Menschen bewohnte Ort – es lief auf einen Haufen Zimmer hinaus. Über Zimmer hatte ich ein, zwei Theorien. Sie standen mir noch deutlich vor Augen, die Abende, an denen Jenn in Kreisen durch unsere Zweizimmerwohnung in Gramercy Park tigerte, um deren langfristige Unbrauchbarkeit zu dramatisieren und die von ihr vorgebrachte Analyse zu unterstreichen, dass nämlich alles gut würde, wenn sie und ich uns erstens geistig von unserer Wohnung, dem historischen und mietpreisgebundenen Ort unserer Liebe, lösten; zweitens einsähen, dass es sinnvoll war, eine Wohnung zu kaufen, in der sich das Kind oder die Kinder leichter unterbringen ließen, die zu bekommen sie sich im Widerspruch zu ihren früheren Empfindungen in dieser Angelegenheit nun eindeutig bereit fühle; und demgemäß drittens alles gut würde, sobald wir uns eine Wohnung mit mehr Zimmern besorgten. Ich muss wohl wenig gesagt haben. Ganz sicher unterließ ich es, die folgende Einsicht zu erwähnen: Wenn man auf der ganzen Welt kein einziges Zimmer benennen kann, in das einzutreten einen mit Freude erfüllt – wenn man unter den Milliarden von Zimmern auf der Welt auf kein einziges zeigen und wahrheitsgemäß erklären kann: In diesem Zimmer werde ich Freude finden –, tja, dann hat man einen sinnvollen Maßstab dafür gefunden, wo man in Sachen Freude steht. Und in Sachen Zimmer auch.
Eine Möglichkeit, die Dummheit dieser Phase meines Lebens – eine Phase, die, fürchte ich, noch andauert – zusammenzufassen, bestünde darin, sie die Phase der Einsichten zu nennen.
Während meiner ersten Internet-Begegnung mit Dubai hatte ich (Sache eines Sekundenbruchteils) eine Vision von mir selbst, wie ich, irgendwie körperlos, von hohem Gebäude zu hohem Gebäude und von Stockwerk zu Stockwerk und Zimmer zu Zimmer eilte, endlos durch einen Raum nach dem anderen hastete, ohne je guten Grund zum Bleiben oder auch nur Innehalten zu finden. Ich assoziierte diesen geisterhaft Eilenden mit einem jener vom israelischen und/oder amerikanischen Geheimdienst geschaffenen Computerwürmer, deren Funktion darin besteht, spurlos von einem Computer zum anderen zu wandern und immer weiterzusuchen, bis sie gefunden haben, worauf sie aus sind – und dann Schaden anzurichten. Vielleicht als Korrektiv zu dieser unerfreulichen Vorstellung entwickelte ich einen überaus erfreulichen Tagtraum von einer zurückgezogenen Existenz auf einer der äußeren Inseln der «Welt», sagen wir, auf einem Teil von «Skandinavien» oder «Grönland», wo ich in einer schlichten, wenn auch bequemen und fast CO2-neutralen Hütte wohnte, allein bis auf vielleicht einen Hund (eine dieser Züchtungen, die darauf spezialisiert sind, immerzu ins Wasser zu rennen), ein, zwei Palmen und gelegentlichen Besuch von einem Vogel. Ich durchlief eine Phase der Islomanie, zu deren Symptomen zählte, dass ich den Begriff «Islomanie» entdeckte, «biene + laut + lichtung» und «islands + stream + bee + gees» googelte und jede Nacht beim Einschlafen «La Isla Bonita» hörte.
Irgendwann knickte ich ein – ich rief Eddie an und bat ihn um ein Update.
Er sagte mir, alles laufe nach wie vor nach Plan, nur die Timeline sei, hauptsächlich wegen Sandros Terminschwierigkeiten, ein bisschen ungewiss, aber unterm Strich sei alles in bester Ordnung. «Hör zu, das Ganze tut mir wahnsinnig leid, ich habe deswegen ein furchtbar schlechtes Gewissen, ich werde mich umgehend darum kümmern, es ist totaler Scheiß.» Er entschuldigte sich dermaßen ausführlich, erging sich in derart übertriebenen Selbstvorwürfen, dass ich mit Verwirrung untermischte Schuldgefühle bekam. War mir etwas entgangen? Hatte Eddie etwas falsch gemacht? Das hatte er nicht; und wie ich Eddie inzwischen kenne, ist mir klar, dass das wahrscheinlich ein taktisches Mea culpa war und er einfach so mit mir umging, wie man mit einem x-beliebigen Problem umgeht. Ich will damit nicht andeuten, Eddie habe eine niedrige Gesinnung; ich glaube nur, dass er keine Bedenken hat, geschäftlichen Zielen den Vorrang vor privaten einzuräumen. (Später gestand er das mir gegenüber ein, ja beharrte geradezu darauf.) Er sagte (am Telefon): «Über eines muss Klarheit zwischen uns herrschen. Ich werde dich nicht mit einem Nasenwasser abspeisen. Du kriegst einen super Deal. Setz deinen Vertrag selber auf. Aber sowie du auf der gepunkteten Linie unterschrieben hast, spielst du mit den großen Jungs. Zwischen mir, meinem Bruder und meinem Vater gilt das Gleiche: keine Gefälligkeiten, keine zweiten Versuche, es werden keine Gefangenen gemacht.» Eddie lachte ein bisschen, und auch ich lachte ein bisschen, zum Teil über den Gedanken, dass mein erwachsener Freund die Piratenflagge des Geschäftslebens hisste. «Geht klar», sagte ich. «Absolut.»
«Keine Sorge», sagte ich zu ihm. «Solche Sachen brauchen immer Zeit.» Das meinte ich ehrlich. Ich kreidete Eddie die Verzögerung nicht an. Er sollte nicht erfahren, dass das Verstreichen der Zeit ungewöhnlich qualvoll für mich war, dass die Verhältnisse bei der Arbeit unerträglich waren, nun da Jenn und ich uns getrennt hatten und wir unsere Tage damit zubringen mussten, einander im Büro aus dem Weg zu gehen, und uns die Nähe des anderen geradezu folterte.
Soweit ich es mitbekam, litt Jenn zusätzlich zum Kernschmerz über das Ende der Beziehung schrecklich unter der «Demütigung», die sie niemals heftiger empfand als bei der Arbeit, umgeben von den Kollegen, in deren Augen sie sich unerträglich herabgesetzt fühlte. Ich begann der wichtigen Frage der Demütigung nachzugehen, die ich nicht völlig verstand (obwohl es auch für mich fast unerträglich war, mich im Büro zu zeigen und mich dort, wie ich feststellte oder mir einbildete, den verständnislosen Blicken bestimmter Leute ausgesetzt zu sehen). Mir schien, dass es heutzutage ein begründetes, weithin akzeptiertes Verständnis eines so alten psychischen Zustandes geben musste. Ich fühlte mich berufen, Internetseiten zu besuchen, die sich modernen psychologischen Fortschritten widmeten, und mich in Diskussionsforen einzuschalten, wo ich mit einer in der Geschichte menschlichen Strebens bislang nicht verfügbaren Effektivität Nutzen aus der Weisheit, Erfahrung und Gelehrsamkeit eines selbstgeschaffenen globalen Netzwerks oder einer Community der persönlich und abstrakt am stärksten an Demütigung Interessierten ziehen, auf diese Weise auf den Schultern von Riesen stehen und, wenn ich denn wollte, einen noch nie dagewesenen, umfassenden Blick auf das Thema gewinnen konnte. Ich kann nicht behaupten, dass es sich so ergab, wie ich gehofft hatte. Es dürfte schwerfallen, eine bösartigere und gehässigere Ansammlung von Starrköpfen und Eiferern zu finden als diese Gruppe von Kommunitaristen, die sich, vielleicht deformiert von einer bitteren, innigen Vertrautheit mit Demütigung und/oder vom Barbarischen in ihrer Wesensart, dem verbalen Niederbrennen jedes Versuchs vernünftiger Argumentation und konstruktiven Umgangs widmeten. Es war ehrlich gestanden grotesk und erschreckend mit anzusehen. Offensichtlich befand sich das Licht der Erkenntnis, das durch alle Zeiten hindurch von Mönchen und Gelehrten bewahrt und von den vornehmsten Geistern der Moderne zum Leuchten gebracht worden war, inzwischen in den Händen einer unaufhaltsamen Horde von Brandstiftern.
Ende März bekam ich einen Anruf von einer Frau, die sich im Auftrag von Sandro Batros an mich wandte. Sie wollte das Treffen auf den morgigen Sonntag verschieben.
«Welches ‹Treffen›?», sagte ich.
«Ich stelle Sie jetzt durch», sagte sie.
Ich hörte Sandro sagen, wie sehr er sich darauf freue, endlich den Freund seines kleinen Bruders kennenzulernen. Er sagte: «Hören Sie, nur eine Vorwarnung. Ich bin dick. Das heißt, richtig fett. Vielleicht hat Eddie Ihnen das gesagt. Ich wollte Sie nur darüber informieren. Keine Überraschungen. Karten auf den Tisch.»
Als Nächstes sagte mir die Assistentin, der Termin sei auf 10 Uhr in Sandros Suite im Claridge’s verschoben.
Ich sagte: «Claridge’s in London?» Ich hörte keine Antwort. Ich sagte: «Ich bin in New York. Ich bin in den USA.»
«Okay», sagte sie nach längerem Schweigen, offenbar ganz und gar von etwas anderem in Anspruch genommen.
Ich legte auf, erwischte ein Flugzeug nach London und nahm ein Taxi von Heathrow nach Mayfair. Ich kann die schrecklich rasenden roten Zahlen des Taxameters nicht aus meinem Gedächtnis löschen. Um 9 Uhr 07 kam ich am Claridge’s an. Ich entsinne mich deutlich, dass das Taxi hinter einem Bentley zum Stehen kam. Um 9 Uhr 08 präsentierte ich mich am Empfang des Claridge’s. Die Empfangschefin sagte mir, Mr. Batros habe ausgecheckt. Sie zeigte auf den Eingang. «Da fährt er», sagte sie, und wir sahen zu, wie der hoteleigene Bentley losfuhr.
Sandros Assistentin erwiderte meine Anrufe nicht. Eddie ebenfalls nicht.
Mein Rückflug ging erst am Abend. Was sollte ich tun? Es war ein elender, verregneter Tag, und ein Spaziergang kam nicht in Frage. Außerdem war das hier London, eine Stadt, an der ich nie Gefallen gefunden habe, vielleicht weil selbst ein Kurzbesuch hier bedeutet, wie ein Sparschwein umgedreht und so lange geschüttelt zu werden, bis man auch die letzte kleine Münze losgeworden ist. Ich nahm die U-Bahn zurück nach Heathrow.
Als ich im Abflugbereich von meiner Zeitung aufblickte, sah ich zwei französisch sprechende kleine Mädchen theatralisch umherschleichen, während sie versuchten, ihrem Vater einen Papierfisch ans Jackett zu heften. Die Mutter war in den Scherz eingeweiht, und auch der Vater war offensichtlich nicht ahnungslos, obwohl er so tat, als bemerkte er nichts. Irgendetwas Altmodisches an der Szene veranlasste mich, nach dem Datum auf meiner Zeitung zu sehen. Es war der 1. April 2007.
Solange ich genügend Beinfreiheit habe, fliege ich gern lange Strecken. Den Rückflug nach New York verbrachte ich durchaus zufrieden: Ich sah mir Bourne-Filme an, von denen ich aus irgendeinem Grund nie genug kriege, trank kleine Flaschen Rotwein aus Argentinien und verfasste in Gedanken eine Reihe imaginärer E-Mails an Eddie Batros. Indem ich nacheinander Formen von Empörung, Gutmütigkeit, Kälte, Reumütigkeit und geschäftsmäßiger Knappheit aufbot, informierte ich ihn immer wieder über das Londoner Debakel und dessen unvermeidliche Konsequenz, nämlich, dass ich mich aus dem Kreis der Kandidaten für die Stelle in Dubai zurückzog.
Ich habe mehr denn je die Angewohnheit, E-Mails zu formulieren, die keine Entsprechung im Faktischen haben. Derzeit stelle ich mir (unter anderem) folgende vor:
Eddie – ich finde, wir sollten uns über Alain unterhalten. Ich verstehe vollkommen, dass der Junge Hilfe braucht, aber ich kann ehrlich gesagt nicht den Babysitter für ihn spielen. Könntest du Sandro bitte informieren, dass er eine andere Regelung treffen muss?
Und:
Sandro – Bitte bestätige, dass ich im Gegensatz zu dem, was mir Gustav in Genf sagt, durchaus bevollmächtigt bin, MM. Trigueros und Salzer-Levi für ihre Arbeit in der Wohnung in Divonne zu bezahlen. Mme. Spindler, die Reinigungskraft, hat ebenfalls unstreitig Anspruch auf Bezahlung. Oder ist unsere Position die, dass sie vertragliche Verpflichtungen einhalten müssen, wir dagegen nicht?
Und:
Sandro – Du kannst mich nicht in Regelungen betr. deine Yacht einbeziehen, sofern du von mir verlangst, der Crew gegenüber wissentlich falsche Angaben zu machen. Das ist professionell und persönlich unerträglich. Jetzt weist man mich (wie ich höre) an, Silvio darüber zu informieren, dass die Liegegebühren in seine Zuständigkeit fallen, dabei ist das gar nicht der Fall, war es nie und kann es auch niemals sein. Meine Antwort an dich lautet daher: (1) ich werde Silvio nichts dergleichen sagen; (2) es reicht mir; und (3) der erste Satz wird hiermit wiederholt.
Und:
Sandro – in Beantwortung deiner Anweisung von heute Morgen («Sieh zu, dass es klappt»), kann ich nur wiederholen, dass es derzeit unmöglich ist, eine maltesische Staatsbürgerschaft für deine Cousins zu kaufen. Das maltesische Recht lässt das noch nicht zu, und ich kontrolliere das Parlament von Malta nicht. Ich bin den auf der Welt herrschenden Gegebenheiten unterworfen.
Dass ich diese E-Mails nicht abschicke, ja nicht einmal tippe, liegt daran, dass es sinnlos, ja kontraproduktiv wäre. Die Brüder Batros lassen sich nicht beeinflussen und schon gar nicht korrigieren. Und selbst wenn, dann nicht per E-Mail, und selbst wenn per E-Mail, dann nicht von mir. Anfangs, als ich diesen Job übernommen hatte, pflegte ich ihnen oft zu schreiben, taktvoll Argument A und B vorzutragen, X anzuregen, den Versuchsballon Y zu starten oder schließlich nachdrücklich Z anzuraten, und die Konsequenz war in allen Fällen null. Es ist beunruhigend, in einer Position zu sein, in der das Ausführen von Aktionen nicht mehr den Effekt hat, einen zum Akteur zu machen. Das Problem haben wir alle, die wir – wie wir das nennen – auf dem Planeten Batrosia arbeiten, und ich bin mir sicher, ich bin nicht der einzige Batrosianer, der als Reaktion darauf Phantom-Mitteilungen verfasst.
Es ist wohl schon leicht verrückt, heimlich ein körperloses Universum der Offenheit und des Zuspruchs zu bewohnen. Echte Verrücktheit aber wäre es, das Zelt seiner Selbstheit in der Welt des Außen aufzuschlagen. Ich möchte die These umdrehen: Nur ein Verrückter würde nicht zwischen sich selbst und seinem repräsentativen Selbst unterscheiden. Diese banale Unterscheidung ist vielleicht am offensichtlichsten am Arbeitsplatz, wo man sich unweigerlich einer ausgeglichenen, anormal fleißigen, als Platzhalter fungierenden Attrappe bedienen muss, die, eben weil sie eine Attrappe ist, das Leben für alle anderen leichter macht, die ebenfalls präsent sind, d.h. von ihren eigenen Attrappen repräsentiert werden. Ein seltsames Phänomen an der ganzen Sache mit Jenn war, dass, als die Neuigkeit von unserer Trennung herauskam – d.h., als Jenn mit ihrer Version von ihrer Neuigkeit herauskam; ich behielt meine Fakten für mich –, einige Leute im Büro, und ich glaube nicht, dass das Paranoia ist, aus ihrem Attrappendasein heraustraten. So ging ich etwa in meiner grundsätzlich optimistischen Büro-Rolle einen Flur entlang, als aufgrund des feindseligen Blicks, den eine vorbeikommende Kollegin mir zuwarf, deutlich wurde, dass das normale Verhältnis von Attrappe zu Attrappe durch eine unfreundliche Beziehung von Person zu Person – oder Frau zu Mann, wie ich schließlich widerstrebend glaubte – ersetzt worden war. Ich war dazu ausgebildet worden, so gut wie jede konstruierte Geschlechterunterscheidung als faktisch, moralisch und rechtlich ungültig anzusehen – und doch gab es, wie ich zu entdecken meinte, eine geheime, weibliche Rechtsprechung, die die Verdammung von Männern im Hinblick auf Vergehen zuließ, die nur Männer begehen konnten! Mehr als einmal liefen, wenn ich einen Raum betrat, die Frauen darin auseinander und unterdrückten ihr Gelächter, und wohin ich auch ging, so schien es mir, gab man mir durch angelegentliches Schweigen und mokante Gesten der Freundlichkeit zu verstehen, dass man mich durchschaut hatte – bis auf meinen abscheulichen männlichen Kern durchschaut hatte. Diese subtile Durchdringung meines Wesens war meine Bestrafung. Derweil blieben die Männer in ihrem Panzer – im Verborgenen, so mein Eindruck. Einmal allerdings, in der Toilette, gab mir einer mit einem gewissen Grad von Mitgefühl stumm einen Klaps auf den Rücken.
Es hatte eine gewisse Ironie, dieses unheimliche Zum-Leben-Erwachen meiner Kollegen, weil Jenn und mir die umgekehrte Entwicklung den Garaus gemacht hatte: Irgendwann war unsere authentische menschliche Interaktion vollständig durch eine Umgangsweise ersetzt worden, die nur unsere Körper-Doubles betraf. Die Denkfigur, die sich mir aufdrängte, als ich darüber nachzudenken begann, was mit uns passierte, war, dass wir in Zombies verwandelt worden waren, die, es konnte nicht anders sein, vom Zauberwerk der Evolution beherrscht wurden. Will sagen, nachdem die Kinderfrage (dachten wir) beantwortet war – wir konnten uns nicht ohne komplizierte medizinische Intervention fortpflanzen und beschlossen deshalb, es nicht zu tun –, wurde unser Zusammensein zu etwas Äußerlichem, sodass wir, ob wir nun nett mit Freunden aßen oder, im Bett, nach dem Körper des anderen tasteten, genauso gut leblos, mit von unseren Gesichtern abfallendem Fleisch, den Broadway hätten entlanghampeln und Panik auslösen können; und als wir es uns wegen des Babys anders überlegten, oder vielmehr Jenn es sich anders überlegte, war es zu spät. In diesem Sinne war es eine Erleichterung, als es sich ergab, dass Jenn im Spätherbst 2006 die mietpreisgebundene Zweizimmerwohnung in Gramercy allein in Besitz nahm und ich nach einer kurzen Standortwechselkrise in eine Luxusmietwohnung mit Blick auf den Verkehr des Lincoln-Tunnels zog. Dieser Umzug, der mit einigen außerordentlich schmerzvollen, anstrengenden und unglaublichen Szenen einherging, verhalf unserer Situation wenigstens zu räumlichem Realismus, wie man das vielleicht nennen könnte.
In diese Wohnung der Realität kehrte ich von der umsonst nach London unternommenen Reise zurück. Ich war zu dem Schluss gekommen, dass die wirkungsvollste Erklärung, die ich den Brüdern Batros gegenüber abgeben konnte, darin bestand, überhaupt keine Erklärung abzugeben. Jedenfalls wäre es ein Widerspruch in sich gewesen, ihnen zu sagen, dass ich ihnen nichts mehr zu sagen hatte. Außerdem war ich zu keiner Mitteilung verpflichtet und gerade dermaßen von ihnen verarscht worden, dass schwerlich zu erkennen war, welche vernünftige Basis für eine künftige Kommunikation über irgendein Thema noch bestehen könnte. Der springende Punkt: Mir blieb nichts anderes übrig, als meinen Dubai-Planungen einseitig ein Ende zu machen – eine Verdrängung, die nicht ohne Nebenwirkungen geblieben sein kann. Es war etwa um diese Zeit, dass ich jeden Abend nach der Arbeit von der Eingangshalle des Gebäudes, in dem ich wohnte, bis zu meiner Luxuswohnung im siebzehnten Stock hinaufzurennen versuchte. Ich muss die Absicht gehabt haben, fitter zu werden, mich leistungsfähiger zu fühlen, meine Gedanken zu ordnen etc.
Ich benutzte die Feuertreppe. Zu Anfang schaffte ich es nur bis in den zweiten Stock und kroch praktisch den Rest der Strecke hinauf. Obwohl ich mich rasch verbesserte, wurde es nach etwa zehn Stockwerken immer sehr mühsam, und vermutlich um mich zu pushen, verfiel ich in die Gewohnheit, mir vorzustellen, ich wäre ein Feuerwehrmann, im siebzehnten Stock wütete ein Feuer und zwei junge Schwestern säßen dort oben im Rauch und in den Flammen fest. Das Problem mit dieser Motivierungsphantasie war, dass sie außerordentliche Anforderungen an meine realen sportlichen Fähigkeiten stellte, sodass ich mich, wenn ich meine Luxuswohnung schließlich erreichte, in einem Zustand sehr realer Not befand, weil ich zu spät dran war, um die beiden kleinen Mädchen zu retten, deren vergeblicher Überlebenskampf mir in schrecklichen Sekundenbildern durch den Kopf schoss, während ich mich verzweifelt und schwitzend hinaufmühte. Eine Dusche und ein Bud Light spülten dieses Aufgewühltsein so gut wie weg, aber ich bezweifle, dass es ein Zufall war, dass ich mich während dieser Zeit öfter beim Brüten über der Geschichte des Subway-Samariters ertappte – des New Yorker Bauarbeiters, der im Januar vor einer herankommenden U-Bahn auf das Gleis gesprungen war, um einen Mann zu retten, der aufgrund eines Anfalls dorthin gestürzt war. Genauer gesagt hatte der Subway-Samariter den gestürzten Fahrgast in den Graben zwischen den Schienen geschubst und sich auf ihn gelegt, während die Bahn mit kreischenden Bremsen über sie hinwegraste.
Diesen Mann beneidete ich zutiefst, allerdings nicht wegen des Geldes und der Sachleistungen, die sofort auf ihn herabregneten. Der Subway-Samariter, der zum Nutzen eines Fremden gehandelt hatte, wurde selbst zum Nutznießer der Freigiebigkeit und Unterstützung von Menschen und Firmen, die er persönlich gar nicht kannte, darunter Donald Trump (Scheck über 10000 US-Dollar); Chrysler (Geschenk eines Jeep Patriot); Gap (Geschenkgutschein über 5000 US-Dollar); Playboy Enterprises Inc. (lebenslanges Gratisabonnement des Playboy – der Samariter hatte während der Rettung eine Beanie-Mütze mit einem Playboy-Bunny-Logo getragen); die New York Film Academy (Schauspielstipendien im Wert von 5000 US-Dollar für die beiden fünf- und achtjährigen Töchter des Samariters (der gestürzte Fahrgast war Student der Film Academy); das Walt Disney World Resort (All-inclusive-Familienausflug in die Disney World plus Mickymaus-Ohren für die Mädchen, plus Eintrittskarten für König der Löwen); die New Jersey Nets (Gratis-Saisonkarte); Beyoncé (Gratis-Backstagepässe und Eintrittskarten für ein Beyoncé-Konzert); Jason Kidd (Jason-Kidd-Shirt mit Autogramm); Progressive (eine kostenlose, zwei Jahre gültige Progressive-Kfz-Versicherung) und die Metropolitan Transportation Authority (ein Jahresvorrat MetroCards). Es war auch nicht so, dass ich dem Samariter seine plötzliche Bekanntheit und seinen öffentlichen Ruhm neidete: Sein Bronzemedaillon der Stadt New York und seine Auftritte bei Letterman und Ellen konnte er behalten, und von Herzen gegönnt war ihm auch sein Gastauftritt bei der Rede zur Lage der Nation von George W. Bush, wo er, Träger des Titels «der Held von Harlem» (so wie vor ihm Lenny Skutnik, «der Held vom Potomac»), Gegenstand der Bewunderung und Adressat der Glückwünsche des Kongresses und des Präsidenten war. Nein, mein Neid gehörte einer weniger materiellen, wenngleich vielleicht nicht weniger unverzeihlichen Ebene an: Ich missgönnte dem Samariter das frisch erworbene und gewiss unbestrittene Privileg, einen Raum zu betreten – einen alltäglichen Raum mit alltäglichen Leuten darin – und dort als vermutlich anständiger Mensch empfangen zu werden, dem es vermutlich ganz anständig gelungen ist, sich alle Mühe zu geben, in einer Welt, in der es, wie man es auch betrachtet, schwierig ist, das Richtige zu tun.
Aber nein – das Privileg wurde bestritten! Mir kam zur Kenntnis, dass sogar der Subway-Samariter der Kritik von Teilen der Online-Community nicht entging, die offenbar die ganze «Geschichte» nicht «kauften», den Verdacht hatten, da gehe irgendetwas «nicht ganz Astreines» vor sich, und anmerkten, der Mann habe zur Zeit des Unfalls seine beiden Töchter zu «deren» Zuhause (d.h. dem ihrer Mutter – d.h. nicht dem des Samariters) begleitet; habe unerklärlicher- und leichtsinnigerweise die Interessen eines «völlig» Fremden über die seiner Töchter gestellt; und sei (wenn man zwischen den Zeilen selbst respektabler Threads las) ein einfacher Afroamerikaner und von daher prima facie ein schlechter Vater und heimlicher Krimineller oder werde bestimmt demnächst als solcher entlarvt. Ich erinnere mich an einen elektronischen Gaffer, der sich auf das «Stalin-Prinzip», wie er das nannte, berief. Das heißt, er stellte die rhetorische Frage, ob Stalin ein guter Mensch wäre, wenn er bloß einmal einer kleinen alten Dame über die Straße geholfen hätte. Klüger als dieser Chor von Kleingeistern und bedrohlicher für die eigene schlichte Bewunderung und Dankbarkeit, die man dem Subway-Samariter entgegenbrachte, waren diejenigen, die die ganze «Heldentumsindustrie» in Frage stellten und zu bedenken gaben, dass diese Art von unverlangter und unverhältnismäßig aufopferungsvoller Intervention ethisch hinfällig sei, weil man schwerlich sagen könne, gute Menschen handelten gewohnheitsmäßig ebenso oder sollten ebenso handeln, und dass es außerdem dumm sei, ein offensichtlich leichtsinniges Handeln, das ohne weiteres die Konsequenz hätte haben können, zwei Kinder ihres Vaters zu berauben, im Nachhinein als vorbildlich hinzustellen. Ein weiterer Kommentator erklärte sogar, es sei sinnlos, moralische Lektionen im Verhalten irgendeines gedankenlosen, instinktgesteuerten (schwarzen) Mannes zu suchen, dessen Handeln in seiner Beliebigkeit, Spontaneität und Irrationalität dem grundlosen Auf-die-Schienen-Schubsen von Menschen, das in der New Yorker Subway ebenfalls vorkomme, wesensverwandt sei.
Ich dachte bloß: Wer ist gestorben und hat diese Leute zum Papst gemacht?
Ich änderte meinen Tagesablauf und lief die Treppe morgens hinauf. Auf diese Weise kam ich dahinter, dass ich nicht der einzige Läufer im Gebäude war. Es gab noch einen, mit Namen Don Sanchez. Er wirkte wie ein physisch und psychisch wohlorganisierter, von Problemen völlig unbelasteter Akademiker mit einem gesunden Schuss Ironie und trug schweißableitende Under-Armour-Shirts, die aus recycelten Plastikflaschen hergestellt waren. Er war nicht aus Vorliebe für diese speziellen Luxuswohnungen in das Gebäude eingezogen, sondern, wie er mir eines Tages erklärte, weil es ihm die erstklassige Laufmöglichkeit angetan hatte, wie sie die nagelneue Treppe bot, die ein tolles Geländer, Stufen mit hellgelb abgesetzten Kanten und eine gute Beleuchtung hatte. Don erzählte mir lachend, er könne sich ein Leben ohne «Vertikalsport» gar nicht mehr vorstellen. Er war im Empire State Building gelaufen und träumte davon, im Taipei 101 und im Swissôtel Singapur zu laufen. Er lief mit Marienkäfer-Ohrhörern. Er war viel schneller und kräftiger als ich und schaffte es schnell und mühelos bis ganz nach oben, in die fünfundzwanzigste Etage. Die kleinen Mädchen in meiner lichterloh brennenden Wohnung würden jedes Mal gerettet werden, wenn ihnen Don Sanchez zu Hilfe eilte. Ich gab es auf, abends zu laufen, und stand stattdessen im Morgengrauen auf, um mit Don zu laufen: Ich fiel rasch zurück, während er immer zwei Stufen übersprang, konnte jedoch in der Gewissheit, dass für die gefährdeten Kinder alles gut werde, stetig weitertraben. So beruhigend war Don, dass ich ihn auf einen Drink in meine Wohnung einlud. Das war kein Erfolg. Ich hatte in meiner Luxuswohnung nur wenige Lampen und nur ein paar Möbelstücke, und aufgrund der langen Schatten und der Dunkelheit war es, als hätte ich es darauf angelegt, uns in einen dieser düsteren, will sagen schwedischen Filme zu versetzen, die sich meine armen Eltern oft gemeinsam ansahen, wobei sie in der Anordnung ihrer jeweiligen Sessel die Anordnung von Stummheit, Schwermut und menschlicher Isoliertheit duplizierten, die das Fernsehen bot. Ich vertraute Don verschiedene Dinge an. Er seinerseits bekannte, dass er alle ein bis drei Jahre auf eine Treppe stieß, die ihn richtig packte, worauf er, wenn ansonsten gleiche Bedingungen herrschten, in das fragliche Gebäude umziehe, um dort zu laufen. Er teilte seine physiologischen Theorien mit. Er gab seine Ansichten zu den unterschiedlichen Anforderungen weiter, welche die perpendikulare und die horizontale Mobilität stellten, und schrieb mir einige einschlägige mathematische Berechnungen auf. Nach ein paar irgendwie unheimlichen Abenden, in deren Verlauf sich jedem von uns fraglos immer stärker der Eindruck aufdrängte, dass der andere geisteskrank war, beschränkten wir unsere Freundschaft auf die Treppe.
Dank eines bedeutungslosen Zufalls liegt meine derzeitige Unterkunft ebenfalls im siebzehnten Stock, aber es wäre natürlich unerhört und verpönt und schlichtweg unzulässig, die Treppe im «Situation» hinauf- und hinunterzurennen. Das Letzte, was das «Situation» gebrauchen kann, sind mittelalte Typen, die herumrennen, in der Öffentlichkeit heftig schwitzen, stöhnen, komisch aussehen, ihre Schmerzen kundtun, unser Ethos untergraben und unseren ohnehin schon schwer unter Druck stehenden, am Quadratmeterpreis ablesbaren Wert noch stärker unter Druck setzen.
Es gibt hier im Yachthafenviertel viele Hochhäuser, aber zu Bewertungszwecken müssen sich die Wohnungsbesitzer im «Situation» – die Kompromisslosen Wenigen, wie The Situation.com uns nennt – nur mit zwei Vergleichsgrößen befassen: mit dem «Aspiration», das von den Träumern neuer Träume bewohnt wird, und dem «Statement», dem «Zuhause der Pioniere des Luxus™». Wir wollen stets miteinander gleichziehen. Weil wir mit Absicht exklusiv an der Privilege Bay – einer elitären Bucht in der größten künstlichen Lagune der Welt – wohnen und, noch wichtiger, weil alle drei Wohnangebote sich auf ein Exzellenz-Ethos geeinigt haben (dessen Grundsätze auf unseren jeweiligen Webseiten stehen), konkurriert unsere Troika intern um die Gunst eines ultra-anspruchsvollen Mikromarktes von Immobilieninvestoren – derjenigen, die in der Terminologie von TheAspiration.com «The Far Side of Aspiration» erreicht haben. Im Prinzip gehen wir drei Wohnangebote konsultativ vor. In der Praxis gleicht das Ganze dem Dreier-Duell aus Zwei glorreiche Halunken: Jedes tut, was auch immer erforderlich ist, um sich einen Vorteil zu verschaffen, und jedes reagiert blitzschnell auf jeden