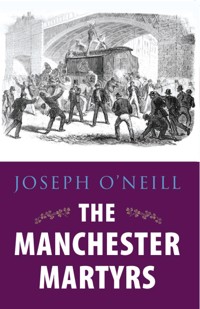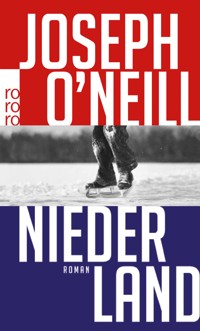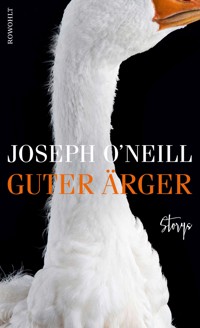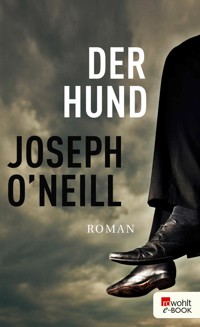24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mark Wolfe ist im Job gerade wegen «Überarbeitung» in den Urlaub geschickt worden, als er zum ersten Mal seit Jahren von seinem Bruder in England hört. Geoff war schon immer ein Geschäftemacher; nun hat er etwas Großes am Wickel und bittet Mark um Hilfe. Er hat ein Video zugespielt bekommen: ein Ballplatz. Rote Erde. Ein Junge, der Fußball spielt wie ein Gott. Die Welt des Fußballs, sagt Geoff, ist gefährlich, aber dieser Junge ist Millionen wert. Man muss ihn nur finden. Bald schon steigt Geoff frustriert aus dem Geschäft aus. Doch Mark findet heraus, dass das Video aus Benin stammt. Und er beschließt, sich mit einem halbseidenen Franzosen, der den Markt der Jungtalente aus Afrika kennt, auf die Suche nach dem Jungen zu machen. Als der Franzose ihn übers Ohr haut und alleine fliegt, kehrt Mark zurück in den Job, wo es auch Drama genug gibt. Doch eines Abends steht der Franzose vor seiner Tür. Er hat den Jungen gefunden. Er war nicht der Erste. Und er erzählt Mark eine ungeheuerliche Geschichte. «O'Neill vermisst geschickt Perspektiven auf Postkolonialismus und Globalisierung.» Die Zeit
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Joseph O'Neill
Godwin
Roman
Über dieses Buch
Mark Wolfe ist im Job gerade wegen «Überarbeitung» in den Urlaub geschickt worden, als er zum ersten Mal seit Jahren von seinem Bruder in England hört. Geoff war schon immer ein Geschäftemacher; nun hat er etwas Großes am Wickel und bittet Mark um Hilfe. Er hat ein Video zugespielt bekommen: ein Ballplatz. Rote Erde. Ein Junge, der Fußball spielt wie ein Gott. Die Welt des Fußballs, sagt Geoff, ist gefährlich, aber dieser Junge ist Millionen wert. Man muss ihn nur finden.
Bald schon steigt Geoff frustriert aus dem Geschäft aus. Doch Mark findet heraus, dass das Video aus Benin stammt. Und er beschließt, sich mit einem halbseidenen Franzosen, der den Markt der Jungtalente aus Afrika kennt, auf die Suche nach dem Jungen zu machen. Als der Franzose ihn übers Ohr haut und alleine fliegt, kehrt Mark zurück in den Job, wo es auch Drama genug gibt. Doch eines Abends steht der Franzose vor seiner Tür. Er hat den Jungen gefunden. Er war nicht der Erste. Und er erzählt Mark eine ungeheuerliche Geschichte.
«O’Neill ist ein kosmopolitischer, kenntnisreicher Berichterstatter aus den Untiefen unserer Gegenwart.» Süddeutsche Zeitung
Vita
Joseph O’Neill wurde 1964 als Sohn einer Türkin und eines Iren in Cork geboren und wuchs in Holland auf. Er studierte Jura in Cambridge und arbeitete als Anwalt in London. Später ließ er sich als freier Autor in New York nieder. Für seinen internationalen Bestseller Niederland wurde er 2009 mit dem PEN/Faulkner Award ausgezeichnet. Das Buch war außerdem, wie sein zweiter Roman Der Hund, für den Man Booker Prize nominiert.
Nikolaus Stingl, geb. 1952 in Baden-Baden, übersetzte unter anderem William Gaddis, William Gass, Graham Greene, Cormac McCarthy und Thomas Pynchon. Er wurde mit dem Heinrich Maria Ledig-Rowohlt-Übersetzerpreis, dem Literaturpreis der Landeshauptstadt Stuttgart, dem Paul-Celan-Preis und dem Straelener Übersetzerpreis der Kunststiftung NRW ausgezeichnet.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2024 unter dem Titel «Godwin» bei Pantheon Books, New York.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Juli 2024
Copyright © 2024 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
«Godwin» Copyright © 2024 by Joseph O’Neill
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München
Coverabbildung Grégory Escande
ISBN 978-3-644-00223-4
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für R
L
Wolfe verhielt sich seltsam gegenüber Kunden und Kollegen. Meine Co-Leiterin Annie fand, wir sollten ihn unseren Richtlinien gemäß schriftlich abmahnen. Ihrer Meinung nach war mit einem erst kurz zurückliegenden Vorfall «eine Grenze überschritten».
Ich war vorsichtiger. Eine schriftliche Abmahnung stellte einen gewichtigen Schritt dar. Ich hatte das Gefühl, es wäre konstruktiver und nicht so destabilisierend für unsere Gemeinschaft, Wolfe ein gewisses Maß an Unterstützung anzubieten. Er war ein langjähriges Mitglied der Group. Es war das erste Mal, dass es echte Probleme mit seinem Verhalten am Arbeitsplatz gab. Ich vermutete, dass er die Art von Schwierigkeiten hatte, denen wir alle uns irgendwann gegenübersehen.
Ich sagte Annie, ich würde einen Kaffee mit ihm trinken gehen und herauszufinden versuchen, was los war.
Ich hegte Wolfe gegenüber keine tieferen Gefühle. Ich wünschte ihm natürlich nichts Schlechtes, kannte ihn allerdings auch kaum, obwohl wir seit sieben Jahren Kollegen waren. Wie ein Großteil unserer erfahreneren Mitglieder arbeitete er von zu Hause aus und kam nur gelegentlich zu Meetings ins Büro. Dort sagte er sehr wenig und ging bei erster Gelegenheit wieder. Das war in Ordnung. Die Mitglieder waren nicht verpflichtet, sich bei der internen Verwaltung der Group zu engagieren.
Die Group (offiziell: die P4-Group) wurde 2004 als Genossenschaft technischer Redakteure gegründet. Die Genossenschafter hießen «Mitglieder». Jedes Mitglied zahlte eine Monatspauschale plus einen jährlichen Beitrag, der sich aus einem Prozentsatz seiner Einkünfte errechnete. Dafür übernahm die Group die Kundenbetreuung für die Mitglieder (einschließlich Honorarverhandlungen und Fakturierung), stellte ihnen ein Büro zur Verfügung, in dem sie sich mit Kollegen und Kunden treffen konnten, und bot ihnen eine Markenpräsenz. Als Teil einer Berufsorganisation mit eindrucksvoller Webseite wahrgenommen zu werden macht einen professionelleren Eindruck. Ein Kollektiv wie die Group ist attraktiv für jemanden, der selbstständig bleiben will, aber keine Lust auf das Risiko, den Ärger und die Einsamkeit hat, die mit einem Dasein als Einzelunternehmer oder Freiberufler einhergehen. Der Begriff «Freiberufler» hört sich gut an, aber die meisten Leute empfinden die ihm zugrunde liegende Wirklichkeit als stressig und keineswegs «frei».
Um Mitglied zu werden, musste eine Redakteurin oder ein Redakteur persönliche und berufliche Eignung nachweisen. Das war nicht so abschreckend, wie es sich anhörte. Wenn man während der dreimonatigen Probezeit einigermaßen zurechtkam, wurde einem höchstwahrscheinlich eine Mitgliedschaft angeboten. Wir waren immer auf der Suche nach neuen Leuten. Unsere Fluktuation war beträchtlich. Die Arbeit als technischer Redakteur ist hart, und nicht jeder ist dafür geeignet.
Annie und ich waren die Co-Leiterinnen der Group. Falls sich ein potentieller Kunde an die Group wandte, war es Aufgabe der Co-Leiterin, sich im Namen der Mitglieder darum zu kümmern. Falls ein Mitglied um Hilfe bei der Berufspraxis bat, mussten wir uns auch darum kümmern. Annie war für eine Hälfte der Mitglieder zuständig, ich für die andere. Das war keineswegs leicht. Mit zunehmender Mitgliederzahl der Group nahmen auch unsere Aufgaben zu. Dabei blieb jedoch unsere Vergütung unverändert bei etwa zwanzigtausend Dollar pro Jahr. Annie und ich machten das nicht zum Thema. Aus Idealismus waren wir bereit, Teilzeitentlohnung für einen Vollzeitjob zu akzeptieren. Idealismus, wenn er echt ist, bedeutet zusätzliche Arbeit.
In unseren Anfängen waren unsere Ideale diffus. Die vier Gründer – Annie und ich plus zwei weitere – waren Frauen, aber wir maßen diesem Umstand keine Bedeutung bei. Wir sahen uns nicht als Feministinnen. Wir sahen uns als ein Quartett kompetenter Frauen. Wenn überhaupt, war uns der Männermangel eher peinlich, und wir unternahmen Anstrengungen, Männer zu werben. Sie wurden gebraucht, weil wir von Anfang an gut zu tun hatten. Im Großraum Pittsburgh haben unzählige medizinisch-wissenschaftliche Einrichtungen ihren Sitz, und alle konnten sie bei ihren technischen und kommerziellen Unterlagen Hilfe gebrauchen. Wir waren viel erfolgreicher, als wir erwartet hatten. Bald wurde es nötig, unsere Arbeit stärker zu systematisieren und zu institutionalisieren. 2006 verfassten Annie und ich die Satzung, Regeln und Richtlinien für Genossenschaftsmitglieder der Group. Sie zusammenzustellen dauerte ein Jahr, aber wie viel Spaß das machte! Wir lernten so viel.
In Wahrheit hatten wir nicht sehr eingehend darüber nachgedacht, was wir eigentlich machten. Wir hatten die Genossenschaft nicht gegründet, weil wir Geschichtsbücher gelesen hatten oder zu politischen Veranstaltungen gegangen waren, sondern weil wir unseren Lebensunterhalt verdienen mussten, und eine Organisationsform wie die Group erschien uns eindeutig vorteilhaft. Wir waren nicht ideologisch motiviert. Aber ich fand es interessant, etwas über die Rochdale Society und die Geschichte der Genossenschaftsbewegung zu erfahren. Annie und ich waren uns darüber einig, dass die Richtlinien die traditionellen Prinzipien der Genossenschaftsbewegung widerspiegeln und sie in den Mittelpunkt unserer Identität stellen sollten. Das funktionierte sehr gut.
Mit zunehmender Reputation bekamen wir Aufträge von Kunden aus dem ganzen Land. Medical Writing war unser Kerngeschäft gewesen, doch mittlerweile übernahmen wir auch Installationsanleitungen, Machbarkeitsstudien und technische Handbücher. Außerdem erweiterten wir unser Dienstleistungsangebot um das Verfassen von Förderanträgen. An dieser Stelle kam Mark Wolfe ins Spiel.
Alle kannten ihn als Wolfe, als wäre er ein Fernsehdetektiv. Er hatte Charisma. Die jüngeren Neuzugänge waren fasziniert von diesem blonden, hoch aufgeschossenen Mann Ende dreißig, der oft mit seinem Hund und weniger oft mit seiner schönen Partnerin und dem gemeinsamen Kind gesehen wurde. Männer schätzten Wolfe wegen der Gerüchte, er habe zwei Jahre in der Antarktis verbracht. Es hieß – noch cooler –, er sei mit dem Profi-Skateboarder Heath Kirchart befreundet: Vor Jahren hatte man die beiden angeblich mitten in der Nacht beim Herumalbern in dem kleinen Skatepark in Polish Hill ertappt. Das Antarktis-Gerücht stimmte nicht – ich hatte Wolfes Personalakte gesehen –, aber dieses Wissen behielt ich für mich. Es ist schön, sich vorzustellen, dass man bewundernswerte Arbeitskollegen hat. Was ich vor mir hatte, wenn ich Wolfe ansah, war ein Mitglied mit Output-Problemen. Seine Bruttoeinnahmen schwankten um die 37000 Dollar pro Jahr. Das lag nicht etwa an mangelnden Fähigkeiten. Laut unserer «honorarbezogenen» Leistungskennzahl war er unser effizientester Verfasser von Förderanträgen – d.h. derjenige, dessen Förderanträge am ehesten Erfolg hatten. Andere Kennzahlen widersprachen diesem Status, aber hier ist nicht der Ort, näher auf das Problem einzugehen, wie sich die Gesamtproduktivität eines Arbeiters am besten messen lässt, ein Problem, das in einem Kollektiv wie der Group, wo wir unsere eigenen Vorstellungen davon hatten, was Wert ausmacht, noch interessanter wird.
Was mich als ungefähr Gleichaltrige an seinem Lebenslauf ansprach, war, dass er (an der Carnegie Mellon, wie so viele von uns in der Group) Molekularbiologie studiert hatte. Das war damals, in der ersten Hälfte der 1990er, ein spannendes Fach, alle waren begeistert von Kary Mullis und seinen Arbeiten zur Polymerase-Kettenreaktion. Mullis hatte sich zuerst als Romanautor und Bäcker versucht, ehe er sich schließlich der Wissenschaft widmete. Er wurde nicht nur als Nobelpreisträger, sondern leider auch als Spinner berühmt.
Ich vereinbarte mit Wolfe ein Treffen außerhalb des Büros. Er schlug das Lili Café in der Nähe seiner Wohnung in Polish Hill vor. Pittsburghs Viertel sind von Stolz und Konkurrenzdenken geprägt, und Polish Hill ist eines der stolzesten – die Sorte, wo Zu-verkaufen-Schilder mutwillig beschädigt werden.
Unser Treffen fand an einem besorgniserregend warmen Januarvormittag statt. Um zu signalisieren, dass die üblichen Formalitäten nicht galten, trug ich ein Baumwollkleid mit blauen Karos, das ich fürs Büro niemals anziehen würde. Ich kam pünktlich. Eine Viertelstunde verging, ehe Wolfe, in zerrissenen Bluejeans und einem weißen Unterhemd, mit einer großen, alten braunschwarzen Promenadenmischung namens Pearson erschien. Anstelle eines Halsbandes trug Pearson ein rotes Halstuch. Er ließ sich unangeleint am Außengeländer der Terrasse nieder.
Wolfe wirkte aufgeregt, als er sich setzte. Ich fragte mich, ob ich etwas falsch gemacht hatte. Ob es mir etwas ausmachen würde, sagte Wolfe abrupt, wenn wir nach draußen umzögen? Er wolle Pearson nicht allein lassen.
«Gute Idee», sagte ich.
Wir nahmen an einem Tisch in der Sonne Platz. Wolfe begann sofort, mit seinem Hund zu interagieren. Pearson befolgte die ausgesprochen speziellen Kommandos seines Herrn mit bemerkenswertem Gehorsam – tatsächlich war, während wir auf unser Frühstück warteten, an ein Gespräch nicht zu denken, da Wolfe unentwegt Befehle signalisierte oder artikulierte, die ich großenteils als unnötig empfand. «Was für ein wohlerzogener Hund», sagte ich. Wolfe setzte zu einer Erklärung seiner Hundeerziehungsphilosophie an, die offenbar von der benediktinischen Ordensregel inspiriert war. Ein zentraler Grundsatz dieser Philosophie, sagte er mir, besage, dass Hunde dann am zufriedensten seien, wenn sie keinerlei Zweifel an ihrem untergeordneten Verhältnis zu ihrem Besitzer hätten. Er verbreitete sich derart ausführlich darüber, dass ich gezwungen war, ihn mit einem direkten Hinweis auf den Anlass unseres Treffens – sein unberechenbares Verhalten am Arbeitsplatz – zu unterbrechen. «Ja», sagte er. «Schieß los.»
Das erste Problem – dasjenige, das Annie am stärksten beunruhigt hatte – ergab sich, als Pete, der Mann am Empfang, Wolfe in der Eingangshalle aufhielt. Pete hatte seinen Job erst seit einem Monat und konnte sich nicht erinnern, diesen Besucher schon einmal gesehen zu haben. Jetzt erzählte mir Wolfe, ihn habe nicht so sehr das Angehaltenwerden, sondern vielmehr Petes Ton aufgeregt. Anstatt seine Identität rasch zu überprüfen, habe Pete ihn herumstehen lassen, während er ein «provokativ in die Länge gezogenes» Gespräch mit einem Lieferanten geführt habe. Petes ganzes Verhalten, die Art, wie er ihn, Wolfe, komplett ignorierte, habe nur darauf abgezielt, dass er, Wolfe, sich machtlos fühlte. «Er war genau wie ein Cop», sagte Wolfe. «Als wäre er das Gesetz. Ich warte eine Weile. Und ich warte noch eine Weile. Und weißt du, was ich dann mache? Ich gehe. Ich gehe arbeiten, in das Büro, für das ich bezahle.»
Das war (wie die Aufnahme der Überwachungskamera zeigte) der Augenblick, in dem Wolfe zum Fahrstuhl ging und Pete dabei den Mittelfinger zeigte. Petes Reaktion bestand darin, Wolfe am Rucksack festzuhalten. Es kam zu einem Gerangel. Ein Stück Wandkunst fiel herunter. Wolfes Rucksack wurde aufgerissen, und der Inhalt flog durch die Eingangshalle. Petes Hemdsärmel zerriss. Es war ein ziemlich schockierender Zwischenfall, der von mehreren Zeugen beobachtet wurde. Pete berichtete später, der Empfang sei unterbesetzt gewesen, er habe sich um mehrere Besucher kümmern müssen und Wolfe gebeten, sich einen Moment zu gedulden. Als Wolfe beschlossen habe, an ihm vorbeizugehen, habe er das Gefühl gehabt, eingreifen zu müssen. Das sei sein Job. Er erklärte, er müsste lügen, wenn er sagte, dass Wolfes obszöne Geste ihn nicht geärgert habe.
Wolfe sagte: «Na gut, vielleicht war ich etwas bissig. Ich wünschte, ich wäre es nicht gewesen. In einer idealen Welt ist niemand bissig. Aber Pete hat sich wie ein Arsch verhalten. Und weißt du was? Einmal in tausend Jahren wehrt man sich. Das war der Tag, an dem ich mich gewehrt habe.» Er schnipste zu seinem Hund hin mit den Fingern. «Bedaure ich den ganzen Vorfall? Natürlich. Hätte ich gern einen zweiten Versuch? Klar. Aber nur aus höherer Vernunft.» Vielleicht dachte er, der Ausdruck «höhere Vernunft» sei mir möglicherweise nicht geläufig, jedenfalls fügte er hinzu: «Nicht, weil ich unrecht hatte.» Dann schnipste er wieder zu Pearson hin mit den Fingern.
Ich sprach das zweite problematische Vorkommnis an. Nachdem der Förderantrag eines Kunden abgelehnt worden war, beschloss man dort, den gesamten Finanzierungsprozess einschließlich der Rolle des Antragsverfassers aufzuarbeiten. Man schickte Wolfe eine E-Mail, im Grunde einen Fragebogen, mit dem man um seinen Input bat. Wolfe – der sich Kunden gegenüber schon öfter ein wenig dickfellig, ihrem Lob wie ihrer Kritik gegenüber ein wenig zu gleichgültig gezeigt hatte – antwortete:
Ich beteilige mich mit dem größten Vergnügen an dieser Aufarbeitung und bin voll und ganz Ihrer Auffassung, dass sie «gründlich und ehrlich» sein sollte. Als jemand, der über jahrelange Praxis auf diesem Fachgebiet verfügt, bin ich der Überzeugung, dass meine Arbeit für Sie die Qualitäten Ihres Antrags umfassend optimiert, ihm womöglich zusätzliche Qualität verliehen hat. Daher ist meine Verfasserschaft hier nicht das Problem. Was die Frage angeht, woran es gelegen haben könnte, schlage ich vor, dass Sie darüber nachdenken, wie glaubwürdig Ihre Organisation als potentielle Empfängerin einer sechsstelligen Fördersumme ist. Schon eine einzige Person mit einer bedeutsamen beruflichen Erfolgsbilanz einzustellen wäre ein guter Anfang.
Die Group bekam eine Beschwerde von dem Kunden. Man bezeichnete Wolfe als «außerordentlich unhöflich und wenig hilfsbereit».
Wenn man den Schriftwechsel unvoreingenommen lese, sagte mir Wolfe, dann sehe man, dass er dem Kunden einen wohlerwogenen und ehrlichen Rat erteile. Dass dem Kunden dieser Rat nicht gefalle, sei nicht sein Problem. Der Kunde, sagte Wolfe, sei ein von Arschlöchern in den Zwanzigern betriebenes Start-up und habe von Anfang an eine dumme und respektlose Forderung nach der anderen gestellt. Der Anspruch auf Förderung sei aussichtslos gewesen. Dass man, einmal auf die Nase gefallen, auf ihn losgegangen sei, wundere ihn überhaupt nicht. Er habe es sogar vorausgesehen.
Ich wies darauf hin, dass wir es oft mit anstrengenden Kunden zu tun hatten.
«Das ist nur allzu wahr», sagte Wolfe.
Ich kämpfte bereits gegen eine vorgefasste Meinung darüber an, was Wolfe plagte, nämlich, dass er an einer Selbstwertkrise litt. Das war ein verbreitetes Problem in der Group. Nicht wenige unserer Mitglieder waren begabte Menschen, für die der Beruf des technischen Redakteurs eine Übergangslösung darstellte. Zeit vergeht. Torschlusspanik setzt ein. Besonders bei Männern kann sich das in einer Art fortwährender Empörung äußern – einer Neigung, Anstoß zu nehmen. Wolfes Beschäftigung, seine Einkünfte stimmten vielleicht nicht mit seiner Vorstellung von Erfolg überein. Er hatte eine Partnerin und ein kleines Kind, und ich vermutete, dass seine finanziellen Verpflichtungen belastend, ja demütigend waren. Seine Tattoos waren mindestens zehn Jahre alt. Heath Kirchart hatte sich zur Ruhe gesetzt. Bald würde dieses schöne blonde Haar weiß werden. Während ihm der Kellner sein Frühstück vorsetzte, sah ich, dass es schon angefangen hatte, weiß zu werden.
Ich sagte: «Eigentlich müsste ich fragen: Ist alles in Ordnung?»
Zwischen Bissen von veganem Ratatouille und Schlucken von schwarzem Kaffee, Handsignalen an seinen Hund und Genestel an der mit einem Karabinerhaken an seinem Gürtel befestigten Schlüsselkette versuchte er, meine Frage zu beantworten. Es war sehr verwirrend. Soweit ich es verstand, hatten seine Sorgen mit Befürchtungen über «die Masse des Volkes» im Kontext eines «Zusammenbruchs» (möglicherweise der menschlichen Zivilisation, vielleicht auch des Kapitalismus) zu tun. Er hatte irgendeine Theorie über «Umkehrung», d.h. die Umwandlung einer Räuber-Beute-Gesellschaftsordnung in eine Beute-Räuber-Ordnung. Irgendwie hatte das mit dem Dschihadismus zu tun – nicht im Sinne eines gewalttätigen religiösen Fanatismus, sagte er, sondern im Sinne eines «ökopolitischen» Kampfes und Durchhaltewillens. Nicht lange, und ich gab es auf, ihm folgen zu wollen. Das Treffen war aus dem Ruder gelaufen. Stattdessen konzentrierte ich mich darauf, mit meiner Frustration fertigzuwerden. Das Café leerte und füllte sich wieder; es wurde kälter; Pearson schlief ein, wachte auf und schlief wieder ein; die Rechnung kam und wurde von mir beglichen; und die ganze Zeit setzte Wolfe seinen Monolog fort. Eine Stunde war verstrichen, als ich bemerkte, dass er zum Ende gekommen war. Ich stand augenblicklich auf.
«Das ist sehr interessant», sagte ich. «Du solltest dir überlegen, das aufzuschreiben.»
Er sagte: «Ja, vielleicht sollte ich das. Es aufschreiben. Mich verewigen.»
Jetzt hatte ich ihn gekränkt. Ich hätte feinfühliger sein müssen.
Ich eilte nach Hause. Ich habe selbst einen Hund, Cutie.
Am nächsten Tag ging ich zu Annie.
«Das Wesentliche, bitte», sagte Annie. Das war ihre stehende Wendung. Sie ergab sich aus dem Muttersein und dessen Auswirkungen auf ihre Zeit.
Das Wesentliche war, dass mein Treffen mit Wolfe zwar chaotisch, aber nützlich gewesen war. Er wusste jetzt Bescheid darüber, wie besorgt die Group war. Er hatte Gelegenheit bekommen, seine Sicht der Dinge darzustellen; und ich hatte etwas über seinen Gemütszustand erfahren: dass er aus welchem Grund auch immer eine Phase emotionaler Instabilität und mangelhafter Selbsterkenntnis durchlief.
Annie sagte: «Und was jetzt?»
Darauf gab es keine naheliegende Antwort. Weder Pete noch Wolfe hatten offiziell Beschwerde eingelegt, und die Alternative – ein proaktives, von oben eingeleitetes Disziplinarverfahren – war nicht wünschenswert in unserer Organisation mit ihrer ausgeprägt horizontalen Kultur. Wir vertraten das Konzept freier Entscheidungsspielräume: Will sagen, der Einzelne legte so weit wie möglich selbst fest, wie er mit den Anforderungen der Mitgliedschaft einschließlich sozialer Konflikte umging. Ein Konflikt, der eine körperliche Auseinandersetzung zur Folge hatte, war jedoch ein extremer Fall. Nach meinem Empfinden waren wir, wenn es zum Schwur kam, in Wolfes Ecke. Das mussten wir sein. Pete war Angestellter der Gebäudeverwaltung, während Wolfe ein Genossenschafter war. Er war einer von uns.
«Warten wir eine Woche», sagte Annie. «Dann reden wir noch mal drüber.»
Genau das schwebte mir auch vor. Manches erledigt sich von selbst.
Doch noch am selben Tag stattete Wolfe mir einen Überraschungsbesuch ab.
Die Büros der Group waren in offenem Grundriss angelegt. Mein Schreibtisch stand in einer Nische, die man «Think Pod» nannte. Der Think Pod bot eine schöne Aussicht auf Baumwipfel, war jedoch für ein Privatgespräch ungeeignet. Wir suchten uns ein Besprechungszimmer.
Das Büro war eine ehemalige Konservenfabrik. Es war groß und geräumig. Es bereitete mir stets Vergnügen, durch den Empfangsbereich zu gehen, dessen große, helle Fenster in Quadrate unterteilt waren. Er war so konzipiert, dass er jedem Raum bot, der auf einem Laptop daddeln oder einfach nur abhängen wollte. Kunden waren von seiner modernen, «coolen» Anmutung angetan. Weil eine offene Grundrissgestaltung sich ungünstig auf den Blutdruck, die Aufmerksamkeit usw. der Arbeitenden auswirken kann, hatten wir eine lange Bank einbauen lassen, auf der man «wandsurfen» konnte – mit dem Rücken zur weißen Ziegelwand sitzen, sodass der Bildschirm nur für einen selbst sichtbar war. Die Bank war bei unseren jüngeren Leuten sehr beliebt. Oft benutzten sie Kopfhörer, um die akustische «Blase» zu schaffen, die bei konzentrierter geistiger Arbeit hilfreich sein kann.
Hinsichtlich dieser Blasen habe ich gemischte Gefühle. In meinem ersten richtigen Job bei einer Firma waren Ohrhörer bei den jüngeren Mitarbeitern die Norm. Es war die Anfangszeit des iPod, und wir waren stolz auf unsere Playlists. Dann fiel mir auf, dass, während wir uns in unserem musikalisch individualisierten Kopfraum abmühten, die Manager keine Ohrhörer trugen. Sie hatten eigene Blasen – ihre Büros. Aus diesen Zimmern drang häufig brüllendes Gelächter, vor allem wenn die Türen geschlossen waren. Einer der lautesten Lacher war mein Chef Dave. Sein Büro war fast so etwas wie ein Habitat – nicht nur wegen seiner Größe, sondern auch wegen der ungewöhnlichen Menge von persönlichen Besitztümern, die er dort hortete. Als Dave in Rente ging, wurde ich dazu abkommandiert, ihm beim Ausräumen seines Büros zu helfen. In einem Aktenschrank fand ich ein Kochsieb, das Dave offenbar dazu benutzte, Obst zu waschen, das er gern bei Straßenhändlern kaufte; in einem anderen einen Schlafsack; und in wieder einem anderen ein ungewöhnlich aussehendes Paar schwarzer Handschuhe. Es waren Kletterhandschuhe, wie Dave mir sagte, während er sie anzog. «Kletterhandschuhe?», sagte ich, und als Antwort öffnete er eine Schublade und entnahm ihr ein neues, orangefarbenes Seil. Ich kannte Dave als netten Chef, aber es war Übelkeit erregend, sich mit einem Mann, der schwarze Handschuhe trug und ein Seil in der Hand hielt, in einem Zimmer aufzuhalten. Es diene zum Abseilen, sagte er. Falls jemals ein Katastrophenfall eingetreten wäre, habe er vorgehabt, aus dem Fenster zu steigen und sich die fünf Stockwerke bis auf die Straße abzuseilen. Deswegen hätten die Handschuhe Innenflächen aus Rindsleder. Ich muss wohl etwas komisch dreingeschaut haben, denn Dave lachte laut. Das sei ein Scherz gewesen: Das Seil sei für seinen Sohn, der Bergsteiger sei. Da lachte ich ebenfalls laut, und an dieser Stelle wurde ich wohl einer von den Lachern. Es fühlte sich gut an. Wir fuhren fort, Daves Sachen in Kartons zu packen. Später verließ er das Büro unter weiterem Gelächter durch den Haupteingang, und danach habe ich ihn nie wieder gesehen. Worauf ich hinauswill, ist, dass Ohrhörer oder Kopfhörer produktiv sind, jedoch dem gemeinschaftlichen Charakter des Arbeitsplatzes Abbruch tun. Die Group war ein ruhiger Ort, und manchmal dachte ich, dass es schön wäre, Daves Gelächter zu hören. Dave ist allerdings tot.
In dem Besprechungszimmer konnte man Wolfe und mich zwar sehen, aber nicht hören.
Er sagte mir, er wollte sich dafür entschuldigen, dass er sich «wie ein Idiot verhalten» habe, nicht nur Pete, sondern auch mir gegenüber, bei unserem Treffen. Er sagte: «Ich kann es nicht erklären. Es sieht mir nicht ähnlich. Eigentlich bin ich nicht so. Es tut mir sehr leid.» Er erklärte, er würde gern mit Pete reden, wenn das helfen würde. Er schien mit den Tränen zu kämpfen.
Ich pflichtete ihm bei, dass es eine großartige Idee sei, sich mit Pete zu versöhnen. Ich sagte ihm, Pete sei wegen des Vorfalls sehr beunruhigt und wäre sicher ebenso erleichtert, wenn man nach vorne schauen und einen Schlussstrich unter die ganze Geschichte ziehen könnte.
Hinterher ging ich geradewegs zu Annie.
Sie sagte: «Bei ihm ist ein Guthaben von vierzehn freien Tagen aufgelaufen.»
Mehr musste sie nicht sagen. Ich schrieb Wolfe eine E-Mail, in der ich mich dafür bedankte, dass er sich zweimal mit mir getroffen hatte. Außerdem schrieb ich:
Annie sagt mir, dass du ein Guthaben von vierzehn freien Tagen hast. Wäre das nicht eine gute Gelegenheit, eine wohlverdiente Pause einzulegen?
«Freie Tage» bezeichneten eine Abwesenheit, während derer keine Mitgliedsbeiträge fällig wurden. Im Gegensatz dazu bedeutete «Urlaub» eine Abwesenheit, während derer weiter Beiträge bezahlt werden mussten. Ich sprach mich schon lange für die Schaffung eines Sabbatjahrs aus, für das man nach sechsjähriger Mitgliedschaft infrage käme, aber dieser Vorschlag wurde nie gebilligt. In meinen Augen ein Fehler.
Jeder braucht mal eine Pause. Manchmal, wenn ich in gedrückter Stimmung war, ließ ich den Blick durch das Büro schweifen und erschrak über den Anblick von Menschen, die sich zur Konzentration zwangen, und dann überkamen mich Zweifel am Sinn und Zweck unseres Tuns. Aber wer stellt das Projekt Arbeit nicht manchmal infrage? In solchen Augenblicken fühlte ich mich den Idealen der Genossenschaft noch stärker verpflichtet. Wenn sich die Entfremdung auch nicht aufheben ließ, so ließ sie sich doch gewiss abmildern. Gewiss war eine positive Solidarität möglich.
Am Montagvormittag antwortete Wolfe auf meine E-Mail. Er erklärte, dass er seine freien Tage mit sofortiger Wirkung nehmen werde.
Die Kurzfristigkeit schien nicht ideal, aber unter den gegebenen Umständen war es wohl besser so.
Falls irgendwem auffiel, dass er fort war, so erwähnte es mir gegenüber niemand.
Wie leicht jemand verschwinden kann.
Manchmal, wenn alle anderen nach Hause gegangen waren, goss ich mir eine Tasse Kaffee ein und machte mich an mein Schreibpensum. Ich hatte jenes Stadium der Erfahrung erreicht, in dem ich ein echtes Spezialgebiet – Biotech-Compliance-Materialien – hatte und meine Arbeit als Redakteurin mir endlich wie eine Übung in Kompetenz vorkam. Wohingegen es mir jahrelang so vorgekommen war, als stieße ich an die Grenzen meiner Fähigkeiten, ganz zu schweigen von der Skepsis, ja dem Misstrauen aufseiten der Kunden. Jedenfalls arbeitete ich in der Group am effektivsten abends. Das Gefühl des Nachsitzen-Müssens, das mit dem Begriff «länger arbeiten» verbunden ist, stellte sich nur selten ein; und auch wenn das Verfassen von Texten mich manchmal frustrierte, wandelte sich das nie zu dem Gedanken, dass ich in meinem Leben auf einen Irrweg geraten war und eigentlich woanders sein und etwas anderes tun müsste. Dennoch kam stets ein Augenblick, in dem die Ruhe mir zusetzte und ich mir der Melancholie eines verlassenen Büros bewusst wurde. Rational betrachtet war das Büro zwar nur zeitweise geräumt worden und würde in nur wenigen Stunden wieder mit Leben gefüllt sein; dennoch hatte es etwas Gespenstisches. Wohlgemerkt: Ich glaube nicht an Geister und nichtkörperliche Wesen. Aber in solchen Augenblicken stellte sich das Gefühl ein, dass ich unbemerkbar neben den Frauen in Hauben und knöchellangen Kleidern arbeitete, die in ebendiesem Raum einst Bördelmaschinen bedient hatten. Es war nicht meine Lieblingsempfindung. Sie führte normalerweise zu einem weiteren unbehaglichen Gedanken: dass alles, wofür wir in der Group gearbeitet hatten, nicht von Dauer war, dass alles an einem unsichtbaren Faden hing. Die Ankunft des abendlichen Putztrupps um acht Uhr machte mir jedes Mal Mut.
Wir Genossenschafter putzten unser Büro selbst. Keiner kam darum herum. Wir hatten einen Putzplan. Jeder musste ungefähr zweimal im Monat ran. Manche machten geltend, dass sich unsere Zeit gewinnbringender nutzen ließe und dass ein preiswerter Dienstleister die Putzarbeit übernehmen solle. Vielleicht war das so, aber ich fand immer, dass es Vorteile gab, die das Verfahren lohnten. Zur Steigerung des Teamgeistes gibt es nichts Besseres als egalitär zur Verfügung gestellte Zeit und Arbeitskraft. Ich habe in der Highschool Basketball gespielt. Ich bekam nicht viele Minuten auf dem Feld, aber die Erfahrung war sehr bereichernd. Mein Trainer sagte einmal zu mir: «Lakesha Williams, du bist eine echte Teamspielerin», und ich habe nicht vergessen, wie stolz mich das machte.
In der zweiten Woche von Wolfes Abwesenheit waren laut Plan Edil und ich mit Putzen dran. Darauf freute ich mich nicht gerade. Edil war der Group kurz nach deren Gründung beigetreten und abgesehen von mir und Annie länger dabei als jeder andere. Meine Beziehung zu ihr war seit jeher von äußerlicher Fröhlichkeit und innerer Beklommenheit gekennzeichnet. Im Lauf des zurückliegenden Jahrzehnts hatte Edil Rechnungen über ungefähr 64000 Dollar ausgestellt. Das reichte nicht, um als Genossenschafterin finanziell vertretbar zu sein. Edil behielt ihre Mitgliedschaft, weil sie stets ihren Beitrag bezahlte. Sie war nicht unbedingt auf ein Arbeitseinkommen angewiesen – ihre Eltern waren in Los Angeles im Filmgeschäft, wie sie gern erwähnte, und sie blieb bei der Group, weil ihr das eine sozial anerkannte Beschäftigung und einen Ort verschaffte, wo sie sich tagsüber aufhalten konnte. Das war prinzipiell in Ordnung. Wir alle hatten unsere Gründe für unsere Zugehörigkeit zur Group. Viele trugen auf finanziell nicht bezifferbare Weise etwas bei. Edil jedoch leistete keinen nicht bezifferbaren Beitrag, es sei denn, einen negativen. Sie mischte sich in die Angelegenheiten anderer Leute ein. Sie verbrachte ihre Zeit damit zu intrigieren. Das war weitgehend harmlos, aber es gefiel mir nicht – und ich mochte sie nicht. Das war ein Gefühl, das ich mir eingestehen musste, wenn ich es jemals überwinden wollte.
Unser Reinigungskalender gab vor, was an einem bestimmten Tag zu erledigen war. Die Teeküche zu putzen, den Abfall hinauszubringen und unseren Betonfußboden feucht zu wischen war eine täglich anfallende Arbeit. Diesmal bestand die Sonderaufgabe darin, die stählernen Deckenventilatoren zu säubern, die sich während der Bürostunden ständig drehten und auf denen sich eine klebrige Schicht aus Staub, Ruß und was nicht noch alles absetzte. Von allen Großstädten östlich des Mississippi hat Pittsburgh die schlechteste Luft. Um einen Ventilator zu säubern, musste man auf einer Stehleiter ganz nach oben steigen und das Gleichgewicht halten, während man mit einem Staubwedel mit langem Griff hantierte. Es war eine Arbeit, die Sorgfalt und Konzentration erforderte. Das, so meine Hoffnung, würde Edil, die den Boden wischte, davon abhalten, mit mir zu reden. Sobald ich ganz oben auf der Leiter stand, beschloss diese Plaudertasche, den Bereich zu wischen, wo ich abstaubte – eine ineffiziente Vorgehensweise, weil mein Staubwedel nach jedem Wischer ihres Mopps weitere schwarze Staubteilchen auf den Boden beförderte, sodass sie erneut wischen musste.
Sie sagte: «Was ist eigentlich mit Wolfe los? Ist er okay?»
Ich sagte nichts. Ich bemühte mich, nicht von der Stehleiter zu fallen.
«Ich mache mir große Sorgen um Pete», sagte Edil. «Er hat drei Kinder, weißt du.»
«Mhm», sagte ich. Dass Edil sich um Pete oder Petes Kinder Sorgen machte, hielt ich für unwahrscheinlich. Als diejenige, die dafür zuständig war, die Weihnachtstrinkgelder für die Angestellten der Gebäudeverwaltung einzusammeln, wusste ich (und nur ich) ganz genau, wie viel Edil gegeben hatte.
«Stimmt es», hörte ich Edil sagen, «dass Wolfe Sonderurlaub bekommen hat?» Sie hatte eine tiefe, klanglich eindrucksvolle Stimme. Vielleicht war es das, was sie befähigte, solchen Unsinn zu reden. «Ich sage nicht, dass das falsch oder richtig ist. Aber einige Leute sind wohl nicht allzu erfreut darüber. Weil nämlich, gibt es eine Bestimmung, die Sonderurlaube vorsieht? Und außerdem, warum belohnen wir jemand dafür, dass er eine Prügelei anfängt?»
Ich stieg die Leiter hinunter. Es war sehr zufriedenstellend, die einen Meter langen Ventilatorflügel schimmern zu sehen. Als ich die Leiter zum nächsten Ventilator schleppte – es gab insgesamt sechs –, folgte mir Edil langsam mit ihrem Eimer. Ich schwitzte, während ich erneut die Leiter hinaufstieg. Ich fing an abzustauben. Ich sagte: «Er hat ein Guthaben von freien Tagen. Keinen Sonderurlaub. Freie Tage.»
Die einzigen Geräusche im Raum waren die, die ich machte. Edil stützte sich auf ihren Mopp und starrte ins Leere. «Willst du nicht mal mit Wischen anfangen, Edil?», sagte ich, wobei ich darauf achtete, freundlich zu lachen.
«Ich habe bloß nachgedacht, Kesha», sagte sie zuckersüß. Sie zog den triefenden Mopp aus dem Eimer.
Danach arbeiteten wir, ohne zu reden. Um zwanzig vor neun ging Edil nach Hause. Dann putzte ich den Boden richtig.
M
Ich bringe die jüngsten ungewöhnlichen Ereignisse mit einem ganz unbedeutenden Vorfall in Zusammenhang, der ihnen vorausging. Im Dezember spazierte ich, tief in Gedanken bei einem künftigen Zeitalter, wie ich es mir ausmalte, eine Straße entlang, als ich im Aufblicken durch die Schaufensterscheibe eines Restaurants eine alte Dame bemerkte, die gierig ein Eis verschlang. Ich bin mir nicht sicher, was mich bewog, stehen zu bleiben. Ich kann nur vermuten, dass es an dem Umstand lag, dass wir Heiligabend hatten, die Temperatur fünfzehn Grad betrug und dass jemand, der an einem warmen Wintertag in Pittsburgh ein Gelato aß, eine Art letzten Strohhalm darstellte. Mehrere Sekunden lang starrte ich ihre lebhafte blaue Zunge an, scheinbar ein Lebewesen, das immer wieder aus seiner Höhle hervorspitzte. Außerdem starrte ich den verwahrlost wirkenden Mann mittleren Alters an, der sich im Fenster spiegelte. Offenbar war es ihm unerträglich, dass sich eine alte Frau Eiscreme schmecken ließ. Ich ging, in jeder Hinsicht angeekelt, weiter. Der einzige Grund für meinen Ekel – muss das noch extra gesagt werden? – war natürlich meine eigene Gehässigkeit.
Also: Ich hatte den Geschmack des Lebens – nicht meines Lebens, das von Liebe berührt war, sondern den des menschlichen Lebens schlechthin – mehr als nur ein bisschen satt. Das zu Ende gehende Jahr, 2014, war ein finsteres gewesen. Ich will die Finsternis gar nicht beschreiben; ich lehne ihre Herrschaft ab. Ich will nur sagen, dass ich Trost darin fand – und, um ehrlich zu sein, trotz der Berührung durch die Liebe immer noch finde –, über die sicher keine tausend Jahre mehr entfernte Zeit zu phantasieren, da unsere Art die Erde nicht mehr bevölkern und endlich ein gewisser Frieden einkehren wird. (Diese Schätzung mag niedrig erscheinen: Schließlich wird Homo sapiens von der Internationalen Union für die Erhaltung der Natur als die am wenigsten gefährdete Spezies eingestuft. Aber alles geht schnell bergab, und die Menschheit ist nur ein flaches Hügelchen, wie uns die Paläontologie lehrt.) Ein flüchtiger Eindruck von dieser glücklichen Zukunft bot sich in der Wildnis der entmilitarisierten Zone zwischen Nord- und Südkorea, wo in Abwesenheit des Menschen neuerlich eine außergewöhnliche Fauna gedieh; und auch in den verstrahlten Wäldern der Sperrzone von Tschernobyl, die stetig wachsenden Populationen von Wolf, Bär, Wildpferd, Elch, Adler, Wildschwein und Luchs Schutz bieten. Für mein verdüstertes Gemüt fungierten diese großartigen natürlichen Nomen als Gegenbegriffe zu Wörtern wie «Enthauptung», «Selbstmordanschlag», «Massenvertreibung», «Massenentführung», «Massenversklavung» und «Massensterben».
Ich muss erklären, was ich mit der Finsternis meine. Ich meine keine bösartige unsichtbare Kraft – keinen großen Widersacher. Ich meine die Dummheit, und zwar nicht die Einfalt und rohe Stumpfheit von ehedem, mit der der Tölpel den Donner der göttlichen Stimme vernahm. Ich meine die moderne Dummheit, will sagen, eine Dummheit, die zweckgerichtet, übertragbar und seltsam gierig ist und überall mit solcher Geschwindigkeit zunimmt, dass ich manchmal denke, es ist nicht das Polareis, das schmilzt, sondern auch irgendein unentdeckbarer Kontinent gefrorener Idiotie. Damit will ich nicht andeuten, dass ich mich über all das erhaben dünke. Das Gegenteil ist der Fall. Ich hatte das starke, hoffnungslose Gefühl, dass ich dabei war unterzugehen. In diesem Sinne trifft es zu, von einem Notfall zu sprechen.
Am letzten Tag des Jahres 2014, als endlich winterliche Kälte eingetreten ist, kommen Sushila und Fizzy am Nachmittag nach Hause und finden mich im Sessel sitzend vor. Ich lese zu meiner eigenen Zerstreuung ein Buch, das ich für Fizzy gekauft habe, die drei Jahre alt ist – William Steigs Dracheninsel.
Irgendetwas in meinem Gesicht beunruhigt meine Frau wohl. «Was ist passiert? Mark?»
Sie schnallt Fizzy los, blickt mir dann über die Schulter auf meinen Laptop, der neben meiner Ausgabe der Dracheninsel aufgeklappt ist. Der Artikel, den ich aufgerufen habe, betrifft – ich bringe es kaum über mich, das zu akzeptieren – das letzte männliche Exemplar des nördlichen Breitmaulnashorns auf der Welt. Dieses Nashorn verbringt seine Tage in einem kenianischen Gehege unter dem Schutz bewaffneter Wachen, weil das Tier ohne diesen Schutz mit Sicherheit von Wilderern getötet werden würde. Man hat ein Verteidigungssystem eingerichtet, zu dem Wachhunde, Wachtürme, Zäune und Drohnen gehören. Ebenfalls in Gewahrsam gehalten werden Tochter und Enkeltochter des Nashorns. Man hofft, dass der alte Bulle eine oder beide besamen wird, sodass das nördliche Breitmaulnashorn noch ein Weilchen erhalten bleibt. Aber diese Hoffnung hat sich noch nicht erfüllt, und die Aussichten dafür stehen nicht gut. Der Bulle ist über vierzig Jahre alt – noch älter als ich. Seine Spermienanzahl ist gering. Er ist nicht mehr stark genug, um die Weibchen kraftvoll zu besteigen, wie es dem Fortpflanzungsverhalten dieser schönen, riesigen Grasfresser entspricht.
Sushila gibt mir einen sanften Kuss auf das linke Augenlid. Sie sagt: «Wie wär’s, wenn ich uns Tee mache», und ich sage: «Danke, das wäre wunderbar», und sie antwortet: «Du bist nicht das letzte Nashorn.» Und weg geht sie, zum Wasserkessel, eine jener winzigen häuslichen Expeditionen, die, zusammengenommen und als ein einziger Weg betrachtet, den großen Treck der Liebe bilden.
Ich will gerade Einwände erheben – ich habe nicht mich mit dem Nashorn, sondern nur das Nashorn mit dem Nashorn identifiziert –, als mir aufgeht, was sie wirklich meint. Sie spricht, nicht zum ersten Mal, von meinem Empfinden, dass unser Zuhause eine Insel und alles außerhalb davon, alles darum herum, ein barbarischer Ozean ist. Diese negative Vorstellung von der Welt, hat Sushila zu bedenken gegeben, sei «vielleicht ein bisschen unrealistisch».
Meine Frau ist ein Mensch, der zum Vergnügen Zbigniew Herbert liest, und ihre Einsichten sind mir kostbar; aber in diesem Punkt lasse ich mich nicht beeinflussen. Die Welt ist verkommen. Sich hinauszubegeben heißt, in ein bösartiges Element einzutreten. Ich verstehe natürlich auch, dass die Rettung schwerlich darin liegt, jeden Tag den ganzen Tag drinzubleiben, wie geborgen und zufrieden auch immer. Die Außenwelt sickert zwangsläufig ein, und das Aufwischen, Abpumpen und Ausschöpfen hat kein Ende. Das Nashorn dringt durch.
Als Sushila mit dem Tee zurückkommt, erzählt sie mir, dass sie eine weitere E-Mail von Faye bekommen hat.
Meine biologische Mutter und ich sind – es gibt keinen besseren Ausdruck dafür – einander entfremdet. Sie hat sich angewöhnt, Sushila E-Mails zu schreiben, in denen es vorgeblich um ihre Enkelin Fizzy geht. Sushila antwortet auf diese E-Mails. Das alles geht für mich vollkommen in Ordnung. Wir leben in einem freien Land, wie wir zu sagen pflegten.
Der Tee ist wie immer ausgezeichnet. Bis ich Sushila kennenlernte, habe ich nie Tee getrunken. Wir trinken nur solchen aus Sri Lanka: Sushila kauft ihn aus irgendeinem romantischen Gefühl der Verbundenheit mit dem Land ihrer Ahnen, das sie noch nie besucht hat. Sie stammt von einer dieser auf Ansichtskarten abgebildeten Frauen mit Korb ab, die strahlend in die Kamera lächeln, während sie auf einem steilen Hang voller Teesträucher arbeiten; jedenfalls versichert uns das Sushilas Mutter, die sich daran erinnert, wie sie ihrer eigenen Mutter Trinkwasser gebracht hat, während diese auf einer ebensolchen Plantage Teeblätter pflückte. Die Bungalows der Pflückerinnen dienen mittlerweile als luxuriöse Touristenunterkünfte. Das erfüllt mich mit einem Zorn, den nicht zu äußern ich mir alle Mühe gebe. In meinem Alter von geschichtlichen Entwicklungen in Wut versetzt und durcheinandergebracht zu werden ist demütigend; und überhaupt hat Sushila erklärt, sie wolle nicht, dass Fizzy in einem wütenden Zuhause aufwächst. Da bin ich voll und ganz ihrer Meinung.
Sushila fährt fort: «Es geht um Geoff.»
Sie spricht von meinem jüngeren (Halb-)Bruder Geoffrey Anibal. Faye ist auch seine Mutter. Geoff hat immer auf der anderen Seite des Atlantiks gelebt und wohnt derzeit in England. Ich bin ihm nur zweimal persönlich begegnet. Geoffs Vater ist ein französischer Gentleman namens Antoine Anibal, mittlerweile verstorben. Laut meinem Dad war «der alte Anibal» ein schrecklich betagter Bursche, ein Methusalem von einem Romeo, der Faye aus Ehrgefühl heiratete, nachdem er sie mit Geoff «angebufft» hatte. Faye lebt in England, in einer Stadt namens Winchester.
«Ich glaube, es ist das Beste, wenn du es liest», sagt Sushila.
«Nein danke.»
Sie leitet Fayes E-Mail an mich weiter.
«Was soll das?»
Sushila antwortet: «Lies sie, lösch sie, egal. Deine Entscheidung. Er ist dein Bruder.»
Um mich zu wiederholen, dies passiert zu einer finsteren, brüchigen Zeit. Die Brüchigkeit, muss ich annehmen, ist die Folge der üblichen, im Lauf von vier Jahrzehnten auf die übliche Weise erlebten Erschütterungen und Schläge, wobei die üblicherweise daraus erwachsende Verhärtung und Schwächung durch eine eigenartige Zerbrechlichkeit auf meiner Seite vielleicht noch verschlimmert wurde. Wer weiß? Wer will es wissen? Wenn eines mich stärker abstößt als die Düsternis draußen, dann ist es die Düsternis drinnen. Nach Jahren tollpatschiger Introspektion bin ich zufällig über privates Glück – Sushila – gestolpert, und seither bin ich der Überzeugung, dass meine große Lebensaufgabe darin besteht, dieses wundervolle Glück wie ein Schatzhüter zu bewahren und zu verteidigen und es keinesfalls durch übermäßige Grübelei zu verspielen. Das ist mein Lebenszweck: ein lebendiges Geschenk ohne Misstrauen anzunehmen; es nicht zu vergeigen. Das ist nicht so leicht, wie es aussieht.
Bald nach der Nashorn-Episode, am 15. Januar 2015, werde ich in ein Handgemenge verwickelt.
Sofern es nicht unvermeidlich ist, arbeite ich von zu Hause aus, im stillen Kämmerlein. Ich verbringe meinen Tag nicht gerne unter der Beobachtung von anderen, ganz gleich wie freundlich sich die Beobachter vielleicht wähnen. Wenn ich dann doch einmal ins Büro gehe, bin ich angespannt. An dem fraglichen Vormittag habe ich einen problematischen Zusammenstoß mit dem Wachmann in der Eingangshalle. Die näheren Einzelheiten dessen, was geschehen ist, tun nichts zur Sache und sind strittig, aber wie auch immer man das Ganze betrachtet, es ist ein sehr bedauerlicher, sehr untypischer Vorfall, bei dem Stimmen und Hände erhoben werden. Zu meiner Verteidigung kann ich anführen, dass ich nicht der Einzige bin, der sich nicht mit Ruhm bekleckert hat. Es gibt einen zweiten Schuldigen. Zum Tangotanzen braucht es zwei, um meinen Dad zu zitieren.
Als ich Sushila von dem bedauerlichen Vorfall erzähle, hält sie es für angebracht, Folgendes zu sagen: «Schatz, du bist im Augenblick sehr angespannt. Mach dir das bewusst und versuche, dich selbst zu schützen.» Dann murmelt sie: «Niemals hätte ich dir diese E-Mail schicken dürfen.»
Diese letzte Äußerung gerät zur verblüffenden Erkenntnis. Sie hat recht: Fayes E-Mail, die ungeöffnet in meiner Mailbox liegt, hat mich in eine unerträgliche Lage gebracht. Sie zu lesen hieße, gegen meine unter nicht geringen emotionalen Kosten aufgestellte Regel des absoluten Nichtkontakts zu verstoßen; die E-Mail ungelesen zu löschen, wie es meiner gewöhnlichen Praxis entspräche, würde freilich gegen eine andere Regel verstoßen – dass Brüder aufeinander aufpassen müssen.
Die Betreffzeile enthält nur das Wort «Geoffrey». Die Inhaltsvorschau lautet:
Liebste Sushila, Geoffrey betreffend hat es einige beunruhigende Entwicklungen gegeben, die
Ich lehne es ab, die Geschichte meines Umgangs mit Faye wiederaufzuwärmen. Aber ich bin davon überzeugt, dass ihr jüngstes Kommuniqué strategisch motiviert ist, wobei die Strategie darin besteht, mich unter dem Vorwand einer Familienkrise in Schlagdistanz zu locken. Es handelt sich bei ihr um einen Menschen, der sich nicht verstehen lässt, ohne dass man die Techniken tierischen Beutefangs in den Blick nimmt. Ich habe über das Thema recherchiert. Tierische Mörder lassen sich grob in zwei Gruppen unterteilen: Lauerjäger und Hetzjäger. Faye gehört zur ersten Gruppe, speziell zur Unterkategorie der aggressiven Mimetiker, die den Buckligen Anglerfisch und die Alligator-Schnappschildkröte umfasst. In Fayes Fall unterstützt das mimetische Signal ihre Ähnlichkeit mit der klassischen Mutterfigur. Der Begriff «Mutter», falls das nicht bereits klar ist, lässt sich nur im strengsten genetischen Sinn auf sie anwenden.
Aus Selbstschutz wie auch aus einem Gefühl brüderlicher Verpflichtung heraus entscheide ich mich für einen Mittelweg: Ich lösche Fayes Mail, aber ich frage Sushila auch, was drinstand. Wir liegen im Bett.
«Sie schreibt, dass sie sich um Geoff Sorgen macht.»
«Was ist los mit ihm?»
«Sie sagt nicht genau, warum.»
Ich gebe einen triumphierenden Laut von mir. «Was habe ich dir gesagt? Sie hält uns den Köder unter die Nase.»
Sushila sagt: «Ich kümmere mich darum. Ich sage dir Bescheid, wenn irgendetwas Wichtiges passiert. Ich möchte nicht, dass du weiter darüber nachdenkst.»
Ich habe meiner Frau gegenüber ein schlechtes Gewissen. Sie kommt bereits tausend und einer Verpflichtung nach, und nun übernimmt sie auch noch die Rolle eines Puffers. Aber ich akzeptiere ihren Vorschlag. Wenn es an diesem Punkt meines Lebens etwas gibt, was ich niemals ablehne, dann ist es ein Puffer.
Sushila erledigt Dinge effizient. Am nächsten Vormittag ruft sie Faye an. Wie sich herausstellt, hat mein Bruder einen Unfall gehabt. Was für einen Unfall oder wie schwer er verletzt worden ist, will er seiner Mutter nicht sagen. Er weicht ihr seit Monaten aus, wie Faye gegenüber Sushila behauptet, und tut sehr geheimnisvoll mit einer geschäftlichen Gelegenheit, über die er sich nicht näher äußern will. Nicht einmal seinen Aufenthaltsort will er verraten. «Alles, was wir wissen», sagt mir Sushila, «ist, dass er auf dem Weg der Genesung ist.»
«Genesung?» Aus irgendeinem Grund sehe ich meinen Bruder mit einer karierten Decke auf dem Schoß in einem Rattanrollstuhl vor mir, während hinter ihm weiße gleißende Alpen aufragen.
«Ach so – und er hat sie um Geld gebeten.»
Ich merke auf. «Wie viel?»
«Fünfzehntausend Pfund. Für sein geheimes Projekt.»
Jetzt muss ich lachen. Wenn es irgendetwas gibt, wovon sich Faye nicht trennen kann, dann ist es ihre Beute. Sie hat nicht einen einzigen Tag ihres Lebens im herkömmlichen Sinne gearbeitet, aber dennoch irgendwie ihr Vermögen gemacht. Als Monsieur Anibal, Geoffs Vater, starb, erbte Faye «Millionen». Jedenfalls laut Dad, der anfing, sie «die lustige Witwe» zu nennen. Sie heiratete bald ein drittes Mal, eine, wie mein Dad behauptete, «kurze, aber zweifellos lukrative Liaison» mit einem ungenannten Griechen. Ironischerweise hat sich Faye nach Dads Tod auch sein Vermögen unter den Nagel gerissen – ein Vermögen, das eigentlich mir zugestanden hätte. Mit Sushilas Hilfe habe ich mir beigebracht, mich nicht mehr damit aufzuhalten. Dad liegt auf dem Calvary Cemetery in Flagstaff, Arizona, in einem Grab, das, als ich es das letzte Mal zu Gesicht bekam, mit einem fröhlich kreiselnden silber- und lilafarbenen Windrädchen geschmückt war. Wer das Windrädchen dort platziert hat, kann ich nicht sagen.
Meinen Bruder anzurufen hat keinen Sinn, selbst wenn ich das wollte (was nicht der Fall ist). Geoff geht nicht ans Telefon, jedenfalls nicht, wenn ich der Anrufer bin. Also schreibe ich ihm eine Nachricht:
Hey. Alles gut? Ich höre Gerüchte.
Dabei belasse ich es. Aufdringlich zu sein wäre sinnlos. Geoff hat noch nie bereitwillig Auskünfte erteilt, was ihn selbst angeht. Seine Finanzen, seine Liebesbeziehungen, seine Arbeit, sein genauer Aufenthaltsort – alles blieb nebelhaft in den Jahren, nachdem er das Studium (in Loughborough, England) abgebrochen und nach Paris gezogen war, über Wasser gehalten von nicht identifizierbaren finanziellen Bojen. Während dieser Zeit wechselten wir gelegentlich Textnachrichten – Witze, Memes – und zu Weihnachten auch Sprachnachrichten. Persönlich gesehen habe ich Geoff das letzte Mal vor fast fünf Jahren, im Sommer 2010, als er mit vierundzwanzig Jahren durch Amerika radelte und hier in Pittsburgh einen Zwischenstopp einlegte. Die Aussicht auf seinen Besuch erfüllte mich mit großer Freude – und Beklommenheit. Eine transkontinentale Solofahrradtour war an sich nicht verrückt, aber für meine Begriffe eben auch nicht direkt normal, auch nicht für einen jungen Burschen ohne Verpflichtungen. Es ließ auf eine Störung, eine Orientierungslosigkeit schließen. Ich machte mir Sorgen, dass ein Forrest-Gump-Typ auf unserer Schwelle erscheinen würde. Und warum hatte er unsere Einladung ausgeschlagen, länger als nur eine Nacht zu bleiben? Wozu die Eile? Ich fragte Sushila nach ihrer Meinung. Erzähl mir mehr von ihm, sagte sie. Wir waren, sechs Monate nach Beginn unserer Beziehung, gerade erst zusammengezogen. Sie wusste noch nicht alles über mich.
Mein armer Bruder! Die ersten fünf Jahre seines Lebens karrte Faye ihn von einer europäischen Großstadt zur nächsten. Ansichtskarten in ihrer Handschrift, die angeblich von «Geoffrey» stammten, erreichten mich aus Monte-Carlo, Positano, Kitzbühel, Santorini. Wollte sie meinen Vater quälen? Als Geoffrey sechs wurde, übergab sie ihn der Obhut seines vierundsiebzig Jahre alten Vaters. Der kleine Junge und der alte Mann lebten in luxuriöser Unordnung zusammen, eine Regelung, die nur dank der Arbeit eines mit im Haus wohnenden kamerunischen Dienstmädchens praktikabel war, wie mir Dad erzählte. Irgendwie machte er Anibals Bekanntschaft und schloss den «alten Knaben» ins Herz, und ich stelle mir vor, dass die gemeinsame Erfahrung, sich um einen Sohn zu kümmern, den Faye verlassen hatte, die beiden miteinander verband. Anibal fiel jedoch der Demenz zum Opfer. Als Geoff elf oder zwölf war, blieb Faye nichts anderes übrig, als ihn wieder zu sich zu nehmen und bei sich in London unterzubringen. Bald darauf flog ich nach England, um die beiden zu besuchen. Das war Dads Idee, nicht meine. Ich hatte beschlossen, mein College-Examen mit einer Reise nach Prag zu feiern, und er sagte: Warum fährst du nicht Geoff besuchen? Und sagst deiner Mom Guten Tag?
Was du von deinem Vater erzählst, gefällt mir, sagte Sushila. Hätte ich doch bloß die Möglichkeit gehabt, ihn kennenzulernen.
Was während meines Besuchs in London geschah, hatte ich ihr noch nicht offenbart. Ich machte mir Sorgen, dass zu viele Hinweise auf Familienverrücktheit sie womöglich verschrecken würden. Doch nun, da ich mit ihr zusammengezogen war, packte ich aus: Meine sogenannte Mutter, die mich über ein Jahrzehnt lang nicht zu Gesicht bekommen hatte, haute binnen einer Stunde nach meiner Ankunft ab. Sie zeigte mir das Haus, dann zog sie ihren Mantel an und verkündete, sie müsse zu einem sehr wichtigen Termin. Mit Make-up, blondem Haar und teuer aussehenden Finger- und Ohrringen sah sie aus wie die Moderatorin einer Nachrichtensendung. Mein Eindruck war, dass sie in Kürze wieder da sein würde. Ihr Termin dauerte vier Tage und Nächte, was genau der Dauer meines Besuchs entsprach. Geoff wurde meiner Obhut überlassen. Wir schafften es, mein Bruder und ich; wir überlebten. Wir aßen Brot, Käse und Frühstücksflocken, die ich an der nahe gelegenen Tankstelle kaufte, und schauten viel Fußball im Fernsehen. Ich hatte in der Highschool Fußball gespielt und verfolgte oberflächlich die englische Premier League. Geoffrey trug jeden Tag und jede Nacht dasselbe Manchester-United-Replica-Trikot – das von Roy Keane mit der Rückennummer 16. Falls er irgendwann einmal die Unterwäsche wechselte, sich die Zähne putzte oder duschte, bekam ich nichts davon mit. Er sagte kaum ein Wort – ich brauchte ein, zwei Tage, um dahinterzukommen, dass Englisch eine Fremdsprache für ihn war. Hinterher schämte ich mich wegen der ganzen Sache. Als ich meinem Dad davon erzählte, äußerte er sich nicht dazu. Er schämte sich ebenfalls.
Er war immer noch von ihr fasziniert, sagte Sushila.
Einige Jahre später kam Geoff nach Pittsburgh geradelt. Er hatte anderthalb Tage Verspätung. Wir grillten in unserem dunklen kleinen Garten, in dem nicht einmal Rucola wächst. Mein Bruder erzählte uns, er habe jahrelang in Paris halbprofessionell Fußball gespielt und sich schließlich damit abgefunden, dass er nicht gut genug sei, um als Spieler den Durchbruch zu schaffen. Die Erfahrung, fuhr er fort, habe sein Wissen über das Spiel vertieft, und – noch wichtiger – er habe das Vertrauen der Pariser Fußballszene gewonnen. Diese Vorteile wolle er nutzen, um als «Fußballvermittler» Karriere zu machen. Es gebe verschiedene Arten von Vermittlern – Spielerberater, Clubvertreter, Talentsucher, Spielervermittler –, und er wisse noch nicht genau, was er werden wolle. Aber er sei zuversichtlich, dass das alles funktionieren werde. Er war euphorisch und optimistisch. Er sei zwar noch jung, und die Branche werde von Typen in den Vierzigern und Fünfzigern beherrscht. Aber seiner Meinung nach werde sich seine Jugend eher günstig für ihn auswirken.
Während Geoff uns das erzählte, mampfte er Unmengen von Essen in sich hinein. Die drei Hamburger, die ich für uns alle gebraten hatte, hatte er sich zusammen mit einem Maiskolben umgehend auf seinen Teller gehäuft; ich musste einen Abstecher zum Kühlschrank machen und die Geflügelwürstchen holen, die eigentlich fürs Frühstück vorgesehen waren. Mitten in der Nacht wurden wir von Geräuschen geweckt: Es war mein Bruder, der in der Küche herumlärmte und sich noch einmal verpflegte. Am nächsten Morgen waren unsere Brombeeren, unser gesamter Käse und zwei Packungen Cracker weg.
Darüber mussten wir lachen. Mein kleiner Bruder radelte achtzig Kilometer pro Tag; er hatte jedes Recht auf einen gewaltigen Appetit. Seine Sportlichkeit hatte etwas Charismatisches, und er war sehr sympathisch und offenherzig, aber auch merkwürdig eindrucksvoll: Wir hörten zufällig, wie er in offenbar fließendem Französisch ein Telefongespräch führte.
Nach seinem Besuch in Pittsburgh blieben wir in Kontakt. Irgendwann kam die Nachricht, dass er tatsächlich in London eine Laufbahn als Berater für Fußballspieler eingeschlagen hatte. Wir telefonierten ab und zu miteinander, und mir fiel auf, dass sein farbloses, neutrales Englisch von einem London-jamaikanischen Argot abgelöst wurde. Das empfand ich als etwas seltsam, da Geoff ein Weißer war, aber was ging es mich an? Wenn er unbedingt übermäßigen Gebrauch vom Vokativ machen wollte, was sollte ich dagegen einzuwenden haben? Wie Geoff redete, war seine Sache. Unterdessen setzte sich sein unstetes Leben fort; jedes Mal, wenn wir von ihm hörten, schien er gerade aus Afrika oder Asien zurückgekehrt zu sein, vermutlich in Geschäften. Die Einzelheiten dieser Reisen behielt Geoff für sich. Alles Gute für ihn, war meine Einstellung. Man muss den Arschlöchern nicht alles auf die Nase binden. Sie meinen es so gut wie sicher nicht gut mit einem.
Ich rechne damit, dass Geoff mir das Lach-Emoticon zurücktexten und damit bestätigen wird, dass es ihm ungeachtet seines Gesundheitszustandes prinzipiell gut geht. Aber Geoff antwortet nicht.
Ich denke nicht weiter darüber nach. Mich beschäftigt anderes. Die Dinge auf der Arbeit haben eine komplizierte Wendung genommen.
Das Gerangel in der Eingangshalle des Büros, das ich zwar nicht verschuldet habe, das aber gleichwohl Selbstvorwürfe bei mir auslöste, ist Gegenstand einer informellen Untersuchung durch die Geschäftsführung geworden. Ich will hier nicht in die ermüdenden, unerheblichen Einzelheiten gehen; Fazit ist, dass offiziell keine Disziplinarmaßnahme ergriffen wurde; inoffiziell hat man mir vorgeschlagen, wie Dirty Harry einen Teil meines Guthabens von freien Tagen abzufeiern. Ich habe den Mund gehalten. Ich habe mir auf die Zunge gebissen.
Als junger, unreifer Mensch hätte ich das niemals getan. O nein – ich hätte mich zur Wehr gesetzt und auf die Konsequenzen gepfiffen. Das war keine Frage von Draufgängertum oder Hochsinnigkeit, sondern hatte, so habe ich das damals wohl wahrgenommen, damit zu tun, dass ich auf einzigartige Weise von den gewöhnlichen Regeln des Schicksals ausgenommen war. Die momentane Situation war ein vorübergehender, schimärenhafter Zustand. Die Zeit hatte ihre Belohnung noch nicht offenbart. Mein Tag würde kommen.
Manchmal gewahre ich ebendiese Vorstellung in den Gesichtern meiner jüngeren Kollegen. Mit jener milden Psychopathie der Jugend können sie nicht umhin, die Welt und die Menschen darin als eine Art ironisches, halbfiktionales Unterhaltungsprogramm zu sehen; und es kann sogar sein, dass sie instinktiv die Gegenwart eines differenzierenden Gottes spüren, der sich ihrer heimlichen Tugenden bewusst ist. Besonders die Männer betrachten mich mit zugleich mitleidloser und mitleidiger Miene. Auf keinen Fall, denken sie, werden sie so enden wie ich und unentwegt Fördermittelanträge für den medizinisch-pharmakologischen Komplex fabrizieren. Sie könnten natürlich durchaus recht haben – und es sei angemerkt, dass ich ihnen allen die Daumen drücke. Ich habe eine gute Vorstellung von ihren Mühen, und ich maße mir ganz sicher kein Urteil über sie an. Ich bin der Letzte, der irgendetwas über selbstverherrlichende kognitive Verzerrungen sagen würde.
Im Lauf des Wochenendes setze ich mich mit meiner Schlappe am Arbeitsplatz auseinander und schmore darin – lasse mich gewissermaßen gar köcheln. Ich haue mich mit meinem treuen Hund Pearson aufs Sofa, lege ihm die Hand auf den Kopf und teile ihm Gedanken mit, die für menschliche Ohren, auch für Sushilas, zu verzagt sind. Sushila bleibt das jedoch nicht verborgen. Man liest nicht Zbigniew Herbert, ohne eine Seele in Nöten nicht zu registrieren.
«Vielleicht ist es gar keine so schlechte Idee, einen kleinen Urlaub zu nehmen», sagt sie.
«Ich habe gerade Urlaub genommen.» Ich muss ihr nicht vorbuchstabieren, dass ich in einer Genossenschaft technischer Redakteure arbeite und kein Gehaltsempfänger mit bezahltem Urlaub bin. Meine Vergütung besteht aus Projekthonoraren (zahlbar zur Hälfte bei Vertragsabschluss, zur Hälfte bei Fertigstellung) plus Erfolgsprämien. Im Wesentlichen ist das Akkordarbeit. Wenn ich nicht arbeite, verdiene ich auch nichts.
«Wir können es uns schon leisten», sagt Sushila. Sie behauptet schon lange, dass mein Blick auf unsere Finanzen zwischen zu großer Euphorie und übermäßiger Negativität schwankt. «Du stehst in letzter Zeit stark unter Druck», sagt sie. «Sei mal nicht so streng mit dir.»
Stehe ich stark unter Druck? Nicht stärker als sonst auch. Obwohl man sagen muss, dass ich die Nachrichten aus der Welt nicht gut verkrafte. In Paris ist gerade ein Raum voller Karikaturisten niedergemäht worden. Offenbar wird das neue Jahr genauso mies wie das vergangene. Wie lange kann das noch so weitergehen? Wann wird es enden?