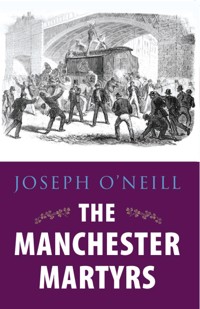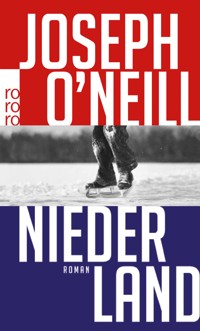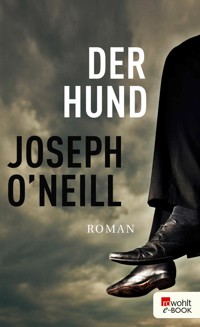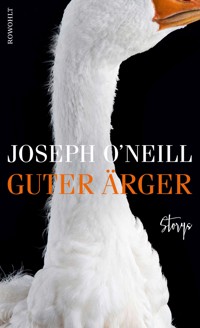
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein einsamer Hochzeitsgast unterhält sich mit einer Gans; zwei Dichter streiten, ob sie sich an einer gereimten "Gnade für Edward Snowden"-Petition beteiligen sollen; ein ängstlicher Ehemann überlässt es seiner Frau, einen Einbrecher zu stellen; ein anderer findet niemanden, der ihm ein Leumundszeugnis zur Miete einer Wohnung ausstellen will. Von bürgerlichen Gesichtshaarmoden bis zu elterlichem Schlafentzug - in diesen dezidiert zeitgemäßen Storys richtet Joseph O'Neill einen scharfen Blick auf unsere Lebensweise im frühen 21. Jahrhundert. Schwankende Stimmungslagen und Denkungsarten stellen die Trivialität, die unterdrückte Gewalt und die bisweilen überraschende Schönheit unseres Lebens zur Schau. Diese brillanten Storys sind voll jäher Volten und schneidendem Witz. Sie transportieren eine anhaltende Verblüffung darüber, dass es uns in der westlichen Welt noch immer so unverdientermaßen gut geht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 212
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Joseph O’Neill
Guter Ärger
Storys
Über dieses Buch
Ein einsamer Hochzeitsgast unterhält sich mit einer Gans; zwei Dichter streiten, ob sie sich an einer gereimten «Gnade für Edward Snowden»-Petition beteiligen sollen; ein ängstlicher Ehemann überlässt es seiner Frau, einen Einbrecher zu stellen; ein anderer findet niemanden, der ihm ein Leumundszeugnis zur Miete einer Wohnung ausstellen will.
Von bürgerlichen Gesichtshaarmoden bis zu elterlichem Schlafentzug- in diesen dezidiert zeitgemäßen Storys richtet Joseph O’Neill einen scharfen Blick auf unsere Lebensweise im frühen 21. Jahrhundert. Schwankende Stimmungslagen und Denkungsarten stellen die Trivialität, die unterdrückte Gewalt und die bisweilen überraschende Schönheit unseres Lebens zur Schau. Diese brillanten Storys sind voll jäher Volten und schneidendem Witz. Sie transportieren eine anhaltende Verblüffung darüber, dass es uns in der westlichen Welt noch immer so unverdientermaßen gut geht.
Vita
Joseph O’Neill wurde 1964 als Sohn eines Iren und einer Türkin in Cork geboren und wuchs in Holland auf. Er studierte Jura in Cambridge und arbeitete als Anwalt in London. Später ließ er sich als freier Autor mit seiner Familie in New York nieder. Für seinen internationalen Bestseller «Niederland» wurde er 2009 mit dem PEN/Faulkner-Award ausgezeichnet, «The Dog» war für den Man Booker Prize 2015 nominiert.
Nikolaus Stingl, geb. 1952 in B.-Baden, übersetzte unter anderem William Gaddis, William Gass, Graham Greene, Cormac McCarthy und Thomas Pynchon. Er wurde mit dem Ledig-Rowohlt-Übersetzerpreis, dem Literaturpreis der Landeshauptstadt Stuttgart, dem Paul- Celan-Preis und dem Straelener Übersetzerpreis der Kunststiftung NRW ausgezeichnet.
Impressum
«Good Trouble» Copyright © 2018 by Pantheon Books, New York
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Januar 2021
Copyright © 2021 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
«Good Trouble» Copyright © 2018 by Joseph O’Neill
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München
Coverabbildung Richard Bailey/Getty Images
ISBN 978-3-644-00222-7
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Gill Coleridge und David McCormick
Begnadigt Edward Snowden
Der Dichter Mark McCain bekam eine an zahlreiche amerikanische Dichter verschickte E-Mail, die ihn aufforderte, eine «Poetition» zu unterschreiben, mit der Präsident Barack Obama gebeten wurde, Edward Snowden zu begnadigen. Die Bitte erfolgte in Form eines Gedichts, das Merrill Jensen verfasst hatte, ein Autor, der, wie Mark wusste, achtundzwanzig Jahre alt war, also ganze neun Jahre jünger als er selbst. In der poetisierten Petition reimte sich «Snowden» auf «am Boden». Und «am Boden» auf «Methoden». Und «Methoden» auf «verboten». Und «verboten» auf «Despoten». Außerdem bestand ein Reim – oder, wie Mark es eher formuliert hätte, ein Widerhall – zwischen «Putin» und «gut schien» sowie «Clinton» und «überwinden». «Russland» fand zumindest einen inhaltlichen Widerhall in «USA», «USA» in «Thoreau» und «Thoreau» einen lautlichen in «Heroe».
Mark leitete die E-Mail an die Dichterin E.W. West weiter. Er schrieb dazu:
Spinne ich, weil mich das wütend macht?
Liz schrieb binnen Sekunden zurück:
Nein.
Sie verabredeten sich für den Nachmittag auf einen Kaffee.
Zur Vorbereitung auf das Treffen versuchte Mark, seine Gedanken zu ordnen. Sein erster Einwand war natürlich, dass schon die Vorstellung eines Gedichts als Petition verfehlt war. Ein Gedicht war in erster Linie ein Ding an sich. Es war definitiv keine Erklärung, die sich auf eine einzige politisch-humanitäre Forderung verkürzen ließ. Dass eine zustimmende Menge oder Masse von Menschen ein Gedicht unterschrieb, erschien wenig sinnvoll: Einem Gedicht konnte man ebenso wenig zustimmen wie einem Baum, sogar wenn man es selbst verfasst hatte. Die Unterzeichner der Poetition würden natürlich argumentieren, dass sie sich dem Petitionsgehalt des Textes anschlössen, nicht seinen formalen Eigenschaften; ohnehin sei die Dichtkunst ein Lichtschwert, das seine Scheide verzehre. Doch selbst wenn man das alles zugestehe, hielt Mark ihnen gedanklich entgegen, warum verfasse man dann eine Petition nicht einfach in Form einer Petition? Warum das Gedicht in den Schmutz ziehen? Weil, könnten die Unterzeichner erwidern, eine in Versform gebrachte Petition wahrscheinlich mehr Aufmerksamkeit errege und wirkungsvoller sei als die Alternative. Worauf Mark antworten würde: Der Nutzen von Gedichten liegt nicht in der –
Er verspürte ein vertrautes dialektisches Schwindelgefühl. Er machte sich auf den Weg zu seiner Bekannten, obwohl das bedeutete, dass er zwanzig Minuten zu früh da sein würde.
Liz wartete schon auf ihn, als er ankam.
Sie umarmten sich. Sobald sie sich gesetzt hatten, fragte Liz: «Und, wirst du unterschreiben?»
Mark sagte: «Ich weiß nicht. Und du?»
Liz sagte: «Nicht mein Problem. Niemand hat mich dazu aufgefordert.»
Mark hielt inne. Das war eine Komplikation, die er hätte voraussehen müssen. Mit übertriebener Bitterkeit sagte er: «Sie werden dich schon noch einspannen.»
«Im Januar habe ich zusammen mit Merrill eine Lesung gemacht», sinnierte Liz.
Mark war bei dem Ereignis dabei gewesen, wie Liz sehr wohl wusste. «Er hat mir leidgetan», sagte er zu ihr. «Du hast ihn wirklich vorgeführt. Natürlich ohne es zu wollen.» Er fuhr fort: «Schau, meiner Meinung nach ist die ganze Sache chaotisch. Im Grunde ballern sie aufs Geratewohl E-Mails raus. Und ich glaube nicht, dass Merrill ein rachsüchtiger Kleingeist ist. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, er hat das Herz auf dem rechten Fleck. Mehr oder weniger. Aber weißt du was? Ich könnte mich auch irren. Offenbar liegt ihm ja an einer bestimmten Art von Erfolg.» An dieser Stelle ließ Mark es gut sein, und er war froh darum, obwohl er Merrill Jensen nicht leiden konnte. Wenn er über einen Kollegen herzog, und sei es aus noch so berechtigten Gründen, bereute er es jedes Mal. (Seltsam, welch erschöpfender Aufwand an Taktgefühl erforderlich war, um durch den Tag zu kommen, ohne über einen anderen Dichter herzuziehen.) In diesem Fall, fand er, hatte er Merrill Jensen nicht den Wölfen zum Fraß vorgeworfen. Er hatte ihn nur niedergemacht, um Solidarität mit Liz zu bekunden, nicht mehr als das.
Liz bezweifelte, dass Merrill sie übergangen hatte, weil er bei der gemeinsamen Lesung von ihr vorgeführt worden war; höchstwahrscheinlich hatte er seiner Erinnerung nach sie vorgeführt. Nein, sie war übergangen worden, weil sie eine Frau war. Jedes Mal, wenn es darum ging, Stellung zu beziehen und die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit zu ertragen, gockelten und quäkten sich die Pfauen en masse in den Vordergrund und sonnten sich in ihrem idiotischen Glanz.
Sie entschloss sich zu sagen: «Wir brauchen Leute wie Merrill. Irgendwem muss daran liegen, prominent zu sein. Sonst würden wir alle verschwinden.»
Mark sagte: «Dylan ist bestimmt angesprochen worden.»
Liz lachte. Der Literaturnobelpreis für den Sänger hatte sie geärgert, ja. Schließlich war Literatur Lesestoff, und Dylans Texte waren größtenteils nicht lesbar – und ohne die Musik nicht einmal anhörbar. Sogar seine angeblich besten Sachen würden verrissen werden, wenn man sie dem Lyrikpraktikum vorlegte, das Liz jeden Dienstag unterrichtete, und zwar nicht nur wegen seiner wortreichen, klischeehaften, hyperaktiven Gestaltung, sondern auch – und noch grundsätzlicher – wegen der Persona des Propheten, die der Sänger so gerne aufbot, ein Kunstgriff, der in einem Popsong wunderbar funktionierte, auf Papier jedoch wie eine Masche wirkte. Abgesehen davon hatte Liz die Nachricht nicht als persönlichen Schlag empfunden. Mark jedoch war wie zahlreiche Männer der Feder, die sie kannte, regelrecht niedergeschmettert gewesen. Zwei Tage lang hatte er es nicht über sich gebracht, seine Wohnung zu verlassen oder auch nur auf Facebook zu posten. Erst nach dieser Trauerzeit war er imstande gewesen, mit Liz darüber zu sprechen, und zwar an ebendem Tisch, an dem sie auch jetzt saßen. Bei diesem Treffen offenbarte Mark, dass er sich am Abend zuvor dabei ertappt habe, wie er an den Siebzehnjährigen zurückdachte, der beim Durchstreifen der Leihbücherei von Forsyth, Missouri, unerklärlicherweise eine zerfledderte Norton Anthology durchblättert und sich zum ersten Mal wirklich dem geheimnisvollen Wortantlitz eines Gedichts gegenübergesehen hatte. Er erinnerte sich noch daran, welches Gedicht so auf ihn gewirkt hatte – komischerweise «Erwachen» von Roethke. Schöpf also die lebend’ge Luft, / Und, Liebste, lern beim Geh’n, wohin es geht, trug er Liz vor. Und in diesem Augenblick habe er sich zu einer herrlichen, ahnungslosen Reise durch die Sprache aufgemacht und sich jahrelang kein einziges Mal einsam oder auch nur eigenartig gefühlt, denn er habe, sagte er zu Liz, jederzeit den Windhauch gespürt, dank dessen die Gedichte, die er lesen und schreiben würde, Anerkennung fänden und sicher auf Höhe gehalten würden, und die Luft der Kultur sei voller solcher Windhauche und Gedichte gewesen. Ja, sagte Liz, ich weiß genau, was du meinst. Bei mir war es Frank O’Hara, sagte sie. Welches?, fragte Mark. «Tiere», sagte Liz, worauf Mark erwiderte: Wir brauchten keine Tachometer, aus Eis und Wasser brachten wir Cocktails zustande, und Liz hätte ihn am liebsten umarmt. Das Blöde ist, fuhr Mark fort, dass es so verdammt schwer ist, den Glauben zu behalten. Und es gibt so vieles, woran man glauben muss. Kannst du das nachvollziehen? Ja, sagte Liz. Mark sagte: Man wird sich bewusst, dass das, was man tut, fast nichts ist. Dass es nur ein paar Atome vom Nichts entfernt ist. Und jetzt, angesichts dieses Skandals, habe ich das Gefühl, dass das, was wir tun, tatsächlich nichts ist. Ich habe das Gefühl, es ist offiziell nichts. Liz erkannte, dass Mark eigentlich vorgehabt hatte, noch mehr zu sagen, aber zu aufgewühlt war, um sprechen zu können. Liz, sie nennen ihn einen Dichter, brachte er schließlich heraus. Weißt du das? Sie nennen ihn nicht Romancier. Sie nennen ihn auch nicht Songwriter. Sie behaupten, er wäre ein Dichter, Liz. Ich weiß, mein Lieber, hatte Liz gesagt.
«Sieht so aus, als nähme er die Auszeichnung nun doch an», stellte sie jetzt fest.
«Natürlich nimmt er sie an», sagte Mark. «Ein Kerl, der so eitel ist? Er hat die ganze Zeit vorgehabt, sie anzunehmen.»
Insgeheim, aber das verriet er Liz nicht, hatte er in den paar Wochen, in denen Dylan auf die Nachricht von der Zuerkennung des Preises nicht reagiert hatte, gehofft, der Sänger würde den schwedischen Clowns sagen, wohin sie sich die Auszeichnung stecken könnten; Bob wäre so redlich, anzuerkennen, dass ein hochgefeierter Multimillionär, der in Konzerten und außerliterarischem Kultstatus macht, nicht das gleiche Spiel spielt wie ein Autor, der sich in einer kleinen Universitätsstadt hinsetzt und ohne Aussicht auf bedeutenden finanziellen Ertrag versucht, sich eine Handvoll Worte einfallen zu lassen, die, wenn nichts dazwischenkommt, maximal hundertvierzig Leser finden, von denen vielleicht zweiundfünfzig sie richtig würdigen und vielleicht sechs sich beeinflussen lassen. Oder eher zwei. Einmal im Jahr warf ein von Stockholm ausgehender, kleiner Strahl der Ehre ein schwaches Licht auf die trüben Bemühungen solcher Autoren. Und nun war ihrer kleinen, dunklen Ecke des Himmels auch noch dieser Schimmer entzogen und wie Talmi in Bob Dylans persönliche Konstellation geworfen worden.
Die siderische Metaphorik bereitete Mark Unbehagen – Sterne waren fast immer kitschig, im Zusammenhang mit einem «Popstar» sogar doppelt kitschig –, aber er hatte nichts anderes. Sprache war ein schwieriges Geschäft. Und die Lyrik, hatte er immer gefunden, war Sprache in ihrer schwierigsten Form.
Diesen Standpunkt hatte er kürzlich seinem Freund Jarvis gegenüber geäußert, der mit kürzeren Prosaformen arbeitete. «Wirklich?», hatte Jarvis gesagt. «Lyrik ist schwierig, klar. Aber gute Prosa ist genauso schwierig, Mann.»
«Was Prosaautoren können, können Dichter im Allgemeinen auch», hatte Mark, leicht beschwipst, erklärt. «Aber der umgekehrte Fall? Nicht so häufig.»
Einen Tag später bekam er eine E-Mail von Jarvis mit einem angehängten Gedicht:
PILLEPALLE
Dass das, was ist,
So bleibt, wie’s ist, das Ganze, liegt, scheint’s, an Physik, was immer
Das ist. Mal sehen: fix fließender Fluss, Lethe, l’été vielleicht,
Viel laicht.
Jeder Frisson, alles, was
Leicht fleucht. Das Feuchte. Das Fleisch.
Er leitete es an Liz weiter:
Was meinst du?
Sie schrieb zurück:
Toll, dass du wieder schreibst! Das ist gut – das Beste, was du seit einer ganzen Weile gemacht hast. So mühelos. «Physik» und «fix» ist eine Freude. Und glaub ja nicht, ich hätte das darin versteckte «ich» nicht bemerkt. In einem Gedicht, das in Materialismus ertrinkt, ist das einfach eine kluge, spielerische Art, die Frage der Subjektivität aufzuwerfen.
Mark meldete sich nicht bei Liz. So wenig wie bei Jarvis.
Was den Nobelpreis für Dylan anging, sagte Liz: «Es ist deprimierend. Ich kann es nicht getrennt vom Phänomen Trump sehen.»
Es war eine Woche vor den Wahlen.
«Ja», sagte Mark. «Und auch nicht vom Hyperkapitalismus. Der Leser als Konsument. Eine interessante Frage.»
Dass er bereits über diese Frage geschrieben hatte, hielt er sogar vor Liz geheim. Es war ein Geheimnis, weil das, was er geschrieben hatte, kein Gedicht war. Seit einigen Monaten arbeitete er heimlich und ausschließlich an einer Reihe von Prosaüberlegungen, die er «pensées» nannte.
Wie leicht pensées von der Hand gingen! Das Schwierigste am Verfassen eines Gedichts war Marks Auffassung nach, sich über die Beziehung des Textes zu dessen eigenem Wissen klarzuwerden, darüber, «welchen Anspruch das Gedicht darauf hat, etwas zu sagen», um aus Liz’ einzigem in eine Anthologie eingegangenen Werk zu zitieren. Bei einer pensée stellte sich ein solches Problem nicht: Man schrieb als Alleswisser. Offenbar – und hier waren Nietzsche, Cioran und vor allem Adorno Marks Meister – bestand der Trick darin, sämtliche erkenntnistheoretischen Schwierigkeiten schlicht beiseitezuschieben und mit Volldampf ins Reich von Behauptung, Meinung und Emphase einzulaufen. Mann, tat das gut. Mit großem Gusto hatte Mark bezüglich des Lesers im Hyperkapitalismus Folgendes aus dem Ärmel geschüttelt:
Eine auf Klassenzugehörigkeit beruhende Unterwürfigkeit verflüchtigt sich zu Recht, doch angemessene Hochachtung – vor Sachverstand, Rationalität und sogar Fakten – verschwindet ebenfalls.
Das ist die Folge eines Zustandes, in dem die eigene Autonomie vorwiegend in der Freiheit, zu konsumieren, besteht. Die objektiven Realitäten werden in Augenschein genommen wie Äpfel im Supermarkt und nur dann akzeptiert, wenn man Gefallen daran findet. Wenn nicht, reicht es nicht aus, den Apfel lediglich zurückzuweisen. Der Apfelbaum selbst muss gefällt werden. Und dann der Obstgarten. Die Hölle selbst kann nicht so wüten wie ein in seiner Bequemlichkeit gestörter Konsument.
Auf diese Weise wird Einkaufen mit Widerstand verwechselt; es herrscht ein unechter Egalitarismus; eine bösartige Mittelmäßigkeit setzt sich durch. Wir erleben die Rückkehr der tricoteuses, die nicht mit Nadeln, sondern mit Touchpads klappern. Muss man noch hinzufügen, dass das Gedicht zu den Ersten gehört, die man zur Guillotine schleifen wird?
Wer hätte geahnt, dass es solchen Spaß machte, dieses Zeug zu schreiben? Am meisten Spaß machte die Stimme – zugleich pedantisch und eindringlich, dazu merkwürdig alt und verzärtelt. Es war die Stimme des leicht erregbaren mitteleuropäischen Professors mit einer Ehefrau, deren wichtigstes häusliches Projekt darin besteht, sicherzustellen, dass ihr Gatte in seinem Arbeitszimmer Ruhe und Frieden genießt.
Mark hatte seit sechs Jahren keine Ehefrau und kein Arbeitszimmer mehr. Liz und er waren sich im Zuge seiner chaotischen Scheidung nähergekommen, als er Hörner aufgesetzt bekam und aus seinem Haus flog. Wie er zu seinem gelinden Entsetzen feststellte, waren seine männlichen Bekannten untaugliche, indiskrete und grotesk erbarmungslose Vertraute. Liz hörte ihm verständnisvoll – und auch ehrlich – zu. Als er zu ihr sagte: Ich bin auf dem falschen Fuß erwischt worden, sagte sie: Ja, vielleicht, und er sagte: Was soll das heißen, vielleicht?, und sie sagte: Footballspieler werden auf dem falschen Fuß erwischt. Du bist nicht auf dem falschen Fuß erwischt worden. Du warst kurzsichtig.
Liz’ Kritik an Marks Lyrik war ebenso einfühlsam und geradeheraus, und dafür war er sehr dankbar und revanchierte sich gern. Ihre Arbeit war nicht so ganz sein Fall – sie war ein bisschen zu akademisch und sexuell –, aber ihre Intelligenz und Sorgfalt standen außer Frage. Jedenfalls misstraute Mark seiner eigenen Arbeit; er befürchtete, damit in einer Sackgasse gelandet zu sein, in der es, wie er einmal Liz gegenüber bemerkt hatte, von den Ratten des Ressentiments wimmelte. Und von den Katzen der Konfusion, meinte Liz. Ganz zu schweigen von den Hunden der Hoffnungslosigkeit.
Wenn Mark sie überhaupt beneidete, dann wegen des wachsenden Ansehens, das E.W. West als Autorin genoss, die das Gefüge von Geschlechterrollen und Sexualität erschütterte. Aber es war nicht Liz’ Schuld, dass ihre biologisch und kulturell bedingten homoerotischen Neigungen gerade en vogue waren, und man konnte ihr auch schlecht zum Vorwurf machen, dass sie in großbürgerlichem Luxus auf der Upper West Side von New York aufgewachsen war. (Mark gegenüber beklagte sie sich häufig darüber, dass sie in Virginia gelandet war, ein Ortswechsel, den sie, wie jeder Leser ihrer «Sappho auf Sizilien» rasch begriff, als Exil erlebte.) Er machte Liz auch nicht zum Vorwurf, dass sie – eine verschwiegene Komplikation ihres biographischen Profils – zum ersten Mal eine Liebesbeziehung zu einem Mann hatte. Er hieß Pickett, offenbar als Hommage an Wilson Pickett. Benannte eigentlich noch irgendwer seine Kinder nach Dichtern? Mark bezweifelte, dass dort draußen in der Welt jemals ein Kind McCain genannt worden war. Und wenn doch, so wäre es mit Sicherheit nach dem politischen Windhund John McCain benannt worden. Von diesem Echo fühlte sich Mark seit langem diffamiert.
Jedes Wort ist ein Vorurteil, wie Nietzsche bekanntlich betont. Man könnte hinzufügen: Jedes Wort schafft ein Vorurteil. Das gilt nirgendwo so sehr wie im Reich der Namen. Der Name eines Menschen ist von seinem guten Namen nicht zu trennen.
Ihm lag sehr viel an Liz, und er war ihr größter Fan und Cheerleader. Dass man wegen der Snowden-Poetition nicht an sie herangetreten war, tat ihm leid.
«Also, was soll ich machen?», fragte er sie. «Unterzeichnen? Das Ding umschreiben?»
«Ah», sagte Liz. «Das Dilemma des Patriarchen.»
Mark bemühte sich um ein mitfühlendes Lächeln. Er sah, dass Liz sauer und gekränkt war, und das aus gutem Grund. Die problematische Lage der Frauen war nicht zu unterschätzen – nicht, dass Liz Gefahr lief, diesen Irrtum zu begehen. In ihrem jüngsten Sonett war das Wort «Mandat» durch den Neologismus «Fraudat» verdrängt worden. Jetzt war Liz, wie sie gern sagte, ladygepisst. Mark hatte dafür volles Verständnis.
Doch einstweilen hatte er sein eigenes Problem, und es juckte ihn, dem Problem in Schriftform nachzugehen. Sie waren mit Kaffeetrinken fertig. Es war Zeit zu gehen.
Die beiden Freunde traten vor die Tür. Es war ein schöner Novembernachmittag. Sie umarmten einander und gingen ihrer getrennten Wege.
Sobald er in seine Wohnung zurückgekehrt war, schrieb er:
Wir schreiben Bertrand Russell die Vorstellung zu, dass es für Bürger einer Demokratie von äußerster Wichtigkeit sei, Immunität gegen Beredsamkeit zu erlangen. Wir sind neugierig auf diese Vorstellung, weil Stevens es war. Und dank Denis Donoghue verbinden wir Russells Aussage mit der folgenden von Locke: «Doch möchte ich erwähnen, dass für die Bewachung und Vermehrung der Wahrheit und Wissenschaft wenig gesorgt wird, seitdem die Künste der Falschheit gepflegt und geehrt werden.»
Wenn wir Russells Worten einen lediglich vorläufigen Wert zubilligen, so können wir fragen: Was ist eine in Verse gefasste Petition anderes als falsche Beredsamkeit? Was ist die Lyrik, wenn nicht eine Entgegnung auf die Kräfte der Falschheit? Was sind diese Kräfte anderes als die Sprache der Macht?
Mark überlegte, ob er erklären sollte, dass Locke mit «Falschheit» «Täuschung» meinte. Er entschied sich dagegen. Der Leser würde von selbst darauf kommen.
Nicht zum ersten Mal fragte sich Mark, wer dieser gedachte Leser war. Er war noch nie, noch kein einziges Mal, einer neutralen Person begegnet, die auch nur von seinen Gedichten gehört, geschweige denn irgendeines davon gelesen hatte. Vielleicht würden seine pensées ihm einen Leser gewinnen, den er physisch berühren könnte.
Er verspürte eine kleine Welle von Übelkeit. Das Gefühl hatte eine gewisse etymologische Berechtigung: Er hatte das Schiff gewechselt. Doch was war die Alternative? Nichts zu schreiben? Es war Monate her, dass er ein Wort Lyrik produziert oder auch nur Lust dazu gehabt hatte.
Mark schrieb:
Wie wenig ich das Schreiben, richtig aufgefasst, mit der Erzeugung von Geschriebenem assoziiere. Je mehr jemand schreibt, desto mehr misstraue ich seiner Qualifikation – als hätte dieser Mensch seine eigentliche Berufung zugunsten des trügerischen Unterfangens, Worte auf die Seite zu setzen, vernachlässigt.
Dann:
Manchmal setze ich mich hin, um zu schreiben, und spüre das innere Vorhandensein von … bösem Glauben. Deshalb sehe ich vom Schreiben ab. Was, andererseits, hieße es, in gutem Glauben zu schreiben? Das klingt noch suspekter.
Er aß ein Käsesandwich mit Senf und Olivenöl. Das war sein Abendessen. Er ging zu seinem Lehnstuhl. Er schrieb:
Es wird allgemein angenommen, dass der Schriftsteller zuvörderst der Sprache verpflichtet sei. Das stimmt nicht. Der Schriftsteller ist zuvörderst dem Schweigen verpflichtet.
Inzwischen war es draußen dunkel. Normalerweise würde der Dichter ein Buch lesen, doch heute Abend fehlte es ihm dazu am Nötigsten. Er machte eine Dose Bier auf und ging online. Eine Zeitlang hüpfte er von Seite zu Seite. Alles drehte sich entweder um die Wahlen oder nicht um die Wahlen. Er checkte seine E-Mails. Nichts Neues. Dann ging er auf Facebook, dann hüpfte er wieder durchs Internet. Er ertappte sich dabei, dass er ohne Interesse, aber mit großer Aufmerksamkeit etwas über Dattelpflaumenfarmer in Florida las. Er checkte abermals seine E-Mails. Hallo, Merrill hatte ihm erneut geschrieben.
Eigentlich hatte Merrill sich selbst geschrieben – Mark war in BCC gesetzt worden. Die E-Mail lieferte «spannende Neuigkeiten»: Es seien Gelder bereitgestellt worden (von wem, sagte Merrill nicht), mit denen für die Poetition eine halbe Seite in der Times finanziert werden könne. Das wird etwas bewegen, stellte Merrill fest.
Marks Reaktion umfasste drei Gedanken. Erstens: «Etwas bewegen?» Zweitens: Was für ein Gauner Merrill Jensen war. Was für ein Maestro der Falschheit. Mark wusste mit Sicherheit, dass Merrill nicht nur Bob Dylans Texte nicht mochte, sondern auch dessen Songs, die er Mark gegenüber – der sie mochte – einmal spöttisch als «Musik für alte Säcke» bezeichnet hatte. Doch kaum wurde der Nobelpreisträger bekanntgegeben, stand der Scheißkerl auch schon an der Spitze der Gratulanten und Befürworter und behauptete, Bob Dylan sei ein nicht anerkannter Gesetzgeber der Welt; ergo sei er ein Dichter. Mark hätte kotzen können: die in ihrer Unehrlichkeit so rechtspopulistische Pseudologik; und die große Lüge, dass es Dylan irgendwie an Anerkennung fehle. Die große Wahrheit – nicht, dass irgendwer sie auszusprechen wagte – war, dass Shelleys Diktum umformuliert werden musste. Dichter waren die nicht anerkannten Dichter der Welt.
Hätte Mark – was nicht der Fall war – zu den unzähligen Schriftstellern gehört, die von den Medien um eine Stellungnahme zu der Preisverleihung gebeten wurden, so wäre er für seine Versgenossen in die Bresche gesprungen. Er wäre den zornigen Online-Barbaren entgegengetreten, die jeden vermeintlichen Dylan-Gegner niedermachten. (Ihre Lieblingsschmähung bestand bezeichnenderweise darin, einem vorzuwerfen, man sei ein «Niemand».) Er hätte festgestellt:
Den Status des Dichters trägt man nicht wie eines jener schönen Festgewänder, das die Empfänger von Ehrentiteln einen einzigen sonnigen, glorreichen Nachmittag lang zur Schau stellen. Nicht einmal Bob Dylan. Wenn es überhaupt so etwas wie ein Dichterkleid gibt, dann ist es ein Plastikponcho zu 4 Dollar 99: zu Modezwecken nicht zu gebrauchen, aber nützlich bei Regen und Kälte. Und in einem Notfall.
Sein dritter Gedanke zur E-Mail von Merrill war, dass sein Name noch nie in der Times erschienen war und dass er das würde, wenn er die Poetition unterschriebe.
Seine Wohnung lag im zweiten Stock eines Hauses im viktorianischen Stil, das der Besitzer nur minimal instand hielt. Es gab ein Schlafzimmer und ein Wohnzimmer mit Küche, ausgestattet mit einem Lehnstuhl, einem Schreibtisch, einer Schreibtischlampe, einem kleinen Sofa und Bücherregalen, die zwei Wände komplett bedeckten. Kein Fernseher. Es gab zwei Fenster. Wenn Mark durch seine Wohnung tigern wollte, bestand seine einzige Möglichkeit darin, zu diesen Fenstern und wieder zurück zu gehen. Das tat er jetzt.
Es war ein Gang, den er schon Tausende von Malen gemacht hatte, und Tausende von Malen hatte er die mit Schindeln gedeckten Dächer der Häuser auf der anderen Straßenseite und hinter ihnen, im Gewerbegebiet der Stadt, zwei braune Glastürme betrachtet. Nachts konnte man jenseits des grellen Lichts der Straßenlaterne direkt vor dem Fenster nicht viel sehen. Und dennoch gab es offenbar ein unauslöschliches Bedürfnis, an eine Öffnung zu treten, die zwecks Licht- und Lufteinlass in eine Wand eingebaut worden war, und durch sie hinauszuschauen.
Dort unten führte irgendwer einen Hund aus. Das war ein Gedicht, gleich da unten: der Herr, die Leine, der fröhliche Hund etc. Aber dieses Gebiet war bereits abgedeckt. Da gab es zunächst einmal das Gedicht von Nemerov; und das von Heather McHugh mit einer der großartigsten Hundezeilen überhaupt – Inspekteur von Zwickeln. Ein Gedicht von Mark McCain hieße Wasser in ein Gefäß gießen, das schon voll war: überflüssig.
Er schaute weiter hinaus, was ebenfalls ein Gedicht war – ein Gedicht über die eigenartige Wahrnehmung dessen, der zum Fenster hinausstarrt. Das Gedicht würde für das Fenster leisten, was Theoretiker für die Schwelle geleistet hatten: Es würde der Vorstellung der Schwellenerfahrung die Vorstellung der Fenstererfahrung beigesellen. Er würde es nicht schreiben. Die automatische metaphorische Assoziativität von «Fenster» wäre einfach zu viel. Er könnte natürlich mit den Assoziationen spielen. Aber es gab doch bestimmt Besseres zu tun, als mit den Assoziationen von «Fenster» zu spielen.
Er kehrte zu seinem Stuhl zurück und schrieb in weniger als einer halben Stunde ein Gedicht, das von seiner vorherigen Arbeit abwich. Das Gedicht maskierte sich als Anmerkungen zu einem möglichen Gedicht. Es trug den Titel «Meditation darüber, was es heißt zu schreiben?» Es lautete wie folgt:
Problem: «Meditation darüber» ist ein Klischee.
«Was es heißt» ist ein Klischee.
Die bloße Vorstellung eines Problems, Doppelpunkt, ist ein Klischee.
«Die bloße Vorstellung» ist ein Klischee.
«Klischee» empfindet man als Klischee.
Genau wie «empfindet man».
Und «genau wie».
Dito Anführungszeichen.
Dito «dito».
Er schrieb Merrill nicht zurück. Er setzte seinen Namen nicht unter die Poetition.