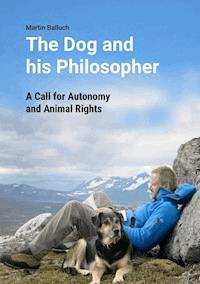14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Promedia
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Ausgehend von der engen Beziehung zu seinem Hund, entwickelt Martin Balluch in seinem Werk "Der Hund und sein Philosoph" eine leicht lesbare Tierrechtsethik, die im zentralen Begriff der Autonomie gipfelt. Er rekonstruiert die Kulturgeschichte der Mensch-Tier-Beziehung und die Rolle der Aufklärung für die Abwertung von Tieren. Der Blickwinkel der modernen Naturwissenschaft macht immer deutlicher, wie sehr die Gefühlswelt von Tieren, die Kulturfähigkeit von Tiergemeinschaften und letztlich die Autonomie der Tiere bislang unterschätzt wurden. Wechselt man Immanuel Kants Definition von Autonomie in eine Form bewusster statt rationaler Entscheidungen und ersetzt "Vernunft" durch "Bewusstsein" ergibt sich ein Recht auf Autonomie, das auch für Tiere gilt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 405
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Martin Balluch Der Hund und sein Philosoph
© 2014 Promedia Druck- und Verlagsgesellschaft m.b.H., Wien
Lektorat und Gestaltung: Stefan KraftCovergestaltung: Gisela Scheubmayr
ISBN: 978-3-85371-824-7(ISBN der gedruckten Ausgabe: 978-3-85371-377-8)
Fordern Sie unsere Kataloge an: Promedia Verlag Wickenburggasse 5/12 A-1080 Wien
E-Mail: [email protected]
Für Kuksi, Hiasl und Stella
Über den Autor
Martin Balluch, geboren 1964 in Wien, studierte Philosophie, Mathematik und Astronomie und arbeitete zwölf Jahre als Universitätsassistent in Wien, Heidelberg und Cambridge. Seit 1997 ist er beim Verein Gegen Tierfabriken engagiert und im Zuge eines 14-monatigen Prozesses in den Jahren 2010–2011 wegen Bildung einer angeblich kriminellen Organisation im Tierschutz zu Österreichs bekanntestem Aktivisten avanciert. Im Jänner 2012 erhielt er den internationalen Myschkin-Preis für Kultur und Ethik in Paris. Im Promedia Verlag sind von ihm bisher erschienen: »Widerstand in der Demokratie. Ziviler Ungehorsam und konfrontative Kampagnen« (Wien 2009) sowie »Tierschützer. Staatsfeind. In den Fängen von Polizei und Justiz« (Wien 2011, 2. Auflage 2014, als E-Book erhältlich).
Inhalt
Vorwort
Vor genau 10 Jahren habe ich meine Dissertation in Philosophie an der Universität Wien zu Tierrechten verfasst. Es war mir ein großes Anliegen, dieses Thema in einer seriösen und wissenschaftlichen Weise in die akademische Welt zu tragen. Wenig gab es damals zu diesem Komplex an den Universitäten zu hören. Doch vieles hat sich seitdem getan. Mittlerweile sind die Human-Animal-Studies etabliert und Tierrechte sind in der Philosophie und auch in der Biologie kein Fremdwort mehr.
Im Jahr 2008 schlug eine Gruppe maskierter Personen mitten in der Nacht die Türe zu meiner Wohnung ein, hielt mir im Bett Schusswaffen an den Kopf und strahlte mich mit Scheinwerfern an. Es war die Polizei. Ich sei verdächtig, Chef einer kriminellen Organisation zu sein, die eine Tierrechtsrevolution plane. Für 105 Tage verschwand ich im Gefängnis. Meine Dissertation, die mittlerweile sogar in Buchform erschienen war, wurde bei der Hausdurchsuchung beschlagnahmt. Letztlich wurde ich wegen ihr sogar angeklagt, Vordenker für kriminelle TierschützerInnen zu sein.
Heute bin ich endgültig rechtskräftig in allen Punkten freigesprochen. Lange nach diesem Urteil gab man mir die letzten beschlagnahmten Gegenstände zurück, darunter meine Dissertation. Sie brachte auch das Rektorat der Uni Wien dazu, mir ein allgemeines Redeverbot in ihren Räumlichkeiten aufzuerlegen. Auf meine Anfrage hin wurde mir mitgeteilt, ich sei ein Sicherheitsrisiko. Wenn ich sprechen würde, könne nicht garantiert werden, dass meine ZuhörerInnen nicht zu randalieren beginnen.
Was für einen Sprengstoff müssen meine Gedanken denn haben, um zu solchen Reaktionen zu führen? Oder haben die Mächtigen in unserer Gesellschaft so viel zu verlieren, wenn wir Tiere ernst nehmen und ihre Autonomie respektieren würden? Als ich das Gefängnis verließ, nahm ich mir vor, wieder einen Hund aus einem Tierheim bei mir aufzunehmen. So lange in einer Zelle zu sitzen machte mir bewusst, wie schrecklich es ist, unschuldig seiner Freiheit beraubt zu werden. Ich fand meinen neuen Freund Kuksi im Tierparadies Schabenreith in Oberösterreich. Er war 2 Monate davor an einer Autobahnraststation ausgesetzt worden. Für uns beide begann ein neues Leben.
Das ist mehr als 6 Jahre her. Wir sind sehr eng zusammengewachsen und unzertrennlich. Unsere Freundschaft hat mich dazu inspiriert, dieses Buch zu schreiben. Im täglichen Zusammenleben ist es mir selbstverständlich, dass Kuksi fühlt und denkt und autonom handelt. Wie könnte das irgendjemand bestreiten?
Als Naturwissenschaftler habe ich zusätzlich zu unseren persönlichen Erlebnissen auch viele Fakten zusammengetragen, um Kuksis Forderung nach Autonomie in unserer Gesellschaft umfassend vorbringen zu können. Immanuel Kant, so hieß es in einer Vorlesung über Tierethik an der Veterinärmedizinischen Universität Wien im Jahr 2008, habe zurecht behauptet, dass Tiere nur Sachen seien. Und er war einflussreich, unser Zivilrecht ist bis heute nach seinen Gedanken formuliert. Dieses Buch stellt Kants Sittenlehre in Zweifel und nützt seine Argumentationsweise, um auch für Tiere Rechte und einen Personenstatus zu fordern. Ich denke, mit dem heutigen Wissen über Tiere ist diese Schlussfolgerung unumgänglich.
Ich hoffe, dieses Buch hat eine nachhaltige Wirkung. Aber keine, die mir neuerliche Verfolgung durch die Behörden einbringt.
Wien, im August 2014Martin Balluch
Editorische Anmerkung:
Ich habe mich bemüht, meine Standpunkte anhand von meinen eigenen, lebensnahen Beobachtungen mit Kuksi und Hiasl zu verdeutlichen. Dennoch war es unumgänglich, auf eine Vielzahl an Literatur aus diversen Wissenschaftsbereichen zurückzugreifen, um meine Argumente zu untermauern. Deswegen werden in diesem Buch etliche ForscherInnen und AutorInnen genannt, die vielen LeserInnen unbekannt sein dürften. Nicht in allen Fällen wurde deren Herkunft und Disziplin angeführt, sondern nur das Erscheinungsjahr ihrer Veröffentlichung in Klammer hinter den Namen gesetzt. Ich hoffe, diese (notwendige) wissenschaftliche Nomenklatur trübt nicht den Leseeindruck. Am Ende dieses Buches habe ich alle erwähnten Werke angeführt, sodass sich die/der interessierte LeserIn weiter in die Thematik vertiefen kann.
Danksagung
Mein Dank gilt zu allererst meinem lieben Hund Kuksi für seine Freundschaft und Liebe, und seine unendliche Geduld während des Schreibens dieses Buches. Ich freue mich schon auf viele Wochen und Monate mit dir in der Wildnis!
Ich möchte mich auch bei Estella Kubek bedanken, die mich unterstützt und aufgebaut hat. Vielen Dank für die wertvollen Kommentare zu den einzelnen Kapiteln.
Danke auch an Paula Stibbe, die mir Hiasl vorgestellt und das Kapitel über ihn kommentiert hat.
Dank an unsere Menschenaffen Hiasl und Rosi für die gemeinsame Zeit und ihre Freundschaft, obwohl sie mehr als genug Gründe gehabt hätten, Menschen zu hassen.
Bedanken will ich mich zudem bei Birgit Deutsch und der Tierarztpraxis Hirschstetten in Wien, die uns durch die dramatischen Monate der Chemotherapie von Kuksi begleitet und dabei viel geholfen haben.
Danke an Eberhart Theuer und Stefan Traxler für die Hilfe beim gemeinsam ausgefochtenen Sachwaltschaftsprozess für Hiasl, sowie an Eva-Maria Maier, Stefan Hammer, Volker Sommer und Signe Preuschoft für ihre hervorragenden Gutachten.
Vielen Dank an den Promedia Verlag für seine Unterstützung und an Stefan Kraft für das Lektorat.
Mein Dank gilt auch dem VGT als meinem Arbeitgeber, dass er mir das Schreiben des Buches ermöglicht hat.
Danke an Kurt Kotrschal, der mir das Wolf Science Center gezeigt und mich durch seine Vorträge zu diesem Buch inspiriert hat.
Vielen Dank an alle WissenschaftlerInnen, die sich in nicht-invasiver Forschung für Hunde und Schimpansen interessieren, insbesondere jene, die dafür ihre Zeit im Dschungel verbringen. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass sie ihr wertvolles Wissen weitergeben.
Und nicht zuletzt möchte ich mich bei all jenen bedanken, die sich für Tiere und Tierschutz engagieren, oder die ihr Leben auf eine pflanzliche Ernährung umgestellt haben. Ihr gebt mir die Hoffnung, dass es eines Tages doch zu einem fundamentalen Umdenken der Menschheit gegenüber Tieren und zu einer Multi-Spezies-Gesellschaft kommt!
Einleitung
Ich liebe die Natur. Und damit meine ich nicht, dass ich gerne durch städtische Parks gehe, Bücher über Naturschutzgebiete lese oder auf ausgetretenen Pfaden klassische Berggipfel besteige. Nein, ich kann nicht leben, ohne immer wieder in die Wildnis zu gehen, so oft es sich ausgeht. Und ich suche möglichst unberührte Wälder, die keine menschlichen Spuren zeigen, ich verlasse Wege und weiche Berghütten aus. Ich gehe in die Arktis in Nordskandinavien oder verbringe Wochen in den Wäldern der Südkarpaten. Der innere Drang in der Natur zu sein ist so groß, dass ich um die 100 Tage pro Jahr aus meinem beruflichen und sozialen Alltag abzweige, um die Wälder, die Berge oder die Tundra zu betreten. Einen Besuch kann man das schon fast nicht mehr nennen, es ist eher ein Nach-Hause-Kommen. Jeden Tag, den ich nicht in der Natur verbringe, empfinde ich als einen verlorenen Tag.
Eigentlich, hätte ich gedacht, ist dieses Verlangen für einen Primaten wie mich das Normalste auf der Welt. Für das Erklettern von Bäumen sozusagen gemacht, d. h. evolutionär adaptiert, ist zu erwarten, dass ich das dringende Verlangen verspüre, es auch tun zu wollen. Und tatsächlich geht es mir so. Einmal durfte ich für einige Wochen am europäischen Kernforschungszentrum CERN bei Genf arbeiten. Das Erste, was ich bei meiner Ankunft tat, war, einen Baum im Campus zu erklettern. Jener Wissenschaftler, der mich gerade durch das Gelände führte, schaute sehr verwirrt drein. Aber von meinem Standpunkt aus verstehe ich überhaupt nicht, wie man ohne Bäume zu erklettern, ihre Rinde zu riechen, auf ihren Ästen zu liegen und ihre Strukturen mit den Händen zu greifen, leben kann. Ich könnte es nicht, wie ich nur zu gut in meiner Zeit im Gefängnis am eigenen Leib verspürte. 105 Tage wurde ich – unschuldig, wie später auch das Gericht bestätigte – in Untersuchungshaft genommen. 105 Tage Beton und Neonlicht, keine einzige grüne Pflanze, nicht einmal im Gefängnishof. Das war für mich die schlimmste Zeit meines Lebens.
Doch zumindest unter den Menschen meiner sozialen Umgebung liege ich mit diesem Verlangen außerhalb der Norm. Ich werde es zwar nie begreifen, aber den meisten anderen Menschen scheint die Natur im Sinne einer Lebenswelt für sie kaum abzugehen. Das konnte ich an jenen Personen beobachten, mit denen ich die verschiedenen Zellen während meines Gefängnisaufenthalts teilte. Kaum jemand, der, wie ich, am mangelnden Zugang zur Natur litt. Die Wildnis war für sie hauptsächlich negativ konnotiert, als etwas Kaltes, Unwirtliches, Unangenehmes, Mühsames, Nasses, Ungeschütztes. Dagegen wurde die warme Zelle als ein vergleichsweise angenehmer Ort erlebt. Als ich das einzige Mal in meinen 105 Tagen Aufenthalt aus der Gefängnisbibliothek drei Bücher zum Lesen bekam, die alle von der Wildnis handelten, stellte mein Zellennachbar voller Überzeugung fest, dass er lieber hier eingesperrt sitze, als auf 80 Grad nördlicher Breite im Franz-Josef-Land in einer winzigen Hütte zu wohnen. Mir ging es genau umgekehrt.
Dieses Natur-Defizit-Syndrom (Louv 2008) begegnet mir aber auch außerhalb der Gefängnismauern auf Schritt und Tritt. Viele Menschen zieht es überhaupt nicht in die Natur, sie sind mit einem Bildband oder einem Film darüber zufrieden. Andere gehen gerne wandern, aber nur auf breiten Wegen ohne Mühsal, maximal von Hütte zu Hütte. Und jene, die außerhalb der touristischen Bereiche unterwegs sind, scheinen die Berge mehr als Sportgerät statt als ihren Lebensraum zu betrachten. Touren sind nur interessant, wenn sie auf schwierige Gipfel, über Gletscher, vereiste Wasserfälle oder senkrechte Felswände führen. Im Wald zu wandern und dort tagelang zu verbleiben, im Dickicht ohne Wege, im Zelt ohne Hütte, ist ein Minderheitenprogramm.
Der Hauptgrund dafür dürfte in der Bequemlichkeit liegen. Wenn man ohne Schutz im Regenguss steht, lernt man ein Dach über dem Kopf so richtig zu schätzen, wenn die Insekten beißen, wirkt die Abschottung von der Natur durch dichte Fenster ideal, wenn in der Hitze die Wasserquelle ausbleibt, ist ein Wasserhahn ein Segensbringer, und wenn man durchs Dickicht kriecht, träumt man von einem asphaltierten Weg. Doch das ist zu kurz gedacht. Wer alle diese Errungenschaften der Zivilisation besitzt, schätzt sie nicht mehr. Kein Wunder, dass im luxuriösen Umfeld die Depression grassiert.
Ich möchte meinen Körper spüren. Ich will vom Regen nass werden, vom Dickicht zerkratzt und von Wasser- und Nahrungsmangel herausgefordert. Die stechenden Insekten brauche ich nicht unbedingt, aber für das Erleben der Wildnis nehme ich sie gerne in Kauf. Tatsächlich fühle ich mich pudelwohl, wenn ich im Regen ohne Zelt und Schlafsack am Waldboden die Nacht verbringe, oder im Schneesturm eine Schlafhöhle grabe. Dann erst bin ich am Leben, alles andere wirkt eher wie eine Fantasie, wie eine Seifenoper im Fernsehen.
Dieser Zugang zur Natur eröffnet mir aber auch einen anderen Blickwinkel auf Lebewesen. Kein Wunder, wenn Menschen von ihrem Sofa aus die Tiere im Wald, die sie am Fernseher sehen, als grundsätzlich anders empfinden. Hier Kultur, dort Natur. Sie selbst könnten ohne technische Hilfen gar nicht überleben, die Tiere da draußen wirken hingegen wie geschaffen für ein Überleben in der Wildbahn. Wie schnell entsteht so der Eindruck einer unüberbrückbaren Kluft, die eine völlige Andersbehandlung rechtzufertigen scheint. Wenn ich dagegen im Regen im Wald liege, begegnet mir der Fuchs in Augenhöhe. Er und ich haben die gleichen Probleme, und die sind ganz andere, als diese Wesen auf ihren Sofas hinter Doppelglasscheiben vor dem Fernseher beschäftigen. Wir haben Hunger, diese anderen müssen eher darauf achten, nicht zu dick zu werden, wir bekämpfen die Kälte, diese anderen haben das Problem, durch zu viel Heizen das Klima zu zerstören, wir überlegen uns, wie wir die nächsten Stunden weiterkommen, diese anderen langweilen sich zu Tode und suchen verzweifelt irgendwelche Formen der Unterhaltung, um die Zeit totzuschlagen. Kein Wunder, dass von meinem Blickwinkel aus der Unterschied zwischen Mensch und Tier völlig verschwimmt.
Ich bin ein Wildtier. Müsste ich mich entscheiden, auf welcher Seite ich stehe, dann für den Wald, als Tier unter Tieren. Und das ist ein tiefes, inneres Gefühl, kein intellektuell erarbeitetes Weltbild, keine rationale Absage an die Zerstörungswut und Gewalt in der Gesellschaft und kein Wegschieben meiner Verantwortung für das, was die Menschheit in der Natur angerichtet hat. Letzteres ist es ja, was mich immer wieder dazu bringt, in die Städte zurückzukehren. Die Überreste von Urwald und unberührter Natur sind zu klein geworden, als dass ich mich dort verkriechen könnte und so tun, als hätte es die letzten 20.000 Jahre Menschheitsgeschichte nicht gegeben.
Von jenen Menschen, die, wie ich, die Wildnis suchen, denken allerdings die meisten wie der Abenteurer und vielfache Buchautor Nicolas Vanier. Er schwärmt nicht nur von den PelzjägerInnen, die mit Metallfallen Wildtieren auflauern, um ihre Felle zu verkaufen, sondern er ist ebenso auf seine 2-jährige Tochter stolz, wenn sie knöcheltief im Blut eines erschossenen Elchs steht und dabei keinerlei empathische Regung zeigt. Mitgefühl sei etwas für die Weichlinge in der Zivilisation, so Vanier, draußen in der Wildnis würden andere Gesetze gelten, da heiße es töten oder getötet werden, da sei Mitleid hinderlich und eine fehlende Anpassungsleistung an die Gegebenheiten. Seltsam nur, dass er diese Ansicht nicht auf Menschen in der Wildnis ausdehnt. Entweder diese sind auch Wildtiere, und rechtfertigen so ihre Gewalt gegenüber Tieren, dann müsste es aber auch vertretbar sein, den nächsten Wanderer zu erschlagen, um an seine Reserven zu kommen. Oder die Menschen stehen außerhalb dieses Geschehens und damit außerhalb der Gesetze der Wildnis, wie Vanier sie begreift. Demzufolge sind ihre Grundrechte zu respektieren, aber dann können sie auch nicht das Recht des Stärkeren bemühen, um ihre Blutspur durch die Natur zu begründen. Entweder das Eine oder das Andere.
Die Wildnis als Ort der rohen Gewalt nimmt im menschlichen Denken eine politische Funktion ein. Am bekanntesten ist vermutlich die Betonung des angeblichen Schreckens des Naturzustandes in Thomas Hobbes’ Behemoth, in dem der Kampf aller gegen alle dargestellt wird und nur durch eine staatliche Zivilisation überwunden werden kann. Vom »survival of the fittest« und »nature red in tooth and claw« schreibt auch Richard Dawkins in seinem Buch The Selfish Gene (Dawkins 1976). Und der wegweisende deutsche Philosoph Immanuel Kant (1724–1804) sieht sogar eine moralische Verpflichtung des Menschen darin, sich von der Natur loszusagen und in der menschlichen Gemeinschaft zu organisieren, um Freiheit erst zu ermöglichen. Die Wildnis sei ein ständiger Kampf ums Überleben, grausam, brutal, kurzlebig. Heute merken wir diese feindliche Einstellung zur Natur daran, dass Nutztiere in Tierfabriken weggesperrt und Haustiere, wie Hunde, aus immer größeren Bereichen der Gesellschaft verdrängt werden. Das bürgerliche Bedürfnis nach Sauberkeit, im physischen wie im psychischen Sinn, umfasst eine Distanzierung von Tieren, eine Abgrenzung der Zivilisation von der Natur.
Mein Erlebnis in der Natur ist ganz anders als die Schilderungen von Kant und Hobbes vermuten lassen. Von den unzähligen Tagen, die ich draußen verbracht habe, kann ich jene Vorfälle, in denen ich Gewalt und Leid sah, an den Fingern einer Hand abzählen. Wie oft beobachtete ich Gämsenherden friedlich grasen, Steinbockkinder fröhlich spielen, Bärenfamilien durchs Unterholz streifen, Füchse in der Sonne liegen, Dachse im Boden wühlen und Raben im Paarflug durch die Luft rauschen. Keine Gewalt, sondern schiere Lebensfreude, soziale Beziehungen, Vertrauen, Kooperation. Die tägliche Aktivität der Wildtiere wirkt befriedigend, symbiotisch und partnerschaftlich. Das Sozialleben ist fast ausschließlich friedlich, die Kämpfe zwischen Steinböcken oder Hirschen sind ritualisiert und haben in meiner Erfahrung immer ohne Verletzungen geendet.
Jonathan Balcombe geht in seinem lesenswerten Buch Second Nature (Balcombe 2010) auf diese Aspekte ein. Er meint, die Darstellung der Gewalt in der Natur sei in Dokumentarfilmen, die die öffentliche Meinung bestimmen, total übertrieben, sie würden sich auf blutrünstige Szenen fokussieren, weil diese mehr Aufmerksamkeit erregen. In Wirklichkeit aber ist die Anzahl der Raubtiere in Ökosystemen viel geringer als die ihrer potenziellen Opfer, sodass solche Szenen im Durchschnitt sehr selten sind. Und es träfe hauptsächlich ganz junge Tiere, oder kranke bzw. alte. Fitte Erwachsene könnten sich sicher fühlen und seien bei der Flucht ihren Raubtiergegnern generell überlegen. Viele Tiere würden in der Natur sehr alt werden, so etwa Eisbären mit einem Alter von bis zu 32 Jahren und Narrwale mit stattlichen 115 Lebensjahren.
Sozial lebende Arten bekommen wenige Kinder, kümmern sich aber um diese intensiv. Und oft wurde beobachtet, dass kranke und behinderte Tiere überleben können, weil ihre Familien und Gruppen ihnen helfen. De Waal (2013) berichtet von einem Rhesusaffenmädchen mit Down-Syndrom, das in seiner Gruppe wildlebender Primaten nicht nur toleriert, sondern auch gefüttert und gepflegt wurde. Und in den Japanischen Alpen wurde ein körperlich schwer behinderter Makake gesichtet, der kaum gehen und schon gar nicht klettern konnte, aber ein langes Leben führte und fünf Kinder großzog. Ohne die Hilfe seiner sozialen Umgebung wäre das nie möglich gewesen. Die Populationskontrolle geschieht durch mangelnde Fruchtbarkeit bei geringerem Nahrungsangebot, oder durch eine Re-Absorption des Fötus im Bauch der Mutter, viel seltener durch Gewalt. Parasiten haben sich evolutionär zu einem symbiotischen Zusammenleben mit ihrem Wirtstier entwickelt, weil sie mit dem Tod ihres Wirts selbst sterben müssten. Aus dem Umstand, dass viele Tiere, wie der Pfau, Extravaganzen entwickeln, kann man ableiten, dass ihnen das Überleben normalerweise leicht fällt. Die Tiere in der Wildnis stünden nicht ständig im Überlebenskampf, meint Balcombe, sondern haben auch viel freie Zeit für Spiel und Sozialleben. Friedliche Kooperation statt Gewalt bestimme das Geschehen.
Ich sehe das auch so. Auch meine Einstellung gegenüber anderen Tieren in der Natur ist durch Mitgefühl bestimmt und das ist keine Kulturleistung, sondern eine natürliche, weit verbreitete Veranlagung. Einmal wanderte ich als Alpinlehrwart mit einem zahlenden Gast nach erfolgter Durchsteigung einer Kletterroute über eine Hochebene. Als wir über einen Bergrücken kamen, trafen wir auf ein großes Gämsenrudel, das, durch unser überraschendes Auftauchen erschreckt, in alle Himmelsrichtungen auseinander lief. Rasch zogen wir uns hinter einen Felsen zurück, um nicht weiter zu stören. Von dort aus konnten wir die Gämsen beobachten. Ein Kind war durch den Vorfall von seiner Mutter getrennt worden. Es lief laut rufend von einer zur anderen Gämse, fand sich aber nicht zurecht. Die Mutter, auf der anderen Seite des Hanges, schrie und suchte ebenfalls verzweifelt. Wir beide, meine Begleiterin und ich, hatten spontan ein starkes Mitgefühl mit Mutter und Kind und waren zutiefst erleichtert, als sie sich wieder vereinten. Wer könnte sich solchen Gefühlen schon verschließen?
Es gibt noch eine andere Seite meines Lebens, die Mathematik und die Philosophie. 12 Jahre lang habe ich als Universitätsassistent für mathematische Physik an den Universitäten von Wien, Heidelberg und Cambridge gearbeitet. Meine Dissertation in Philosophie wurde auch in Buchform herausgegeben (Balluch 2005). Dabei handelt es sich um eine tierethische Analyse mit Mitteln der Mathematik und auf Basis naturwissenschaftlicher Erkenntnisse. Dieser abstrakt-intellektuelle Zugang zur Welt komplementiert mein unmittelbares Naturerleben.
So kam ich auch in Berührung mit Immanuel Kant, der als zentraler Philosoph der Aufklärung bis heute die Diskussion über Ethik dominiert. Das Zivilrecht, das das Zusammenleben der Menschen in unserer Gesellschaft und ihr Verhältnis zu Tieren regelt, basiert auf seinem Gedankengut. Er hat sich das Verdienst erworben, eine von der Religion unabhängige Metaphysik zu entwickeln bzw. zu entdecken. Doch er hatte keinerlei Naturerfahrung, zeit seines Lebens kam er aus Königsberg nicht heraus. Ich behaupte, das unmittelbare Erleben der Wildnis kann Impulse liefern, die die künstlich-kalte Mensch-Tier-Dichotomie bei Kant zu überwinden helfen. Für Kant war die Natur etwas, was der Mensch transzendieren muss, um zu sich selbst zu finden. Ich plädiere dafür, das wilde Tier in uns wieder zu finden, und sich nicht davor zu fürchten. Es ist nicht durch Gewalt, sondern durch Kooperation und Mitgefühl bestimmt.
Für Kant stand die Freiheit des Menschen im Mittelpunkt seiner Metaphysik der Sitten. Moralisches Handeln hieß für ihn, die Autonomie aller anderen nach Möglichkeit zu respektieren. Kants Ethikkonzeption ist nicht daran orientiert, das Leiden von Menschen zu minimieren, ganz im Gegensatz dazu, wie beim Tierschutz gegenüber Tieren vorgegangen wird. Die autonome Entscheidung ist im Prinzip zu beachten, selbst wenn sie mehr Leid bedeutet. Doch einen Menschen zu berauben oder zu töten, um vielen anderen zu helfen, ist grundsätzlich ausgeschlossen. In heutigen Gesetzen ist diese Moral in Form von Grundrechten verankert, die vor einem utilitaristischen Umgang schützen sollen. Darunter sind im Wesentlichen die Rechte auf Leben, körperliche Freiheit und Unversehrtheit zu verstehen. Sie spannen das Recht auf, die eigene Autonomie ausleben zu können.
Aber auch bei meiner Betrachtung der Natur ist Autonomie der zentrale Begriff. In der Pelzfarm werden Wildtiere, wie Nerze und Füchse, in Drahtgitterkäfige gesperrt. Man versorgt sie dort mit ausreichend Nahrung und Trinkwasser und sie sind vor anderen Raubtieren geschützt. Sie müssen nicht jagen gehen und könnten den ganzen Tag zufrieden herumliegen. Doch die Pelztiere brechen, wenn sie es können, aus ihren Käfigen aus. Sie versuchen alles, um in Freiheit zu gelangen. Sie beißen sich durch die Gitterstäbe oder sie laufen überraschend davon, wenn der Käfig geöffnet wird. Im Waldviertel in Niederösterreich lebt bereits seit Generationen eine Population amerikanischer Nerze, die ursprünglich aus Pelzfarmen stammen. In England haben sich die aus Pelzfarmen entflohenen Nerze bereits so etabliert, dass sich die Tradition entwickelt hat, sie mit speziellen Hunderudeln zu jagen.
Durch ihre Flucht stimmen die Pelztiere aus den Farmen mit ihren Füßen ab, für Autonomie statt einem »bequemen Leben«. Sie wollen lieber den Stress der Freiheit in der Wildnis erleben, lieber hungern müssen, verfolgt werden, dem Regen ausgesetzt sein usw., als im Käfig vor sich hin zu vegetieren. Ich kann diese Einstellung nachvollziehen. Auch ich setze mich lieber den Unannehmlichkeiten und Gefahren der Natur aus, als am Sofa zu liegen, wobei natürlich das Leben eines Menschen in der Zivilisation mit dem eines Pelztiers in Farmkäfigen nicht zu vergleichen ist. Aber ich klettere lieber in der Felswand, mit allen Risiken, die damit verbunden sind, als mich im geschützten Haus zu langweilen. Mir ist intuitiv Autonomie wichtiger als Bequemlichkeit und Schutz.
Und damit dürfte ich nicht alleine dastehen. Die Frauenbewegung, insbesondere um 1900 und ab den 1950er- bis zu den 1990er-Jahren, forderte ebenfalls Autonomie. Die Frauen waren vielleicht durch ihre Ehemänner gut versorgt und mussten nicht einer Lohnarbeit nachgehen, aber sie konnten weder über ihr eigenes Leben, noch über die Politik im Land bestimmen. Die Forderung der Frauenbewegung bestand darin, Autonomie zu bekommen, aber im Gegenzug für ihren eigenen Unterhalt zu sorgen und sich in der Gesellschaft eigenständig durchsetzen zu müssen. Es mag mühsamer sein, für sich selbst gerade zu stehen, aber das ist die Voraussetzung für Freiheit und Autonomie. Und heute ist weithin anerkannt, dass diese Ziele der Frauenbewegung berechtigt waren.
Bei meinen Wildniseskapaden haben mich über Jahrzehnte hinweg immer wieder Hunde begleitet. Ich habe bei ihnen dieselbe Leidenschaft und dasselbe Feuer gespürt, wie in mir. Was aber die Wildnis in der Begleitung von Hunden auszeichnet, ist, dass wir uns dort als Gleiche begegnen können. Zwei autonome Wesen, die aufeinander Rücksicht nehmen, aber grundsätzlich gleichberechtigt sind. In der Natur sind uns Menschen die Hunde in vieler Hinsicht überlegen. Hatten sie in ihrer Jugend ausreichend Freiheit, um ihre Persönlichkeit zu entfalten, brauchen sie uns in der Wildnis nicht mehr. Hier können sie für sich selbst sorgen und sogar, umgekehrt, uns beraten und helfen. Deshalb sind meine Touren durch die Arktis mit meinem Hundefreund der Ausgangspunkt in diesem Buch, um mich einer Neudefinition des Mensch-Tier-Verhältnisses zu nähern.
Autonomie bei Hunden? Für viele Menschen ist das ein Widerspruch. In der städtischen Welt führt man Hunde an der Leine, hängt ihnen einen Beißkorb um und gibt ihnen Kommandos. Hunde müsse man kontrollieren, sie seien potenziell gefährlich. Und insbesondere auf der Straße könne man ihnen nicht vertrauen, die Verkehrsregeln würden ihre beschränkte Intelligenz übersteigen. Seltsam, leben doch insbesondere in den Außenbezirken der Städte überall Marder, Füchse und sogar Dachse, ohne dass sie ständig überfahren werden. Wer solche Ansichten und einen Hund hat, dem bzw. der würde ich dringend empfehlen, einmal in die Wildnis zu gehen. Eine Woche lang mit dem Zelt ohne menschliche Spuren unterwegs zu sein wird diese Meinung ändern. Hunde sind in Wahrheit unglaublich selbstständig und, wenn gut sozialisiert, sehr kooperativ und friedlich. Es ist nicht notwendig, sie zu kontrollieren oder ihnen einE RudelführerIn zu sein. Hunde sind sozial eher wie Menschen, sie wollen in egalitären Gruppen leben und selbst entscheiden können, schließen sich aber gerne der Meinung erfahrener Individuen an. So jedenfalls funktionieren Wolfsrudel und Menschenfamilie.
Für Menschen, die der Natur und den Tieren völlig entfremdet sind, wirken Hunde manchmal bedrohlich, wie tickende Zeitbomben. Mangels Sprache sei es nicht möglich herauszufinden, was in ihnen vorgeht. Abgesehen davon hätten Tiere keine Moral und wären deshalb unberechenbar. Besser, sie werden möglichst aus der menschlichen Gesellschaft ausgesperrt. Zumeist reduziert man sie in der Wahrnehmung zu instinktgetriebenen Robotern oder zu behavioristischen Reiz-Reaktions-Maschinen. Hunden sei jederzeit jede Gewalttat zuzutrauen.
Auch bei dieser Denkweise würde ich einen Besuch in der Wildnis empfehlen, um die Realität zu erfahren. Weder handeln Menschen nur rational und vernünftig, noch sind Hunde völlig irrational und unvernünftig. Wenn ich mit meinem Hundefreund in der Wildnis unterwegs bin, verstummt bald die Stimme in meinem Kopf. Ich denke, ohne zu sprechen – wie die Hunde auch. Entscheidungen, in welche Richtung wir als nächstes weitergehen, wo wir unseren Lagerplatz aufschlagen oder welche Route durch die steilen Felsen die sicherste ist, werden ohne Worte getroffen. Abgesehen davon kommunizieren wir ständig und verstehen uns sehr gut. Die Hundeseele ist für mich keine fremde Welt, zumeist kann ich sehr klar nachfühlen, was mein Freund gerade empfindet und umgekehrt. Wir können uns blind aufeinander verlassen. In der Natur wird uns letztlich klar, dass wir gar nicht so verschieden sind.
Aus diesem Zugang heraus ergibt sich ein ganz anderes Weltbild. Die Aufklärung hat den Menschen in den Mittelpunkt gestellt und es ist zweifellos ein großartiger Fortschritt, alle Menschen als Gemeinschaft aufzufassen. Doch die Gemeinsamkeit wurde durch die Abgrenzung von den Tieren erkauft, zu deren Leidwesen. Wir müssen uns fragen, ob dieses »wir« nicht erweiterbar ist, ob nicht neben multiethnischen Gesellschaften auch echte Multi-Spezies-Gesellschaften eine Zukunftsoption wären, die die Lebensqualität aller Beteiligten erhöht. Mein Buch will dieser Frage nachgehen.
KAPITEL 1: Kuksi und ich
Wir waren schon länger in der skandinavischen Tundra nördlich der Baumgrenze unterwegs, jetzt haben wir uns für eine ausgiebige Rast auf das kurze Gras gelegt. Alles ist ruhig und entspannt, kein Schlechtwetter in Sicht, es ist angenehm kühl. Plötzlich kommt die Sonne hinter den Wolken hervor und brennt auf uns herab. Diese unmittelbare Hitze weckt mich und ich hebe den Kopf. Direkt neben mir liegt Kuksi und macht genau dasselbe. Wo ist der nächste Schatten, denke ich mir, und sehe etwa 20 Meter entfernt einen größeren Felsblock. Also stehe ich auf, Kuksi genauso. Ich gehe direkt auf den Felsen zu und Kuksi, wie auf Kommando, neben mir her. Im Schatten angekommen lege ich mich wieder nieder und Kuksi macht gleichzeitig genau dasselbe. Kuksi ist mein Hundefreund, mit dem ich schon seit Tagen in der Wildnis unterwegs bin.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!