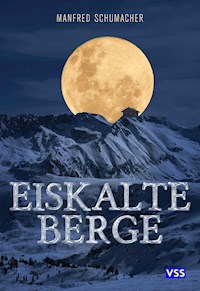6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: vss-verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die Heilerin Gunde schließt sich auf der Flucht vor Ordensmönchen, die ihr geheimnisumwittertes Medizinbuch beanspruchen, und vor einem rachsüchtigen Vogt dem Kinderkreuzzug von 1212 an. Sie triff auf drei kampferfahrende Mönche und eine kleine Gruppe Hübschlerinnen, die den Kreuzzug in Planwagen begleiten und ihre Liebesdienste anbieten. Als der Jungmüller Norwin, der ebenfalls vor Häschern auf der Flucht ist, zum Kreuzzug stößt, spitzen sich die Ereignisse zu. Norwins Bogenschießkünste und die außergewöhnlichen Schwertkünste der Mönche sorgen dafür, dass sie den langen Weg bis nach Speyer unbeschadet überstehen. Nach Speyer jedoch eskalieren die Ereignisse, nachdem Gunde einen der Hurenwagen als Lazarett nutzen darf. Vor der Kulisse des höchstwahrscheinlich stattgefundenen Kinderkreuzzugs von 1212 entwickelt der Autor eine Geschichte um ein ominöses Medizinbuch, dessen Krebsrezepturen moderne Chemotherapien vorwegnehmen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 398
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Der Hurenwagen
Historischer Roman
Titel
Der Hurenwagen
Historischer Roman
Manfred Schumacher
Impressum
Copyright: vss-verlag, Frankfurt am Main
Jahr: 2021
Lektorat/ Korrektorat: Chris Schilling
Covergestaltung:
Verlagsportal: www.vss-verlag.de
Gedruckt in Deutschland
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publi-kation in der Deutschen Nationalbibliografie
Das Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheber-rechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verfassers unzulässig
PROLOG
In der Mitte des Raums stand ein niedriger, grob gezimmerter Tisch. Darauf lag eine Matratze aus Stroh, von der Halme an einigen Stellen durch die Leinennähte hervorschauten. Die Frau mittleren Alters setzte sich mühsam darauf. Sie verzog, als sie sich setzte, vor Schmerzen das Gesicht, und ebenso, als sie zuerst das eine und dann das andere Bein auf die Unterlage hob. Sie legte sich stöhnend auf den Rücken und wartete gespannt. Die andere Frau, deutlich jünger als sie, trat hinzu und streifte ihr den langen Rock bis zum Bauchnabel hoch. Die freiliegende Scham hob sich im schummrigen Licht der Kammer als dunkles Dreieck von der hellen Haut der Liegenden ab.
„Ich werde dich jetzt untersuchen. Hab keine Angst“, sagte die Frau.
„Ja, Herrin“, entgegnete die Liegende. Ihr Gesicht war hohlwangig und strahlte eine Müdigkeit aus, die mit ihrem Leiden zu tun haben mochte.
„Ich bin keine Herrin, nur eine Heilerin. Eine einfache Heilerin“, entgegnete die Stehende lächelnd. Sie trug über ihrem Rock eine weit fallende Leinenschürze. Ihr langes, wallendes Haar, das die Farbe frischer Kastanien hatte, trug sie verknotet unter einem hellen Tuch, das ihr tief in der Stirn saß.
„Ich muss mit der Hand in dich hinein. Es tut ein bisschen weh. Außerdem sind meine Hände etwas kalt“, sagte sie mit einem flüchtigen Lächeln. Sie tastete zuerst sorgsam den Bauch der Kranken an mehreren Stellen ab. Sie bat sie, sich auf die Seite zu drehen, dann auf den Bauch. Sie drückte konzentriert am Rücken und am Becken. Dann musste sich die Kranke wieder auf den Rücken legen. Sorgsam führte die Kastanienrote ihre Finger in die Scheide der Frau ein. Die Liegende stöhnte und biss auf die Zähne. Nach vielen Herzschlägen richtete die Heilerin sich wieder auf und suchte den Blick der Liegenden.
„Dein Unterleib hat sich gesenkt. Deshalb verlierst du Urin, wenn du dich anstrengst, und verspürst ständig einen Druck auf der Blase. Daher kommen auch die Schmerzen beim Wasserlassen. Auch deine Entzündung an der Scheide und das Geschwür hier.“ Sie deutete auf eine Stelle zwischen dunklem Haar. Die Kranke reckte, mit ihrem Blick dem Finger der Heilerin folgend, den Kopf instinktiv nach vorn. Wegen der hochgeschlagenen Rockschöße konnte sie aber nichts sehen. Sie legte den Kopf zurück aufs Laken und sah die Heilerin abwartend an.
„Deine schweren Rückenschmerzen und Beschwerden beim Arbeiten kommen auch daher“, führte die Kastanienrote weiter aus. „Ich werde dir einen halben Granatapfel einsetzen und damit deinen Beckenboden heben“, erklärte sie weiter.
„Einen Granatapfel?“ Die Augen der Kranken weiteten sich und sie schaute die Heilerin erstaunt und verunsichert an. Sie kannte Granatäpfel nicht, hatte nur davon gehört. Sie wusste aber, dass Granatäpfel irgendwelche Früchte waren, und eine solche sollte jetzt in ihr Geschlecht hinein.
„Nur keine Angst“, wehrte die Heilerin beruhigend ab. „Ich hab das schon mehrmals gemacht und es hilft wirklich. Schon mein Lehrmeister hat es praktiziert, der es wiederum von seinem Lehrer, einem arabischen Chirurgus, wusste.“
Das schien die Kranke ein wenig zu beruhigen. Sie nickte als Zeichen ihrer Zustimmung. Ihre Augen schauten aber weiter gespannt und folgten argwöhnisch den Bewegungen der Heilerin. Die Kastanienrote nahm, ohne sich weiter um die Kranke zu kümmern, von einem Regal ein Messer und ging damit zur Feuerstelle. Sie hielt die Klinge eine Zeitlang über das Feuer, ging zu einem anderen Regal und holte eine rote Frucht, ähnlich einem Apfel, aus einem irdenen Topf. Sie teilte sie in zwei Hälften. Eine Hälfte bearbeitete sie mit dem Messer. Dann kam sie zum Lager der Kranken zurück.
„Leider wird es jetzt richtig weh tun“, bereitete sie die Liegende vor. Sie drückte ihr vorsichtig ein Beißholz zwischen die Zähne. „Damit du dir nicht in die Zunge beißt“, sagte sie erklärend. Die Kranke nickte angestrengt. Ihr Blick war voller ängstlicher Vorahnung. Die Heilerin führte ihre Finger mit der halben Frucht ein. Nach einer für die Patientin quälend langen Zeit war es endlich geschafft. Die Frau auf dem Lager hatte Schweißtropfen auf der Stirn, die ihr die Heilerin mit einem Tuch behutsam abtupfte.
„Du warst sehr tapfer“, sagte sie anerkennend und strich der Frau mitfühlend über die Stirn. Sie half ihrer Patientin, sich aufzurichten. Vorsichtig und abwartend kam sie hoch, saß zunächst für wenige Momente auf der Kante und setzte dann ihre nackten Füße auf den Boden auf, um sich ganz aufzurichten. Sie horchte nach innen und wartete auf den Schmerz. Dann leuchteten ihre Augen und sie sagte der Kastanienroten freudestrahlend, dass sie sich besser fühlte. Überschwänglich, wenn auch in einfachen, bescheidenen und wenig geschmeidigen Worten dankte sie ihrer Wohltäterin und ein Gefühl von Erleichterung spiegelte sich in ihrem Gesicht.
„Ach ja, da ist noch was“, sagte die Heilerin. Schon war sie an einem Regal, griff sich einen Krug und entfernte den Holzpfropfen, der ihn versiegelte. Sie entnahm ihm mit einer kleinen Küchenschaufel, ebenfalls aus Holz, eine Handvoll Kräuter. Die Kräuter wanderten in ein kleines Leinensäckchen, um das sie einen Hanffaden als Verschluss band. Im nächsten Augenblick war sie wieder bei der Frau, der sie das Säckchen in die Hand drückte. „Das ist eine Mischung aus Raute und ein paar anderen Kräutern.“ Sie sah die Frau vielsagend und ein wenig verschwörerisch an. „Koch die Kräuter und gib den Sud deinem Mann zu trinken. Misch ihn am besten in eine Suppe oder Grütze. Das nimmt ihm die Manneskraft und er lässt dich die nächste Zeit in Ruhe.“
Sie nickte ihr aufmunternd zu. Die Frau stutzte zuerst. Dann begriff sie und lächelte verschämt - aber auch dankbar. Nach einer kurzen Verlegenheitspause verfinsterte sich plötzlich ihre Miene. „Ich – ich kann Euch leider keine Pfennige geben“, stotterte sie, als ihr dieser Teil der üblichen Gepflogenheit einfiel. Ihr Blick wanderte verlegen zu Boden, suchte aber rasch wieder die Augen der Heilerin. „Ich bringe Euch die nächsten Tage frische Eier, ganz bestimmt“, beeilte sie sich zu sagen. „Wenn unsere Hennen gut legen“, fügte sie mit einem kurzen Hochziehen der Schultern und hilflosen Lächeln einschränkend hinzu.
Die Heilerin Gunde legte ihr beruhigend die Hand auf die Schulter. „Alles gut, Hannah, alles gut. – Mach dir keine Gedanken!“
„Pfennige haben wir momentan nicht, wisst Ihr.“ Hannah ließ sich nicht beruhigen. „Mein Mann – er -.“ Sie stockte und machte eine hilflose Bewegung.
Gunde fasste Hannah an beiden Schultern, um sie zu beruhigen. Sie kannte Hannahs Mann und wusste um ihre Sorge, den Kindern das Notwendigste geben zu können. In dem Moment klopfte es aufgeregt an der Tür. Gunde entschuldigte sich mit einem erklärenden Blick bei ihrer Patientin und ging zur Tür. Sie hatte den Riegel vorgeschoben, wie sie es immer bei Behandlungen tat, und öffnete. In der Türöffnung stand ein Mädchen, zehn bis zwölf.
„Was willst du?“, fragte sie.
„Du musst kommen, Heilerin, schnell!“
„Wer bist du, Kleine? Was gibt es?“
„Meine Mutter schickt mich“, antwortete das Mädchen hastig. „Sie arbeitet für die Familiaren im Laienhof am Roten Hang.“
Gunde schaute das Mädchen fragend an, das sofort kapierte. „Meister Hildebrandus. Es geht ihm schlecht.“ Gunde erschrak. Hastig wandte sie sich ihrer Patientin zu. „Hannah, ich muss leider rasch fort, aber wir sind ja auch erst mal fertig. Schau bitte nach spätestens zwölf Nächten wieder vorbei.“ Hannah nickte eifrig. Gunde begleitete sie zur Tür und verabschiedete sie.
„Komm, lass uns gehen“, sagte sie zu dem Mädchen, das geduldig und stumm im Türeingang wartete. Sie war schon auf der Schwelle, als ihr einfiel, die für sie wichtige Frage zu stellen. „Was fehlt ihm?“
„Er hat den Schlagfuß, sagt die Mutter“, entgegnete das Mädchen. Sie schaute neugierig zu Gunde hoch, weil sie auf ihre Reaktion gespannt zu sein schien. Die zeigte so gut wie keine. Statt einer sichtbaren Regung packte sie eilig zwei Tiegel in einen Korb. Dann gingen sie.
„Und du bist?“
„Agneta.“
„Gut, Agneta, dann lass uns schnell gehen!“
Sie eilten etliche Meilen an Weinbergen, Hecken und Wiesen vorbei. Die Mosel verschwand rasch aus ihrem Blickfeld. Sie tauchte in der Talsenke erst wieder auf, als sie Trier erreichten. Wenig später erklommen sie am Kalenfels eine kurze Anhöhe, um nach einer Weile auf eine Lichtung zu gelangen. Von dort ging es in südwestlicher Richtung am nicht zu übersehenden Getreidespeicher und an der Pauluskirche vorbei. Nach kurzem Weg sahen sie die Dachspitzen des Irminenklosters. Dann waren sie am Laienhof angelangt. Hildebrandus war in einem schlechten Zustand. Er war schwach. Das rechte Bein und die Hand waren gelähmt. Er konnte nur mit Mühe sprechen, die Wörter kamen undeutlich heraus. Trotzdem erkannte er die Frau, die in die Kammer eingetreten war, sofort.
„Gunde – du hast es – geschafft“, artikulierte er lallend. „Nicht – viel – Zeit“, ergänzte er vielsagend. Die Anstrengung, Lippen und Zunge zu bewegen, um mit widerspenstigem Mund Wörter zu formen, war ihm ins Gesicht geschrieben. Sie nickte. Tränen kullerten ihre Wangen runter und sie wischte sie rasch weg.
„Wie - lange - her?“, kam es schleppend aus seinem Mund.
Sie nickte erneut. „Jahre“, antwortete sie mit einem eher schmerzlichen Lächeln.
Diesmal nickte er und lächelte, während ihn die Erinnerung einholte. „Jah-re“, sagte er gedehnt. Sein Kopf hob und senkte sich zur Bestätigung. Zwei Kleriker aus dem nahen Kloster waren zugegen, um ihm in seiner Sterbestunde geistlichen Beistand zu geben. Zwei Frauen saßen stumm in einer Ecke. Eine davon, wohl Agnetas Mutter, hatte der Kleinen dankbar zugenickt, als sie neugierig hinter Gunde in der offenen Tür gestanden hatte. Nach einer weiteren knappen Geste der Frau hatte sie die Kammertür von außen geschlossen.
Einer der Mönche stimmte leise die Bußpsalmen an. „Herr! Strafe mich nicht in Deinem Grimme, und züchtige mich nicht in Deinem Zorn. Erbarme Dich meiner, o Herr, denn ich bin schwach. Heile mich, o Herr, denn meine Gebeine sind vor großem Schmerz ganz zerschlagen“, begann er. Sein unterdrückter Singsang, mit einer für einen Mann hohen Fistelstimme vorgetragen, brach sich an den lehmverkleideten Wänden und machte die Situation im Raum noch bedrückender. Ein weiterer Mönch wollte den Kranken noch nicht kampflos allein der Fürbitte seines Glaubensbruders überlassen. Er hantierte an einem Beutel und packte Aderlassbinde und –eisen aus. Gunde versperrte ihm den Weg, als er an das Lager von Hildebrandus herantreten wollte.
„Wer bist du Frau, dich mir in den Weg zu stellen?“, fuhr er sie entrüstet und zugleich erstaunt an.
Hildebrandus signalisierte ihm mit seiner gesunden Hand, nahe an sein Gesicht zu kommen. „Kein - Aderlass. Hör auf - sie. - Sie weiß -.“ Seine Worte brachen ab. Erschöpft sank er auf sein Lager zurück.
„Ihr hörtet es. Er will es nicht“, fauchte Gunde den Mönch an.
„Er ist nicht mehr bei Sinnen. Ich muss entscheiden, was für ihn richtig ist.“ Er wollte, ohne sich weiter um Gunde zu kümmern, die Binde am Arm von Hildebrandus anbringen. Doch sie schlug ihm die Hand weg, schob ihn fort und stellte sich schützend vor Hildebrandus. „Er sagte doch – kein Aderlass!“, herrschte sie ihn an.
„Was wagst du dich – Weib!“, keifte der Mönch entrüstet und trat einen Schritt auf sie zu.
Flink fischte sie einen Tiegel aus ihrem Korb und entfernte den Holzpfropfen. „Geht, geht sofort – oder -! Ich schwöre es Euch. Ich schütte Euch dies hier über.“ Sie hielt ihm den Tiegel drohend unter die Nase. „Es zerfrisst alles, was es berührt. Eure Wangen und Nase zerschmelzen im Nu bis auf die Knochen und Ihr lauft für den Rest Eures Lebens mit einem hässlichen Totenschädel herum. Wollt Ihr das?“ Ihre Augen funkelten ihn so böse an, dass er erschrocken zurückwich.
„Was weiß denn eine Kräuterfrau von Heilkunst. Er leidet unter überflüssigen und verdorbenen Säften. Sein Blut ist giftig, und dagegen hilft nun mal Aderlass und tüchtiges Schwitzen.“ Er starrte sie mit großen, forschenden Augen an. „Außerdem ist der Zeitpunkt günstig, denn gerade erst haben die Tage des abnehmenden Monds begonnen.“
„Ich bin Heilerin und keine Kräuterfrau“, entgegnet Gunde. „Und ich weiß mehr als ein Tonsor, der sonst im Kloster den Mönchen Tonsuren und Bärte rasiert. - Ihr geht jetzt besser!“ Sie deutete auf die Tür. „Nicht seine Säfte sind krank. Sein Kopf ist krank. Da hilft weder Schwitzen noch Aderlass.“ Erneut wies sie zur Tür. Die beiden anderen Mönche schauten dem Ganzen erschrocken zu. Der Tonsor zog widerwillig ab und warf ihr, bevor er die Tür von außen schloss, einen letzten giftigen Blick zu.
Gunde schwenkte herum in Richtung der Mönche, um den Tiegel zurück in ihren Korb zu packen. Die Mönche wichen erschrocken zurück, der wieder aufgenommene Bußpsalmgesang brach jäh ab. „Keine Angst!“, grinste Gunde. „Da ist nur in Öl getränkte Raute und Petersilie drin.“ Sie packte den Tiegel weg. „Ich dachte, die Gicht hätte Euch vielleicht befallen.“ Sie sagte es in Richtung von Hildebrandus. „Dann hätte ich Euch einen guten Kräuterverband daraus gemacht. Leider ist es nicht so einfach.“ Sie blickte ihn mit trauriger Miene an. Er lächelte nur schwach. Es folgte eine kurze Pause. Dann machten beide Mönche mit den Bußpsalmen weiter. Hildebrandus winkte Gunde zu sich heran. Er drückte ihr dankbar die Hand.
„Das Fach – im Boden“, begann er keuchend. „Das – da-s Brett – unter der K-Kerze. – Lose!“ Er bedeutete ihr mit einer Bewegung der Hand, dorthin zu gehen, um nachzuschauen. Sie schob den Eisenständer mit der Kerze zur Seite, bückte sich und fasste das Brett an. Tatsächlich, es war lose und ließ sich leicht anheben. Erstaunt nahm sie einen in ein Ledertuch gehüllten Gegenstand an sich und kam damit an Hildebrandus´ Lager zurück. Sie zeigte ihm ihren Fund. Er drehte leicht die Hand. „Auf -“, formten seine Lippen. Sie faltete das Tuch zur Seite.
„Euer Buch – Euer Heilbuch!“, sagte sie erstaunt.
Er nickte. „Für – dich.“
„Aber Meister Hildebrandus! – Ich bin doch nur – ich war doch nur -“.
Er unterbrach sie, indem er seine gesunde Hand mit aller verbliebenen Kraft auf ihre Hand legte, die das Buch hielt. „Für – dich!“, wiederholte er und seine Augen suchten angestrengt ihren Blick. Bevor sie zu einer weiteren Entgegnung kam, nickte er bestätigend. Einmal und dann ein weiteres Mal. Er versuchte, sich weiter aufzurichten. Sie stützte seinen Rücken und er drehte den Kopf in Richtung der Mönche, winkte sie schwach mit der Hand zu sich. „Ihr sagt – es dem - Prior. Falls der – Tonsor -. Dass sie meinen – Willen -.“ Er schaute beide fragend an. „Meinen – Willen“, wiederholte er.
Sie verstanden und nickten. Das Sprechen hatte ihn angestrengt und er sank erschöpft zurück. Eine geraume Zeit lag er stumm und ausdruckslos da. Die Frauen saßen immer noch schweigend in der Ecke. Die Mönche waren beim dritten Bußpsalm angelangt, als Hildebrandus sich wieder bemerkbar machte. „Tr-agt mich – Eins- Ei – n-!“ Seine Worte waren kaum noch verständlich. Er machte eine kurze Pause, um erneut zu beginnen.
„Er möchte zur Einsiedelei“, vollendete Gunde für ihn. Ihr war wieder eingefallen, wie sehr er früher den Platz unter dem Ahornspalier neben der wuchtigen Klause geliebt hatte.
„Aber in seinem Zustand? - An der Einsiedelei ist doch immer ein zugiger Wind“, warf Agnetas Mutter zaghaft ein.
„Draußen scheint die Sonne und die Tage sind jetzt schon warm“, entkräftete Gunde ihren Einwand. Es macht wohl sowieso keinen Unterschied mehr, dachte sie, und es machte sie erneut traurig. „Außerdem legen wir eine Decke über ihn“, sagte sie laut. „Also, tut, was er sich wünscht! Holt Männer, die ihn dorthin tragen!“
Wenig später bewegte sich eine kleine Schar einen gewundenen Pfad hoch zur auf einem kleinen Plateau gelegenen Einsiedelei. Vorn marschierten vier Männer, die Hildebrandus samt Lager trugen. Dann folgten die beiden Mönche, der eine singend, während der andere den Sterbenden hin und wieder mit Weihwasser besprengte. Dahinter Gunde und mehrere Frauen und Männer, alle Bedienstete oder Familiare des Laienhofs. Sie erreichten, dem Gefolge einer kleinen Prozession gleich, das Plateau und betteten Hildebrandus an seinem Lieblingsplatz auf der Wiese vor der Klause. Einige derzeitige Bewohner der Klause gesellten sich zu ihnen. Alle umringten das Lager des alten Mannes. Sein Gesicht wirkte jetzt eingefallen und so bleich wie sein struppiger Bart und sein für sein hohes Alter noch immer volles, schlohweißes Haar. Gunde saß neben ihm, weil er es so wollte, und hielt seine Hand.
So verging die Zeit bis zum Sonnenuntergang, den Hildebrandus noch mitbekam. Der Schein der versinkenden Sonne lag satt und goldgelb auf dem Weinberg vor ihnen; ebenso auf der sich daran anschließenden Bruchkante aus rotem Fels und tief unten auf dem trüben dunklen Wasser der Mosel. Hildebrandus lächelte Gunde schwach an. Danach verfiel er in einen Schlummer. Später errichtete man ein Feuer, um den Sterbenden und die Umstehenden zu wärmen. Gunde ließ mehr Decken bringen. Irgendwann leuchtete es hell in der Dunkelheit und Funken flogen ab und an gen Himmel. Zu dem Zeitpunkt waren nur noch Gunde und die beiden Mönche bei ihm. Hildebrandus war längst nicht mehr ansprechbar und dämmerte vor sich hin. Seine Brust hob und senkte sich nur noch schwach. Dann auch das nicht mehr. Einer der Mönche sprach ein Gebet. Gunde weinte leise in sich hinein. Männer trugen den Toten zurück zum Laienhof und Gunde begleitete sie.
Gunde nahm den Weg zurück zu Hildebrandus´ Kammer, um ihren Korb zu holen. Sie ließ den Eindruck der leeren Kammer kurz auf sich wirken, schloss leise die Tür und suchte den Weg zur kleinen Kapelle. Zwei brennende Kerzen vor dem Eingang wiesen ihr den Weg. Sie trat ein und schloss hinter sich die schwere Tür. Ihre Schritte hallten dumpf auf den Steinplatten, bis sie das Lager des Toten erreichte. Die Frauen hatten den Leichnam bereits ordentlich aufgebahrt. Sie hatten ein frisches Leinentuch bis zum Kopf über ihn gedeckt und ihm ein kleines Holzkreuz auf die Brust gelegt. Auch standen zwei brennende Kerzen in Metallständern links und rechts am Kopfende. Plötzlich gab es an der Eingangstür ein Geräusch. Gunde wandte sich um und sah Agneta im Türrahmen.
„Du noch auf?“, fragte sie das Mädchen erstaunt. „Ist es nicht schon viel zu spät für dich? Du solltest schon schlafen.“
Das – das geht gerade noch nicht“, druckste die Kleine herum und kam näher.
Gunde sah sie erstaunt an. „Und warum?“
„Weil der Johann gerade seinen Pimpel in die Mutter steckt. Dann grunzt und schnaubt er immer, dass das Vieh im Stall ganz unruhig wird.“
„Sagten die beiden dir das so“, wollte Gunde verblüfft wissen.
„Nicht gerade so.“ Agneta trat verlegen von einem Fuß auf den anderen. Gunde wartete geduldig auf die weitere Ausführung. „Na, ich hörte mal, dass der Johann das sagte, als er mit den anderen Knechten viel von dem richtigen Starkbier trank“, fasste sich die Kleine ein Herz. „Da sagte er, er würde jetzt zur Mutter gehen und das machen, was ich – gerade – sagte.“
„So, so, sagte er das?“
„Ja, ganz genau so. – Mir sagen sie immer, sie haben was Wichtiges zu bereden und ich soll erst wieder reinkommen, wenn vor der Tür die Kerze brennt.“
„Aha“, sagte Gunde lächelnd. Auch Agneta hatte ihre Scheu verloren und grinste.
„Meine kleinen Geschwister dürfen bei ihnen drin bleiben, weil sie noch nichts mitbekommen, sagt Mutter. Sie zieht dann ein Laken vor das Bett.“
„Was ist denn mit deinem Vater?“, fragte Gunde, einem Impuls gehorchend.
„Der ist schon lange tot.“
„Das tut mir leid“, meinte Gunde spontan. Das Mädchen zuckte mit den Schultern und verzog kurz das Gesicht zu einer schmerzlichen Geste des Bedauerns. Im nächsten Moment war sie wieder drüber hinweg. „Ich kannte ihn ja kaum.“
Gunde nickte und sah, als sie die Kleine beobachtete, dass das Mädchen noch etwas anderes auf dem Herzen hatte. „Ist da noch was?“
„Hm, na ja, mich tät - interessieren, warum Herr Hildebrandus dir das Buch gegeben hat.“
Gunde stutzte einen Moment. „Deine Mutter erzählte es dir?“, fragte sie zurück. Das Mädchen nickte und schaute gespannt zu ihr herüber.
„Ich – ich weiß es nicht, wenn ich ehrlich sein soll.“
„Aber er kannte dich vorher?“
„Ja, er kannte mich. Ich war seine Schülerin, etliche Jahre. - Das ist aber Jahre her.“
„War er damals ein Lehrer?“
„Ja er war ein Lehrer und obendrein ein berühmter Medicus und Heiler.“ Sie legte für einen Moment die Hand auf das Kreuz und schaute lange in das bleiche Antlitz des Toten, dem die Mägde ein Leinentuch um Kopf und Kinn gebunden hatten.
„Er mochte dich wohl sehr, weil er dir sein Buch gab“, meldete sich die Kleine wieder.
„Ja, wahrscheinlich“, sagte Gunde und kämpfte dabei gegen den plötzlichen Kloß im Hals an. Es entstand eine kurze Pause, in der Agneta ruckartig auf dem Absatz kehrt machte, zur Tür ging und am Pfosten vorbei in den Gang spähte. Dann tauchte ihr Kopf wieder auf. Sie hob mit einem Grinsen im Gesicht aufmerksamkeitssteigernd einen Finger hoch. „Die Kerze brennt wieder“, sagte sie verschwörerisch.
„Aha“, erwiderte Gunde schmunzelnd.
„Dann kann ich ja jetzt gehen“, erklärte die Kleine. Sie räkelte sich am Türpfosten und wippte in plötzlicher Ungeduld mit ihrem Fuß auf und ab. „Leb wohl!“, rief sie Gunde zu und war im nächsten Moment verschwunden. Gunde eilte zur Tür. „Leb du auch wohl“, rief sie ihr nach. Die Kleine hörte es, wendete den Kopf und winkte kurz zurück.
Gunde verabschiedete sich von dem Toten, indem sie die über der Brust gefalteten Hände drückte und ihn kurz auf die Schläfe küsste. „Danke – danke für alles, lieber Meister“, sagte sie leise. Liebevoll und schmerzlich zugleich ruhte ihr Blick auf ihm, dann machte sie kehrt und griff sich den Korb zu ihren Füßen.
Plötzlich hörte sie draußen auf den Steinfliesen sich rasch nähernde Schritte und das Tok-tok eines Stocks. Gespannt wartete sie, bis sich die Tür öffnete und die Gestalt eines Mönchs in der Tür stand. In der Hand trug er ein Talglicht. Es warf ein schummriges Licht auf sein Habit und seine das Gesicht verhüllende Kapuze. Er warf einen langen Blick in den Raum, um die Szene, die Frau neben dem aufgebahrten Toten, auf sich wirken zu lassen. Barmherziger Jesus, lass das niemand von Hildebrandus´ früherem Orden sein, flehte Gunde insgeheim. Das konnte sie jetzt am allerwenigsten gebrauchen. Als er gemessenen Schritts näherkam, konnte Gunde ihn besser sehen. Der Mann war mittleren Alters und hatte ein schmales Gesicht mit flacher Stirn, über der eine büschelige Strähne dunklen Haars unter der Kapuze hervorschaute. Seine Augen lagen eine Spur zu eng zusammen, was ihnen im flackernden Licht der Kerze etwas Unheimliches gab. Seine Nase war lang und gebogen, wie der Schnabel eines Vogels. Der schmale Kopf ging in einen ebenso schmalen, dünnen Hals über, dessen Adamsapfel halb von einem weißen Halstuch verdeckt wurde. Es war besonders fein gewirkt und glänzte auffällig im Kerzenlicht. Auf dem Tuch war eine kleine silberne Taube kunstvoll eingestickt, die die Flügel ausbreitete. In dem Moment wurde Gunde schlagartig klar, dass ihr Flehen nichts genutzt hatte. Ihr Blick blieb wie gebannt an dem Tuch haften. Sie hatte ein solches Tuch schon mal gesehen. Obwohl es viele Jahre her war, konnte sie es und seinen Träger sofort einordnen. Dem Neuankömmling war ihr Blick nicht verborgen geblieben. Er fixierte Gunde mit kleinen Augen.
„Du kennst die Halsbinde“, fragte er wissend und deutete mit dem Zeigefinger seiner freien Hand auf das Tuch. Seinen Wanderstab hielt er fest in der anderen Faust, die Gunde blass und schmal vorkam.
Sie nickte. „Was wollt Ihr hier?“, fragte sie mit einer nicht zu überhörenden Ablehnung in der Stimme.
„Einem aus dem Leben abberufenen Mitbruder die letzte Ehre erweisen und für seine unsterbliche Seele beten“, sagte der Mönch eisig. „Leider wurden wir zu spät unterrichtet, dass er sich im Sterben befand. - Wir wären sonst zweifellos früher gekommen.“ Gunde hörte das ehrliche Bedauern in seiner Stimme. Seine Augen aber waren jetzt kleine Schlitze. Lauernd beugte er sich nach vorn und schielte halb um sie herum auf ihren Korb. Gunde tat so, als bemerkte sie es nicht.
„Er schwor eurem Orden vom Heiligen Geist schon vor undenklicher Zeit ab“, sagte sie stattdessen.
„Einmal Bruder, immer Bruder“, meinte der Mönch und schickte ein gummihaftes Lächeln hinterher, das wie eine Maske war. Rasch wurde sein Gesicht wieder ernst und mit zwei stockenden Schritten war er am Kopfende von Hildebrandus´ Totenlager. Er lehnte seinen Stab vorsichtig gegen die Bahre, faltete die Hände und betete: „Domine, ne in furore tuo arguas me: neque in ira tua corripias me. …“ Seine dünne Stimme hob und senkte sich und die Worte brachen sich dumpf an dem dunklen Gemäuer. Als er endete, bekreuzigte er sich und Gunde tat es ihm nach. Er schwieg lange, während er das Gesicht des Toten im Blick hatte. Gunde wartete gespannt.
Dann endlich löste sich der Mönch von dem Toten und wandte sich wieder ihr zu. „Uns wurde zugetragen, dass er dir vor seinem Tod sein Formelbuch gab“, sagte er fast beiläufig, obwohl ihn sein stechender Blick verriet. Natürlich, daher wehte also der Wind! Sie wollten sein Buch. Deshalb vorhin der gierige Blick zum Korb. Gunde nickte und verschränkte trotzig die Arme vor der Brust. Seine kleinen Augen stachen jetzt im Flackerlicht unter der Kapuze wie Speere hervor.
„Es gehört uns, dem Orden. Es gehört in unseren Besitz“, presste er mit unterdrückter Wut hervor.
„Es gehörte ihm und nur ihm. Er konnte damit machen, was er wollte. - Das geht euren Orden überhaupt nichts an“, antwortete sie bestimmt. Auch ihre Stimme war jetzt etwas lauter geworden, obwohl sie sich in Anbetracht des Ortes und der Situation um Mäßigung bemühte.
„Nach seinem Ableben gehört es uns und nicht dir“, zischte er aus Respekt vor dem Toten, statt sie, was er sichtbar liebend gern getan hätte, in unbeherrschter Wut anzubrüllen. „Wer bist du denn schon? Wohl doch eine dieser Salbenmischerinnen und Kräuterlieseln, die heute in Mode gekommen sind.“ Er sah sie feindselig an. „Was will denn jemand wie du damit? Geradezu eine Sünde wär es, es dir zu überlassen.“
Er eilte plötzlich um die Bahre herum. Sein Blick war auf den Korb geheftet und es war offensichtlich, dass er sich daran zu schaffen machen wollte. Auf halbem Weg dahin stellte Gunde ihm rasch ein Bein, sodass er hinstürzte. Als er wieder hochkam, robbte er auf allen Vieren mit zwei, drei raschen Bewegungen zur Bahre und bekam seinen Stock zu fassen. Damit wollte er, immer noch auf dem Boden kniend, nach ihr schlagen. Doch sie kam ihm zuvor. Sie trat ihn rasch und heftig gegen die Brust, dass er mehr vor Verblüffung als vor Schmerz aufstöhnte und gleich darauf nach hinten purzelte. Der Stab fiel ihm aus der Hand und polterte dumpf auf den Steinboden. Rasch griff sich Gunde den Korb und rannte in Richtung Kapellenausgang. Hastig stieß sie die Tür auf und lief den Flur entlang in Richtung Osten, wo sie den Ausgang des Laienhofs vermutete. Ihre Pantinen klapperten laut über die Steinfliesen. Hinter sich hörte sie die raschen Schritte ihres Verfolgers.
Plötzlich bemerkte sie vor sich einen Schatten und ein schemenhaftes Gesicht. Erschrocken wich sie zurück, um im nächsten Moment das vertraute Gesicht Agnetas vor sich zu sehen. Das Mädchen hielt einen Finger vor den Mund und bedeutete Gunde mit einer Handbewegung, ihr zu folgen. Es ging eine schmale Treppe hoch, dann um eine Ecke zu einer Holztür. Agneta schob Gunde hindurch und schloss sie von innen. Gunde roch Gras und Bäume. Vor sich hörte sie das Zirpen vieler Grillen. Sie befand sich im an den Laienhof angrenzenden Weinberg.
Sie hörte ihr pochendes Herz, als drinnen die keuchende Stimme ihres Verfolgers Agneta anherrschte. „Sahst du die Frau, Mädchen?“
„Was für eine Frau, ehrwürdiger Vater?“, antwortete Agneta unschuldig. Gunde hörte eine für einen frommen Mann eher unheilige Unwillensbekundung und Schritte, die sich eilig entfernten. Sie schlüpfte aus den Pantinen und steckte sie eilig in den Korb. Auf nackten Füßen rannte sie aus dem Weinberg und überquerte eine Wiese. Da hatte die Dunkelheit sie bereits verschluckt.
Kapitel 1
Hubertushorn, irgendwo zwischen Trier und Keyserslutern,
im Jahre des Herrn 1212
Man sagt, dass jeder neue Tag das ganze bisherige Leben verändern kann. Oft sind damit aber nur die an jenem Tag begangene oder unterlassene Tat, getroffene Entscheidungen oder Dinge gemeint, die besser nicht gesagt werden sollten oder gerade doch. Oft ist es eine Begegnung, die alles verändert. Oder ein Blick. Dieser Blick, der sein ganzes bisheriges Leben über den Haufen werfen sollte, stand Norwin an jenem Tag, der so sonnig und unbeschwert begonnen hatte, noch bevor. Norwin war seit kurzem der Jungmüller von Hubertushorn, etwa auf halber Strecke zwischen Trier und Keyserslutern gelegen, und es war für ihn eine rasante Karriere gewesen. Der Aufstieg vom ungelittenen Stiefsohn und einzigen, dafür aber ordentlich herumgestoßenen und ausgenutzten Knecht und Gehilfen zum Müller. Sein eigener Herr! Er war jetzt sein eigener Herr, wenn man einmal davon absah, dass die Mühle zur Vogtei von Bous gehörte, der sie zu gehörigen Abgaben verpflichtet war.
Der Karren, auf dem Norwin saß, wurde von einem kräftigen Maultier gezogen. Die Räder schabten knirschend über den von der anhaltenden Sonne festgebackenen Lehm des holprigen Wegs. Der führte an der Mühle vorbei hoch nach Hubertushorn. Norwin befand sich auf dem Rückweg. Bereits früh mit dem ersten Schrei des Hahns war er aufgebrochen. Er hatte Johann, einem der Fronbauern von Hubertushorn, den alle nur Klopper nannten, seinen ausgemachten Anteil an geschroteter Gerste abgeliefert. Johann schlug zwar gern mal seine Tiere, weswegen er seinen Spitznamen weg hatte und nicht sonderlich gemocht wurde. Aber er war auch ein fleißiger Bauer und für die Mühle ein regelmäßiger Lieferant. Außerdem lastete Trauer auf der Familie. Wieder einmal. Ein weiteres Kind war der Bauersfamilie gestorben. Norwin hatte das Mädchen als kleines, zartes Geschöpf mit braunen glänzenden Zöpfen in Erinnerung. Die Kleine hatte sich unter der Holztreppe zum Heuschober stundenlang mit den vielen Katzen des Hofs beschäftigen können. Wahrscheinlich warteten die Katzen jetzt auf ihre Gesellschafterin und vielleicht trauerten sie wie die Menschen im Haus um sie. Als er daran dachte, fiel ihm ein, dass er vorhin auf dem Hof überhaupt keine Katze gesehen hatte, was einen gehörigen Unterschied zu früheren Anfahrten machte. „Hopp, hopp, Brauner. Mach mal bisschen hin!“, spornte er das Maultier gutmütig an und rüttelte zur Aufmunterung an der Leine. Der Braune schlief fast ein, obwohl er jetzt keine Säcke mehr ziehen musste und es die Anhöhe runter ins Tal ging. Das Maultier ließ sich jedoch nicht beirren und behielt seinen Trott bei. Norwin resignierte und lehnte sich auf dem Bock zurück. Eigentlich war es nur ein Brett, das der dicke Hintern des Müllers über viele Jahre glatt poliert hatte.
Das war aber auch eine Hitze, obwohl die Sonne noch vor Mittag am Himmel stand. Norwin schaute kurz in ihre Richtung und blickte im nächsten Moment wieder weg, weil das Licht zu sehr in die Augen stach. Er kniff sie zusammen. Als er sie wieder öffnete, blieb es kurz dunkel. Doch der Schatten über der Landschaft war sofort wieder weg und er sah vor sich in der Entfernung das Birkenwäldchen entlang der Prims. Bereits seit vielen Tagen war es in frischgrünem Laub erblüht. Dann nur noch der langgezogene Bogen und gleich danach hörte man bereits das entfernte Rauschen des Primswassers, wenn es in das veralgte Wasserrad am Mühlenteich einschoss.
Norwin wischte sich einige Schweißperlen aus der Stirn. Er fingerte mit einer Hand hinter sich in der Ecke am Karrenbrett nach dem Wasserschlauch. Immerhin hatte er an den gedacht. Dafür hatte er seinen Strohhut vergessen. Wer hätte auch gedacht, dass die Sonne heute so stark brennen würde. Er nahm den Pfropfen aus dem Schlauch und trank einige Schlucke. Anschließend schüttete er sich eine gehörige Ladung ins Haar, das ihm strohblond über den Ohren lag und hinten an den groben Leinenkragen stieß. Er kämmte mit der Hand stirnaufwärts über den Schädel, um seinen Mittelscheitel wieder einigermaßen geradezurücken. Darunter schaute ein einigermaßen hübsches Jungmännergesicht von Anfang zwanzig hervor. Markant darin waren die Stupsnase und die vollen Lippen in einem noch milchigen Gesicht, in dem erste Stoppeln zögerlich sprossen und jetzt in der Sonne auf seinen Wangen wie feinster Goldstaub funkelten. Seine Gestalt war eher drahtig und athletisch. Das krasse Gegenteil des vorherigen Müllers, der übergewichtig und rundlich war, aber mit einem Kreuz wie ein Bär in der Mühle herumhantiert hatte. Gegen ihn wirkte Norwin geradezu zerbrechlich und schlaksig. Zudem war er einen ganzen Kopf größer als sein Stiefvater.
Die Mutter hatte ihn früher Bohnenstange genannt. Doch dann legte er an Muskeln und Gewicht zu, sodass es mittlerweile einigermaßen passte. Auch seine Hautfarbe war nicht die eines Müllers, stellte man sich den doch als bleich und käsig vor, weil er immer im Schatten unter dem Dach der Mühle seiner Arbeit nachging. Eben weiß wie das Mehl, das er mahlte - quasi wie ins eigene Mehl gefallen. Doch Norwin war braun wie ein Bauer, der den ganzen Tag auf dem Feld der Sonne ausgesetzt war. Das hing mit seiner wahren Leidenschaft zusammen - der Jägerei.
Zu allen möglichen Zeiten zwischen Sonnenauf- und untergang war er im Wald und in den Wiesen unterwegs. Was er als Jägerei bezeichnete, nannten andere Wilddieberei und besonders vor den Jägern und Aufsehern des Vogts musste er sich vorsehen. Auch dem Müller war seine Leidenschaft ein Dorn im Auge gewesen, weil er mögliche Strafen des Vogts, die auch ihn treffen würden, fürchtete. Dabei hatte er das häufige Wildbret auf seinem Tisch sicherlich nicht verachtet. Norwin war nicht nur ein Wilddieb. Er war, auch wenn er es mit aller Bescheidenheit betrachtete, ein ausgezeichneter. Das hing weniger mit seiner Spürnase zusammen: dass er wusste, wann und wo er auf die Pirsch gehen musste und wie er am besten den vogtischen Jägern aus dem Wege ging. Es hing einfach damit zusammen, dass er ein ausgezeichneter Bogenschütze war, der einer Maus ein Auge ausschießen konnte, wenn es darauf ankam.
Das Bogenschießen hatte er vom alten Leibold gelernt, der früher Soldat und danach Geselle beim Wagner in Grimburg war. Auch als Wagnergehilfe hatte der alte Leibold mehr Fleisch auf dem Tisch haben wollen - wie es sich die feinen Herrschaften leisten konnten, er aber mit seinem mageren Gesellenlohn nicht. Da hatte er sich seiner erlernten Schießkunst und seines Bogens besonnen, den er seinerzeit in einer Kommode verstaut hatte, und war neben Leibold dem Wagnergesellen zu Leibold dem Wilddieb geworden. Irgendwann, als Leibold noch nicht der alte Leibold war, hatte Norwin ihn im Wald bei seiner Nebentätigkeit überrascht und es war eins zum anderen gekommen. Der Junge war neugierig gewesen, wollte wissen, wie das mit dem Bogen und besonders mit dem Treffen mit so einem Bogen ist. Leibold war im Grunde ein gutmütiger Mensch und außerdem ein bisschen eitel. Immerhin eitel genug, um ein wenig mit seinem Wissen um die Kunst des Bogenschießens zu prahlen, und der Junge schien ein dankbarer Bewunderer seiner Kunst zu sein.
Zudem hatte der Junge schnell und gut gelernt, wie Leibold nach einiger Zeit neidlos anerkennen musste. So gut, dass die Gerüchte, Leibold habe jetzt selbst einen Gesellen, keine größeren Wellen schlugen, zumindest nicht solch große Wellen, dass sie den Vogt oder seine den Wald und dessen Inhalt verantwortenden Bedienstete erreichten. Denn Leibold und Norwin trafen gemeinsam so gut, dass sie bald halb Grimberg und Hubertushorn mit frischem Fleisch versorgten. Gratis, versteht sich. Noch nicht mal bewusst als eine Art Schweigegeld, sondern eher als Gefälligkeit. Die wurde nicht nur in Naturalien beglichen, sondern auch dadurch, dass alle tunlichst den Mund hielten. Wenn mal wieder ein Jäger des Vogts im Ort einritt und nach möglichen Verdächtigen fragte, die den von der Vogtei verwalteten Wildbestand der Benediktinerabtei in Kell dezimierten.
Als der alte Leibold noch jung war, war er mit den Kreuzrittern gegen die Heiden in den Krieg gezogen. Er hatte Norwin auch erzählt, wo sie genau waren und gekämpft hatten, doch ihm waren die Ortsnamen entfallen. Er hatte es nicht mit geografischen Namen. Er wusste, dass weiter nach Süden hin das alemannische Land und weiter dahinten die Alpen waren. Das reichte ihm auch. Auf jeden Fall wusste er, dass sie den Leibold damals zum Bogenschützen ausgebildet hatten und der hatte das, was sie ihm fürs militärische Schießen beigebracht hatten, an Norwin weitergegeben. Denn Beute ist Beute, sagte Leibold, ganz egal ob feindlicher Soldat oder Hase auf der Wiese. Wie man sich an sein Ziel heranpirschte, ein möglichst freies Schussfeld suchte, Schussdistanzen einschätzte, den Pfeil sauber von der Sehne löste oder eine möglichst geringe seitliche Abweichung hinkriegte. All das wusste er von Leibold.
Ein leichter Wind machte sich bemerkbar. Norwin fühlte ihn für einen Moment angenehm am Rücken, dort wo das verschwitzte Hemd wie festgebacken schien. Auch das kleine Lederbeutelchen um seinen Hals, in das er den von Johann kassierten Mahllohn gepackt hatte, klebte ihm unter dem Hemd auf der Brust. Der Luftzug rüttelte leicht an der Schnur. Norwin war für die Erfrischung dankbar, wurde so die Hitze doch zumindest für kurze Zeit erträglicher. Der Wind griff auch in die Birken voraus am Weg und deren Äste schwangen sanft auf und ab wie zur Begrüßung.
Er dachte an die Zweige, die sie am nächsten Sonntag wieder beim St. Pirminsfest auf dem Dorfplatz schwenken würden, wenn die Kapelle einzog. Brachlaub musste am Pirminstag unbedingt dabei sein, darauf bestanden sowohl der Priester als auch der Dorfschulze. Der lange Eckard würde die Radleier wieder so verquer drehen, dass sich fast alle für einen kleinen Moment wünschten, so taub wie die alte Mutter Ida zu sein, dass sie das nicht mitbekamen. Norwin musste unwillkürlich grinsen, als er es sich bildlich vorstellte. Trotzdem war es schön und alle im Dorf liebten die Abwechslung. Er saß mit den Jungs herum. Sie tranken, machten ihre Späße und schielten nach den Jungfern, mancher auch nach dem einen oder anderen verheirateten Weib, von dem man wusste, dass es anfällig für männliche Blicke war, um es mal so zu sagen. Später waren die meisten sturzhagelvoll. So war es immer. Vorher wurde zum Tanz aufgespielt. Die allgemeine Freude daran konnte auch Eckard mit seiner Leier nicht verderben. Stärker ausgeprägt war die allgemeine Tanzfreude definitiv auf der Seite der holden Weiblichkeit.
Norwin sah dem Spektakel mit gemischten Gefühlen entgegen. Zugegeben, es schmeichelte ihm, dass ihm die Jungfern im Dorf schöne Augen machten und sich wieder um ihn herumdrängeln würden, wenn der Schulze zur Damenwahl aufrief. Nicht nur Leibold hatte schon mal zu ihm gesagt, er hätte einen Schlag bei den Weibern. Der musste es ja wissen, lebte er doch, nachdem seine Frau vor Jahren gestorben war, in wilder Ehe mit der kahlen Dore. Das wiederum war dem Priester ein Dorn im Auge und er hatte schon mal gedroht, er würde es nach Trier melden. Es wurde im Dorf auch gemunkelt, dass Leibold uneheliche Bälger mit verheirateten Frauen aus der Umgebung hatte.
Beim letzten Pfingstfest hatte es deswegen sogar ziemlichen Stunk gegeben. Der Fronbauer vom Kuhanger hatte ihn damit aufgezogen und Leibold hatte rot gesehen und weil er ziemlich besoffen war, hatte er damit gedroht, seinen Bogen zu holen und alle umzulegen, die ihn auch nur schief ansahen. Doch alles hatte sich dann wieder rasch beruhigt. Auf jeden Fall war es Norwin nicht ganz geheuer, wenn er an das bevorstehende Dorffest dachte. Klar, er freute sich darauf, fröhlich zu sein, mit den anderen zu trinken, nahe den Jungfern zu sein, sie beim Tanz zu berühren, sie im Kreis zu drehen, ihre erhitzten, warmen Körper durch ihre Kleider zu spüren, sie zu riechen.
Einerseits! Aber da war auch diese Befangenheit und Schüchternheit in der Nähe des weiblichen Geschlechts. Dass ihm oft nichts Gescheites einfiel, wenn sie irgendwas zu ihm sagten. Meistens was Albernes oder Neckisches, worauf ihm nur ein verlegenes Lächeln entfuhr und sie jungmädchenhaft kicherten und die Köpfe zusammensteckten. Einen Narren hatten ihn seine Kumpane gescholten, dass er seine Chancen nicht nutzte, und ihm Felix als leuchtendes Beispiel hingestellt. Felix, der scheele Felix! Weil er von Geburt an mit einem Auge schielte und es, wenn er einen anguckte, immer so aussah, als suchte er rechts von einem was. Und auch wenn er schielte und nicht geradeausgucken konnte wie Norwin. Und auch nicht seine blauen Augen mit den goldumflorten Wimpern hatte, auf die die Damen laut Leibold besonders standen. So hatte er doch, auch wenn er reichlich Körbe sammelte, bereits seine Eroberungen, obwohl er noch ein Jahr jünger als Norwin war. Oder zumindest sagte er das.
Das zwiespältige Gefühl, sich sowohl auf die Pirminsfeier zu freuen als auch mögliche unangenehme Situationen zu fürchten, die zu erwarten waren, trieb ihm mehr Schweiß auf die Stirn, als es die Sonne heute allein schaffte. Mit der Hand wischte er darüber und strich das glänzende Nass an der Hose ab. Vor lauter Nachdenken und Grübeln war seine Hand mit dem Zügel auf seine Knie gerutscht. Der Braune hatte das als Zeichen gedeutet, zwischendrin mal ein Päuschen einlegen zu dürfen. Als Norwin es merkte, munterte er das Maultier mit einem Ruckeln an der Leine auf. Das Muli wehrte erst mal mit einem heftigen Schlagen des Kopfes lästige Fliegen ab und setzte sich dann wieder mit einem kurzen Schnauber in Bewegung. Die Radnarben des Karrens ächzten, als sich das Gefährt in Bewegung setzte.
Er würde es diesmal bei der Jungfer Katharina versuchen, ganz bestimmt, rundete Norwin seine Überlegungen ab. Der Karren rumpelte gerade unter dem Astgeflecht der Birkenallee entlang, das spürbaren Schatten spendete. Einige Krähen krächzten den Störenfrieden entgegen, hüpften und flatterten dann aber unwillig zur Seite. Ja, er würde versuchen, bei ihr zu landen. Aber anders als der scheele Felix, der sich bei Festen an die Jungfern ranwanzte, dass sie wahrscheinlich gar keine andere Chance hatten, als ja zu sagen, damit er Ruhe gab. Nein, er würde es auf seine Art versuchen, aber anders als sonst doch auch auf eine Art, die als Annäherungsversuch durchging.
Jungfer Katharina war eine ganz Hübsche und anscheinend schon halb einem Sohn eines Sattlermeisters versprochen, der selbst Sattlergeselle und derzeit auf Wanderschaft war. Als sie an Pfingsten zusammen tanzten, hatte sie sich, wenn er sie beim Reigen in die Höhe hob, eng an ihn gepresst, dass ihre beiden schweißnassen Halbkugeln fast aus dem Ausschnitt gehüpft wären. Und wenn er sie im Kreis gedreht hatte, hatte sie einen Duft verströmt, der ihn an das Rosenwasser erinnerte, das die Mutter vor Weihnachten in den Marzipanteig tat. Das Bild der hüpfenden Halbkugeln mit ihrem seidigen Glanz stand jetzt klar vor seinem geistigen Auge. Definitiv würde er es diesmal bei ihr versuchen, Sattlergeselle hin oder her, zog er einen mentalen Schlussstrich unter seine Grübelei.
Norwin schnalzte mit den Lippen. Eigentlich als spontane Aufmunterung für ihn selbst gedacht, bezog es der Braune auf sich und legte diesmal tatsächlich einen Zahn zu. Am Ende der Biegung kam bereits ein Teil des Wasserrads mit seinen eisernen Zapfen ins Blickfeld. Das Rauschen der Prims, die dort vorn in die Schaufeln plätscherte, wurde stärker. Ebenso das Gegacker der Hühner im Mühlenhof. Im nächsten Moment holperte der Karren in die letzte Schleife des Wegs, kamen der rechtsseitige Kalksteinsockel und das mächtige Fachwerkgebälk ins Blickfeld, die alten krummen Weiden entlang der Prims und die mächtige Linde vor dem Getreideschober. Als die Linde ganz sichtbar und nicht mehr von dem Fels am Weg verdeckt wurde, stockte Norwins Blick. Da baumelte etwas an einem der Äste. Ein Tuch, eine Fahne? Drehte sich an der Schnur, noch einen winzigen Moment durch die leicht blendende Sonne der Erkenntnis verborgen.
Die Mutter! Angst und Schmerz durchjagten seinen Körper, lähmten Norwin zuerst für eine winzige Zeitspanne, um ihn dann in einer ebenso winzigen Zeitspanne wie eine Feder zu spannen und anzutreiben. Er sprang vom Bock und rannte. Die eiskalte Hand, die sein Herz umklammerte, hielt weiter daran fest, bis er dicht unter dem Seil war. Ein Messer, verdammt – irgendwas! Seine Augen suchten in Panik den Hof ab. Sein herumjagender Blick erfasste den Hackklotz, in dem die Handaxt steckte. Schon riss er sie heraus und schleuderte sie in Richtung des Seils, unter dem sie nach nur wenigen Schritten in den trockenen Lehm schlug.
Der Klotz! Rasch rollte er den Klotz zur Stelle, packte die Axt unterhalb der Schneide und war schon mit einem Fuß auf dem Klotz, dann auch mit dem anderen. Frenetisch säbelte er an dem straffen Hanfstrick, während die andere Hand den schlaffen Körper hielt. Norwin keuchte vor Panik und Anstrengung. Mit einem kratzigen Geräusch gab der Hanf nach. Der Kopf der Mutter schlug massiv gegen seine Brust, während ihr wegsackender Körper ihn vom Klotz mit in den Staub riss.
„Mutter, Mutter!“, rief er sie mit tränenerstickter Stimme an, als er sich neben ihr hochrappelte. Rasch löste er die Schlinge um ihren Hals und schleuderte das Stück Hanf wütend weg, als hätte es ihr willentlich die Luft genommen. Er flehte sie an, rüttelte und schüttelte sie. Doch vergebens. Er lag neben ihr auf den Knien und hielt ihre Hand, während Tränen über seine Wangen rannen. Ihr Kopf war seltsam nach hinten gebogen und ihre glasigen Augen starrten unentwegt nach oben zum Rest des Stricks, dessen aufgelöste Fasern leicht hin- und herschwangen. Mit einer sanften Bewegung seiner Hand schloss er ihre Augen, während ihm erneut Tränen über das Gesicht liefen. Eine lange Zeit lagen beide Gestalten still und stumm im Mühlenhof, während die Hühner weiter gackerten und pickten und sich nicht für sie interessierten.
Dann bemerkte Norwin die roten Striemen an ihrem Handgelenk. Eilig griff er nach der anderen Hand und besah sich die entsprechende Stelle. Das Gleiche. Sein Gesicht verzog sich zu einer undefinierbaren Grimasse. Unmittelbar darauf befand er sich in der Hocke, richtete sich ganz auf. Sorgfältig suchte er den Hof, den angrenzenden Wiesensaum und die Büsche entlang der Hofmauer ab. Doch das, was er suchte, fand er nicht. Fast schon enttäuscht ging er zu ihr zurück. Schweren Herzens bückte er sich, umfasste sie mit beiden Händen und hob sie hoch. Lang wie der Saum ihres Kleids hing ihr loses Haar zur Erde. Mit dem Ellbogen stieß er die Tür zur Mühle auf und trat mit seiner Last über die Schwelle.
Kapitel 2
Die Mutter war mittlerweile aufgebahrt, aber eher notdürftig. Eben so, wie Norwin es nach dem Schock am frühen Nachmittag hinbekommen hatte. Er hatte sie in ihr Bett gelegt, ihr das Haar gekämmt und die Feiertagshaube aufgesetzt. Ihre bleichen Hände ruhten überkreuzt auf ihrer Brust, die bis hoch zum Hals das beste Leinentuch bedeckte, das er in ihrer Truhe gefunden hatte. Auf dem Sims stand eine Kerze. Sie erhellte die Kammer nur unzureichend, in die jetzt in den Abendstunden von draußen immer dämmrigeres Licht fiel. Zudem hatte er den Stoffvorhang bis auf einen kleinen Spalt am Fenster zugezogen, damit keine Insekten ihre Ruhe störten. Er saß neben ihrem Bett auf ihrem Lieblingsstuhl, dem alten Schaukelstuhl, den ihr der Müller vor gut zwei Jahren aus der Stadt mitgebracht hatte. Er hielt Totenwache. Er würde die ganze Nacht hindurch Totenwache halten.